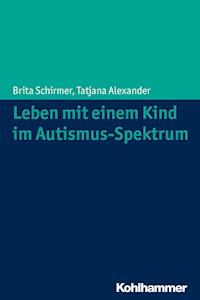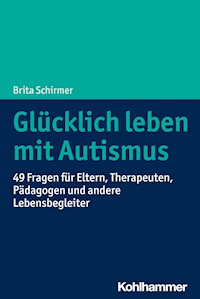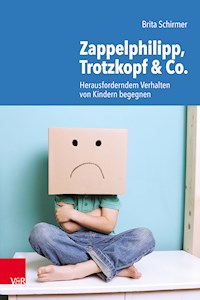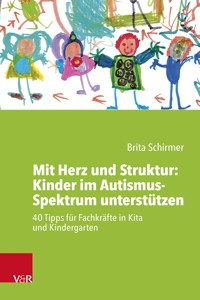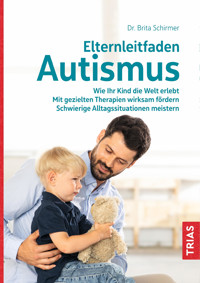
29,99 €
Mehr erfahren.
Die beste Hilfe für Ihr Kind
Viele Eltern mit einem Kind im Autismus-Spektrum sind nach der Diagnose hilflos und suchen nach fundierten Informationen. Sie wollen nicht nur wissen, was sich dahinter verbirgt, sondern auch, wie Sie ihrem Kind wirklich weiterhelfen und gemeinsam den Alltag bewältigen können. Dr. Brita Schirmer verfügt über jahrelange Erfahrung in der Elternberatung und bietet Ihnen eine kompetente Orientierungshilfe an, um die individuell beste Förderung zu finden.
- Sie sind nicht allein: Berichte aus Selbsthilfegruppen, Fallbeispiele und Erfahrungsberichte zeigen Ihnen, was anderen geholfen hat.
- Innenwelt besser verstehen: Lernen Sie die Lebenswelt der Kinder im Autismus-Spektrum kennen.
- Optimale Unterstützung: Finden Sie heraus, welche Therapie am besten geeignet ist, und wie Sie Ihr Kind unterstützen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Elternleitfaden Autismus
Wie Ihr Kind die Welt erlebt. Mit gezielten Therapien wirksam fördern
Dr. Brita Schirmer
21 Abbildungen
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Liebe Leserin, lieber Leser
1 Was ist Autismus?
Was die Eltern erleben
Das Kind verhält sich anders als erwartet
Die Eltern trifft keine Schuld
Wie die Diagnose gestellt wird
Anamnese: Das Gespräch mit dem Arzt
Das Kind wird beobachtet
Körperliche Untersuchung
Psychologische Untersuchung
Symptome: Wie zeigt sich Autismus?
Der frühkindliche Autismus
Triade von Beeinträchtigungen
Es müssen mehrere typische Symptome aus allen drei Bereichen vorhanden sein
Das Asperger-Syndrom
Der atypische Autismus
High-functioning-Autismus
Das Autismus-Spektrum
Wie häufig ist Autismus?
Mögliche Ursachen
Ist Autismus heilbar?
Welche Therapie ist die beste?
Intelligenz und spezielle Begabungen
Ein Kind, das immer dasselbe tut, lernt weniger
Wie Umwelt und Erbanlagen zusammenwirken
Wichtige Informationen werden nicht erkannt
Warum die Nachahmung nicht funktioniert
Besondere Begabungen
2 Wie erlebt mein Kind seine Welt?
Besonderheiten der Wahrnehmung
Wie reagiert Ihr Kind?
Besonderheiten beim Sehen
Die Blendungsempfindlichkeit
Was Sie bei Blendempfindlichkeit tun können
Die Filterschwäche
Alle Informationen erscheinen gleich wichtig
Das Kind schafft sich seine eigene Ordnung
Hilfen bei Filterschwäche
Verzerrungen
Das periphere Sehen
Besonderheiten beim Hören
Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen
Überempfindliche Kinder müssen vor lauten Geräuschen geschützt werden
Das Abschalten
Filterschwäche beim Hören
Die Gestaltung des Alltags für Kinder mit einer Filterschwäche
Verzerrungen
Interpretationsprobleme
Wie sollten Sie mit Ihrem Kind sprechen?
Welche Hörtherapien gibt es?
Wie funktioniert die Tomatis-Therapie?
Das Kind soll die Stimmen so hören, wie es sie im Mutterleib wahrgenommen hat
Die Wirksamkeit ist umstritten
Auditory Integration Training (AIT)
Wie funktioniert das AIT?
Auricula-Hörtraining
Wie funktioniert das Auricula-Hörtraining?
Das Warnke-Verfahren
Besonderheiten des Tast- und Bewegungssinns
Überempfindlichkeit gegenüber Berührungen
Wenn Ihr Kind Berührungen schlecht ertragen kann
Auswirkung auf soziale Beziehungen
Auswirkung auf die tägliche Hygiene
Auswirkung auf das Tragen von Kleidung
Auswirkung auf die Ernährung
Mangelndes Schmerz- und Berührungsempfinden
Geringes Schmerzempfinden
Wenn das Kind seinen Körper zu wenig spürt
Wenig Hungergefühle und Harndrang
Therapiemöglichkeiten
Besonderheiten beim Riechen und Schmecken
Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Gerüchen
Auf der Suche nach starken Geschmacksreizen
Die Zusammenarbeit der Sinne
Wie wirkt sich eine intermodale Störung aus?
Therapie nach Affolter
Wie die Affolter-Therapie funktioniert
Therapie nach Delacato
Behandlungsschritte nach Delacato
Tägliches Üben
Sensorische Integrationstherapie (SI)
Probleme bei alltäglichen Handlungen
Handlungsfehler
Lassen Sie sich von Handlungsfehlern nicht provozieren
Der Handlungsfluss
Erinnern Sie sich an Ihre erste Fahrstunde?
Das Kind kann nicht gleichzeitig essen und zuhören
Handlungsablauf in Bildern oder mit Schrift darstellen
Fehlende Informationen aus dem eigenen Körper
Unzureichende Vorstellungen vom Raum
Warum Nachahmung nicht klappt
Die Spiegelneuronen funktionieren nicht richtig
Wie Sie Ihrem Kind das Nachahmen erleichtern können
3 Auffälligkeiten des Sozialverhaltens
Was macht die Kommunikation so schwierig?
Spiegelneuronen und Sozialverhalten
Empathie: Gefühle anderer nachempfinden
Nonverbale Kommunikation
Betroffene verfügen über wenig Mimik und Gestik
Betroffene können ihre Gefühle schlecht ausdrücken
Wie Sie Ihrem Kind helfen können, seine Gefühle auszudrücken
Blickkontakt
Wie der Blickkontakt verändert ist
Wie die Betroffenen das Problem schildern
Blickkontakt und frühkindliche Entwicklung
Gemeinsame Aufmerksamkeit: einer folgt dem Blick des anderen
Verhaltenstherapie
Wie funktioniert die Therapie?
Gewünschtes Verhalten belohnen/verstärken
Eine Verhaltenstherapie wird häufig eingesetzt
Die Kosten müssen Sie meist selbst tragen
Options-Methode
Die Therapie verläuft in drei Phasen
Floortime – Spielzeit auf dem Boden
Eltern als aktive Spielpartner
Immer in Kontakt bleiben
Welche Grundannahme steckt hinter Floortime?
Mifne – intensive familienorientierte Therapie
Die Therapie gliedert sich in drei Phasen
Relationship Development Intervention (RDI)
Early Start Denver Modell (ESDM)
Körpersprache verstehen und entwickeln
Wie Sie Ihrem Kind helfen können
Computerprogramm FEFA zum Erkennen von Mimik
Die Theorie der schwachen zentralen Kohärenz
Wenn alles mühsam aus Einzelteilen zusammengesetzt werden muss
»Auf dem Bett liegt eine große Nudel«
Ihr Denkstil ist anders, aber weder besser noch schlechter
Social Stories – angemessenes soziales Verhalten vermitteln
Wie ist die Geschichte aufgebaut?
Wie Sie die Social Story schreiben sollten
Welches Problem wollen Sie beschreiben?
Besprechen Sie die fertige Geschichte gemeinsam
Social Story Set
Comic Strip Conversation
Die gewählte Farbe verdeutlicht die Gefühle
Das Kind »antwortet« mit Zeichnungen auf Ihre Fragen
Comic Strips zu geplanten zukünftigen Situationen
Benutzen Sie einzelne Kästen zum Gliedern
Theory of Mind: Gedanken anderer erkennen
Wie sich die Theory of Mind bei einem Kind entwickelt
Was passiert, wenn diese Theory of Mind fehlt?
Die sozialen Probleme werden nachvollziehbar
Was bewirkt Empathietraining?
Aufbau des Empathietrainings
Sprechen lernen
Reden Sie mit Ihrem Kind!
Schrift als Unterstützung
Verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Lernprogramme
Was ist Kommunikative Sprachtherapie?
Das Kind erfährt, dass sich Sprechen lohnt
Das Picture Exchange Communication System (PECS)
Wie funktioniert das PECS?
In der ersten Phase sind ein Helfer und ein Kommunikationspartner beteiligt
In der zweiten Phase werden Distanz und Ausdauer trainiert
In der dritten Phase kommen mehrere Bilder ins Spiel
Karten kombinieren und Satzstrukturen bilden
Wie Sie die PECS-Karten gestalten können
Gebärden einsetzen
Autistische Sprachbesonderheiten
Echolalie: Wörter und Sätze häufig wiederholen
Echolalien können aus unterschiedlichen Gründen auftreten
Alles wird wörtlich verstanden
Redewendungen erklären und einüben
Ungewöhnliche oder fehlende Betonungen
Probleme mit Wörtern wie »ich, dir, hier, da«
Üben, mit jemandem einen Dialog zu führen
Gesprächsregeln werden nicht erkannt
Gesprächregeln systematisch vermitteln
Selbstgespräche
Funktion der Kommunikation
Soziale Anteile der Kommunikation lehren
Verschiedene Formen der Begrüßung bei verschiedenen Bekanntheitsgraden vermitteln
Angehörige informieren, worüber sich ein Kind im Autismus-Spektrum gern unterhält
Warum viele Betroffene im Internet kommunizieren
Die schriftliche Form nimmt den Zeitdruck
Unkomplizierter Austausch
Man muss nicht auf Mimik oder Betonung achten
Gleichberechtigter Austausch
4 Unterstützung auf dem Lebensweg
Das Familienleben gestalten
Den Alltag strukturieren
Strukturierung der Zeit
Zeitliche Abläufe gestalten
Was Sie bei Zeitplänen beachten sollten
Zeitdauer deutlicher machen
Den Raum gestalten/strukturieren
Frühförderung
Wie finden wir die geeigneten Therapien?
Warum Frühförderung so wichtig ist
Welche Therapien entsprechen den Kriterien?
Stellen, die Frühförderung anbieten
Sozialpädiatrische Zentren und Frühförderstellen
Frühförderung ist kostenlos
Wie viel Zeit, Energie und auch Geld können Sie
aufbringen?
Unterstützung beim Spielen
Unterschiede im Spielverhalten
Wie Sie das Spielen und die damit verbundene Entwicklung fördern können
Andere Kinder mit einbeziehen
Mögliche Stoffwechselprobleme
Kasein- und glutenfreie Ernährung
Was sind Kasein und Gluten?
Wie wirkt sich eine Gluten- und/oder Kaseinunverträglichkeit aus?
Wie wirkt ein Entzug von Gluten und Kasein?
Pilzüberbesiedlung im Darm
Wodurch kann das Gleichgewicht gestört werden?
Welche Folgen hat ein gestörtes Gleichgewicht?
Nebenprodukte der Pilze
Durchlässiger Darm
Autoantikörper
Welche Auswirkungen auf das Verhalten eines Menschen kann die Pilzüberbesiedlung im Darm haben?
Was kann eine Pilzkur bewirken?
Welche Anti-Pilz-Produkte gibt es?
Vitamin- und Nahrungsergänzungsstoffe
Schadstoff- und Schwermetallbelastung
Diäten oder Pilzkuren sind kein Allheilmittel!
Lassen Sie mögliche Unverträglichkeiten/Infektionen vom Arzt untersuchen
Die geeignete Schule
Was sagt das Gesetz dazu?
Inklusion oder Förderzentrum?
Die Entscheidung sollte individuell und nicht dogmatisch getroffen werden
Was spricht für, was gegen Förderzentren?
Sonderpädagogischer Förderbedarf
Spezielle Helfer im Unterricht
Ausbildung und Beruf
Agentur für Arbeit frühzeitig einbeziehen
Informationsveranstaltungen besuchen
Praktika gut vorbereiten
Die berufliche Eingliederung
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)
Berufsbildungswerk (BBW)
Betriebliche Berufsausbildung
Berufsvorbereitung
Integrationsfachdienste
Arbeitsassistenz
Studium
Wohnen
Die Finanzierung
5 Den Alltag bewältigen
Routinen und Stereotypien
Der Umgang mit Stereotypien
Schwierigkeiten in der Ernährung
Überempfindlichkeiten
Unterempfindlichkeiten
Probleme beim Kauen des Essens
Das Essverhalten verändern
Schlafen
Probleme beim Einschlafen
Was können Sie tun, um das Kind zum Einschlafen zu bringen?
Probleme mit dem Durchschlafen
Melatonin steuert den Tag-Nacht-Rhythmus
Sauberkeit
Sauberkeit am Tag
Sauberkeit in der Nacht
»Piesel-Piepser«
Wutausbrüche und Aggressionen
Instrumentelle Aggression
Gehen Sie zweigleisig vor
Aggression als Kommunikationsversuch
Affektive Aggression
Regelverstöße
Aggression aus Angst
Umorientierte Aggression
Impulsive Aggression
Was tun?
Was tun bei automatisierter Aggression?
Wann können Medikamente helfen?
Autoaggressionen
Auch Autoaggressionen können instrumentell, affektiv, impulsiv und automatisiert sein!
Autoaggressionen als Ausdruck einer Erkrankung
Autoaggression als Selbststimulation
Wann dürfen/müssen Fixierungen verwendet werden?
Die Geschwister
Besondere Chancen für die Entwicklung des Geschwisterkindes
Besondere Risiken für die Entwicklung des Geschwisterkindes
Nicht erlaubte Geschwisterrivalität
Übergroße Rücksichtnahme
Eine große Gefahr besteht in Überforderung
Auch die Möglichkeit der Isolation besteht
Der Platz in der Geschwisterreihe
Wer hilft uns?
Rechtsansprüche
Der Schwerbehindertenausweis
Merkzeichen B, G, oder H
Pflegegeld
Verhinderungspflege
Kurzzeitpflege
Hilfen im Haushalt
Psychische Entlastung der Eltern: Selbsthilfegruppen
Familiäre Netzwerke nutzen
Literatur
Infos zum ersten Kapitel
Autismus-Therapiezentren
Infos zum zweiten Kapitel
Berührungsapparat von Temple Grandin
Therapie nach Delacato
Sensorische Integrationstherapie
Infos zum dritten Kapitel
Verhaltenstherapie
FEFA
Infos zum vierten Kapitel
Strukturierung der Zeit
Stoffwechselprobleme und ihre Behandlung
Ausbildung und Beruf
Wohnen
Infos zum fünften Kapitel
Die Geschwister
Pflegegeld
Steuererleichterungen
Wutausbrüche und Aggressionen
Selbsthilfegruppen
Stichwortverzeichnis
Autorenvorstellung
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser
ein Kind zu bekommen und es aufwachsen zu sehen gehört zu den schönsten, eindrucksvollsten und prägendsten Eindrücken des Lebens. Es ist aber ohne Zweifel auch eine anstrengende Angelegenheit. Ganz besonders, wenn den Eltern die Entwicklung ihres Kindes Sorgen bereitet.
»Wir erhalten alle Informationen nur zufällig und die Suche danach kostet so viel Zeit und Energie«, sagte mir vor Jahren die Mutter eines kleinen Jungen mit frühkindlichem Autismus. Diese Zeit und Energie kann sinnvoller eingesetzt werden. Deshalb gründete ich vor 20 Jahren eine Eltern-Selbsthilfegruppe, gab mit den Berliner Eltern und Studierenden das Handbuch »Autismus in Berlin« mit vielen Adressen und Kontaktmöglichkeiten heraus und aus diesem Grunde entstand auch dieses Buch.
Ich habe in den vergangenen Jahren von den Eltern viel lernen könen. Fachleute für ihr eigenes Kind, die sie sind, haben sie mit viel Engagement Möglichkeiten der Förderung für ihr Kind gesucht und gefunden. Oftmals sind es aber auch die kleinen Tricks und Kniffe, mit denen man große Wirkung erzielen kann, die ich über die Jahre gesammelt habe und nun auch anderen Eltern zur Verfügung stellen möchte.
Daneben habe ich mich um die Aufarbeitung der umfangreichen Forschungs- und Betroffenenliteratur bemüht und versucht, die wichtigsten Ergebnisse so darzustellen, dass auch ein Nicht-Fachmann oder eine Nicht-Fachfrau sie verstehen können.
Einige Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum haben mir dabei mit ihrem fachlichen Rat zur Seite gestanden, bei denen ich mich ganz ausdrücklich bedanken möchte. Ein besonderer Dank gilt Anja Lederer und Dr. Lars Niemann sowie den Familien von Franz, John und Tino.
Berlin im Herbst 2020 Brita Schirmer
1 Was ist Autismus?
Was die Eltern erlebenWie die Diagnose gestellt wirdSymptome: Wie zeigt sich Autismus?Intelligenz und spezielle Begabungen
Was die Eltern erleben
Aus dem Leben
»Er ist ganz anders als die anderen Kinder«
»›Paul ist aber ganz anders als die anderen Kinder‹. Eher nachdenklich sagte Ullas Mutter das – Pauls Mutter brach beinahe in Tränen aus. Es stimmte, Paul war ganz anders als die anderen Kinder. Wo die als Erstes fröhlich die Erzieherin umarmten, stürmte Paul an den Menschen vorbei in seine Matratzenhöhle. Die anderen gaben sich im Morgenkreis bereitwillig die Hände, Paul zuckte zurück und saß allein da. Die anderen winkten, wenn die Erzieherin ihnen zuwinkte – Paul rührte sich nicht und schaute auf einen Punkt hinter ihrer Schulter.«(1)
»Unser Kind ist anders als andere«. Irgendwann im Laufe der Entwicklung ihres Kindes mit Autismus-Spektrum kommen die Eltern zu dieser Erkenntnis. Sie entsteht schleichend, schrittweise, zieht sich über Wochen, Monate und manchmal auch über Jahre hin. Oftmals können die Eltern diesen Gedanken auch gar nicht konkretisieren.
Das fein aufeinander abgestimmte System zwischen Eltern und Kind kann durch die Behinderung eines Kindes irritiert werden, wenn das Kind nicht in der Lage ist, die von den Eltern erwarteten Signale zu geben. Wenn es sie z. B. nicht anschaut oder wenn es scheinbar am zufriedensten ist, wenn es in Ruhe gelassen wird. Die Eltern werden durch das Verhalten ihres Kindes in einem hohen Maße verunsichert. Diese Verunsicherung ist etwas, was man fühlen, aber eben häufig nicht exakt beschreiben kann.
Aus dem Leben
»Manchmal hatte ich das Gefühl, sie wäre eine Fremde«
»Ich wusste nur, dass etwas nicht in Ordnung war, aber ich wusste nicht, was das war. Manchmal hatte ich das frustrierende, beinahe erschreckende Gefühl, sie wäre eine Fremde. ›Ich mache mir Sorgen ihretwegen‹, platzte ich einmal meiner Schwester Debbi gegenüber heraus. Aber als diese mich nach dem Grund fragte, wusste ich keine Antwort«(2), so schildert Catherine Maurice, Mutter zweier Kinder mit Autismus-Spektrum, diese Empfindungen.
Das Kind verhält sich anders als erwartet
Viele der erwarteten schönen Momente bleiben aus. Ihr Kind reagiert nicht auf Sie, wie es andere Kinder tun und auch seine Entwicklung verläuft anders. Was sind die ersten Anzeichen eines Autismus-Spektrums, die die Eltern beobachten können?
Bei Verdachtsmomenten können Screeninginstrumente herangezogen werden. Ein Screening ist so etwas wie eine Filterung. Sie hilft, Klarheit über die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Autismus-Spektrum-Störung zu gewinnen. Die M-CHAT ist ein solches Screeningverfahren. Sie kann im Alter von 24 Monaten eingesetzt werden.
Erfasst werden hier
die Fähigkeit zum So-tun-als-ob-Spiel,
die Fähigkeit, auf etwas zu zeigen, um die Eltern auf den Gegenstand aufmerksam zu machen
die Fähigkeit, der Zeigebewegung der Eltern mit den Augen zu folgen (und nicht nur die zeigende Hand anzusehen).
Für Kinder ab dem Alter von vier Jahren existiert der »Fragebogen zur Sozialen Kommunikation« (FSK) von Bölte und Poustka (2006), ab dem Vorschulalter kann die »Skala zur Erfassung der sozialen Reaktivität« (SRS) von Bölte und Poustka (2008) verwendet werden.
Vom Grundschul- bis zum Jugendalter kann für Heranwachsende die »Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom« (MBAS) von Kamp-Becker und Remschmidt (2005) eingesetzt werden. Für Kinder und Jugendlliche mit Intelligenzminderung ist die »Skala zur Erfassung von Autismus-Spektrum-Störungen bei Minderbegabten« (SEAS-M) von Kraijer und Melchers (2003) geeignet.
Auch hierbei handelt es sich um sogenannte Screeningverfahren, d. h., es wird keine Diagnose gestellt, aber man kann mit ihrer Hilfe herausfiltern, ob ein Diagnoseprozess sinnvollerweise eingeleitet werden sollte. Er kann damit Eltern sicherer machen, ihre Beobachtungen einzuordnen. Ausführliche Literaturangaben finden Sie im Serviceteil.
Frühe Hinweise auf ein Autismus-Spektrum
Bitte prüfen Sie, welche der folgenden Aussagen auf Ihr Kind zutrifft:
In den ersten sechs Lebensmonaten
schreit das Baby »anders« als andere,
□
die Eltern können dieses Schreien kaum interpretieren,
□
oftmals dauert es stundenlang.
□
Das Baby scheint andere Menschen wenig zu brauchen.
□
Es schaut seine Eltern nicht an.
□
Oft hat es keine Freude an Körperkontakt oder verlangt ihn in einem ungewöhnlichen Maße.
□
Häufig wirkt es selbstzufrieden.
□
In der Zeit vom siebten bis zum 12. Lebensmonat
kratzt oder schabt das Baby auf Oberflächen,
□
verhält sich extrem ruhig, meldet sich wenig oder
□
schreit oder weint lange und lässt sich nicht beruhigen.
□
Es reagiert nicht auf laute Geräusche und wirkt wie gehörlos.
□
Es ist überempfindlich gegenüber bestimmten Geräuschen (z. B. Staubsauger) und hat Angst vor ihnen.
□
Das Baby beteiligt sich wenig an sozialen Spielen, z. B. hat es kaum Interesse daran, sich zu verstecken.
□
Es versucht nicht, mit seinen Eltern zu kommunizieren und sich mit seinem Spielzeug zu beschäftigen.
□
Es reagiert ungewöhnlich auf Geräusche, auf Ansprache, darauf hochgenommen zu werden, auf Licht oder auf Bilder.
□
Es schaut Personen nicht an,
□
lehnt sich nicht mit dem Kopf an,
□
lächelt oder lacht nicht und wirkt wie ein ›ernstes‹ Kind.
□
Es macht Verhalten von Personen nicht nach,
□
es zieht sich zurück, wenn Mutter oder Vater versuchen, mit ihm keinen Kontakt aufzunehmen.
□
Die Gewöhnung an feste Nahrung bereitet Schwierigkeiten.
□
Es schaukelt oder wiegt sich hin und her.
□
Im Alter von 12 Monaten zeigt es noch keine Gesten (Zeigen mit dem Zeigefinger, Winken usw.).
□
In der Zeit von 18 bis 24 Monaten
zeigt das Kind nicht auf einen Gegenstand, um die Eltern auf ihn aufmerksam zu machen,
□
es folgt nicht ihrem Blick.
□
Es »tut nicht so als ob«, also die Puppe mit einem nicht vorhandenen Löffel füttern oder ein beliebiges Stück Holz nicht behandeln als wäre es ein Auto.
□
Das Kind spricht noch keine einzelnen Worte.
□
Es kratzt, schabt oder leckt an Oberflächen,
□
tastet oder klopft anhaltend an Gegenständen,
□
sieht lange auf bestimmte Muster (z. B. Tapeten),
□
bewegt Gegenstände wiederholt vor dem Gesicht hin und her,
□
lauscht auf spezielle Geräusche (wie Rascheln, Zischen, Rauschen, Surren),
□
›überhört‹ andere (leise oder laute) Geräusche, wirkt wie gehörlos,
□
reagiert überempfindlich oder ängstlich auf Geräusche (z. B. Staubsauger),
□
kann sich nur schwer im Raum orientieren,
□
bleibt an Raumgrenzen (z. B. Teppichkanten) stehen,
□
spielt nicht mit Gleichaltrigen, Geschwistern oder Eltern,
□
sieht an Personen vorbei oder scheint durch sie hindurchzusehen.
□
Andere Menschen schaut es nur selten an, oder sehr kurz, oder lange und starr, selten direkt.
□
Es kann Körperkontakt nur zulassen, wenn es Dauer und Art kontrollieren kann, wehrt Kontakt sonst ab.
□
Das Kind schreit oder weint lange und lässt sich nicht beruhigen.
□
Es scheint kein oder ungewöhnliches Verlangen nach Trost in Situationen seelischer Not zu haben.
□
Von sich aus nimmt es keinen oder wenig Kontakt zu den Eltern auf, es scheint mit sich selbst zufrieden zu sein.
□
Das Verhalten anderer macht es nicht nach,
□
es zieht sich zurück, wenn die Eltern oder Geschwister mit ihm Kontakt aufnehmen wollen.
□
Das Kind lächelt oder lacht nicht und wirkt wie ein ›ernstes‹ Kind.
□
Es sitzt oder krabbelt nicht oder verspätet, beginnt verspätet mit dem Laufen,
□
bewegt bestimmte Körperteile und Gegenstände immer auf gleiche, oft merkwürdige Weise, ist manchmal dabei sehr geschickt,
□
hat einen auffälligen Gang,
□
verdreht Augen, Finger, Hände, Hals,
□
wedelt mit Armen, Händen, Tüchern, Bändern o. ä.
□
Es spricht immer noch nicht oder hört nach dem Sprechbeginn allmählich wieder auf,
□
es wiederholt Wörter oder Wortreste ohne erkennbaren Sinn,
□
produziert immer wieder gleiche Laute und Töne,
□
benutzt Worte nicht, um Personen etwas mitzuteilen,
□
benutzt keine oder wenig sprachbegleitende oder ersetzende Mimik oder Gestik.
□
Es isst auffällig, stopft, schlingt, schluckt nicht, kaut nicht,
□
nimmt nur Brei oder Flüssiges oder spezielle Speisen zu sich,
□
schläft schlecht ein oder wacht zu früh auf,
□
liegt stundenlang nachts wach (›braucht‹ wenig Schlaf).
□
Je mehr Aussagen auf Ihr Kind zutreffen, umso wahrscheinlicher ist ein Autismus-Spektrum. Diese Checkliste allein ist aber kein ausreichendes Diagnoseinstrument, sondern gibt nur einen ersten Hinweis. Ob tatsächlich ein Autismus-Spektrum vorliegt, sollten Sie unbedingt, wie im nächsten Unterkapitel beschrieben, klären lassen.
Man weiß, dass viele Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum die Symptome bereits sehr früh wahrnehmen. Sie beobachten bestimmte erste Hinweise auf ein Autismus-Spektrum (siehe oben), eine sichere Diagnose kann zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gestellt werden. Ein Teil der Eltern erkennt diese Auffälligkeiten bereits in der Mitte des zweiten Lebensjahres, knapp die Hälfte der Eltern sogar schon im ersten Lebensjahr.
Info
Einige Kinder zeigen erst spät autistische Symptome
Ungefähr jedes vierte Kind zeigt aber erst spät autistische Symptome. Diese Kinder entwickeln sich im ersten Jahr oder sogar in den ersten anderthalb Jahren unauffällig. Einige Kinder sprechen zu ihrem ersten Geburtstag sogar schon besonders viele und komplexe Wörter. Allerdings verändert sich ihr Entwicklungsstand bis zum zweiten Geburtstag nicht, während die Entwicklung ihrer Altersgenossen rasant voranschreitet. Manche Kinder verlieren sogar Fähigkeiten wieder, die sie schon hatten.
Die Ursachen dieser Entwicklung liegen im Unklaren. Für die weitere Entwicklung, seine Intelligenz oder die Ausprägung des Autismus des Kindes scheint es keine Rolle zu spielen, ob sich die Symptome von Geburt an oder erst später zeigen.
Im Hinblick auf die Früherkennung eines Autismus-Spektrums kann man davon ausgehen, dass neben den Eltern die Kinderärzte die erste Möglichkeit hätten, die Anzeichen einer autistischen Behinderung wahrzunehmen.
Manchmal werden die Beobachtungen der Eltern von den Ärzten entweder nicht ernst genommen oder nicht richtig interpretiert. Eltern beschreiben diese Erfahrung als besonders belastend. Durch die beschwichtigenden oder abwehrenden Beruhigungen der Ärzte fühlen sie sich in ihren Wahrnehmungen und in ihrer Rolle als Eltern verunsichert.
Die Eltern trifft keine Schuld
Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum sind in einer besonderen Situation. Sie sind meist sogenannte „traditionslose Eltern“, d. h., sie können nicht von Erfahrungen im Umgang mit Kindern im Autismus-Spektrum zehren. Auch ihrem Umfeld fehlen diese Traditionen. Das führt zu einer Verunsicherung der Eltern und kann sie anfälliger für Schuldgefühle machen.
Unnötigerweise machen sich viele Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum solche Schuldgefühle. Für Eltern ist es aber wichtig, diese Schuldfalle zu entdecken, damit sie ihr entgehen können. Wer sich schuldig fühlt, kann nämlich seinen Sohn oder seine Tochter oft nicht gut begleiten. Man neigt dann zu einem Verhalten der Wiedergutmachung, wird sein Kind wahrscheinlicher verwöhnen und ihm Anstrengungen abnehmen. Das kann aber Entwicklungsprozesse behindern.
Die Gründe für ihre Schuldgefühle sind unterschiedlich. Einige werden im Folgenden genauer erläutert werden.
Zunächst einmal fühlen sich einige Eltern schuldig, weil sie befürchten, die Entwicklungsstörung (mit)verursacht zu haben. Die kann aber ganz ausdrücklich ausgeschlossen werden. Niemand trägt Schuld, wenn ein Kind im Autismus-Spektrum ist.
Eltern – und besonders Mütter – suchen bei sich häufig nach eigenem Fehlverhalten und »Gründen« für die Probleme ihres Kindes.
»Hatte das System sich nicht entsprechend entwickeln können, weil ich im entscheidenden Abschnitt der Schwangerschaft durch die Fehl- und Frühgeburtsgefahr hatte liegen müssen? Hätte ich die Schwere der Störung vielleicht mindern können […] Solche Gedanken quälten mich und ich machte mir Vorwürfe, etwas falsch gemacht zu haben.« (Sitar-Wagner, 2011, S. 90). Die Frage, die sich Eltern immer wieder stellen, ist die, warum sich gerade ihr Kind anders als andere entwickelt. Zudem besteht zwischen frischgebackenen Müttern und Vätern oftmals ein Wettbewerb um die Entwicklung des Kindes: »Lächelt dein Kind schon?«, »Steht es, läuft es bereits?« Die »Leistungen« des Kindes werden dabei als »Leistung« der Eltern angesehen.
»Warum entwickelt sich das eigene Kind nun nicht wie erwartet?«, so die quälende Frage. »Hätte ich es nicht impfen lassen dürfen?«, »Hat ihm mein Rauchen so sehr geschadet, vielleicht das Glas Wein, das ich ab und zu getrunken habe?« Die Antworten, die die Eltern, und hier insbesondere die Mütter, finden, bestehen in der Regel aus impliziten Selbstvorwürfen. Sie listen auf, was sie tatsächlich oder auch nur vermeintlich getan oder unterlassen haben und fühlen sich als mangelhafte, gescheiterte Mütter. Oftmals trägt die Umwelt noch dazu bei, diese Schuldgefühle zu verstärken, indem sie die Eltern ungefragt mit Hinweisen für den »richtigen« Umgang mit dem Kind überschütten oder die Probleme des Kindes auf ein vermeintliches Fehlverhalten des Kindes zurückführen. Glücklicherweise spielt heute die von einer psychoanalytischen Betrachtung des Autismus geprägte Auffassung, dass die Eltern durch ihre emotionale Kälte Schuld an der Autismus-Spektrum ihres Kindes hätten, keine Rolle mehr.
Aber obgleich es zunächst einmal unwahrscheinlich ist, dass die Eltern tatsächlich Fehler gemacht haben, kann man schlicht konstatieren, dass alle Menschen, also auch Eltern, Fehler machen. Doch der Mythos von der »guten Elternschaft« besagt, dass gute Eltern keine oder nur kleine Fehler machen. Es steht dabei der furchtbare und verhängnisvolle Umkehrschluss im Raum: Eltern, die Fehler machen, sind schlechte Eltern. Doch Fehler sind erlaubt!
Es gibt noch eine weitere Ursache für ungerechtfertigte Schuldgefühle: der Mythos, dass man alle seine Kinder in gleicher Weise lieben muss. Erfahren die Eltern von der Behinderung ihres Kindes, werden sie meist neben der Liebe und der Hoffnung, die sie spüren, mit ihrer eigenen Traurigkeit, Wut und Aggression konfrontiert. Da dies aber Gefühle sind, die in unserer Kultur für Eltern gegenüber ihren Kindern nicht akzeptiert werden, können sie sie nicht zulassen. Sollten sie dies doch tun, führen diese Gefühle wieder zu Schuldgefühlen. Erfahren die Eltern zugleich noch eine gesellschaftliche Ablehnung des Kindes, wird das emotionale Chaos noch verstärkt.
Außerdem fühlen sich einige Mütter und Väter schuldig, wenn sie von Bekannten, Pädagogen und Therapeuten erfahren, dass es Therapien gibt, die sie früher hätten beginnen oder intensiver durchführen können. Oder wenn ihnen vorgehalten wird, in welchen Situationen sie sich entwicklungsfördernder hätten verhalten sollen. Kurz: Wenn sie glauben, sie hätten ihren Nachwuchs nicht genug gefördert und unterstützt.
Doch die meisten Eltern wollen das Beste für ihr Kind und machen es so gut, wie es ihnen möglich ist. So gut wie möglich ist gut genug. Der schuldbesetzte Blick zurück hilft niemandem. Schauen Sie in die Zukunft. Denn obwohl Ihr Verhalten nicht die Ursache dafür ist, dass sich Ihr Kind nicht wie erwartet entwickelt, können Sie doch entscheidend dazu beitragen, dass die Entwicklung voranschreitet. Was Sie genau für Ihr Kind tun können, wird in den nächsten Kapiteln gezeigt.
Symptome: Wie zeigt sich Autismus?
Aus dem Leben
Das »rätselhafte« Kind
»Nehmen Sie Ihr ›rätselhaftes‹, vier Jahre altes Kind. Holen Sie es aus dem Bett, in dem es seine Siesta gehalten hat. Sagen Sie ihm die üblichen, liebevollen Worte, dann sagen Sie ihm, dass Sie mit ihm in den kleinen Park gehen werden. Es antwortet nicht, natürlich, zeigt keinerlei Regung, lächelt nicht, aber es versteht Sie. Das erkennen Sie an seiner ein bisschen übertrieben geistesabwesenden Miene, die es immer aufsetzt, wenn es irritiert ist und nicht möchte, dass man das merkt. Es weicht Ihrem Blick aus. Es wird unruhig. Jetzt gilt es, die Treppe hinunterzugehen. Dazu brauchen Sie vielleicht eine halbe Stunde, wenn Ihr Kind beschlossen hat, auf ›seinen Stufen‹ stehen zu bleiben, auf denen es für gewöhnlich lange verweilt und dabei das Geräusch eines Motors nachahmt. Entweder akzeptieren Sie das, oder Sie machen kurzen Prozess, indem Sie es packen und vorwärtsziehen. Damit riskieren Sie eine furchtbare Szene, Geschrei, Fußtritte, ein Kind, das sich auf dem Boden wälzt, sich zerkratzt, sich beißt, auf seinen Kopf einschlägt.«(4)
Eltern von einem Kind im Autismus-Spektrum erhalten von ihren Mitmenschen oft viele gut gemeinte Ratschläge. »Sie müssen konsequenter sein!« »… liebevoller«, »Nun lassen Sie es doch in Ruhe!«, »Also, früher hätte man …«.
Die Kinder wirken auf andere Menschen oft einfach nur unerzogen, weil sie sich nicht an Regeln halten, sich schlecht beeinflussen lassen und vor allem, weil man die Behinderung den Kindern nicht ansieht. Viele Eltern sehen dann einen Fernsehbericht oder lesen ein Buch, in dem das Verhalten eines Kindes mit Autismus-Spektrum beschrieben wird. Oder eine Freundin oder eine Erzieherin erwähnt, dass das Kind »irgendwie autistisch« wirke.
Sie fürchten sich vor diesem schrecklichen Wort und hoffen andererseits doch, endlich zu verstehen, was der Grund für das merkwürdige Verhalten ihres Kindes ist. Natürlich interessiert es sie, was Autismus ist.
Der frühkindliche Autismus
»Wir Menschen mit Autismus sind nicht besser oder schlechter als andere Menschen. Wir haben denselben Wert. Wir sind nur in manchen Bereichen anders, wir sind etwas Besonderes. In unserer Gesellschaft hat man es schwer, wenn man sich zu sehr von den anderen unterscheidet, aber manchmal ist es nicht unbedingt ein Nachteil, anders zu sein.«(5)
Der frühkindliche Autismus wird mit seinen Besonderheiten bereits vor Vollendung des dritten Lebensjahres sichtbar. In drei Bereichen zeigt sich, dass sich das Kind nicht wie erwartet entwickelt. Diese drei zentralen Bereiche, die Beeinträchtigung der Kommunikation, der sozialen Interaktionsfähigkeit und der Phantasie werden auch »Triade von Beeinträchtigungen« genannt.
Triade von Beeinträchtigungen
Kommunikation. Das Kind benutzt und versteht Sprache in der sozialen Kommunikation wenig oder gar nicht, das Kind benutzt also z. B. keine Worte, um die Mutter auf einen Hund oder ein Auto aufmerksam zu machen, es erzählt ihr nicht von seinen Erlebnissen. Viele Kinder sprechen nicht, andere reden vor sich hin, ohne dass sie anderen etwas mitteilen wollen; sie wiederholen Reime, zählen und sprechen Sätze, die keinen Bezug zur Situation haben – sie sagen z. B. »Der Franzi fährt bald nach Hause«, egal, was man sie fragt oder zu ihnen sagt.
Soziale Interaktionsfähigkeit. Es zeigt wenig oder keine soziale Zuwendung oder gegenseitigen sozialen Austausch, es spielt z. B. keine sozialen Kleinkindspiele, wie »Guck-guck«; es tröstet die Schwester nicht, wenn sie weint; es wird nicht übermütig vor Freude, wenn der Papa nach einer Dienstreise wieder heimkommt.
Phantasie. Beim Spielen verwendet das Kind sein Spielzeug nicht entsprechend seiner Funktion, sondern dreht nur an den Rädern des Matchboxautos, statt mit ihm in eine Garage zu fahren. Es kämmt die Puppe nicht mit dem Kamm und legt sie nicht ins Bett. Es ist auch nicht zu einem »So-tun-als-ob-Spiel« in der Lage: es tut also nicht so, als ob es in einer leeren Cremedose für die Puppe eine Suppe kocht und es »telefoniert« nicht mit einem Holzstück am Ohr.
In jedem Bereich dieser Triade von Beeinträchtigungen gibt es verschiedene Symptome, von denen bei jedem Kind einige zutreffen müssen, wenn es einen frühkindlichen Autismus hat. Es ist unmöglich, dass alle Symptome bei einem Kind auftreten, da sie sich zum Teil gegenseitig ausschließen. Ein Kind kann z. B. nur entweder ohne verbale Sprache sein oder eine echolalische Sprache haben (siehe unten). Beides sind Symptome aus dem Bereich der gestörten Kommunikation. Welche Merkmale aus den drei Bereichen sich letztlich kombinieren, ist individuell verschieden.
Es müssen mehrere typische Symptome aus allen drei Bereichen vorhanden sein
Es handelt sich bei der Diagnose »frühkindlicher Autismus« stets um eine Summationsdiagnose, die Summe der Symptome ist letztlich entscheidend. Sie kennzeichnet zwar ein ziemlich klar umrissenes Syndrom, ist aber auch der Sammelbegriff für die individuell verschiedene Kombination von Symptomen aus einem Symptomkatalog. Ein fehlendes oder vorhandenes Einzelsymptom rechtfertigt weder eine Diagnose »frühkindlicher Autismus«, noch deren Ausschluss. Dies gilt ebenso für das Asperger-Syndrom und den atypischen Autismus. Jedes einzelne Symptom kann auch während der normalen Entwicklung oder im Zusammenhang mit anderen Störungen bzw. Behinderungen auftreten. Nehmen wir z. B. das Wiederholen von Äußerungen, die das Kind gehört hat. Man nennt dieses Phänomen »Echolalie«.
Echolalie. Viele Kinder im Autismus-Spektrum echolalieren. Einige wiederholen sofort, was ein anderer gesagt hat (sofortige Echolalie), andere erst zu einem späteren Zeitpunkt (verzögerte Echolalie). Aber alle Kinder echolalieren, wenn sie zu sprechen beginnen. Sie wiederholen, was man ihnen vorspricht, ohne das Gehörte verstehen zu können. Dies ist eine normale Phase der Sprachentwicklung. Ein Symptom eines Autismus-Spektrums ist die Echolalie nur, wenn sie ungewöhnlich lange und/oder intensiv auftritt.
Rhythmisches Schaukeln. Oder betrachten wir das rhythmische Schaukeln mit dem Körper. Diese motorische Stereotypie kennt man auch von Kindern, die wenig Anregung bekommen haben, weil sie z. B. für eine lange Zeit ihrer frühen Kindheit im Krankenhaus (hospitalisiert) waren. Einzelne Symptome sind nun keine »autistischen Züge«, sondern Auffälligkeiten, die möglicherweise in ein Autismus-Spektrum gehören können. Es gibt kein Symptom, das es nur beim Autismus gibt.
Die Kennzeichnung eines Symptoms als »vorhanden« oder »nicht vorhanden« unterliegt der subjektiven Entscheidung des Untersuchers und wird daher von verschiedenen Diagnostikern unterschiedlich bewertet. So kommt es, dass einige Kinder im Laufe ihres Lebens auch unterschiedliche psychiatrische Diagnosen erhalten.
Autismus ist ein Sammelbegriff für die individuell verschiedene Kombination von Symptomen aus einem Symptomkatalog. Dabei können die Symptome zudem noch unterschiedlich stark ausgeprägt sein.
Es dürfte aber auch deutlich geworden sein, dass man nicht einfach sagen kann: »Dieses Kind kann nicht autistisch sein, denn es guckt mich ganz normal an«. Ist der Blickkontakt unauffällig, muss ein anderes Merkmal aus dem Katalog zutreffen. Das könnte die Unfähigkeit sein, entwicklungsgemäße Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen, der Mangel, spontan Freude, Interessen oder Erfolg mit anderen zu teilen oder ein Mangel an sozioemotionaler Gegenseitigkeit.
Das Asperger-Syndrom
Es ist eine falsche Betrachtungsweise des Asperger-Syndroms, wenn es lediglich als Defizit oder als Problem verstanden wird. Viele Betroffene berichten, dass sie sich wünschen, dass man sich stärker auf ihre Fähigkeiten als auf ihre Defizite konzentriert und das Asperger-Syndrom nicht als Krankheit oder als Störung betrachtet, sondern lediglich als eine Variante, wie ein Mensch sein kann. In diesem Buch wird deshalb auch die Bezeichnung »Menschen im Autismus-Spektrum« verwendet, wenn nicht Bezug auf die fachärztliche Diagnose genommen wird.
Aus dem Leben
»Wir haben auch unsere Vorzüge«
»Aber wir Menschen mit Autismus haben auch durchaus unsere Vorzüge. Die meisten von uns sind pünktlich, zuverlässig, aufrichtig und ehrlich. Wir wünschen uns Gerechtigkeit und ein Leben in Frieden. Wir legen weniger Wert auf Äußerlichkeiten oder auf so genannte ›Statussymbole‹ als andere Menschen. Wir wünschen uns Menschen, die es gut mit uns meinen, nicht solche mit dicken Geldbörsen. Wir sind genügsam und können uns manchmal über ausgesuchte Kleinigkeiten viel mehr freuen als über viele teure Dinge. Und es gibt wohl für jeden Betroffenen noch viele weitere individuelle Vorzüge, die andere Menschen nicht besitzen, die ihn zu einem einmalig liebenswerten Menschen machen. Es scheint sinnvoll, sich diese Besonderheiten einmal in Ruhe zu überlegen und zu notieren. In Krisensituationen können sie vielleicht hilfreich sein.«(6)
Menschen mit dem Asperger-Syndrom durchlaufen keine abnorme Sprach- oder kognitive Entwicklung. Trotzdem ist die Kommunikation auffällig. So haben diese Kinder oft eine wenig modulierte Sprachmelodie, sie artikulieren oft übergenau und verwenden unübliche sprachliche Wendungen. Meist fällt es ihnen schwer, sich auf ihren Gesprächspartner einzustellen, sie reden lange über Themen, die sie besonders interessieren, völlig gleichgültig, ob ihre Gesprächspartner auch daran interessiert sind oder nicht. So erzählte der Bruder eines Jungen mit Asperger-Syndrom, dass sein Bruder bei jedem Abendessen der Familie über die Preise verschiedener Grundnahrungsmittel bei unterschiedlichen Verbrauchermärkten sprach. »Milch kostet heute bei X 90 Cent, bei Y 87 Cent, bei Z 91 Cent. Butter kostet heute bei X 1,21 Euro, bei Y 89 Cent usw.« »Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das nervt!« klagte der Junge. »Das interessiert uns gar nicht!«
Wie beim frühkindlichen Autismus treten Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion auf und ist das Spektrum an Interessen und Aktivitäten begrenzt. Sieht man von Meilensteinen der motorischen Entwicklung ab, ist das Verhalten des Kindes in den ersten drei Lebensjahren unauffällig. Die Diagnose wird bei diesen Kindern auch oft sehr viel später gestellt als beim frühkindlichen Autismus.