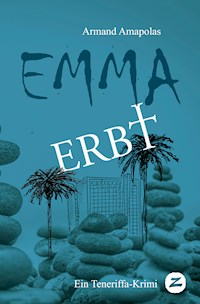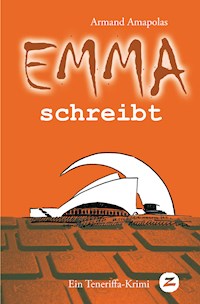Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zech Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Emma auf Teneriffa
- Sprache: Deutsch
Emma auf Teneriffa · Teil 3 2015. Die Journalistin Emma Schneider arbeitet an einem literarischen Reiseführer über Teneriffa. Während auf dem europäischen Kontinent immer mehr Flüchtlinge eintreffen, verhindern auf der Kanareninsel zwei junge Aktivisten ein Treffen völkisch-nationaler Parteien, am Jahrestag des Franco-Putsches. Kurz darauf sind beide wie vom Erdboden verschluckt... Emma und ihr Kollege Mike von der Inselzeitung – ihr Liebhaber, ihr Freund? – stoßen auf eine obskure Stiftung, die auf Teneriffa Großes im Sinn hat. Während sie undercover die Vorgänge um eine Kinderwunschklinik ausspionieren, bringen sich Emma und Mike selbst in Lebensgefahr. Und ihre Zweifel wachsen: Auf wessen Seite steht Kommissar Madrigal von der Guardia Civil eigentlich?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Handlungen und handelnden Personen dieses Romans sind frei erfunden. Leider gilt das nicht für die historischen Bezüge. Und zum Glück nicht für die beschriebenen Landschaften und Orte.
Alle Rechte vorbehalten · All rights reserved
©2024 Verlag Verena Zech, Santa Úrsula, Teneriffa/Spanien
www.zech-verlag.com · www.editorial-zech.es
Text: Armand Amapolas
Umschlaggestaltung und Illustration: Karin Tauer
ISBN 978-84-127281-1-8
eISBN 978-84-127281-2-5
Armand Amapolas
EMMA bleibt
Ein Teneriffa-Krimi
Für Anna und Boris und Alexej und all die anderen.
»Y es entonces que pido emocionada mi primera gracia: la gracia de volver.« / »Und dann bitte ich voller Inbrunst um die größte meiner Gnaden: die Gnade der Rückkehr.«
Dulce María Loynaz
»Man muss Terror säen, man muss den Eindruck von Überlegenheit erzeugen, indem jene, die nicht denken wie wir, ohne Skrupel und ohne Zaudern eliminiert werden.«
General Emilio Mola Vidal
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Epilog
Dank und Quellen
1
»Geben Sie die Straße frei! Sofort!«
»Gerne. Lassen Sie mich einfach weiterfahren!«
Der Sicherheitsmann in schwarzer Uniform trat einen Schritt zurück und brabbelte hektisch auf sein Handgelenk ein. Während er abwechselnd lauschte und sprach, spannte sich sein Körper sichtlich an. Mike kam es vor, als nehme der Bursche innerlich Haltung an. Mimik und Gestik verkündeten: Jawoll! Sí, commandante! Ein betont grimmig dreinblickender Kollege des Schwarzmanns blockierte derweil mit seiner schieren Körpermasse die enge Zufahrt zum Wanderparkplatz.
Also war tatsächlich wohl etwas dran gewesen an diesem Tipp. Mike war froh, auf den Anrufer gehört zu haben. Zunächst hatte er den jungen Mann – jedenfalls klang seine Stimme jugendlich – für einen Spinner gehalten oder, eher noch, für einen Jugendlichen, der Schabernack trieb, sich einen Spaß davon versprach, einen Reporter in den Wald zu schicken, im Sinne des Wortes.
»Bitte legen Sie nicht auf!« Die Dringlichkeit, die Ernsthaftigkeit in der Stimme des jungen Mannes hatten bewirkt, dass Mike ihm zuhörte und jetzt sogar tat, wozu der Anrufer ihn aufgefordert hatte: »Seien Sie morgen Nachmittag in Las Raíces. Bitte! Sie kennen doch sicher das Faschisten-Monument da im Wald. Bringen Sie eine Kamera mit oder jedenfalls Ihr Handy. Und lassen Sie sich besser nicht als Journalist erkennen. Ich garantiere Ihnen: Sie werden staunen. Es wird sich lohnen. Seien Sie rechtzeitig da, spätestens um fünf. Besser, Sie fahren früher hin und geben sich als Wanderer aus!«
»Warum sollte ich das tun? Wer sind Sie überhaupt? Und woher haben Sie meine Handynummer?«, hatte Mike den Anrufer gefragt.
Weder er noch der junge Mann hatten aufgelegt – beziehungsweise die Verbindung unterbrochen; in vordigitalen Zeiten nannte man das »auflegen«, und Mike benutzte diese Vokabel immer noch, aus schierer und lieber Gewohnheit. Ob der Anrufer gewusst hätte, was mit »auflegen« gemeint war? So ein Unsinn fegte Mike durch den Kopf, während er erwartete, der Anrufer werde das Gespräch nun zügig beenden. Doch das tat er nicht, sondern fragte zurück: »Sie sind doch Michael Dorenbeck? Der Journalist aus Hamburg? Der jetzt hier auf Teneriffa für die Inselzeitung schreibt?«
In die Pause hinein hörte Mike sich sagen: »Ja.«
»Na bitte. Woher wir Ihre Handynummer haben, tut jetzt nichts zur Sache, aber dass wir sie haben, sollte Ihnen zeigen: Wir wissen, wer Sie sind und was Sie können. Wir liefern Ihnen eine Exklusivstory. Im Wald bei Las Raíces liefern wir Ihnen morgen eine Story, wie sie in Ihrem Touristenblättchen noch nie gestanden hat. Versprochen!« Der Anrufer versuchte, seiner Stimme einen sehr bestimmten, autoritativen Klang zu geben, was ein wenig aufgesetzt wirkte. Mike spürte, wie aufgeregt der junge Mann in Wirklichkeit war.
»Wieso ich?«, wollte er wissen.
Darauf fiel dem Anrufer keine schnelle Antwort ein. Er schien sich erst mit jemandem zu beraten. Dann, und seine Stimme hatte jetzt einen fast bittenden Klang angenommen: »Wir kennen einfach keinen anderen ernsthaften Journalisten mit Kontakten zur internationalen Presse hier auf der Insel, keinen, der Deutsch spricht. Wir brauchen Sie als Zeugen. Bitte!«
»Wir? Wer ist: Wir?«
»Haben Sie schon mal was von Darkwatch gehört? Wir sind Darkwatch. Und Sie wissen doch, was morgen für ein Tag ist?«
»Der 17. Juli. Ja, und?«
»Das sagt Ihnen nichts? Doch, bestimmt sagt Ihnen das was. Sie leben doch schon eine Weile hier in Spanien, Herr Dorenbeck. Dann wissen Sie doch sicher, was nach dem 17. Juli 1936 passiert ist! In Spanien. Na, klingelt’s?«
Ja, es hatte geklingelt. Außerdem hatte ein schneller Blick ins Internet bestätigt, nach dem Telefonat: Darkwatch gab es tatsächlich.
Das war, sprach Das Netz, eine linke – oder linksradikale? – Gruppe von meist deutschen Aktivisten, die völkische Organisationen beobachteten und deren Treffen störten. Vor allem während sogenannter Montagsdemos sogenannter »besorgter Bürger« war die Gruppe in Erscheinung getreten. Mit Zwischenrufen wie »Nazis, haut ab!« Oder indem sie auf Internetseiten, wo sonst die angebliche »Überfremdung« Deutschlands durch muslimische Einwanderer beklagt und der bevorstehende Untergang des christlichen Abendlandes beschworen wurde, Hitler-Zitate platzierten, die ganz ähnlich klangen wie die Sprüche der Redner, die bei solchen Demos auftraten, nur drastischer. Gern stellten sie auch Fotos zerstörter Städte aus dem Zweiten Weltkrieg dazu, Fotos ausgemergelter KZ-Opfer, erhängter Nazi-Gegner, halbverwester Soldatenleichen.
Mike war beeindruckt. Wenn der Anrufer, der seinen Namen partout nicht nennen wollte, tatsächlich einer von denen war, sollte Mike wirklich mal einen Ausflug in die Berge unternehmen.
Vielleicht könnte er sogar Emma überreden mitzukommen. Und wenn das Ganze doch eine Ente sein sollte, könnten sie zu zweit immer noch einfach wandern gehen. Zu zweit, im Wald allein…
Leider hatte Emma keine Zeit. Hatte sie zumindest behauptet. Sie müsse dringend einen Krimi von Agatha Christie zu Ende lesen, weil sie am nächsten Tag zu einem Telefoninterview mit einer Kennerin der berühmten Kriminalschriftstellerin verabredet sei. Da wolle sie nicht völlig ahnungslos sein.
»Die Agatha-Christie-Biographie muss ich auch noch lesen. Nee, geh du mal alleine Pilze suchen im Wald! Aber pass auf dich auf, denn du weißt doch: Im Wald, da sind die Ro-häu-häui-ber.« Emma zog das letzte Wort melodisch in die Länge.
Mike bildete sich ein, eine Anzüglichkeit herauszuhören. Ihm fiel auf: Er hatte Emma noch nie singen gehört. Sowas! Und ja: Ihm gefiel ihre Stimme, wenn sie sang. Ihm gefiel nicht nur ihre Stimme. Sie sollte öfter für ihn singen. Und überhaupt… Aber all das sagte er ihr nicht. Er hatte ihr so manches nicht gesagt, nie. Worüber er sich im nächsten Moment ein klein wenig ärgerte – ohne so recht zu wissen, warum. Aber da hatten beide ihr kurzes Telefonat auch schon wieder beendet und ihre Handies weggesteckt.
Bei Las Raíces lag nicht irgendein Wanderparkplatz, das wusste er. Der hohe, lichte Kiefernwald dort, nur ein paar Kilometer hinter Teneriffas Nordflughafen den Berg hinauf Richtung Teidegipfel, lud zum Wandern und Picknicken ein, und das taten viele Menschen auch, vor allem an Wochenenden. Doch bekannt geworden und geblieben, jedenfalls unter älteren Tinerfeños, war Las Raíces aus einem anderen Grund. Bei der Erwähnung des 17. Juli »klingelte« es tatsächlich in Michael Dorenbecks Gedächtnis. Jeder, der nur ein bisschen mit Spaniens Geschichte vertraut war, dem sagte dieses Datum etwas:
Am 17. Juli 1936 hatte ein General der spanischen Armee, genauer General Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Salgado y Bahamonde Pardo, Capitán General de Canarias, hier im Wald auf Teneriffa Mitverschwörer um sich versammelt, um am nächsten Tag zu einem Putsch gegen Spaniens demokratisch gewählte Regierung aufzubrechen. Die Regierung der spanischen Republik hatte den General auf die vom Festland weit entfernten kanarischen Inseln zwangsversetzt. Man hatte geglaubt, ihn da ruhigzustellen. Ein schwerer Irrtum. In den Folgejahren sollte Spanien erst in einem blutigen Bürgerkrieg versinken, dann unter einer drückenden Diktatur jahrzehntelang verdorren.
Anders als die Nazizeit in Deutschland endete Francos Regime nicht 1945, sondern erst drei Jahrzehnte später, 1975, mit dem Tod des bis dahin längst »allergrößten Generals«. Dem im wirklichen Leben nur 1,63 Meter großen Diktator wurden überall in Spanien Denkmäler, Straßen und Plätze gewidmet. Der 18. Juli wurde zum Beginn eines ehrenvollen und schließlich erfolgreichen Kreuzzugs gegen die Kräfte des Bösen verklärt; gegen Kommunisten, Sozialisten, Anarchisten, gegen Atheisten, Journalisten und sonstige »Volksfeinde«.
Zum Glück war das jetzt, im 21. Jahrhundert, alles längst Vergangenheit und weithin vergessen. Fast.
Mitten im Esperanza-Wald auf Teneriffa, allerdings gut verborgen zwischen hochgewachsenen Kiefern, stand zur Erinnerung an das Treffen vom 17. Juli 1936 ein gewaltiges steinernes Monument. Während der Diktatur fanden hier häufig Erinnerungstreffen »alter Kameraden« statt. In der Nach-Franco-Zeit verfiel der Ort in einen Dämmerschlaf. Erst 33 Jahre nach dem Tod des Diktators beschloss die Inselregierung, nach erbitterten Diskussionen, das Monument abzureißen. Es dauerte weitere sieben Jahre, bis tatsächlich Bagger anrollten und den Obelisken stürzten. Statt das Monument völlig zu entfernen, blieb eine Art Waldbühne erhalten.
Das alles wusste Mike. In den spanischen Zeitungen war das zuletzt immer mal wieder ein großes Thema gewesen. Und dahin wollte er jetzt, zu dieser Waldbühne. Wenn die beiden »Sicherheitskräfte« ihn nicht an der Einfahrt zum Wanderparkplatz Las Raíces hindern würden.
Die beiden hätten auch gut unter Franco Dienst tun können, fand er. Die schwarzen Barette auf ihren kantigen Schädeln sahen allerdings ein bisschen harmloser aus als der Tricornio, die dreispitzige Plastikkappe, an der Soldaten der damals berüchtigten Guardia Civil zu Francos Zeiten zu erkennen gewesen waren. Nein, das hier waren keine Soldaten, auch keine Polizisten, keine Beamten der Guardia Civil. Das hier waren offenbar Angestellte eines privaten Sicherheitsdienstes mit obskuren »Security«-Plaketten an ihren Phantasieuniformen. Von denen würde sich Mike nichts verbieten lassen! Das hier war schließlich eine öffentliche Straße in einem öffentlichen Waldgebiet! Auf einer Insel freier Bürger eines freien Landes. In EU-Europa. Das alles hätte Mike diesem Schwarzmann gerne gesteckt, wenn der ihm denn zuhören würde, statt stur wegzublicken und einem unsichtbaren Vorgesetzten zu lauschen, dabei immer wieder heftig nickend, als könnte sein Männeken im Ohr ihn sehen.
Jetzt, endlich, beugte der Schwarzmann sich wieder zu Mikes Autofenster hinunter, aber nur, um in barschem Ton zu wiederholen: »Machen Sie die Zufahrt frei! Endlich! Kehren Sie um oder fahren Sie weiter!«
Während des erzwungenen Stopps waren immer wieder Fahrzeuge an Mike vorbeigewinkt worden, von diensteifrigen, salutierenden Kollegen des Schwarzmanns. Offenbar verwehrte man nur ihm und seiner Cinquecenta die Weiterfahrt. Schwarze Limousinen oder SUVs, mit abgedunkelten Fenstern, die durften hinein in den Wald.
»Hören Sie, wieso können die hier durchfahren und ich nicht?«
Den Schwarzmann schien Mikes simple Frage zu überfordern. Er wandte sich wieder ab und sprach in sein Armgelenk hinein. Was immer er daraufhin zu hören bekam, von »oben« – er beschied Mike: »Das geht Sie nichts an. Die haben Clearance. Sie nicht.«
»So? Und wo bekomme ich diese Clearance? Dann beantrage ich sie hiermit.«
Schwarzmann war sichtlich überfordert. Er nahm erneut eine aufrechte Haltung an und beriet sich mit seinem Kollegen, der immer noch breitbeinig Mikes Fiat den Weg versperrte. Derweil rauschte ein weiterer SUV an ihnen vorbei in die Tiefen des Kiefernwaldes hinein.
Mike trat die Kupplung durch und aufs Gaspedal. Leider ließ dieser Imponiertritt das Motörchen seines Autos nur sanft aufsäuseln, und keineswegs herrisch röhren, wie Mike es sich gewünscht hätte. Manchmal, wenn auch nur sehr selten, bedauerte er dann doch, automobil abgerüstet zu haben und so einen putzigen, knuddeligen Fiat 500 zu fahren, den er liebevoll, schon in Ermangelung anderer dauerhafter Liebschaften, zur Cinquecenta verweiblicht hatte. Ein blech gewordener Abschwur jeden Machogehabes, das war sie, seine geliebte Cinquecenta. Hübsch rundlich sah sie aus. Nie gab sie Widerworte. Die Ansprüche, die sie an ihn stellte, waren berechenbar und verständlich. Mehr als ein bisschen Benzin und Pflege verlangte sie nicht. Sie schnurrte, wenn sie fuhr. Allerdings konnte sie nicht röhren. Und nicht singen.
Mike entschloss sich, anders Bewegung in die Dinge zu bringen. Er öffnete die Fahrertür und stieg aus. Er hatte vor, die schwarzen Gestalten nach ihrem Vorgesetzten zu fragen.
»Steigen Sie wieder ein! Sofort! Zu Ihrer eigenen Sicherheit! Sie können hier nicht herumlaufen. Das ist gefährlich.« Schwarzmann klang jetzt geradezu verzweifelt. Fast hätte er Mike leidgetan.
Freundlich lächelte er den Security-Mann an: »Erstens ist das meine Sache. Zweitens haben Sie mir nichts zu befehlen. Drittens will ich ja wieder einsteigen. Und weiterfahren. Und wandern gehen, da im Wald. Wie es mein gutes Recht ist. Als Bürger. Der Wanderparkplatz dahinten gehört der Allgemeinheit, also mir genauso wie Ihnen. Machen Sie endlich Platz und lassen Sie mich durch, und gut ist’s.« Mike deutete auf seine Wanderschuhe, die ihn tatsächlich aussehen ließen wie jemanden, der nur gekommen war, um die erhabene Schönheit der gigantischen Kiefern zu bestaunen und die klare Bergluft zu genießen.
Das harmlose Auto, die Schuhe, Mikes Wanderkluft, Zeitdruck, was auch immer, jedenfalls schienen die beiden von Mikes Harmlosigkeit nun doch überzeugt zu sein, vielleicht wussten sie auch einfach keinen weiteren Rat. Jedenfalls nickten sie, nach einer letzten Konversation mit Handgelenk und Knopf im Ohr, einander zu und traten zur Seite.
»Vale. Fahren Sie! Aber langsam! Parken Sie ihren Wagen auf dem Picknickplatz! Nur da! Halten Sie den Kreisel frei! Und stören Sie auf keinen Fall die Veranstaltung! Anderenfalls hätte das ernste Konsequenzen für Sie.« Beide Schwarzmänner legten ihre rechte Hand demonstrativ auf die Griffe der Schlagstöcke, die in Holstern steckten und Gewaltbereitschaft signalisierten. »Jetzt machen Sie, dass Sie hier wegkommen!«
»Yes, Sir!« Mike salutierte den beiden und schlug die Hacken seiner Wanderschuhe zusammen, spöttisch grinsend. Wenn Blicke töten könnten, wäre er jetzt eine Leiche. Stattdessen klemmte er sich wieder hinter das Steuer seines Kleinwagens, legte einen Gang ein und fuhr los, hinein in den Wald.
Ohne Reifen quietschen zu lassen. Ohne Emma. Allein. Wie Emma seinen Auftritt wohl gefunden und kommentiert hätte? Schade, dass er das nie wissen würde.
2
Emma Schneider, deutsche Journalistin – oder Ex-Journalistin, sie war sich da nicht so sicher – hatte es sich derweil auf einer der Liegen am Pool des La Palma gemütlich gemacht. La Palma, so hieß das 13-stöckige Apartmenthaus in Puerto de la Cruz, in dem ihre Oma Ilse den letzten, den wohl schönsten Teil ihres langen Lebens verbracht hatte, auf jeden Fall den aufregendsten, und wo sie gestorben war, auf dem Balkon des Apartments, das nun Emma gehörte, dank Omas Testament.
Ein Angebot, es sofort zu verkaufen, hatte sie abgelehnt, bei ihrem ersten Aufenthalt in Oma Ilses Apartment, kurz nach deren Tod. Der eine Reihe weiterer mysteriöser Todesfälle nach sich gezogen hatte. Emma lief immer wieder ein Schauer über den Rücken, wenn sie an ihre Erlebnisse an der Fuente de las Ánimas dachte. Sie war dann schnell nach Deutschland zurückgeflogen, damals. Wo zum Glück und zu ihrer Ablenkung ein neuer Job auf sie wartete. Den sie allerdings fast schneller wieder losgeworden war, als er ihr zugeflogen kam.
Nun ja, ihre journalistische Karriere hatte sie sich ohnehin anders erträumt, als für ein regionales Hochglanzmagazin Schmeichelgeschichten über Reifenhersteller zu schreiben. Wer als junger Journalist Geld verdienen wollte, in Zeiten wie diesen, musste erlernte Prinzipien über Bord werfen und sich verkaufen. So sah Emma das: verkaufen. PR wurde ordentlich entlohnt, ernsthafter Journalismus hingegen drohte zur brotlosen Kunst zu verkommen. Auch in traditionellen Medien war die einst scharf gezogene Grenzlinie zwischen Werbung und redaktioneller Recherche längst verblasst. Die Einhaltung hehrer journalistischer Prinzipien war eine Sache für Erben und Helden geworden. Wenn selbst Koryphäen ihres Berufsstandes wie Michael Dorenbeck der Flut nicht trotzen konnten, was sollte sie, Emma C. Schneider aus Wanne-Eickel, als arbeitslose Berufseinsteigerin dagegen ausrichten können? Sie wollte sich nicht verkaufen. Aber sie musste leben, von irgendwas. Sie suchte sich Nischen.
Diese Nische hier fühlte sich gerade ganz gut an. Es gab Ärgeres, als nachmittags am Pool zu liegen, auf Teneriffa, im Schatten einer Palme, und Agatha Christie zu lesen. Nun gut, Agatha Christie-Romane waren nicht so ganz ihr Ding, sah Emma ihre Vorahnung bestätigt, je länger und je mehr sie las. Wie am Fließband hatte die berühmte Engländerin Kriminalromane abgesondert, vor fast hundert Jahren. Auf einer Treppe in Puerto de la Cruz konnte man Titel um Titel aufschnappen, während man Schritt für Schritt Stufe um Stufe nahm. Auf jeder Stufenwand war ein Titel notiert, von »The Mousetrap« über »The mysterious Mr. Quin« bis zum »Tod auf dem Nil«. Emma hatte sich die Treppe, die hinauf zum Ortsteil La Paz führte, am Vormittag angesehen, wie auch die schmucke alte Villa, in der Agatha Christie hier zu Gast gewesen war, 1927. Den mysteriösen Herrn Quin soll sie hier kennengelernt beziehungsweise erfunden haben.
Emma hatte den Auftrag angenommen, einen literarischen Reiseführer über Teneriffa zu schreiben. Literarisch in dem Sinne, dass sie über berühmt gewordene Autoren schrieb, die entweder von der Kanareninsel stammten oder irgendwann hier hängengeblieben waren – das waren gar nicht wenige; kein Wunder, wie Emma fand. Die »Elysischen Gefilde« der Kanaren mit ihrem milden Klima hatten es schon den alten Griechen angetan, auch wenn Homer, Aristoteles und Co. noch keine Charterflugverbindung vom Olymp zum Teide hatten. Die Idee des Verlags jedenfalls war, die Spuren bloßzulegen und aufzusammeln, die Autorinnen und Autoren wie Agatha Christie, Alexander von Humboldt oder María Loynaz auf Teneriffa hinterlassen hatten, daraus schöne, leicht lesbare Texte zu formen, nett bebildert, versteht sich, und so die Sogkraft zu verstärken, die von Teneriffa zunehmend auf lesende, also tendenziell gebildete, also tendenziell ordentlich betuchte Festlandseuropäer ausübte. Das Cabildo von Teneriffa, die Inselregierung, bezuschusste das Projekt ordentlich, was Emma aber erst erfahren hatte, nachdem die Tinte unter ihrem Autorenvertrag schon trocken war. Also eigentlich war sie auch jetzt wieder eine Lohnschreiberin. Von wegen Journalistin!
Teneriffa wollte sich zur Kulturinsel profilieren. Es hatte schließlich nicht nur den höchsten Gipfel Spaniens zu bieten, sondern auch eines der spektakulärsten Konzerthäuser der Welt und eine rege Kunstszene. Nur wusste der größte Teil der Welt bisher noch nicht genug darüber, fand die Inselregierung. Und lockte deshalb Schreiberlinge wie Emma an, vor allem aber auch Filmproduzenten und Kameracrews.
All das war Emma noch völlig unbekannt gewesen, als sie das Erbe ihrer Oma angetreten hatte und Besitzerin eines Apartments im La Palma geworden war. Sie hatte Teneriffa – ihre Oma und ihren schon früher verstorbenen Opa Heinrich im Blick – für eine fast schon deutsche Rentnerinsel gehalten. Dass dort auch Einheimische lebten, Tinerfeños, dass die Insel eigentlich, auch ohne Touristen, im Grunde eine Millionenstadt mit viel Natur war, das dämmerte ihr erst jetzt, dank ihrem neuen Rechercheauftrag, der sie auch in Inselecken brachte, wo keine deutschen Rentner oder rothäutige Engländer die Liegen an Hotelpools blockierten. Und dank, das musste sie zugeben, Michael Dorenbeck, ihrem Kollegen, Freund, Einmal-Liebhaber, ihrem – ja, was eigentlich?
Diese Frage blitzte in ihrem Hirn immer mal wieder auf, während sie von der Agatha-Christie-Lektüre nicht wirklich gefesselt war und dann und wann ein paar Bahnen im Swimmingpool zog. Dabei glaubte sie zu spüren, dass ihr in jedem Moment Dutzende Augenpaare folgten, von den Balkonen des La Palma herab. Der palmenumrahmte Pool lag wie eine Bühne unter den Rängen des Apartmenthauses. Jedes Apartment hatte einen Balkon, und jeder Balkon glich einer Loge.
»Vielleicht wirbelst du ja wieder eine vertrocknete Leiche auf«, hatte Mike ihr die bittere Erkenntnispille zu versüßen versucht, dass sie nichts als eine PR-Autorin war, eine Prostituierte des Wortes: »Du hast ja eine fast magische Anziehungskraft auf gewaltsam Verstorbene.«
Naja, auf ihre noch nicht ganz verstorbenen Mitbewohner des La Palma übte sie zweifellos eine gewisse Anziehungskraft aus. Sie hatte durch ihr Wiedererscheinen auf der Insel den Altersdurchschnitt der Hausbewohnerschaft kräftig gesenkt. Der Anblick ihres schlanken Körpers am und im Pool war so manchem Hausbewohner in seiner Loge ein Wohlgefallen – das war ihr so oder ähnlich schon häufig beschieden worden, bei Zufallsbegegnungen im Aufzug oder Treppenhaus. Allerdings äußerten sich ihre männlichen Mitbewohner zu diesem Thema nur – dann aber sehr freimütig –, wenn sie bei der Begegnung mit Emma nicht von ihren jeweiligen Gattinnen begleitet wurden. »Wenn der Reiseführer kein Bestseller wird«, hatte Mike gespottet, »kannst du Geld nehmen für deine Auftritte am Pool. Da kommt sicher was zusammen.«
Mike. Michael. Komisch, mit Michael hatte sie ihn noch nie angesprochen. Immer nur mit Mike, seitdem er für sie nicht mehr der Herr Dorenbeck war. Was Mike jetzt wohl gerade erlebte? Warum war sie nicht mitgefahren, in den Esperanza-Wald, statt sich hier begaffen zu lassen? Schön schattig sollte es dort sein, unter den alten Kiefern, tausend Meter über dem Meer. Und wenn sie mal ehrlich zu sich war: Von Mike ließ sie sich sogar ganz gern begaffen. Der Gedanke ließ sie kichern. Wer weiß, vielleicht hätte sich sogar eine Gelegenheit ergeben, nicht nur zu frotzeln, sondern endlich mal ernsthaft miteinander zu reden. Also nicht über den Journalismus an sich oder skurrile Engländerinnen, sondern über, ja, über was genau? Darüber, was das war mit ihnen, zwischen ihnen. Mit dem Herumgedruckse aufzuhören. Denn zu ihrer Verblüffung hatte Emma festgestellt: Sie vermisste Mike, wann immer er nicht da war. Sie hatte ihn in Deutschland vermisst. Und wenn sie ganz, ganz ehrlich zu sich war, hieß der entscheidende Grund, schon wieder nach Teneriffa zurückzukehren und schon wieder in Oma Ilses, noch immer mit Omas alten Möbeln bestücktem Apartment im La Palma unterzukriechen, allen Heilbutts und Glotzern dieses Hauses zum Trotz: Michael Dorenbeck. Der jetzt bestimmt was Spannendes erlebte, im Kiefernwald, während sie sich hier am Rentnerpool mit Agatha langweilen musste.
3
»Heute, Freunde, beginnt eine neue Zeit! Hier und heute, Freunde, brechen wir auf! Wir brechen auf zu einer neuen Reconquista. So wie unsere Ahnen vor einem halben Jahrtausend die Muselmanen zurückgejagt haben in die Wüsten Afrikas, so werden auch wir Europa heute wieder befreien!« Die Rednerin legte eine Kunstpause ein, um sich blickend, Applaus einfordernd und einfangend, bevor sie wiederholte: »Befreien! Wir werden Europa befreien, aus dem Klammergriff des Islam werden wir unseren Kontinent befreien. Des Islam, der heute auf eine neue Art, auf eine besonders perfide Art versucht, sich Europa untertan zu machen und das christliche Abendland auszulöschen. ‚Unsere Schwerter sind die Bäuche unserer Frauen‘, schreien die Imame von ihren Minaretten. Und sie rufen das nicht nur in Mekka, in Kabul, in Ägypten oder Syrien, in Ankara und Konstantinopel, sie rufen das längst inmitten unserer Städte – unserer Städte! –, hier bei uns, in Europa. In Madrid, in Barcelona, in Sevilla. In London, Paris, Berlin, in Rom und in Kopenhagen.«
Die Rednerin hielt erneut kurz inne. Ihr Gesicht legte den Ausdruck der Empörung ab und sich ein Lächeln zu. Das Lächeln galt einigen Männern und Frauen mittleren Alters, die in der ersten Reihe einer überschaubaren Zuhörerschar direkt vor ihr standen, auf einer abgezirkelten Steinfläche mitten im Esperanza-Wald. Die Rednerin und hinter ihr eine Handvoll Gestalten, allesamt Männer, einige in Uniform, hatten sich auf den Stufen einer Art Empore platziert, die sich von dem Platz davor abhob wie der Chorraum einer Kirche von deren Schiff. Die hochragenden, kerzengerade gewachsenen Kiefernstämme rund um diese steinerne Bühne herum verstärkten den Eindruck, sich in einer Kathedrale zu befinden. Einer Kathedrale des Waldes. Mike glaubte unter den Personen hinter der Rednerin auch einen Geistlichen ausmachen zu können. Das passte ja: Kathedrale, Priester, dieser Ort. Die katholische Kirche hatte Francos Putsch und sein Regime mehr als unterstützt. Sie war Teil des Regimes gewesen.
Anders als Kirchenmauern war der Wald durchlässig, nicht nur für Lichtstrahlen, sondern auch für Wanderer wie Mike. Zwar hatten ihn weitere schwarzgewandete Ordner daran gehindert, den mit Natursteinplatten gepflasterten Weg vom Parkplatz zu diesem Versammlungsort mitten im Wald zu betreten, denn das war das hier ja offensichtlich, ein Versammlungsort, allerdings ohne dass irgendein Denkmal, Kreuz oder sonstwas erklärte, welchem Zweck er diente, in der ausschließlichen Gesellschaft stattlicher Bäume. Mike hatte den Ordnern und den Anzugträgern, die anders als er offenkundig hoch willkommen waren, jeweils freundlich zugelächelt, wie Wanderer es tun, wenn sie, in der Einsamkeit der erhabenen Natur, Gleichgesinnten begegnen. Einige hatten sogar professionell zurückgelächelt.
Mike hatte dann einen großen Bogen um den Steinweg herum geschlagen und sich dem Versammlungsplatz von der Seite genähert. Damit fiel er nicht mehr weiter auf, denn er war keineswegs der einzige Zaungast, den das Spektakel angezogen hatte. Offenbar hatten sich noch ein paar andere Zufallswanderer von dem Aufmarsch der Limousinen, Ordner und Anzugträger angelockt gefühlt. Auch einige Reporter oder Blogger schienen ihren Job zu tun. Jedenfalls sah Mike Kameras und Mikrofonträger und fühlte sich jetzt fast wie unter Kollegen. Presse war also doch nicht völlig unwillkommen bei diesem merkwürdigen Aufgalopp im Wald. Allerdings erkannte Mike keinen einzigen der vermeintlichen Kollegen, die, anders als er, an sichtbar um den Hals gehängten Plastikkärtchen als akkreditiert, also offiziell zur Berichterstattung zugelassen, erkennbar waren. Sie hatten wohl, wie hatte der Schwarzmann das genannt: Clearance. Sie schienen nicht von der Insel zu kommen. Die hier hauptberuflich tätigen Journalisten kannte Mike alle. Er suchte sich eine gute Position mit guter Sicht auf das Geschehen vor ihm und richtete, misstrauisch von den »Kollegen« beäugt, die Kameralinse seines Handys auf das Geschehen. Er berührte den Aufnahmeknopf.
»Unsere Vorfahren haben vor einem halben Jahrtausend Spanien zurückerobert. Sie haben in einem zähen, Jahrhunderte währenden Kampf die iberische Halbinsel, unsere Península, dem Islam entrissen und sie der Christenheit zurückgegeben, Andalusien zuletzt. Damals war der Muselman nur bis zu den Pyrenäen vorgedrungen und im Osten Europas bis auf den Balkan und bis kurz vor Wien. Damals wurde er zurückgeschlagen, auch vor Wien. Er wurde zurückgeschlagen, weil die Christenheit zusammenstand, angeführt von Prinz Eugen, dem edlen Ritter. Auch heute muss das christliche Abendland, müssen wir zusammenstehen…« Die Rednerin hielt erneut kurz inne und nickte demonstrativ dem Kuttenträger zu, der mit gefalteten Händen schräg hinter ihr stand, wohlwollend lächelnd.
»Und es steht zusammen! Wir stehen zusammen! Als Christen und als Europäer. Heute und hier. Ich begrüße unsere Freunde aus Österreich, aus Deutschland, aus Italien, aus Ungarn, aus Dänemark und dem United Kingdom.« Die Rednerin deutete mit ihrer rechten Hand während dieser Aufzählung auf einzelne der vor ihr stehenden Personen. »Ganz besonders freue ich mich, dass auch die slawische Christenheit in dieser historischen Stunde an unserer Seite steht, hilfreich und mit großer Entschlossenheit. Ganz außerordentlich freue mich deshalb über die Anwesenheit unserer Freundin, die aus dem fernen Moskau angereist ist.« Offenbar schien auch eine Russin im Publikum zu sein, die jetzt nickte und ihren Nachbarn zulächelte. Mike erhaschte dabei einen raschen Blick auf ihr Gesicht. Es kam ihm vage bekannt vor.
»Denn das rufen wir unseren Feinden heute und von hier aus zu, von diesem geheiligten Boden aus: Wir sind viele, wir sind überall und wir werden immer mehr!«
Die Rednerin hatte offenbar die Absicht, an dieser Stelle tosenden Applaus zuzulassen. Doch von Tosen konnte keine Rede sein. So kraftvoll die vor und hinter ihr Gruppierten in die Hände klatschten: Ihr Applaus verlor sich, anders als in einem geschlossenen Kirchenraum, in den Weiten der Natur. Er verwehte im Rauschen der Kiefernkronen. Mike kam das Sprachbild vom Pfeifen im Wald in den Sinn. Auf einem niedrigen Tisch vor der Rednerin, das nahm Mike jetzt erst wahr, lag ein Degen mit blanker Klinge, drapiert wie die Bibel auf einem Altar. An den »Altar« angelehnt standen Kränze mit Stoffschleifen.
»Wir werden immer mehr! Wir sind überall!« Was der Applaus an Lautstärke nicht hergab, versuchte die Rednerin herbeizubeschwören, indem sie nun fast schrie: »Wir stehen zusammen! Dies zu beschwören sind wir heute hier an diesen geheiligten Ort gekommen.« Sie räusperte sich kurz und fuhr dann, wieder in ruhigerer Tonlage, fort: »Unsere Feinde haben versucht, ihn zu entweihen, diesen von der Geschichte gesegneten Boden. Sie wollten alle Spuren tilgen, alle Erinnerungen an den Kreuzzug, der hier seinen Anfang genommen hat. Doch es ist ihnen nicht gelungen. Denn sie mögen zwar Wahlen gewinnen, doch sie gewinnen nicht die Herzen der Völker. Geheiligt ist er, dieser Waldboden, ja, denn hier hat schon einmal die Reinigung Spaniens ihren Anfang genommen. Die Reinigung von dem Gift, das die katholische Christenheit geschwächt hatte, damals, so wie es sie auch heute wieder schwächt: von dem Gift des Selbstzweifels, verkleidet als falsch verstandene Toleranz, von dem Gift der Verweichlichung, der Dekadenz, von dem Gift des Bolschewismus, dem Gift einer falsch verstandenen und sich selbst aufgebenden Demokratie, von dem Gift…«
Wieder hielt die Rednerin inne, doch diesmal nicht, um Applaus entgegenzunehmen oder einen weiteren Gast zu begrüßen. Sie schien irritiert. Sie wandte den Kopf und rümpfte die Nase. Auch im Publikum hatte sich Unruhe breitgemacht, Unbehagen. Einige der Zuhörer hielten sich die Hand oder ein Taschentuch vor die Nase. Jetzt roch Mike es auch. Ein stechender Gestank machte sich breit, der Geruch von Schwefel, wie von faulen Eiern.
»Ein Gift, das unsere europäischen Gesellschaften hat verfaulen lassen«, nahm die Rednerin den Faden wieder auf, doch es fiel ihr sichtlich immer schwerer, Luft zu holen. Auch sie hielt sich jetzt eine Hand vor Mund und Nase. Sie sah sich hilfesuchend um.
Die Ordner drängten vom Rand der Arena nach vorn, die Reihen der Zuhörer lichteten sich.
»Ein Gift…«, setzte die Rednerin erneut an, brach den Satz aber, um Luft ringend, sofort wieder ab.
Die ersten Gäste verließen das Rund und hasteten zum Parkplatz zurück. Einige husteten heftig, wie von Asthma geschüttelt.
Die Ordner und auch der geistliche Würdenträger scharten sich schützend um die Rednerin, schickten dabei suchende Blicke in den Wald und hinauf zu den Baumkronen. In der Tat kamen von dort immer wieder merkwürdige Geräusche. Es klang wie das Knacken großer Nüsse. Der Gestank wurde immer infernalischer. Die Fliehenden beschleunigten ihre Schritte. Auch die Rednerin, jetzt umgeben von einem schützenden Pulk schwarz gekleideter Ordner, verließ hastig die Bühne und zog die Ehrengäste mit sich in Richtung der großen Lichtung, die als Parkplatz diente. Mike vernahm das jaulende Geheul eilig gestarteter Motoren.
Einige der Ordner setzen sich ab von dem Pulk und begannen in den Wald zu laufen, der hinter der Arena lag. Mike drehte sich um und glaubte, in der Ferne, zwischen den Stämmen der Kiefern, eine Bewegung wahrzunehmen. Was war das? Ein Fahrrad?
Während auch Mike das Feld räumte und gemächlich zu seiner Cinquecenta zurückspazierte, brummte das Handy in seiner Hosentasche zwei Mal vibrierend auf. Er zückte es erst, als er im Wagen saß und das Gewusel um ihn herum beobachtete. Wenn ein paar Dutzend Autos gleichzeitig starten und vom Parkgelände Richtung Straße drängen, ist Chaos unvermeidbar. Von den Ordnern war nichts mehr zu sehen. An Wegfahren war einstweilen nicht zu denken.
Mike sah nach, wer ihn angesimst hatte. Eine Nummer war ihm unbekannt, die andere vertraut.
»Haben Sie alles gefilmt? Können wir uns treffen?« Die Botschaft mit der unbekannten Absendenummer war mit »Rosa« unterschrieben.
»Wann kommst du zurück? Können wir zusammen essen?« Hier fehlte der Name. Aber Mike kannte die Absenderin.
4
Internationales Neo-Nazi-Treffen auf Teneriffa gesprengt
Auf der Kanareninsel Teneriffa endete eine Versammlung von Führern rechtsradikaler Parteien aus mehreren europäischen Ländern am Mittwoch im Chaos. Infernalischer Gestank unterbrach die Reden und die geplante Niederlegung von Kränzen an dem Ort, wo 1936 der Militärputsch gegen die demokratisch gewählte spanische Regierung begonnen hat. Zu dem Stinkbomben-Angriff bekannte sich eine Gruppe namens »Darkwatch«.
Zu dem Treffen beim Rastplatz in einem Wald hatte eine Organisation eingeladen, die sich »Front der Völker« nennt. Laut Darkwatch handelt es sich dabei um eine »Internationale der Neofaschisten«. Deren Ziel sei die Vernetzung anti-demokratischer, rassistischer Parteien und Organisationen aus ganz Europa, die Abschaffung der Europäischen Union und die Errichtung nationalstaatlicher Diktaturen.
Nach dem Stinkbomben-Angriff wurde das Treffen abgebrochen. Spanische und deutsche Sicherheitsbehörden wollten den Vorgang zunächst nicht kommentieren.
Darkwatch ist eine Gruppe selbsternannter Aktivisten »gegen Faschismus, Rassismus, Homophobie und Fremdenfeindlichkeit«. Sie war bisher nur in Deutschland in Erscheinung getreten. Mit ihrer Aktion auf den Kanaren wollte sie eigenen Angaben zufolge »auf die zunehmende internationale Vernetzung der rechtsradikalen Szene« aufmerksam machen. Es gelte: »Wehret den Anfängen!«
Das Hamburger Recherchenetzwerk Sincerus konnte die Authentizität eines auf YouTube geposteten Handy-Videos bestätigen. Darauf sind neben dem vom Verfassungsschutz beobachteten sächsischen Pegida-Aktivisten Uwe Hockmann auch Vertreter des französischen Front National, der italienischen Neofaschisten und der EKIP zu erkennen, die sich für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union stark macht.
Als Rednerin trat bei dem Treffen auf dem Waldgelände, das zu den Zeiten der Franco-Diktatur wie ein Schrein geheiligt wurde, die spanische Politikerin der Partido Popular Alejandra Vidal Roca auf. Sie wetterte gegen die angebliche Islamisierung Europas, als das Platzen hunderter, offenbar ferngezündeter Stinkbomben die Fortsetzung der Veranstaltung unmöglich machte. Zu weiteren Reden kam es nicht mehr.
Die Partido Popular (PP) ist eine Schwesterpartei der CDU/CSU und gehört dem Verbund europäischer Volksparteien an. Ihr Vorsitzender Mariano Rajoy ist seit 2011 Spaniens Ministerpräsident. Ein Regierungssprecher in Madrid distanzierte sich von dem Treffen im Wald auf Teneriffa. Ein Sprecher der PP erklärte, der Parteivorstand habe Alejandra Vidal Roca zu einer Stellungnahme aufgefordert, die aber noch nicht vorliege. Der PP verurteile entschieden jede Form des Rassismus und des Anti-Islamismus.
Am 17. Juli 1936 trafen sich General Franco und seine Mitverschwörer im Wald nahe der Inselhauptstadt La Laguna, um Details der geplanten Invasion Festlandspaniens zu besprechen. In den Wochen darauf setzte Franco mit ihm treu ergebenen Truppen über Gran Canaria und Marokko nach Spanien über. Es begann ein drei Jahre währender, überaus blutiger Bürgerkrieg, den Franco nur mit Hilfe aus Nazi-Deutschland gewinnen konnte. Das von Darkwatch verhinderte Treffen fand am Jahrestag des Putschbeginns statt.
Mikes Text, in Gänze oder in gekürzten Fassungen, erschien in den nächsten 24 Stunden, gedruckt und gepostet, in Hunderten von Zeitungen rund um die Welt und online, nicht nur in Spanien und Deutschland. Sogar der New York Times war er eine Meldung wert. Mike hatte ihn über das Journalistennetzwerk Sincerus den Nachrichtenagenturen zugespielt. Sincerus hatte den Text in seinen Newsletter aufgenommen, der vor allem in Redaktionen und von Bloggern gelesen wurde.
Ole Stüber, Mikes Kollege und Freund aus Hamburger Tagen, der jetzt als Investigativ-Journalist für Sincerus arbeitete – ohne damit nennenswert Geld zu verdienen – hatte auch dafür gesorgt, dass Mikes Handy-Video auf YouTube erschien. Mike konnte sich vor Interview-Anfragen kaum retten, obwohl er mehr, als in dem dürren nachrichtlichen Text stand, dabei nicht von sich gab. Immerhin konnte er nebenbei fleißig Werbung für die Inselzeitung und natürlich auch für die Insel selber machen. In Ermangelung von Details über die Darkwatch-Aktivisten berichteten Blogger und Boulevardzeitungen eben über ihn, Michael Dorenbeck. Laut »Bild« war er ein »Hamburger Ex-Star-Reporter«, der jetzt »als Aussteiger unter der Sonne der Kanaren das Leben genoss«.
5
»Hey, du bist jetzt berühmt! Bekomme ich ein Autogramm?« Emma wedelte mit einer Ausgabe der deutschen Boulevardzeitung vor Mikes Gesicht herum. Der hatte sich hinter seinem Schreibtisch in der Redaktion der Inselzeitung verschanzt, was ihm aber keinen Schutz vor der Blattattacke bot. Emma hockte sich auf den Schreibtisch und beugte sich grinsend zu Mike hinunter. Der konnte dem Getätschel mit der bunten Zeitung nur entgehen, indem er sich auf seinem Schreibtischstuhl weit nach hinten lehnte. Zum Glück war die Stuhllehne flexibel genug.
»Nicht berühmter als du, Emma. Allenfalls sind wir jetzt in derselben Liga. Bist du nicht die ‚hübsche Reporterin‘, die für Bild-Leser einen Mordfall nach dem anderen aufgeklärt hat? Die Agatha Christie von der Emscher, sozusagen? Und überhaupt: Was machst du hier? Was verschafft mir die Ehre und das durchaus zweifelhafte Vergnügen deines Überfalls? Solltest du nicht jetzt gemütlich im Liegestuhl liegen und den 50. Agatha-Krimi lesen, statt arbeitende Kollegen von ihrer Investigativtätigkeit abzuhalten? Mein Autogramm bekommst du nur, wenn ich von dir auch eines kriege.«
»Okay.« Emma griff zu einem der dicken Filzstifte, die auf Mikes Schreibtisch herumlagen, zwischen Stapeln von Papieren, Magazinen, Büchern. »Wohin soll ich schreiben? Auf den Arm? Oder auf die Stirn? Die Brust? Dann musst du dein schickes Hawaii-Hemd aber ausziehen.«
»Für dich gerne. Später. Das ist übrigens kein Hawaii-Hemd. Auf Hawaii-Hemden sind Palmen oder Papageien. Mein Hemd ist…« Mike schaute auf sein Hemd hinunter und suchte nach Worten. »…bunt. Abstrakt-bunt. Aber schön, dass es dir gefällt. Deine Bluse steht dir aber auch ganz ausgezeichnet. Vor allem, wenn du dich so weit nach vorne beugst.« Er stierte in den V-Ausschnitt ihres Hemdes hinein.
»Spanner!« Emma richtete sich kerzengerade auf, warf die Zeitung auf den Schreibtisch und zuppelte ihre Bluse übertrieben angespannt zurecht. »Jetzt hast du’s verdorben. Jetzt will ich kein Autogramm mehr von dir, ätsch!«, gab sie sich schmollend.
»Na, ihr Turteltäubchen! Störe ich?« Ursula Blaukamp, die Verlegerin der Inselzeitung und in dieser Eigenschaft Mikes Chefin, hatte geräuschlos den Raum betreten.
Chefin hin oder her: Beide wussten, wie sehr sie aufeinander angewiesen waren, Ursula Blaukamp und Mike. Die Verlegerin auf ihren einzigen fest angestellten Redakteur, der für Mindestlohn alles tat, was Journalisten so tun, allerdings in selbstbestimmtem Tempo und Ton; Mike wiederum auf diese patente Frau, die seit Jahrzehnten auf Teneriffa heimisch war und fast im Alleingang eine deutschsprachige Zeitung und einen Radiosender etabliert hatte, dank bester Vernetzung mit Airlines, Hotels, Gastronomen, Handwerkern, Anwälten und Ärzten, die mit ihren Anzeigen die Existenz der Inselzeitung sicherten. Und ihm so geholfen hatten, auf seiner Fluchtinsel Teneriffa etwas, wie er fand, Sinnvolles zu tun und nicht nur in der Sonne rumzuliegen und sich zu betrinken. Das bisschen Geld, das er damit verdiente, konnte er ganz gut gebrauchen, denn im Kern lebte der »Ex-Starreporter« von Erspartem und dem Erbe seiner Eltern. Befriedigend war das nicht.
Emma befürchtete zu erröten, als sie Ursula Blaukamps spöttisches Lächeln sah. Schnell rutschte sie von Mikes Schreibtisch herunter und setzte sich mit durchgedrücktem Rücken brav auf einen Stuhl an der Wand. Sie kam sich verrückterweise vor wie eine beim Mogeln ertappte Schülerin. Und fragte sich: wieso eigentlich? So ein Quatsch. Weder sie noch Mike hatten Verbotenes getan. Sie hatten ja noch nicht einmal, wie nannte Frau Blaukamp das: geturtelt. Oder doch? Und wenn? Verwirrend. Gut, dass wenigstens Mike die Kontrolle behielt.
»Du störst doch nie, Ursula. Wir sind gerade in einer Redaktionskonferenz. Gut, dass du dazukommst. Emma Schneider kennst du ja. Sie ist wieder auf der Insel. Sie recherchiert jetzt hier für einen Reiseführer, einen literarischen. Sie qualifiziert sich gerade zur Agatha-Christie-Expertin.«
»Toll.« Ursula Blaukamp lächelte Emma jetzt fast ironiefrei zu. »Herzlich willkommen! Schön, dass Sie wieder hier sind. Wenn Sie auf der Insel sind, Emma, dann passiert hier immer was. Das ist gut für die Auflage. Und für Herrn Dorenbeck.« Da war er wieder, der Hauch von Spott in ihrer Stimme, als sie von Emma zu Mike, von Mike zu Emma sah. »Wollen Sie nicht auch für uns mal was schreiben? Gute Autorinnen werden hier immer gebraucht.«
»Gerne. Wenn das Honorar stimmt. Herr Dorenbeck scheint ja nicht so besonders gut zu verdienen hier. Wenn er sich nur solche Hemden leisten kann.«
»Och, der Herr Dorenbeck gibt nicht so viel auf Äußeres. Er ist mehr ein Mann der inneren Werte, wissen Sie? Sie sollten ihn besser kennenlernen. Es lohnt sich. Er hat auch gute Seiten.« Jetzt kam es Emma vor, als würde Mike hinter seinem Notebook-Bildschirm erröten. Aber das war wahrscheinlich nur eine Lichtspiegelung.
Mike räusperte sich und rückte seinen Stuhl zurecht. »Was kann ich für dich tun, Ursula? Du siehst, ich bin – wir sind gerade sehr beschäftigt.« Er ließ seinen rechten Arm vage über das Papierchaos auf seinem Schreibtisch kreisen, Emma einschließend.
»Natürlich. Ihr müsst ja eine internationale Nazi-Verschwörung aufklären.« Ursula Blaukamps Gesichtsausdruck wechselte zu theatralischem Ernst. »Da will ich nicht im Weg stehen. Natürlich nicht. Im Gegenteil. Wenn ihr Hilfe braucht, ich bin dabei. Ich wollte eigentlich nur wissen, was darüber in unserer Zeitung stehen wird.« Sie hob das ‚unserer‘ leise mahnend hervor. »Die Deadline naht, wie du, vielleicht, noch weißt. Und da wären ja auch noch so ein paar andere unfertige Geschichten, über das Unwetter bei Garachico, über die Käse-Prämierung im Kongresszentrum, über die bevorstehenden Romerías… Habe ich was vergessen?« Ursula legte einen Zeigefinger vor ihren Mund, als müsste sie angestrengt nachdenken.
»Bestimmt. Aber keine Sorge, wir haben alles im Griff. Ich habe ja jetzt eine äußerst fähige Hilfsreporterin – wenn du die Sache mit dem Honorar geklärt bekommst.« Mike schenkte seiner Verlegerin ein zuckersüßes Lächeln. Emma ahmte ihn nach und strahlte Ursula Blaukamp ebenfalls auffordernd an.
»Na gut, dann ist ja alles klar. Ich sehe, ihr kommt schon zurecht. Weitermachen!« Ursula Blaukamp nickte den beiden zu, drehte sich um und verschwand aus dem Büro.
»Lass die Tür ruhig offen!« rief Mike ihr noch nach. Vergeblich. Die Verlegerin schob die Tür betont geräuschlos, aber bestimmt ins Schloss.
»So, das wäre geklärt. Wir können weitermachen. Wo haben wir aufgehört?« Mike sah Emma fragend an.
»Beim Honorarsatz. Gibt’s Zeilengeld, wenn ich deine Lohnsklavin werde, oder eine Pauschale? Und wer bestimmt darüber, du oder die Verlegerin? Du könntest übrigens ruhig aufstehen, wenn deine Chefin den Raum betritt. Ein bisschen mehr Respekt zeigen.«
»Stimmt. Du hast Recht. Ich war wohl abgelenkt.« Mike senkte seinen Blick von Emmas Augen zu einer südlicheren Körperregion. »Meinetwegen könnten wir dem gern heute Abend weiter nachgehen. Ich könnte was kochen, in meiner Cabaña, falls du dich da hintraust.«
»In dein Liebesnest?« Emma tat pikiert. »Wie geht es Anuschka übrigens?«
»Danke, gut, soviel ich weiß. Sie studiert jetzt in Barcelona.«
Mit Anuschka, der Tochter der Vermieter seiner Cabaña, einer Hütte auf einer weitläufigen Finca im Orotavatal, unterhielt Mike eine lose Immermalwiederbeziehung, wie Emma, leider, wusste. Eine Immermalwiederbeziehung, die überwiegend, wenn nicht ausschließlich sexueller Natur war. Immer mal wieder, wenn Anuschka, in den Semesterferien oder »zwischen Jobs« ihre Eltern auf Teneriffa besuchte und auf der Finca bei der Orangenernte oder dem Herrichten von Ferienwohnungen mithalf. Emma war das bei ihrem letzten Besuch auf der Insel und in Mikes Cabaña nicht entgangen. Miteinander gesprochen hatten sie darüber aber nie.
Mike empfand das dringende Bedürfnis, dem Gespräch eine andere Richtung zu geben. »Wir sollten klären, wie wir mit Darkwatch weiter umgehen. Rosa hat mir wieder eine SMS geschickt.« Mike reichte Emma sein Smartphone über den Tisch.
»Danke, steht da«, las Emma vor, »nur: Danke!«
»Die nächste, scroll runter!«
»Am Franco-Denkmal in Santa Cruz, am Militärhistorischen Museum, morgen früh 8 Uhr. LG Rosa«
»Die kam, kurz bevor du hier aufgetaucht bist. Ich hätte sie sonst schon an dich weitergeleitet.«
»Rosa. So. Klingt nach einem Rendezvous. Bist du sicher, dass du mir die Nachricht weiterleiten wolltest? Hast du eine Neue? Oder wieder nur was für zwischendurch? Wo sexy Anu ja so weit weg ist, in Barcelona. Ooch, du Armer!«
»Emma! Lass das! Bitte! Lass uns diese Dinge heute Abend besprechen, beim Essen, ja, wenn’s sein muss! Wir können auch in ein Restaurant gehen, wenn dir das lieber ist. Rosa, so heißt oder so nennt sich die Kontaktperson, die mir schon die Information über die Aktion in Las Raíces zugespielt hat. Das Franco-Denkmal in Santa Cruz ist fast noch monumentaler als das im Wald und noch umstrittener. Die Linken und der größere Teil der Öffentlichkeit hier auf der Insel verlangen den Abriss, so wie beim Denkmal im Wald. Das ist aber hier alles hoch umstritten. Die Debatte darüber ist erbittert und auch ein bisschen verlogen.«
»Ehrlich gesagt: Das verstehe ich nicht. Das ist ja, als gäbe es in Deutschland noch Hitler-Denkmäler oder Goebbels-Plätze. Wer will denn sowas?«
»Du darfst nicht vergessen: Nazi-Deutschland hat den Krieg verloren. Die Städte waren zerbombt, lagen in Ruinen. Die Siegermächte haben schon dafür gesorgt, dass übrig gebliebene Hakenkreuze rasch verschwunden sind. Und die Besiegten, auch die überzeugten Altnazis unter ihnen, konnten gar nicht schnell genug ihre Parteibücher, ihre NSDAP-Nadeln und die Hitler-Bilder an den Wohnzimmerwänden verschwinden lassen. Sie sollten und wollten ja ab sofort brave Demokraten sein. Hier in Spanien dagegen hat es so einen Bruch mit der Vergangenheit nie gegeben. Der Übergang von der Diktatur zur Monarchie war fließend und sogar von Franco selbst so – naja, so ähnlich – geplant. Nur dass der junge König Juan Carlos dann, kaum dass der Generalísimo im Grab lag, dessen Erbe sofort, so sahen und so sehen es die Franquisten, mit Füßen getreten hat. Anders als vom Alten gewollt, hat er Parteien wieder zugelassen, echte Parteien, und Pressefreiheit, und Spanien ist dann ziemlich schnell zu einer sehr lebendigen Demokratie geworden. Der König hat auf seine Allmacht verzichtet und repräsentiert nur noch. Wie die Queen in England. Nur ein einziges Mal noch ist er als Oberbefehlshaber in Erscheinung getreten: als Franco-treue Offiziere 1981 putschen wollten und mit Waffen im Parlament erschienen. Da hat Juan Carlos seine Uniform angezogen, ist im Fernsehen erschienen und hat das Militär zur Ordnung gerufen. Er, der König, das muss man sich vorstellen, hat die Demokratie verteidigt. Und vermutlich gerettet, in diesem Moment. Deshalb lassen die Spanier ihm seither auch so gut wie alles durchgehen.«
»Durchgehen? Was soll das heißen? Was lassen sie ihm durchgehen, ihrem König?«
»Naja, aus Juan Carlos, dem jungen mutigen König, ist inzwischen ein alter Schwerenöter geworden. Mit Frauengeschichten und merkwürdigen Geschäften seiner Familie. Das ist zwar ein Thema in spanischen Medien, und schon lange ist seine Abdankung gefordert worden oder gleich die Abschaffung der Monarchie und die Rückkehr zur Republik, aber mehrheitsfähig ist das nicht, bisher jedenfalls. Man weiß eben, was man an ihm hatte, als die Demokratie noch jung war und gefährdet. Und jetzt sitzt ja sein Sohn auf dem Thron.«
»Okay, verstehe. Aber die Franco-Denkmäler hat man nicht angerührt. Obwohl doch bis vor kurzem sogar die Sozialisten regiert haben, ganz lange sogar, wenn ich recht im Bild bin. Ich müsste das nachlesen, sorry.«
»Das ist schon richtig. Erst haben die Bürgerlichen regiert, aber eben auch die Demokratie verteidigt, dann kamen die Sozialisten an die Macht, die PSOE, also eigentlich sind das im deutschen Sinn Sozialdemokraten. Und Spanien hat sich, in rasantem Tempo, grundlegend verändert. Die Katholische Kirche war früher fast allmächtig hier, regierte in jedes Schlafzimmer hinein, Politik wurde von den Kanzeln verkündet. Und heute: Sind nur die geliebten Rituale geblieben. Semana Santa-Umzüge, Los Reyes zu Weihnachten, so was. Rituale halt, wie Stierkämpfe oder Karneval. Spanien ist eine ziemlich säkulare Gesellschaft geworden. Aber das ging wohl nur, weil über die Vergangenheit einfach nicht geredet worden ist, lange Zeit. Die Verbrechen des Franco-Regimes wurden nie geahndet, Täter nie belangt, die Folterer und Mörder des Regimes. An die Opfer des Terrors im und nach dem Bürgerkrieg wird erst seit ein paar Jahren erinnert, aber fast zaghaft nur, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Dabei hat fast jede zweite Familie hier und auf dem Festland im Bürgerkrieg und während des Terrors danach Angehörige verloren. Viele sind einfach verschwunden, in Massengräbern verscharrt, irgendwo. Erst seit ein paar Jahren gibt es ein Gesetz, das die Aufarbeitung der Geschichte ermöglicht, die Umbenennung von Straßen und Plätzen, etwa der Rambla in Santa Cruz, die bis vor kurzem noch Francos Namen trug, und einen Verein, der spanienweit Gräber ortet und Leichen exhumiert. Das ist aber alles hoch umstritten. Das Gesetz wurde unter den Sozialisten verabschiedet. Jetzt regieren wieder die Konservativen, die Partido Popular. Und eigentlich will niemand an die alten Wunden rühren. In Deutschland hat es ja auch bis zu den 68ern gedauert, dass die Nazi-Verbrechen ein großes Thema wurden. Vergiss das nicht!«
»Und deshalb steht hier mitten in der Hauptstadt noch immer ein Denkmal für Franco, aha. Den Mörder. Das verstehe ich richtig?«
»Ja, genau. Und was für eines. Du solltest es mit eigenen Augen sehen. Wir sind ja eingeladen. Von Rosa. Morgen früh. Wir könnten zusammen hinfahren.«
»Gleich von deiner Cabaña aus, meinst du? Clever eingefädelt. Nachdem du mich mit deinen zugegeben erstaunlichen Kochkünsten weichgedünstet und mit Wein mariniert hast. Denk gar nicht erst daran!«
»Schade. Die Vorstellung, dich zu dünsten und zu marinieren, hat schon was. Da könnte man zum Kannibalen werden. Aber ich hab ja schon gesagt: Wir können auch in ein Restaurant gehen. Conejo oder Cerdo geht auch.«
»Kaninchen? Schwein? Interessante Alternativen. Das lässt tief blicken. Über dein Frauenbild müssen wir uns mal ernsthaft unterhalten, gern sogar beim Essen. Fisch vielleicht. Ich erinnere mich an ein wirklich köstliches Ceviche.«
Mike lächelte geschmeichelt und breitete einladend seine Arme aus. Emma winkte energisch ab. »Nix da. Nicht heute. Heute wartet Agatha auf mich, wie du ja weißt. Schließlich hast du mich zur neuen Miss Marple erklärt. Danke dafür, übrigens! Tolles Kompliment. Aber morgen vielleicht, nach getaner Arbeit. Wir sehen uns um acht. Bei Franco.«
»Auch gut. Danke für die dezente Würdigung meiner Kochkünste, nebenbei. Morgen früh: ich könnte dich auch abholen? Am La Palma? Um sechs Uhr dreißig? Wir sollten früh aufbrechen, morgens kann der Verkehr auf der Nordautobahn verheerend sein. Vielleicht besser schon um sechs. Wenn wir zu früh da sind, könnten wir uns in Ruhe schon mal umsehen. Vielleicht gibt es dann sogar irgendwo schon einen Cortado.«
»Okay. Gut. Ich warte vor der Tür auf dich und deine Cinquecenta.« Emma gab dem Wort Cinquecenta einen Klang, als wäre es der Tarnname einer weiteren von Mikes Geliebten. Und im Grunde hatte er ja auch eine irgendwie amouröse Beziehung zu diesem albernen Gefährt.
Kaum, dass sie die Redaktionsräume verlassen hatte, bedauerte Emma, Mikes Einladung zum Dinner so schnöde – und zu frech? – ausgeschlagen zu haben. Im Innenhof des alten kanarischen Hauses, in dessen erstem Stock Ursula Blaukamps Inselzeitung residierte, hockten große Gruppen und zwei, drei Paare an Tischen voller Gläser und Flaschen, Relikte offenbar eines langgezogenen Mittagsmahls.
Die Canarios, das war Emma schon oft aufgefallen, aßen gern nachmittags. Und tranken. Alkoholkontrollen schien es auf den hiesigen Straßen eher keine zu geben. Oder jedenfalls hatte keiner Angst davor. Denn all diese Menschen in den vielen Restaurants konnten doch unmöglich samt und sonders zu Fuß ins Lokal gewandert sein. Zumal viele Restaurants, anders als dieses hier mitten in Puerto de la Cruz, irgendwo im Hinterland versteckt lagen, oft weit abseits von Hauptstraßen, nur zu erreichen über schmale, steile Sträßchen, die hohe Fahrkunst erforderten. Jedenfalls von Emma. Sie fand das Fahren auf Teneriffas Neben- und Seitenstraßen abenteuerlich und wollte sich gar nicht erst vorstellen, dabei Alkohol im Blut zu haben.
Aus der offenen Küche des Restaurants heraus klapperte und duftete es verführerisch nach Knoblauch und Frittiertem. Emma beeilte sich, an die frische Luft auf der Plaza de Charco zu kommen und strebte dem großen Parkplatz am Meer zu, wo sie ihren Mietwagen, es war wieder mal ein kleiner weißer Opel Corsa, suchte und glücklicherweise auch recht schnell fand. Jeder zweite Wagen hier schien weiß zu sein und ein Opel Corsa oder dessen Doppelgänger. Ein knubbeliger Cinquecento wäre ihr jetzt fast lieber gewesen.
6
Es regnete nicht heftig, aber hartnäckig in La Laguna, als sie im dichten Berufsverkehr an der früheren Inselhauptstadt vorbeifuhren, die jetzt zum Weltkulturerbe zählte, was man aber von der Autobahn aus wirklich nicht erahnen konnte. Emma erspähte durch das Geniesel nur Firmengebäude und Reklametafeln und sonstige gesichtslose Zweckbauten. Irgendwann hatten sie auch den Nordflughafen passiert, wo neben dem neuen Terminal noch immer auch der alte, der aus der Franco-Zeit, stand, wo sie als Kind mehrmals angekommen war, um mit Oma und Opa Ferien zu machen, im La Palma.
Komisch, fand sie, dass Bauten aus der Franco-Zeit immer gleich zu erkennen waren. Die hatten alle so was Militärisches, Strenges, Freudloses, obwohl ihnen die irrsinnige Monumentalität der deutschen Nazi-Bauten abging. Emma hatte mal das ehemalige Reichsparteitagsgelände der NSDAP in Nürnberg besucht, als Schülerin, bei einem Klassenausflug. Und hatte sofort die Filme von Leni Riefenstahl vor Augen, von unübersehbaren Menschenmassen, in Reih und Glied und wie beseelt ihren »Führer« bejubelnd. Auch Frauen himmelten ihn geradezu an. Dabei sah Hitler in Emmas Augen immer aus wie Charlie Chaplin im Film »Der Große Diktator«. Lächerlich. Wie konnte frau so einem zujubeln? Dem GröFaZ, dem selbsterklärten »Größten Feldherrn aller Zeiten«? Sie hätte mal mit ihren Omas und Opas darüber reden sollen, als die noch lebten. Warum hatte sie das nie getan? Jetzt war es zu spät dazu. Haben die Spanierinnen den kleinen, dicklichen Franco wohl auch so angehimmelt?
Die Wolkendecke, die über La Laguna hing, riss fast schlagartig auf, als sie die Abzweigung der Süd-Autobahn passierten. Strahlendes Blau lugte zwischen dem Watteweiß der Wolken hervor und vor ihnen glitzerte der Atlantik im Morgensonnenlicht. Emma fand den Anblick erquickend wie Espresso zum Frühstück. Sie musste einfach lächeln. Ob es jedem so erging, der hier herfuhr? Die Autobahn nahm eine Kehre und führte, steil wie eine Rutschbahn, auf Santa Cruz zu, die neue Inselhauptstadt unten am Meer, am Hafen, die aber längst durch einen Siedlungsbrei mit dem höher gelegenen La Laguna verwachsen war, der alten Hauptstadt.
Emma suchte und sah das in der Sonne funkelnde Auditorio, wo sie, kein Jahr war das her, Horst Hanisch das erste Mal getroffen hatte. Hanisch, dessen Memoiren sie schreiben sollte, und der dann, kaum hatten sie sich kennengelernt, umgekommen war, auf mysteriöse Weise. Frau Blaukamp hatte schon Recht. Emma und die Insel, das ging offenbar ohne Leichen nicht ab. Ohne Morde. Aber jetzt, im dritten Anlauf, sollten die einzigen Leichen, mit denen sie zu tun hätte, die in Agatha Christies Krimis bleiben. Emma drückte unbewusst ihre Daumen, während Mike die Abfahrt zur Avenida Marítima nahm und prompt in einen kleinen Stau geriet.
Sie zuckelten mehr, als dass sie fuhren, zwischen Altstadt auf der linken und den Hafenanlagen auf der rechten Seite die Marítima entlang und fanden ohne längeres Suchen – eine Tatsache, die Mike geradezu in Verzückung versetzte – eine Parklücke am Rand der vierspurigen Straße, kurz nachdem sie aus einem Tunnel wieder aufgetaucht waren.
»Von hier aus können wir zu Fuß gehen. Oder erst noch ein paar Schritte zurück. Eins der Cafés am Boulevard hat bestimmt schon geöffnet. Und uns bleibt Zeit für einen Cortado, wie geplant«, schlug Mike ihr vor.
»Gegen ein Bocadillo hätte ich auch nichts einzuwenden. Und ein Glas Orangensaft vielleicht.«
Emma hatte nichts gefrühstückt, in der Eile. Ihr war gerade noch Zeit geblieben, unter die Dusche zu springen und sich ein paar Klamotten überzuwerfen. Selbst fürs Haare föhnen hatte es nicht gereicht. Ärgerlich. Mike und seine Cinquecenta warteten schon auf dem Parkstreifen vor der Glastür zum La Palma, wie Emma von ihrem Balkon aus sehen konnte. Immerhin verzichtete Mike darauf zu hupen. Es war ihr immer schon peinlich gewesen, sich zu verspäten, auch nur um ein paar Minuten.
Pünktlichkeit, das hatte sie von Paul Bärkamp in der Redaktion der Halterner Post gelernt, war eine der fünf Grundtugenden des Journalismus. Neugier, Mut, Demut, Akkuratesse, so hatte ihr Lokalchef das immer wieder heruntergebetet, und: Pünktlichkeit! Weil ohne Pünktlichkeit keine Zeitung rechtzeitig gedruckt und ausgetragen werden könne, keine Sendezeit einzuhalten sei. Paul Bärkamp fand, das gelte auch in den Zeiten des Internets noch, obwohl das keine Druck- und Sendetermine kannte. Und Akkuratesse schon gar nicht. Emma wünschte sich, er hätte Recht.
Das Bocadillo, wie hier belegte Brötchen hießen, war knusprig und lecker, der Orangensaft frisch gepresst, der Café con Leche angenehm stark, die Morgensonne ließ die Welt lächeln. Emma kam es jedenfalls so vor. Mike und sie saßen auf Plastikstühlen unter Bäumen, an ihnen brauste der Berufsverkehr vorüber, Fußgänger, Autos, sogar einige Radfahrer, die sich neuerdings auf der Insel rasant zu vermehren schienen. Jedenfalls meinte Emma, in ihrer Kindheit hier nie Radfahrer gesehen zu haben. Alle Verkehrsteilnehmer, die rollenden wie die schreitenden, schienen sich zügig, aber ohne jene angestrengte Eile zu bewegen, wie Emma sie aus deutschen Städten kannte. Oder kam es ihr nur so vor, dass die Menschen hier allesamt entspannter waren, gelassener, heiterer?
»So. Wir sollten gehen«. Mike blies zum Aufbruch.
Eigentlich schade. Emma wäre gern noch bisschen länger hier sitzen geblieben. Aber die Pflicht, sie rief. Pünktlichkeit: Das hieß, vor der vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort zu sein. Jedenfalls sah Paul Bärkamp das so. Und der hatte, fand Emma, eigentlich immer Recht. Sie bewunderte ihren früheren Chef, der jetzt, nach der Einstellung der Halterner Post, mit ein paar anderen pensionierten und frühverrenteten Kollegen einen lokalen Nachrichten-Blog am Leben erhielt. Natürlich ohne damit Geld verdienen zu können. Für Emma war das leider keine Alternative gewesen. Sie musste Geld reinholen. Sie war weit entfernt vom Rentenalter, und erspart hatte sie nichts Nennenswertes. Ihre Eltern lebten beide noch, und zu erben gäbe es da auch nicht viel. Nur Oma Ilse hatte ihr ein Apartment vermacht. Auf Teneriffa. Das könnte sie verkaufen. Aber was dann? Wie lange käme sie mit dem Geld aus? Und wo sollte sie leben? In Bochum? Ihre Wohnung dort hatte sie untervermietet, einstweilen, AirBnb sei Dank. Oder auf Teneriffa? Im Ernst? Für länger womöglich? Für immer? So wie Mike? Nein, auch das war keine realistische Option. Oder vielleicht doch?
»Da ist es«, riss Mike sie aus diesen Gedanken. Sie waren offenbar nicht die einzigen, die sich heute früh für das ‚Monumento a la Victoria‘ interessierten.
»Das Franco-Denkmal heißt jetzt Siegesdenkmal«, hatte Mike ihr beim Kaffee erzählt. »Die Stadtverwaltung hat es gerade offiziell umbenannt. Das soll die Weiterexistenz des angeblich künstlerisch wertvollen Monstrums verträglich machen und Kritiker besänftigen. Gelingt aber nicht. Kein Wunder. Victoria, der Sieg, das meint ja immer noch Francos Sieg. Über die eigenen Landsleute. In den Augen der Franco-Gegner verhöhnt das Denkmal die Opfer der Diktatur.«
Sie näherten sich einer Straßenecke, an der eine Art Brunnen aufgemauert war, aus dessen Mitte sich eine steinerne Gestalt erhob. Nein, es waren zwei Gestalten, wie Emma im Näherkommen erkannte. Auf dem Rücken eines scheinbar fliegenden Engels mit weit ausgebreiteten Armen und Flügeln stand hochaufgereckt und sich auf ein Schwert stützend – oder war es ein christliches Kreuz? Eine Kreuzung aus beidem? – eine männliche Gestalt. Ihr steinerner Umhang schien im Wind zu flattern. Die Gesichtszüge des Mannes mochten denen des noch jungen Franco ähneln, fand Emma, als sie näher traten. Allerdings trieften seine Mundwinkel von Blut, aus seinem Schädel ragten, ebenfalls blutrot, Hörner empor. Wie die eines Teufels. Auch die Klinge des Schwerts war rot bekleckert, ebenso wie die neun steinernen Stelen, die wie aufgefächert die Rückwand der wasserlosen Brunnenanlage bildeten. Hier hatte also wohl ein Farb-Attentat stattgefunden, auf den steinernen Caudillo.
Eine junge Frau drückte Emma und Mike im Vorbeihuschen Flugblätter in die Hand. Täuschte sich Emma oder zwinkerte sie Mike dabei zu? Gut sah sie aus, die junge Frau. Höchstens zwanzig oder fünfundzwanzig mochte sie sein, schlank und sportlich wirkte sie in ihrer eng anliegenden Radfahrerkluft. Rosa?
Bevor Emma die Frau ansprechen konnte, war sie auch schon wieder verschwunden, wie abgetaucht zwischen den paar Dutzend Menschen, die sich rund um das Monument verteilt hatten, zwischen dem Brunnenmäuerchen und der Straßenkante, Neugierige, Passanten, Kamerateams. Eine Fernsehreporterin platzierte sich gerade im schrägen Winkel zur Engelsfigur und machte sich, der Kamera zugewandt, bereit für einen Aufsager. Zwei Polizeiautos bremsten scharf, aus unterschiedlichen Richtungen kommend. Die Kameras schwenkten wie choreographiert in deren Richtung, von einem zum anderen.
»Guck an, die Polizei ist auch schon alarmiert«, lenkte Mike Emma von seiner – seiner? – Rosa ab. »Und nicht nur die Policía Local eilt herbei, sondern auch die Guardia Civil. Da schau her, da steigt doch ein alter Bekannter aus dem Wagen. Unser tüchtiger und vielfach begabter Oberst Madrigal. Hattet ihr zwei nicht mal was miteinander?«
Emma gönnte Mike einen Blick von der Art, der man Tötungsabsichten nachsagt.
7
Die Polizisten wussten offenkundig nicht so recht, was sie tun sollten. Sie sahen sich das bekleckste Denkmal an, machten Fotos und nahmen den Stapel Flugblätter auf, den wohl die »Attentäter« auf dem Brunnenrand abgelegt hatten. Madrigal postierte sich neben einer der Stelen und scannte mit seinen Augen die Schar der Neugierigen. Eine sichtbare Regung zeigte er nur, als er Mike und Emma erkannte.
»Ich glaube, er hat dir zugelächelt, unser Comisario«, konnte Mike es nicht lassen, weiter zu sticheln.
»Lass das! Warst du es nicht, der mich gebeten hat, ja geradezu beauftragt, damals mit dem Kommissar Kontakt zu suchen, als Quelle? Wenn ich was mit dem angefangen hätte, dann wärst du der Kuppler gewesen. Ist das nicht hier sogar noch verboten, Kuppelei? Aber der Comisario ist tatsächlich viel charmanter als er tut, wenn er im Dienst ist. Sehr charmant sogar.«
Madrigal kam jetzt auf sie zu. Mike faltete das Flugblatt, das er immer noch nicht hatte lesen können, zusammen und steckte es in die Hosentasche. Emma folgte dem Beispiel.
Madrigal nickte Mike zu und ergriff Emmas Hand, deutete höflich einen Handkuss an. Sie widerstand der Versuchung, ihn ihrerseits mit einem Knicks zu begrüßen. Sie beließ es bei einem zauberhaften Lächeln. Sie fand die Frage vergnüglich, was Mike dabei wohl dachte.
»Herr Kommissar, wie schön, Sie wiederzusehen! Qué tal? So fragt man doch hier? Oder finden Sie vor lauter Leichen keinen Schlaf?«