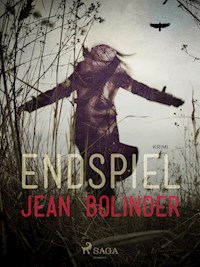
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal scheint verrückt zu spielen: Ein junger Mann verhindert den Mord an einer Frau und verliebt sich in sie. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht dieses komische Gefühl, dass er nicht wirklich deuten kann. Die Frau hat etwas an sich, was er nicht ausstehen kann, was ihn aber gleichzeitig auch magisch anzieht. Um mehr über seine Gefühle und die Frau an seiner Seite herauszufinden, taucht er tief in die Vergangenheit seiner Auserwählten ein – eine Reise mit verheerenden Folgen, denn die Frau hat einige Leichen im Keller. – Ein hinreißender psychologischer Krimi, der den Leser von der ersten Sekunde in seinen Bann zieht.REZENSION"Nach zehn Büchern in Folge über die Familie Bundin startet der Verfasser mit 'Endspiel' eine Reihe psychologischer Kriminalromane, in denen der Mensch und dessen scheinbar irrationales Denken und Handeln in den Hintergrund gerückt werden und somit eine spannende Handlung entsteht." – www.tomelius.seAUTORENPORTRÄTJean Bolinder ist ein schwedischer Autor und wurde 1935 in Linköping geboren. Er schreibt unter anderem unter den Pseudonymen Elisabeth Schalin und Jesper Borgham. Bolinder studierte Universität von Uppsala und arbeitete viele Jahre beim Theater und Film. Als Schriftsteller ist er vor allem für seine Kriminalromane und Psychothriller bekannt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean Bolinder
Endspiel
Saga
1
Der linke Scheibenwischer war verbogen und verschmierte das Glas. Die Sicht wurde erschwert, unter den gelben Straßenlaternen wirkte alles wie schwarzes Öl. Der Asphalt war naß, schlüpfrig wie ein Strand nach einem Tankerunglück; schmelzende grauweiße Schneeflocken wirbelten wie niedergeschmetterte Seevögel in der Luft, eisklare Kristalle klebten an der Scheibe.
Das „Swisch-swisch“ der Scheibenwischer bildete die Geräuschkulisse.
Schnee. Dunkelheit. Wasser. Dunst, den die Scheinwerfer durchschnitten.
Der Mann, der neben mir im Taxi saß, roch nach Nässe. Er trug eine schwarze Lederjacke über einem grauen Anzug. Blondes Haar und blonde Bartstoppeln. Um Mund und Kinn ein weicher Zug.
Er machte an und für sich keinen erschreckenden Eindruck. Aber er strahlte Verzweiflung aus. Das regte mich auf.
Manchmal sinne ich darüber nach, wodurch ein Mord im Taxi ausgelöst werden mag. Ob es nur davon herrührt, daß ein Kerl Geld braucht und beschließt, einen Taxichauffeur auszurauben, und so das erstbeste Opfer aussucht. Eine Lotterie also, wenn man Taxichauffeur ist. Man nimmt eine Menge Lose aus einer Trommel und wickelt eins nach dem anderen auf, bis man eins mit einem schwarzen Kreuz erwischt. Das bedeutet den Tod. Der Tod wartet auf einen in Gestalt eines Fahrgastes, der Geld braucht. Für Drogen oder Alkohol. Oder für sein Mädchen.
So kann es natürlich sein. Eine Solovorstellung. Der Mörder handelt, und das Opfer ist von Anfang an preisgegeben. Ich bin jedoch nicht sicher, ob es immer so sein muß.
Das nächstemal bin ich es vielleicht. Das nächstemal steht vielleicht das Taxi, das ich fahre, irgendwo auf einem Seitenweg, und ich sitze mit einer Kugel im Kopf über das Steuer gebeugt. Die Suche nach dem Mörder beginnt, und die Leute fragen sich beim Frühstück: „Wie ist denn das passiert?“
Ja, wie ist es passiert? War es eine Solovorstellung oder ein Dialog? Hatte der Kerl, der den Fahrer berauben wollte, gar nicht die Absicht gehabt, ihn zu töten? Trieb der Fahrer den Räuber dazu, ein Mörder zu werden? Wäre es nicht zu dem Mord gekommen, wenn der Fahrer die richtigen Worte gefunden hätte? Ein wenig diplomatisch gewesen wäre?
Manchmal frage ich mich, ob es wohl Menschen gibt, Taxichauffeure und andere, die einfach ermordet werden wollen. Vielleicht treiben sie unbewußt andere zum Mord. Oder soll man es Mithilfe zum Selbstmord nennen?
„Figge redet, wie er es versteht“, sagen meine Kollegen, wenn ich meine Gedanken äußere. „Hat dich deine Mutter einmal auf den Kopf fallen lassen, als du klein warst?“
Deshalb habe ich es mir abgewöhnt, über das zu reden, was mir durch den Sinn geht. Wie es zu einem Mord im Taxi kommen mag, darüber habe ich noch nie mit einem Menschen gesprochen. Die Kollegen würden sich wahrscheinlich an die Stirn tippen.
Der Blonde neben mir war am Norrmalmstorg zu mir eingestiegen. Er hatte dort gestanden und mit einer Zeitung gewinkt. Um halb zwei Uhr nachts. Er wollte nach Blackeberg gefahren werden: Sigrid Undsetsgata 3.
Er schwieg lange Zeit. Ich überlegte, ob er wohl etwas gegen mich plante. Ich überlegte auch, wie ich ihn behandeln müßte, um so billig wie möglich davonzukommen. Mit Freundlichkeit, dachte ich. Überlaß ihm das Geld und sei freundlich. Gib seinen Aggressionen keinen Sauerstoff, damit sie ja nicht aufflammen.
Ich hatte ein paar Tage mit Darmgrippe im Bett gelegen, und ich fühlte mich noch matt und angeschlagen. Infolgedessen war ich unlustig und ein wenig niedergedrückt. Vielleicht glaubte ich deshalb, er führe etwas gegen mich im Schilde. Bildete mir deshalb etwas ein.
Wir hatten ungefähr den halben Weg zurückgelegt, als er aus der Lederjacke ein großes Messer hervorzog. So einen Hirschfänger, den die Elchjäger benutzen. Er befühlte die Schneide und warf mir einen schrägen Blick zu.
Ich war vollständig eingeschüchtert. Noch nie in meinem fünfundzwanzigjährigen Leben hatte ich mich so gefürchtet. Ich wurde von dem wahnwitzigen Impuls erfaßt, mitten in der Fahrt abzuspringen, mich hinauszuschleudern auf die matschige Fahrbahn, nur weg von dem Kerl mit dem Messer. Was auch kommen mochte, bloß nicht das Messer. Lieber durch den Sturz auf die Straße sterben, als totgestochen zu werden.
Aber ich wollte überhaupt nicht sterben. Darum blieb ich im Auto.
„Damit werde ich ein Weibsbild erstechen“, sagte der Mann unvermittelt. „Zu ihr sind wir jetzt unterwegs. Sie wohnt in Blackeberg, Sigrid Undsetsgata 3.“
Schlimm, es gestehen zu müssen, aber meine erste Reaktion auf diese schrecklichen Worte war Erleichterung. Eine ungeheure Erleichterung, daß er es nicht auf mich abgesehen hatte. Das Messer sollte sich in einen anderen Menschen bohren, und Figge Höglund durfte weiterleben.
Auf einmal schämte ich mich. Wie selbstsüchtig von mir. Berührte es mich denn gar nicht, daß der Mann die Absicht hatte, eine Frau umzubringen? Und daß ich ihm dabei half, indem ich ihn zu ihr brachte?
„W-w-warum w-w-ollen Sie sie töten?“ stammelte ich.
Er kniff die Lippen zusammen, als ob er nicht daran denke, Auskunft zu geben; doch dann redete er schnell und verworren, und ich merkte, daß er nach Alkohol roch.
„Das Weibsbild verdient es nicht anders. Margit Svensson heißt sie. Sie wohnt dort draußen mit ihrem kleinen Sohn. Sie war ... nein, so ist es nicht. Ich bin mit ihr gegangen. Sie war dumm, das merkte ich bald. Ach, was erzähle ich dir das alles ...“
Er holte Luft und schwieg eine Weile. Schließlich fuhr er fort: „Sie verpfiff mich bei der Polizei. Sie fand allerlei heraus. Und ich kam ins Untersuchungsgefängnis. Zuerst hatte ich nichts dagegen, im Knast zu landen, aber dann wurde ich verurteilt. Sie brachte lauter Anklagen vor, und ihr wurde mehr geglaubt als mir. Wenn die Polente einen erst in den Klauen hat, ist nichts mehr zu machen. Auch wenn man unschuldig ist. Also kam ich richtig ins Kittchen. Inzwischen ist sie nach Blackeberg umgezogen. Ich war noch nicht dort, aber ich habe sie angerufen. Was glaubst du, was da geschah? Ein Kerl meldete sich am Telefon. Ließ mich nicht mit ihr reden. Und da beschloß ich, zu ihr zu fahren und sie zu töten. Sie verdient es nicht anders.“
Er schaute mich an. Offensichtlich erwartete er eine Antwort.
„Frauen können ... können teuflisch sein“, sagte ich.
Er blieb stumm. Ich hatte das Gefühl, daß von mir noch mehr erwartet wurde.
„Ja, wirklich“, beteuerte ich, „Frauen können uns das Leben sauer machen.“
Die ganze Zeit überlegte ich fieberhaft, wie ich mich aus der Situation ziehen könnte, in die ich unversehens geraten war. Ich konnte ihn doch nicht zu der Frau fahren und zulassen, daß er sie umbrachte, und wenn ich mich weigerte, bekam ich das Messer selbst in den Bauch.
Es war wahrhaftig ein Dilemma. Aber Blackeberg näherte sich, und die Zeit wurde knapp.
„Es gibt unmögliche Weiber“, plapperte ich weiter. „Und das schlimmste ist, daß man auf sie angewiesen ist.“
„Die wird es abkriegen“, knurrte er, „darauf kannst du Gift nehmen.“
Mein Nacken war ganz steif, die Muskeln verkrampften sich. Alles kam mir unwirklich vor, es schien in weiter Ferne zu geschehen. Saß ich wirklich im Auto mit einem Mann, der eine Frau töten wollte?
„So meinte ich es nicht“, antwortete ich mit unsicherer Stimme. „Es wird damit enden, daß Sie es abkriegen. Menschenskind, die Polizei wird Sie früher oder später schnappen. Ich kenne Fälle, wo man hätte meinen können, es würde ihr nicht gelingen. Die Polizei ist unmenschlich.“
Das meiste von dem, was ich sagte, war erfunden, aber ich versuchte einen Ton anzuschlagen, der Verständnis verriet und ihn gleichzeitig zur Besinnung brachte und umstimmte.
„Dummes Zeug“, entgegnete er und wandte mir das Gesicht zu. „Die Bullen sind ganz gewöhnliche Menschen. Gute und schlechte wie überall. Sie haben nichts Besonderes. Höchstens die Gefängniswärter. Und das kann ich dir sagen: Mir ist es ganz gleich, was aus mir wird. Ich bin fertig, verstehst du. Für mich gibt’s keine Zukunft. Meine Bauchspeicheldrüse ist hin. Dann muß man ohnehin bald ins Gras beißen. Begreifst du?“
Ja, ich hatte begriffen. Er wollte nicht Vernunft annehmen, und ich sollte sein williges Werkzeug sein. Sollte ihn zu seinem Opfer fahren. Sollte ihm die Möglichkeit geben, Margit Svensson zu töten. Vor den Augen ihres kleinen Sohnes.
Wenn ich mich weigerte, bekam ich eben das Messer ab.
Ich hatte die Wahl zwischen ihrem und meinem Leben.
Manchmal hatte ich einen Alptraum. Dann stehe ich in einer langen Reihe vor einem Henker. Er sagt zu mir: Du kannst wählen, Figge. Entweder dein Leben oder das des Kindes dort.
Selbstverständlich wollte ich mich für das Kind opfern. Aber würde ich es auch im wirklichen Leben tun? Hätte ich den Mut, so zu wählen, wie es alle Menschen von mir erwarten würden?
Bisher bin ich nie in eine solche Lage geraten. Läßt mich meine angeborene Feigheit die Wahl so treffen, daß ich mir mein eigenes Leben erhalte, wenn ich wirklich vor die Entscheidung gestellt würde?
Mein Traum endet damit, daß ich mein Leben wähle. Der Henker grinst mich an, und das Kind beginnt zu weinen. Zwei kräftige Schergen ergreifen es und führen es fort. Ich fühle, daß ich zwar mein Leben gerettet habe, daß es aber ein unwürdiges, schmutziges Leben ist. Ein Leben, das nicht lebenswert ist.
Das Auto fuhr weiter über eine blanke Fläche. Die Scheibenwischer bewegten sich hin und her. Die lichtarme, ölige Luft wirkte kompakt. Es war der siebente Januar 1976. Der Morgen war noch weit entfernt, da es erst auf zwei Uhr zuging. Noch über sechs Stunden.
Wie wird mir zumute sein, wenn es hell ist? Was wird bis dahin geschehen sein? Mußte ich dann meine Handlungsweise verantworten? Handlungsweise? Es war ja, als ob ich gar nicht handelte. Ich saß nur da und fuhr. Brachte ihn zu einem Ziel, das immer näher kam.
Am meisten beunruhigte mich der kleine Sohn.
„Sie sagten, sie lebt mit ihrem kleinen Sohn zusammen“, hob ich von neuem an. „Wie alt ist er?“
„Sieben Jahre. Thomas heißt er.“
„An ihn haben Sie wohl nicht gedacht? ich meine, mutterlos und ... Hat er einen Vater?“
„Misch dich nicht ein“, sagte er leise. „Du sollst mich nur hinfahren. Keine Sorge, ich werde schon bezahlen, was es kostet. Glaubst du, ich hätte Vater und Mutter gehabt? Glaubst du, ich .. “
Er starrte mich an. Sein Gesicht war kreideweiß. Die Hand umklammerte das Messer. Er war kein Mensch, mit dem sich vernünftig reden ließ. Jedenfalls konnte ich nicht die richtigen Worte finden, die ihn umgestimmt hätten.
„Ich mußte mir selbst helfen“, murmelte er.
Mitleid, dachte ich, Mitleid wirkt vielleicht.
„Wie schrecklich“, antwortete ich so gefühlvoll wie möglich. „Ohne Vater und ohne Mutter. Wahrhaftig, Sie hatten es nicht leicht. Konnten Sie sich denn selbst helfen und sich durchbringen?“
Er antwortete nicht.
„Das muß verdammt schwer gewesen sein. Nicht jeder bringt das fertig. Dazu braucht man Kraft. Es muß schrecklich gewesen sein. Aber Sie haben es geschafft! Großartig!“
Ich fand selbst, daß meine Worte wie aus einem amerikanischen Roman klangen. Er konnte sie kaum schlucken.
„Geschafft! Was hab’ ich denn geschafft? Keinen Scheißdreck. Ich weinte, und ich machte ins Bett, als ich klein war. In der Schule und auf der Straße wurde ich von den andern Kindern gehänselt. Ich hab’ am Daumen gelutscht und später gesoffen. Nennst du das es schaffen? Du bist ja nicht bei Trost!“
Vorhin hatte er gesagt, er habe sich selbst helfen müssen, und nun wollte er es nicht gelten lassen, daß es ihm gelungen war. Er geriet von einem Extrem ins andere, und wahrscheinlich übertrieb er.
„Haben Sie bedacht, daß das, was Sie vorhaben, den Jungen in genau die gleiche Lage bringen wird?“ fragte ich.
Plötzlich wurde er wütend. Er warf sich auf mich und hielt mir das Messer vors Gesicht. Der Wagen schlingerte, und ich sah kaum, wohin ich fuhr. Während ich mich zurückbeugte, versuchte ich auszukuppeln und zu bremsen. Infolgedessen machte der Wagen einen Ruck, und die Messerspitze traf mich an der rechten Seite der Nase.
„Das geht dich nichts an, hast du verstanden? Weiter!“ Er ließ von mir ab, und ich bekam die Steuerung wieder in den Griff. Von meiner Nase rann Blut und kitzelte mich an der Backe.
Wortlos verlangsamte ich die Fahrt und bog ab. Wir befanden uns in Blackeberg, und bald mußte die Sigrid Undsetsgata kommen. Die Straßen waren fast manschenleer, und ich wußte nicht, was ich unternehmen sollte.
Am einfachsten war es wohl, ihn zum gewünschten Ziel zu bringen. Was er dann machte, das war seine Sache. Oder die der Polizei.
Jedenfalls hatte ich mich bemüht, ihn umzustimmen. Leider war es mißglückt.
Mit dem Menschen war eben nicht zu reden, davon war ich überzeugt.
2
Die Scheibenwischer bewegten sich. In meinem Kopf kreisten viele Gedanken. Doch sosehr ich auch nachdachte, ich fand keine Lösung.
Meine Feigheit veranlaßte mich, mehr über mein Schicksal nachzusinnen als über das der Frau, zu der er fahren wollte. Wird er mich zum Dank für die Fahrt niederstechen? Das wäre vielleicht das bequemste für ihn. Dann könnte er nach der Ausführung seines Vorhabens mit dem Taxi wegfahren.
Vielleicht rettete mich meine Feigheit aus dem Dilemma. Ich dachte nämlich, daß ich so oder so sterben würde, was ich auch machte. Selbst wenn ich seinen Befehl bis aufs Tüpfelchen ausführte, würde er mich töten. Ich würde sowohl mein Leben als auch meine Ehre verlieren.
Aber wenigstens konnte ich versuchen, die Ehre zu behalten.
Fast ohne mir dessen voll bewußt zu sein, bog ich in die Björnstjerne Björnsonsgata ein, nicht in die Sigrid Undsetsgata. Er hatte gesagt, er sei noch nie dort gewesen. Sie war umgezogen, während er im Gefängnis saß.
Ich hoffte, daß er es nicht merken würde.
Vor dem Haus Nummer 3 hielt ich und wartete ab. Ein Schlachtopfer, das keine Hoffnung mehr hat.
„In Ordnung“, brummte er. „Was macht das?“
Ich wies auf den Taxameter, und er kramte in seiner Brieftasche.
„Ich weiß schon, daß du Trinkgeld zu bekommen hast“, sagte er. „Zehn Prozent. Du kriegst sogar ein bißchen mehr von mir. Ich weiß, was sich gehört. Hab’s immer gewußt.“ Er sah mich mit den Augen eines Betrunkenen an. „Ehrensache.“
Er gab mir tatsächlich ein gutes Trinkgeld. Dann klopfte er mir freundlich auf die Schulter und krabbelte hinaus, wobei er murmelte: „Nun muß ich nur noch durch die Tür kommen.“
Die Tür! Ich hatte nicht daran gedacht, daß sie selbstverständlich geschlossen sein würde und daß er vermutlich nicht in die Wohnung gelangen könnte, selbst wenn ich ihn an der richtigen Adresse abgesetzt hätte.
Nachdem ich gewendet hatte, fiel mir ein, daß es am besten wäre, Margit Svensson auf alle Fälle zu warnen. Es war ja keine weite Entfernung bis zur Sigrid Undsetsgata, und vielleicht würde er sich dorthin durchfragen.
Ich fuhr also weiter, stellte mein Taxi auf einem Parkplatz in der Nähe ab und ging durch das Schneegestöber zum Haus Nummer 3.
Das Schloß der Haustür war nicht in Ordnung, und ich konnte ohne weiteres eintreten. Margit Svensson wohnte im zweiten Stock.
Ich klingelte.
Die Tür wurde beinahe sofort geöffnet. Ich hatte geglaubt, Margit Svensson wecken zu müssen; aber sie war vollständig bekleidet und sah überhaupt nicht verschlafen aus.
Hatte sie jemanden erwartet? Ihr Gesicht wirkte so. Als sie erkannte, daß sie einen Fremden vor sich hatte, verschwand der erwartungsvolle Ausdruck.
„Entschuldigen Sie“, sagte ich, „aber ich muß mit Ihnen sprechen. Darf ich hineinkommen? Und es wäre am besten, die Tür abzuschließen.“
Sie widersprach nicht. Sie nickte nur und trat beiseite, um mich einzulassen. Dann schloß sie die Tür hinter mir.
„Worum handelt es sich?“ fragte sie und ging voraus in ein kleines Wohnzimmer.
Sie war bildschön. Das hatte ich nicht erwartet. Ich hatte sie mir eher häßlich und verlebt vorgestellt, mager und mit ungepflegtem Haar. Als ein billiges Frauenzimmer, das zu meinem Fahrgast gepaßt hätte. Als ein armes, ausgenütztes Mädchen, das sich in der untersten Schicht der Gesellschaft herumtrieb. Als eine Halbprostituierte mit unterdurchschnittlicher Intelligenz.
Nichts davon stimmte mit Margit Svensson überein, einer schlanken Frau mit goldrotem Haar, weißer, fast durchsichtiger Haut, großen hellbraunen Augen und vollen Lippen von natürlichem Rot.
Niemals hätte man sie in Zusammenhang mit dem Kerl in meinem Taxi gebracht. Er hatte ja behauptet, mit ihr gegangen zu sein. Das kam mir ganz ungereimt vor, zumal sie klug dreinblickte.
Ich war plötzlich überzeugt, an die falsche Adresse geraten zu sein, und sagte: „Ich ... ich muß mich geirrt haben. Ich möchte zu Margit Svensson.“
„Das bin ich“, antwortete sie.
„Gibt es noch eine Margit Svensson hier im Haus?“
Sie zuckte die Schultern und zündete sich eine Zigarette an. Wir saßen uns an einem Tisch gegenüber.
„Nicht daß ich wüßte. Aber man kennt ja nicht alle Hausbewohner.“
Sie bot mir eine Zigarette und Feuer an.
„Danke. Haben Sie einen Sohn, der Thomas heißt?“
Ihre Augen verrieten Beunruhigung. Sie schien etwas sagen zu wollen, begnügte sich aber mit einem Nicken.
Wahrscheinlich hätte sie mich nicht hereingelassen, wenn meine Uniform nicht gewesen wäre. Eine Uniform flößt immer Vertrauen ein, auch eine gewöhnliche Chauffeursuniform.
„Ich mußte einen Mann nach Blackeberg fahren“, berichtete ich. „Er wollte zu Ihnen, um ... um sein Mütchen an Ihnen zu kühlen. Er hatte ein großes Messer bei sich.“
Sie blieb stumm, schaute mich nur aufmerksam an.
„Er behauptete, Sie hätten ihn bei der Polizei angezeigt. Während er im Gefängnis saß, sind Sie hierher umgezogen. Und nun wollte er sich rächen.“
Sie schwieg immer noch. Sie schien sich nicht im geringsten aufzuregen, rauchte unangefochten und hörte mit dem Interesse eines Steuerberaters oder eines Anwalts zu, dem man seine Probleme unterbreitet. Mit freundlicher, aber unpersönlicher Anteilnahme.
„Ich setzte ihn in einer falschen Straße ab, um Sie warnen zu können. In der Björnstjerne Björnsonsgata. Er bezahlte die Fahrt und gab mir übrigens auch Trinkgeld. Dann fuhr ich hierher, um ... na ja, um Sie zu warnen.“
Kein Wort von ihr.
„Die Haustür läßt sich nicht schließen. Er kann also ohne weiteres hinein.“
„Ich weiß“, sagte sie ruhig. „Er rief mich heute abend an. Ein guter Freund von mir sprach am Telefon mit ihm. Ich wußte, daß Bosse zu mir kommen wollte.“
„Warum haben Sie dann aufgemacht?“ fragte ich.
Sie zuckte die Schultern und reichte mir das Zigarettenpäckchen. „Sie sind anscheinend aufgeregt. Möchten Sie noch eine Zigarette?“
Ich gab ihr Feuer und zündete mir ebenfalls eine neue Zigarette an. In mir wuchs große Verwunderung: Warum hatte sie aufgemacht, wenn sie wußte, daß er kommen würde? Wieso war sie so ruhig? Focht sie die Drohung denn gar nicht an?
Es war ein ganz gewöhnliches Zimmer, in dem wir saßen. Die Einrichtung bestand aus Sesseln, Sofa, einem Tisch mit Natursteinplatte, einer roten Hängelampe mit drei Birnen. Auf dem Farbfernseher standen zwei Bierkrüge mit der Aufschrift Hamburg. Auffallend war nur das Bücherregal mit ziemlich vielen Büchern.
Den Boden bedeckte ein handgeknüpfter Teppich. Die Bilder zeigten Waldlichtungen, spielende Kinder und ein Pariser Straßenmotiv, lauter Öldrucke, die man in allen Einrahmungsgeschäften sieht.
Beim Fenster hing das Farbfoto eines Dorfladens mit einer Texacopumpe. Das war der einzige persönliche Gegenstand. Alles andere wirkte anonym und hätte jedem x-beliebigen gehören können.
„Es ist sehr nett von Ihnen, daß Sie mich warnen wollten“, sagte sie. „Bosse hat Sie offenbar erschreckt.“
Das klang fast, als ob sie mich feige finde, und ich verteidigte mich sofort: „Nicht gerade erschreckt. Aber ich muß gestehen, daß ich nicht wußte, was ich tun sollte. Denn wenn ich mit ihm hierher gefahren wäre, hätte er vielleicht .. hätte er Ihnen vielleicht etwas angetan, und wenn ich mich geweigert hätte, wäre er sicher in Wut geraten.“
„Sicher“, pflichtete sie bei. „Bosse weiß nicht, was er tut, wenn er wütend wird. Und meistens hat er Alkohol im Leib. Sonst ist er sanft und nachgiebig. Er ist es gewöhnt, vor anderen zurückzutreten.“
Da sie wieder schwieg, dachte ich daran, mich zu verabschieden. Ich konnte ja nicht die ganze Nacht bei einer fremden Frau bleiben, nur weil sie gehaßt wurde. Außerdem mußte das Auto rollen. Es brachte nichts ein, wenn es stillstand.
„Möchten Sie Tee haben?“ fragte sie. „Und eine Kleinigkeit zu essen?“
„Es ist schon spät, und Sie müssen schlafen“, wehrte ich ab. „Das macht zu viele Umstände ...“
Sie lachte, und ihr Lachen gefiel mir. Es war, als würde ihr Gesicht von innen erhellt. Vielleicht hatte sie, dachte ich, eine schöne Seele, die durch die weiße Haut schimmerte. Das Lachen entzündete so etwas wie eine Hoffnung in mir. Die Hoffnung, in den schönen Garten eintreten zu können, durch dessen Gittertor ich jetzt blickte.
„Ich will ohnehin Tee trinken. In einer solchen Nacht findet man schwer Schlaf, wie Sie sich denken können.“
Sie verschwand durch eine Tür. Vermutlich in die Küche. Sie füllte einen Kessel mit Wasser.
In diesem Augenblick merkte ich, daß ich auf die Toilette mußte. Das kam von der Nervenanspannung im Auto. Ich begab mich in die Diele hinaus, wo ich eine Tür mit der Aufschrift „Hier ist es“ gesehen hatte. Bevor ich hineinging, drückte ich auf die Klinke der Wohnungstür. Obwohl ich Margit ermahnt hatte, sie abzuschließen, war sie unverschlossen.
Ich drehte den Schlüssel und legte die Sicherheitskette vor. Dieser Bosse, der nicht wußte, was er tat, sollte nicht hereinschlüpfen können. Falls er das Haus fand.
Im Spiegel in der Toilette sah ich, daß meine rechte Wange blutig war. Beim Abwaschen floß das Blut von neuem, und ich mußte es mit einem Stück Klosettpapier stillen.
Über dem einen Handtuch war ein Schildchen mit der Aufschrift Margit, über einem recht schmutzigen stand Thomas; der dritte Haken mit der Bezeichnung Gäste war leer. Es waren weiße Plastikhaken in Form von Vampirzähnen. Umgekehrt, als ob der Vampir auf dem Rücken liege und gähne.
Ich trocknete mir die nassen Hände an den Hosenbeinen ab und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Sie rumorte immer noch in der Küche herum, und ich vertrieb mir die Zeit, indem ich mich umschaute.
Das Zimmer hatte einen Balkon auf der Rückseite des Hauses. Ich betrat ihn. Etwa zwanzig Meter entfernt stand eine große Kiefer. Am dunklen Himmel waren keine Sterne zu sehen. Es schneite immer noch. Der Rasen unten war weiß im Schein einiger Laternen. Die Luft war kalt, so daß mich fröstelte.
Dann sah ich mir ihre Bücher an. Da gab es von allem etwas. Mehrere Taschenbücher über Psychologie und Medizin. Strindbergs gesammelte Werke. Hesses Steppenwolf in schwedischer Übersetzung. Sigrid Undsets Romane. Kinderbücher, die sicher Thomas gehörten.
Ich nahm ein psychologisches Buch heraus: Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten von C. G. Jung. Der Umschlag war eine surrealistische Zeichnung, die unter anderem den nackten Unterleib eines Mädchens zeigte, ohne Schamhaare. Wohl ein Traum, nahm ich an. Eine Darstellung dessen, was sich in unserer Psyche rühren kann, ohne daß es uns bewußt ist.
„Hier kommt der Tee“, hörte ich sie sagen, „auch ein paar belegte Brote.“
Sie hatte delikate Brötchen gemacht, mit Eiern und Kaviar, einige mit Salatblatt und Leberpastete.
„Interessieren Sie sich für Psychologie?“ fragte ich und stellte das Buch an seinen Platz.
„Ich bin Arztsekretärin“, antwortete sie und setzte sich. „Bei einem Psychiater am Sveaväg. Da wird man natürlich beeinflußt.“
Als der Tee genügend gezogen hatte, schenkte sie ein. Da ich nicht recht wußte, worüber ich mit ihr reden sollte, sah ich ihr beim Eingießen zu. Sie trug keinen Ring. Meiner Vermutung nach war sie entweder geschieden oder eine unverheiratete Mutter.
„Bitte sehr“, sagte sie und machte eine einladende Geste.
Ich nahm ein Eierbrötchen. „Ein Genuß“, sagte ich nach dem ersten Bissen. Ich war hungrig. Das wird man, wenn man nachts fährt.
„Sind Sie von Beruf Taxichauffeur, oder machen Sie das nebenher?“ erkundigte sie sich.
„Von Beruf. Ich fahre für eine Witwe.“
„Was heißt das?“
„Sie hat eine Zulassung. Manchmal verheiratet sich ein Mann mit einer sogenannten Taxiwitwe, um den Beruf ausüben zu können.“
„Und haben Sie auch die Absicht, die Witwe zu heiraten?“ Ich lachte. „Nein, so viel liegt mir doch nicht daran. Inger — so heißt meine Taxiwitwe — ist zwar eine nette Frau, aber ...“
In diesem Augenblick wurde an der Wohnungstür geläutet. Lange und energisch. Dann hörte man Geschimpfe und einen wütenden Tritt an die Tür.
Bosse mit dem Messer hatte die Sigrid Undsetsgata gefunden. Er stand vor der Wohnungstür und wollte hinein.
Wollte hinein, um sie zu töten.
Mich wahrscheinlich auch.
3
Margit erhob sich langsam. Auf ihrem Teller lag ein halbverzehrtes Brötchen mit Leberpastete, daneben das Salatblatt, dessen einer Rand bräunlich und aufgerollt war.
Der Lärm vor der Tür nahm zu.
„Ich muß ihn wohl hereinlassen und versuchen, mit ihm zu reden“, sagte sie schicksalsergeben. „Sonst krakeelt er die ganze Nacht. Weckt die Hausbewohner und Thomas.“
Ich riet ihr ab: „Das dürfen Sie nicht. Er ist nicht bei Sinnen. Er läßt nicht mit sich reden. Sie sagten ja selbst, er weiß nicht, was er tut, wenn er betrunken und wütend ist.“
Wir gingen auf den Zehenspitzen zur Tür.
„Hören Sie auf!“ rief ich. „Es nützt nichts, wir öffnen auf keinen Fall.“





























