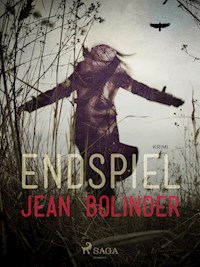Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nachdem der erste Schnee fiel, erprobte ein kleiner Junge mit seinem Vater, dem Landpolizisten, seinen neuen Schlitten. Unterdessen ist der Junge ein erwachsener Mann, doch an jenen kalten Novembertag der 1930er Jahre erinnert er sich haargenau. Es ist der Tag, an dem er seinen Vater zum letzten Mal lebendig sah. Auch wenn die Ermordung seines Vater zum Tabu-Thema geworden ist, entschliesst sich der erwachsene Junge dennoch den Mord aufzudecken. Seine Ermittlungen führen ihn nicht nur in den Kreis einer mächtigen Familie, sondern auch in ein Netz aus Lügen und Intrigen. – Ein literarisch gelungener Kriminalroman. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean Bolinder
Wer ist dein Richter?
Ein Bergh-Krimi
Saga
In christening thou shalt have two godfathers;
Had I been judge, thou shouldst have had ten more,
To bring thee to the gallows, not the font.
Du wirst zwei Paten bei der Taufe haben;
Wär ich dein Richter, kriegtest du zehn mehr,
Zum Galgen, nicht zum Taufstein, dich zu bringen.
Shakespeare
Der Kaufmann von Venedig
Akt IV, Scene I
Erster Teil
Erstes Kapitel
Das Bild starrte mich von der Staffelei an. Ein mageres Gesicht mit tiefliegenden Augen. Das Hemd am Hals offen.
Das Gesicht hatte sein eigenes Leben. Es grinste mich höhnisch an und veränderte sich fortwährend wie ein Spiegelbild in windbewegtem Wasser. Das Gesicht verbeulte und verzerrte sich, bis mir der Anblick Verwirrung und Unbehagen bereitete. Die Proportionen stimmten nicht. Kinn und Hals wurden plötzlich katzenhaft. Ein Bild im Bild, und das Ganze verwandelte sich noch mehr. Eine bösartige Katze starrte mich aus neapelgelben Augen an, und ich fühlte, wie mir der kalte Schweiß ausbrach.
Vorsichtig führte ich den Pinsel über die Leinwand, um die Katze verschwinden zu lassen. Ich führte den Pinsel gegen den Strich, worauf die Katze fauchte und einen Buckel machte. Sie schlug mit der Pfote nach meiner Hand und kratzte mich in Sekundenschnelle. Ein kadmiumroter Striemen zeichnete sich auf der hellen Haut ab.
Ich schloß die Augen, um dem lähmenden Gedankenkreis zu entrinnen. Als ich wieder hinschaute, blickte mir mein Vater von der Leinwand entgegen. Er sah vorwurfsvoll aus, und ich hörte meine Schuld durch die Dunkelheit ihm zurufen.
„Wenn er nur nicht die Katze sieht!“ dachte ich. „Wenn er nur nicht merkt, daß ich die Katze mit dem Pinsel gegen den Strich gestreichelt habe.“
Durch die Farbe traten titanweiße Flecken hervor. Zuerst war es wie ein Ausschlag, dann aber verbreiteten und vergrößerten sich die Flecken, bis sie ineinander flossen und ein schimmerndes weißes Rechteck entstand.
In dem Weiß ahnte ich die Katze. Sie schlich durch den Schneefall und lauerte mir auf. Mein Vater war längst in das Weiß fortgeradelt und war weder mit Rufen noch mit Wünschen mehr zu erreichen.
Ich gab es auf. Ich konnte an diesem Tage keine Ordnung in mein Selbstporträt bringen. Es blieb unvollendet und unsinnig.
Draußen blies ein frischer Wind von der Laholmsbucht her. Es roch nach Salz und Grün, und die Sonne stach in die Augen.
Zweites Kapitel
Ich haßte sie.
Ich mußte sie hassen. Sie war eine Noijbe, und ich haßte alle Noijbes.
„Guten Tag“, sagte sie und lachte. „Ich heiße Beatrice. Gestehen Sie ruhig, daß Sie mir gefolgt sind.“
Ich haßte sie, und doch liebte ich sie. Als sie mich anlachte, liebte ich sie. Es war, als hätte ich sie schon immer geliebt, obwohl ich sie zum erstenmal sah. Als ob wir in einem früheren Leben vereinigt gewesen und bis jetzt getrennt worden wären. Jeder war allein umhergeirrt. Wir hatten einander entbehrt, ohne zu wissen, was uns fehlte. Bis wir wieder vereinigt wurden.
„Dan Johansson“, stellte ich mich vor und reichte ihr meine farbenbekleckste Hand. „Ich hörte, daß Sie heute Geburtstag haben, und habe Ihnen eine Kleinigkeit mitgebracht.“
Es war nur eine Skizze, die ich für meinen Blitzbesuch in Nybo hervorgeholt hatte.
„Dan Johansson ist Maler, mußt du wissen“, sagte Marianne Bundin, als ob mein Geschenk irgendwie erklärt werden müßte.
„Das brauchst du nicht zu betonen“, erwiderte Beatrice. „Das sehe ich an dem Bild! Es ist richtig spannend. Ein Anschlag oder eine Andeutung von etwas Bestimmtem. Es kommt mir vor wie eine Mitteilung für mich persönlich ... ein ganz verwirrendes Geschenk, das Sie mir gemacht haben, Dan.“
Sie ließ es nicht zu, daß ich sie haßte. Als sie sprach, hätte sie mir zuwider sein müssen; statt dessen bewirkte sie, daß ich sie liebte. Trotz allem, was sie vertrat.
Das war Anfang Juni 1973. Vor dem Hause der Familie Noijbe blühte der Flieder, und der Goldregen hatte einen besonders hellen Kadmiumton. Der Hallandsche Landrücken glitt in weichen Linien zu den kecken Strandumrissen der Laholmsbucht hinab. Das Wasser war so grün, wie August Becker es zu malen pflegte, und der Horizont verschwamm indigoblau.
Absurd, an einem solchen Tag Haß zu fühlen!
Aber ich dachte die ganze Zeit an die Worte meiner Mutter: Daß die Noijbes meinen Vater umgebracht hatten. Sie waren schuld, nicht ich. Der kindliche Schrecken, den ich durchs Leben mit mir herumtrug, war unbegründet. Die Noijbes waren schuld, und ich mußte es beweisen. Ich hatte mich bei ihnen eingenistet wie ein Soldat in einem Trojanischen Pferd, und ich war mit meinem Haß bewaffnet.
Beatrice fegte mit Kaffeekanne und Kuchenschüssel herein. Sie war wie ein Frühlingshauch in einem muffigen Krankenzimmer, kühl, frisch und unehrerbietig. Ihr Körper war schmal und sehnig, das kurzgeschnittene Haar dunkel und ungebändigt. Sie konnte ein wenig ungeduldig wirken, aber hinter der Maske fand man mehr Wärme, als ihr Verhalten ahnen ließ. Die Brüste waren klein, die Schultern ausdrucksvoll. Das Gesicht enthüllte nichts von dem, was die Schultern verrieten. Mir fiel ihr feiner und doch kräftiger Nacken auf.
Sie war funktionell wie die Ausstellung in Stockholm, in deren Zeichen sie das Licht der Welt erblickt hatte.
Aber ich greife den Tatsachen voraus. Als sie den Kaffee hereinbrachte, wußte ich noch nichts von der Ausstellung. Da haßte und liebte ich sie nur.
Ihr Bruder, Erland Noijbe, betrachtete mit Abscheu die Mahlzeit. Seine Frau machte sich daran, den Kaffee einzuschenken. Sie war blond und blauäugig und hochschwanger. Sie trug ein blödsinniges Umstandskleid, das geziert kleinmädchenhaft aussah, denn es hatte Rüschen und Puffärmel.
„Soll das heißen“, meckerte Erland zu Beatrice hinüber, „daß wir dieses Rattengift ohne einen kleinen Schuß Kognak trinken sollen?“
„Du weißt, Papa kommt heute abend“, antwortete Beatrice und kramte aus einer Kommode einen X-Haken hervor.
„Na, und?“ knurrte Erland, erhielt aber keine Antwort. Bald hing meine Skizze an dem X-Haken. Darauf waren ein Stückchen Strand mit zottigen Grasbüscheln, die Silhouette einer Brücke mit blasigem Gegenlichtwasser und ein kleiner Junge, der mit einer Plastikschaufel grub. Ich hatte sie vor einer halben Stunde unter meinen Bildern in Nybo ausgesucht, und zwar mit voller Absicht, um etwas zu übergeben, das mir gleichgültig war. Jetzt merkte ich, daß ich das richtige Bild für Beatrice gewählt hatte. Sie hatte die Skizze als persönliche Mitteilung bezeichnet, und das war sie auch.
„Mir gefällt das Bild“, sagte sie. „Es ist in gewisser Weise idyllisch, hat aber einen interessanten, beunruhigenden Unterton. Als ob der kleine Junge im nächsten Augenblick sterben würde. Oder als ob die ganze Landschaft zum Untergang verurteilt wäre.“
Sie wußte es genau. Unsere Kommunikation war hundertprozentig.
„Malen Sie nur Landschaften?“ erkundigte sich Eva Noijbe.
„Nein. Gerade jetzt bin ich an einem Selbstporträt. Aber ... es will nicht fertig werden. Ich ändere es immer wieder um, und nie bin ich damit zufrieden.“
„Künstler sind Egoisten“, äußerte sich Erland Noijbe. „Sie lassen sich von der unerhörten Aufgabe lähmen, ihre eigene Seele einzufangen. Wahrscheinlich finden sie nichts so sublim wie die eigene Seele.“
Erland war zu dick für den Stuhl, auf dem er saß. Anscheinend hatte er in letzter Zeit stark zugenommen, denn er platzte auch aus den Kleidern. Ein paar Hemdenknöpfe waren aufgegangen, und die Hosen spannten sich eng um die fetten Schenkel. Er hatte die bleichsüchtige Korpulenz, die manche Alkoholiker bekommen.
Der gewichste Schnurrbart schien ein verzweifelter Versuch zu sein, sich das fehlende Ansehen einer Persönlichkeit zu verleihen. Die Mundwinkel hingen nach unten, und die scharfen Falten zum Kinn verstärkten den mißmutigen Ausdruck. Die himmelblauen Augen unter den geschwollenen Lidern hatten einen furchtsamen und selbstbedauernden Blick.
Ihn haßte ich. Haßte seinen überheblichen Ton und sein unverschämtes Auftreten. Er war ein echter Noijbe. Ein echter Mörder.
Ich dachte an einen Frühlingsabend in Uppsala zurück. Tage und Nächte des Grübelns waren ihm vorausgegangen. Angst. Dann faßte ich endlich einen Entschluß. Ohne meinen Mantel anzuziehen, ging ich den ganzen langen Weg zur Polizeiwache am Marktplatz. Ging rasch durch die Tür zu dem Pult, schob einen Mann weg, der mit dem diensthabenden Polizeibeamten über einen Fahrraddiebstahl sprach, und sagte mit einer Stimme, die vor Erregung und Entsetzen zitterte:
„Ich habe ihn getötet. Ich halte die Schuld nicht mehr aus. Kann sie nicht mehr ertragen. Hören Sie, ich habe ihn ermordet. Hören Sie mich nicht? Hören Sie mich nicht? Hören Sie mich nicht ...“
Drittes Kapitel
„Ja, heute abend kommen Vater und Irma“, sagte Erland, „und vielleicht noch mehr von der alten Garde, um eine Rede auf dich zu halten, Schwesterlein. Also will ich meine kleine Rede jetzt halten. Wenn du sie zu trocken findest, bist du selbst schuld.“
„Du wirst heute abend noch mehr als genug zu trinken bekommen“, versetzte Beatrice unmutig. „Beklag du dich nicht.“
„Nun wird er von sich selbst reden“, flüsterte Marianne mir zu. „Erland spricht nie von etwas anderem als von sich selbst. Außer meinem Mann Jöran, der Gott sei Dank bei den Kindern in Gotland bleiben mußte, ist Erland der schlimmste Egoist, den ich kenne.“
„Ich selbst bin um zehn Uhr vormittags an einem kalten, windigen Novembertag 1935 geboren“, unterrichtete uns Erland. „Es schneite, und es war der Todestag Karls XII. Deshalb habe ich mich immer ein wenig verfroren und auf der Schattenseite des Lebens gefühlt ...“
Erland war Schriftsteller. Nach mehreren mißglückten Romanen gelangte er zu einem gewissen Erfolg, da eines seiner Bücher vom Fernsehen verfilmt wurde. Das mit der Schattenseite des Lebens war also mit Vorbehalt aufzunehmen.
„Du, Schwesterchen, hast dich immer auf der Sonnenseite des Lebens befunden“, fuhr Erland fort. „Du wurdest auf der Funkausstellung in Stockholm geboren ...“ „Ich muß doch bitten“, fiel Beatrice ein, „ich wurde in Linköping geboren. Vater war allerdings in Stockholm auf der Ausstellung. Egoistisch wie alle Männer.“
„Jetzt halte ich eine Rede“, sagte Erland ärgerlich, aber niemand hörte ihm mehr zu, außer vielleicht seiner Frau. Marianne war damit beschäftigt, kleine Blumen in einem Silberbecher zu ordnen, und Beatrice erzählte mir: „Diesen Becher bekam ich als Taufgeschenk von Tante Irma und ihrem damaligen Verlobten. Ich hole ihn immer an meinem Geburtstag und an meinem Tauftag hervor. Mein Tauftag ist übrigens Vaters Geburtstag. Wir feiern ihn immer hier.“
Ich ließ mir den Becher von Marianne geben und las die Gravierung: „Für Beatrice von ihren Taufpaten Irma und Kurt.“
Die anscheinend harmlose Widmung rüttelte mich auf. Ich wußte, daß sie ein Fadenende der ganzen verwikkelten Geschichte war, die hinter meinem Haß auf die Familie Noijbe lag. Ich bemühte mich, einen unverfänglichen und gleichgültigen Ton anzuschlagen, als ich fragte: „Irma und Kurt — Verwandte von Ihnen?“
„Irma ist meine Patin“, antwortete Beatrice, und ihre Stimme hatte etwas Abweisendes. „Eine Verwandte ist sie eigentlich nicht. Aber ...“ Sie unterbrach sich und sagte gleichsam begütigend: „Sie kommt heute abend. Dann werden Sie sie kennenlernen. Sie bleiben doch zum Essen?“
„Gern, danke“, gab ich zurück. „Wer ist denn Kurt? Kommt er auch?“
Ich wußte, wer Kurt war. Aber Beatrice wußte nicht, daß ich ihn vom Hörensagen kannte. Er hatte in meiner Lebenstragödie eine sehr wichtige Rolle gespielt. Nun wollte ich unter allen Umständen herausfinden, welche Rolle es gewesen war.
Beatrice antwortete mir nicht. Statt dessen blickte sie zu Erland hinüber, der sich aus einem Barschrank eine Whiskyflasche geholt hatte und sich mit einem Drink versah.
„Man kann einen Siebenunddreißigjährigen nicht mehr erziehen“, murmelte sie und zuckte die Schultern. „Das wird ja heiter werden, wenn Papa kommt.“
Als ich vor ein paar Tagen auf Erland gestoßen war, hatte er in der Bar des Hotels Båstad Bloody Mary getrunken. Eva und Marianne hatten ihn wie unglückliche Kükenmütter umflattert. Das hatte nichts geholfen. Im Verlauf des Abends war er immer betrunkener geworden.
Da ich selbst einst auf dem Wege gewesen war, Alkoholiker zu werden, kannte ich das Verhaltensschema gut. Und ich freute mich, daß ein Noijbe auf den Weg bergab geraten war. Gleichzeitig nahm ich die Gelegenheit wahr, mit ihm in Verbindung zu treten, ich kannte ja Marianne von früher her.
Ihr hatte ich es auch zu verdanken, daß ich zu dem Geburtstagskaffee mitgenommen worden war. Das hatte nun zu einer Einladung zum Abendessen geführt.
„Möchten Sie vielleicht auch etwas trinken, Dan?“ fragte Beatrice. „Da die Flasche doch zum Vorschein gekommen ist ...“
„Nein, danke. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Aber Sie haben meine Frage nach Kurt nicht beantwortet. Wer war ... ich meine, wer ist er?“
Es verwirrte mich, daß ich mich versprochen hatte; doch niemand schien es bemerkt zu haben. Dann aber begegnete ich Erlands Blick im Spiegel über Beatrices Kopf. Er sah mich verschlagen und berechnend an, als ob er hinter etwas gekommen wäre, das er für seine Zwecke auszuschlachten gedachte.
Zuerst erhielt ich wieder keine Antwort auf meine Frage, aber dann sagte Erland: „Er hieß Kurt von Spoor. Er ist tot. Körperlich und ... geistig. Sein Andenken ist ausgelöscht, wie man das Andenken an einen verhaßten Diktator in einem totalitären Staat auslöscht, indem man seinen Namen von allen Erinnerungsstätten und Inschriften entfernt.“
Nachdenklich fügte er hinzu: „Wenn man sich vorstellt, daß einer, der gelebt hat, so tot sein kann ... Daß man sich nicht an ihn erinnert. Keiner will sich mehr an ihn erinnern. Dabei war er doch Beatrices Pate ...“
Viertes Kapitel
Knut: Was ist das für ein Fahrgast? Mit wem habe ich die Ehre?
Maske: Ich bin dein bester Freund.
Knut: Danke ergebenst, aber wie ist der Herr zu titulieren? Wie ist der Name, wenn ich fragen darf?
Maske: Ich heiße Tod.
Knut: Ergebener Diener, hochwürdiger Herr! Aber bitte um Entschuldigung, wenn ich mich so schnell wie möglich auf die Beine mache.
Das war 1943. Ein Kriegswinter vor über dreißig Jahren. Noch erinnere ich mich an den Dialog Wort für Wort. Wir saßen in der Aula der städtischen Mittelschule von Tågby und sahen eine Theatervorstellung. Gevatter Tod hieß das Stück, und es war von dem schwedischen Dramatiker August Blanche.
Ich war vierzehn Jahre alt; ich trug Knickerbocker und ein Hemd mit Manschettenknöpfen. Bald sollte ich die Schule verlassen und auf die Kunstakademie gehen.
Die Vorstellung begann und damit meine große Niederlage. Ich wurde von schrecklicher Angst ergriffen, als der Tod die Bühne betrat, und ich zitterte am ganzen Leib. Dann kamen unmännliche Tränen, die ich nicht beherrschen konnte. Ich stürzte aus der Aula, verfolgt von den verwunderten Blicken der Schulkameraden.
Das, was auf der Bühne gesprochen worden war, hatte etwas in meiner Seele berührt. Ich wußte nicht, daß es mit dem zusammenhing, was mich viele Jahre später in eine Heilanstalt brachte.
Als Erland nun von Beatrices totem Paten sprach, überkam mich etwas von der alten Angst. Sie stand zwischen mir und der Pflicht, die ich erfüllen mußte, aber die Pflicht war stärker. Die Pflicht und der Zwang, die Noijbes zu entlarven.
„Warum müssen alle Erinnerungen an Kurt ausgelöscht werden?“ fragte ich mit einer Stimme, die nicht gerade fest war.
Beatrice wehrte ab: „Lieber Dan, wir wollen von der Sache nicht mehr reden. Das ist ein wunder Punkt in meiner Familie, verstehen Sie. Wir Kinder haben nie erfahren, warum.“
„Einmal fragte ich Papa“, sagte Erland. „Worauf er explodierte! Ich weiß nur, daß Kurt tot ist. Und daß mit seinem Tod irgend etwas Furchtbares und Unerfreuliches verbunden ist.“
Er nippte an seinem Whisky und raunte mir dann zu: „Fragen Sie Irma. Sie kommt heute zum Abendessen. Fragen Sie jemand, der nicht zur Familie gehört.“
Beatrice waren seine Worte nicht entgangen, und sie wurde ganz blaß.
„Nein, was Sie auch tun, fragen Sie Irma auf keinen Fall“, drang sie in mich. „Sie dürfen unter keinen Umständen mit ihr über Kurt sprechen. Das würde zu einer Katastrophe führen!“
Die Sonne schien durch ein Seitenfenster und warf einen weißen Fleck auf den Boden. Mitten in dem Lichtfleck schlief die dänische Dogge Elof.
„Was ist Ihr Beruf?“ fragte ich Beatrice. „Ich würde wetten, Sie üben eine künstlerische Tätigkeit aus. Weil Sie ein so feines Gefühl für Kunst haben.“
„Ich habe mit Mode zu tun“, antwortete sie. „Entwerfe Kleider und so. Das hier habe ich selbst gemacht.“
Sie wies kokett auf ihr veronesergrünes, weiß abgesetztes Kleid. Es war einfach und gleichzeitig ein wenig romantisch-mädchenhaft. Ein Mittelding von beginnendem Empire und leichtsinnigem Rokoko, zum Beispiel mit einer Andeutung von Puffärmeln.
Der Rock schwebte mutwillig um ihre schlanken Beine und verlieh ihr zusammen mit dem unentwickelten Busen die knabenhafte Keuschheit, die paradoxerweise die Charleston tanzenden jungen Mädchen der zwanziger Jahre so anziehend gemacht hatte.
Plötzlich erkannte ich, daß sie mir nicht nur ihr Kleid zeigte, sondern mehr von sich selbst.
Ich begegnete dem Blick ihrer großen hellbraunen Augen. Da lachte sie ein wenig verlegen und verschwand.
„Ich muß nach dem Essen sehen“, rief sie mir über die Schulter zu, wie um ihr Verhalten zu erklären.
Wir stammten aus demselben Kirchspiel. Ihr Vater, General Noijbe, besaß ein großes Gut vier Kilometer von meinem Elternhaus Strålnäs entfernt, den Herrenhof Frälsetorp, und dort war sie aufgewachsen. Aber ich konnte mich nicht erinnern, sie als Kind jemals gesehen zu haben. Ich war erst sieben Jahre alt, als meine Mutter mit mir nach Tågby zog, und Beatrice mochte damals fünf gewesen sein.
Sie konnte sich an mich ebensowenig erinnern. Gottlob hatte ich einen so gewöhnlichen Nachnamen, daß sie mich nicht mit einem gewissen Gendarm Johansson in Verbindung brachte, den an einem verschneiten Novembertag 1935 der Tod ereilt hatte. Auf dem Weg zwischen Strålnäs und Boxholm.
„Ich hasse sie“, dachte ich verzweifelt. „Sie und das ganze Noijbe-Gesindel. Mördersippe!“
Erland hatte sich mit einem neuen Whisky versorgt. Er schien sich mit der Umwelt versöhnt zu haben und zeigte sich auch mir gegenüber freundlich gestimmt.
„Wissen Sie, Dan“, flüsterte er mir vertraulich zu, „das mit Kurt ist hochinteressant. Wenn Irma auftaucht, werde ich sie, hol’s der Teufel, fragen. Mögen die andern sagen, was sie wollen!“
„Tun Sie das“, spornte ich ihn an.
In diesem Augenblick kam ein Auto über den Kiesweg gefahren. Es war ein schwarzer Mercedes-Diesel, am Steuer saß eine sechzig- bis siebzigjährige Dame. Sie hatte aufgestecktes Haar und wirkte altmodisch elegant. Beatrice lief die Treppe hinunter und schloß sie in die Arme.
„Wenn man vom Teufel spricht“, murmelte Erland düster.
„Ist das Irma?“ fragte ich leise.
Er nickte. Dann flüsterte er zurück: „Jetzt werde ich sie fragen. Das alte Schätzchen ahnt nicht, was ihm blüht!“
Fünftes Kapitel
Irma Bergner war trotz ihrer Jahre eine sehr schöne Frau. Das helle Haar war vermutlich gefärbt, aber es sah so weich und glänzend aus wie bei einem jungen Mädchen. Die Augen waren blau und groß, die Wangen frisch. Ich mußte an eine Heckenrose an einem kühlen Herbsttag denken. Ihre Farbe ist besonders intensiv, wenn der erste Frost zugebissen und der Tod unter den Gewächsen und Blättern ringsum Ernte gehalten hat. Schade nur, daß Irma Bergner ihre Schönheit nicht durch einfache Kleidung und Schmucklosigkeit wirken ließ. Statt dessen war sie so überladen, daß sie in dieser Umgebung protzig erschien.
Der Kaffee wurde eingeschenkt und der Kuchen angeboten. Irma aß mit gutem Appetit und sprach vom Wetter, vom unanständigen Fernseh-Programm und von der Gesundheit des Generals.
„Sie war mit Kurt von Spoor verlobt“, berichtete mir Erland in Verschwörerton. „Dann starb er, wie es halt so ging. Sie soll den Armen überredet haben, sich das Leben zu nehmen. Später verheiratete sie sich mit einem Direktor Bergner. Können Sie sich vorstellen, daß sie zu ihrer Zeit eine so unglaubliche Schönheit war, daß sich alle Männer die Beine nach ihr abgelaufen haben?“ „Das kann ich wirklich. Sie hat eine wundervolle Kopfform. Und wie ging es mit dem Bergner?“
„Er starb ... lassen Sie mich überlegen ... 1959, glaube ich.“
„Hat er sich auch ihretwegen das Leben genommen? Durch Überredung oder sonst eine raffinierte Methode?“
„Durchaus möglich“, murmelte Erland. „Nein, wir dürfen nicht ungerecht sein. Er stürzte mit 132 anderen in Südamerika ab. War es nicht in Argentinien? Irma war damals zu Hause in Schweden und muß also als unschuldig angesehen werden.“
Irma hatte ihr Geplauder eine Weile auf Marianne Bundin konzentriert. Sie hatte in Marianne das „Töchterchen des Arztes“ erkannt und wollte wissen, wie es „dem guten Doktor“ und „der entzückenden Doktorfrau“ ging.
Erland zeigte bereits, daß er mehr zu sich genommen hatte, als ihm gut tat. Er hockte schwerfällig in seinem Sessel und stierte vor sich hin.
„Fragen Sie sie nach Kurt“, ermahnte ich ihn und wies mit dem Kinn auf Irma. „Wenn Sie’s wagen!“
„Ob ich’s wage?“ zischte er aggressiv. „Hältst du mich für feige, du kleiner Farbenkleckser?“
Er erhob sich und nahm den Silberbecher vom Tisch. Ein Gänseblümchen fiel aufs Tischtuch, ohne daß er es merkte.
„Du, Irma“, begann er mit schwerer Zunge, „diesen Becher habe ich immer so schön gefunden. Wie ist es damit, hat Beatrice ihn nicht von dir zur Taufe bekommen?“
Irma brach mitten in ihrem Geplauder mit Marianne Bundin ab. Ihre Augen wurden wachsam. Das Gesicht straffte sich, der Mund wurde hart und bestimmt.
„Ja, allerdings“, sagte sie mit kalter, klarer Stimme.
„Hier steht aber Irma und Kurt“, fuhr Erland fort. „Wer ist Kurt? Ich wollte schon immer wissen, wer das ist. Oder war. Und Beatrice nimmt es auch wunder. Ich finde, es ist unser Recht, das zu erfahren. Er war immerhin Beatrices Taufpate. Und seinen Paten möchte man doch kennenlernen. Oder wenigstens wissen, wer es war. Oder etwa nicht?“
Sicher fünfzehn Sekunden lang war es totenstill im Zimmer. Totenstill bis auf das Ticken einer Standuhr, das leise Schnarchen des Hundes Elof und das Knistergeräusch zweier Zwergpapageien im Bauer.
Dann stand Irma auf. Sie war sehr blaß geworden, und ihre Augen schienen tiefer in den Höhlen zu liegen als zuvor.
„Was du nicht wissen willst!“ war das einzige, was sie sagte, ehe sie auf dem Absatz kehrtmachte und hinausschwebte.
Wir hörten einen Wagenschlag zuknallen. Der Mercedes fuhr an, und wir sahen ihn in einer Wolke von Staub und stiebendem Kies hügelabwärts verschwinden.
Sechstes Kapitel
Einige Stunden waren vergangen. Ich war nach Båstad hinuntergefahren, um mich umzuziehen.
Mein unvollendetes Selbstporträt starrte mir höhnisch entgegen. Ich hatte das Gefühl, die Noijbes zermalmen zu müssen, bevor ich es fertigmalen konnte.
General Noijbe wurde zum Abendessen erwartet. Zum erstenmal sollte ich Aug in Auge mit dem Manne stehen, der mein Leben geprägt hatte.
Es gab einen Traum, den ich immer wieder träumte: Mein Vater radelt auf einem verschneiten Landweg. Die ganze Landschaft ist weiß. Auch das Gesicht meines Vaters ist weiß, und er blickt mir entgegen. Ich selbst befinde mich hoch oben und betrachte alles gleichsam von einer Anhöhe aus. Oder durch eine Glasscheibe.
Da entdecke ich auf dem Weg eine Katze. Sie ist noch weißer als die Landschaft. Eine titanweiße Katze in einer zinkweißen Landschaft. Die Katze ist klein, aber sie wächst. Zuerst langsam, dann immer schneller. Sie löscht alles aus, den Boden, das Fahrrad, meinen Vater ... Alles ist weiß und die Luft so verdünnt, daß ich nicht genug Sauerstoff in die Lungen bekomme. Ich erwache und schnappe nach Luft. Das Herz schlägt wild in meiner Brust. Furchtbare Angst beschleicht mich, und ich rufe: Papa, Papa, wo bist du?
Schuldgefühl. Ich trank mehr und mehr. Zwangsvorstellungen und Zwangshandlungen. Die endgültige Katastrophe an einem eiskalten Frühjahrsabend in Uppsala. „Hören Sie, ich habe ihn ermordet. Hören Sie mich nicht? Hören Sie mich nicht?“
Das Jahr in der Heilanstalt. Das Bewußtsein, das während des Traumes wachblieb, wurde immer seltener. Als ich entlassen wurde, war ich auf dem Weg, ins Gleichgewicht zu kommen. Aber ich mußte Bescheid wissen. Mußte vollständige Klarheit gewinnen. Und meine Mutter sah mich mit einem Gesicht an, das in fast vierzigjähriger Einsamkeit gealtert war. „Es sind die Noijbes. Ich hasse sie, Dan. Du mußt sie auch hassen. Das bist du deinem Vater schuldig. Und mir. Und dir übrigens auch.“
Nachdem ich den Blick meines mißglückten Selbstporträts wütend zurückgegeben hatte, ließ ich zum zweitenmal an diesem Tage meinen Saab zum Haus der Noijbes auf dem Hallandhügel hinaufschnurren. Die grünen Laubvorhänge öffneten sich plötzlich, und ich sah das türkis- und ultramarinfarbene Wasser der Laholmsbucht endlos unter mir liegen. Licht und Schatten tanzten über die halländischen Ebenen. Es war ein wenig neblig geworden. Die Farben wurden gedämpft und veränderten sich mit der Lichtstärke. Sollte der sonnige Tag mit Regen enden?
Auf dem Vorplatz standen mehrere Wagen. Marianne Bundins rote Hundehütte. Beatrices linienschöner, elfenbeinfarbener Jaguar. Erlands weißer Triumph Spitfire. Und ein großer Mercedes, noch größer und glänzender als der, mit dem Irma am Nachmittag gekommen war.
Das mußte das Auto des Generals sein. Ich war ein bißchen enttäuscht. Ich hatte einen Lincoln oder einen Rolls-Royce erwartet.
„Guten Abend, Dan. Herzlich willkommen. Erlauben Sie, daß ich Sie mit meinem Vater bekannt mache.“
Beatrice war auf mich zugetreten. Ich vermochte nicht zu entscheiden, ob sie nur die gewöhnliche Liebenswürdigkeit der Gastgeberin entfaltete oder ob ihr Ton mehr enthielt. Auf jeden Fall fehlte der spontane Kontakt, den ich bei unserer ersten Begegnung gefühlt hatte. Aber es lag etwas anderes vor. Erwartung?
Der General war groß und hager. Er hatte ein weißes Schnurrbärtchen unter einer Stupsnase, und das glatte weiße Haar war in der Mitte gescheitelt. Seine Gesichtsfarbe war ziemlich bleich, die dünnen Lippen hatten einen bläulichen Ton.
Er sah aus wie der gebieterische gestiefelte Kater in meinem alten Märchenbuch.
Beatrice stellte mich ihm vor: „Das ist Dan Johansson, Papa. Er ist ein hervorragender Kunstmaler. Ein guter Freund von Marianne Bundin.“