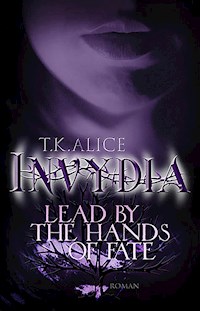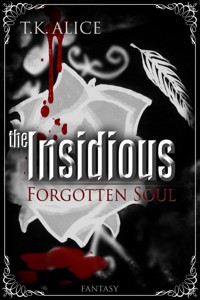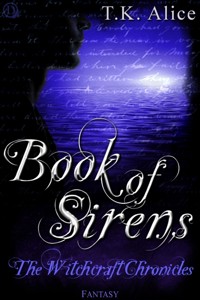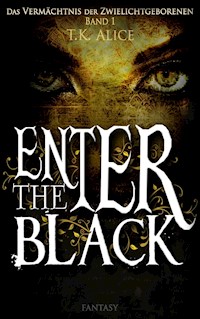
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Vermächtnis der Zwielichtgeborenen
- Sprache: Deutsch
- Schatten der Vergangenheit - Eine junge Künstlerin; etwas chaotisch, ein wenig sozial verarmt, aber doch lebensfroh auf ihre eigene Art - so könnte man Annie beschreiben. Sie liebt, sie lebt und sie ist stolz auf das, was sie tut, selbst wenn sie manchmal ein wenig schüchtern sein mag. Doch unter der farbenfrohen Oberfläche, lauern tiefsitzende Fragen: Wer bin ich? Woher komme ich? Wozu bin ich hier? Und die Antworten auf diese Fragen, könnten sie vielleicht sehr bald mehr kosten, als sie zu geben bereit ist ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Schwester Nisha
und meine Tante Ursula.
Inhaltsverzeichnis
Prologue
Chapter 1: And the Sky is Distant
Chapter 2: As I Watch You Burn
Chapter 3: With What Binds Us to the Past
Chapter 4: We Had to Encounter Madness
Chapter 5: And Got to Portray Sadness
Chapter 6: As We Made Ourselves at Home
Chapter 7: In This Wide and Open World
Chapter 8: With Driving Memories Among Us
Chapter 9: And Whatever Pain May Come
Chapter 10: We Will Get Up Again
Chapter 11: For When This Sun Comes Up
Chapter 12: Though We May Be Cursed
Chapter 13: Your Eyes Will Tell Stories
Chapter 14: My Ears Will Catch on Hints
Chapter 15: Our Lips Will Spread Legends
Chapter 16: While We Stumble Upon History
Chapter 17: And See Ourselves Unclouded
Chapter 18: With Childlike Naiveté
Chapter 19: In the Blink of an Eye
Chapter 20: Everything Went Down the Drain
Chapter 21: Now Another Moon is Rising
Chapter 22: Basking in its Silver Glow
Chapter 23: Look up at the Screaming Sky
Chapter 24: Ashes Falling Down like Snow
Chapter 25: Inside Me, there’s a Raging Blast
Chapter 26: Revealing Secrets of the Past
Chapter 27: A Moonlit Flower on the Stage
Chapter 28: Showing Me the Only Way
Chapter 29: In the Snow and on the Streets
Chapter 30: Hidden in My Memories
Chapter 31: I’m Looking for the Answer
Epilogue
Prologue
Huntsville, Florida, USA
6. September 2006
Regen.
Es regnet bereits seit Tagen. Ungebremst fallen die kalten Tropfen auf mich herab. So als würde mich der Himmel verspotten wollen., ohne mir auch nur eine kleine Verschnaufpause zu gönnen.
Ich weiß nicht, wie ich überhaupt noch hier sein kann. Die Kälte durchdringt meine Haut wie eine scharfe Klinge; sie betäubt das Fleisch und schält es langsam von meinen Knochen. Es fühlt sich zumindest so an.
Der Schmerz in meinen Gliedern ist zeitweise unerträglich. Ich sehe blaue Linien an der Oberfläche. Kein gutes Zeichen?
All das, während ich keine Ahnung habe, wo ich mich befinde.
An einem einsamen Ort. In einer kahlen Gasse.
Ein plötzliches Scheppern durchschneidet das beständige Prasseln und bringt mich dazu, die Hände schützend an den Kopf zu halten. Schwarze Vögel steigen zu meiner Linken in den Himmel empor. Die Dunkelheit umgibt sie, als sie verschwinden.
Erschrocken beginne ich zu rennen, geradeaus auf einige Lichter zu. Lichter, die aus dem Dunkeln zu mir scheinen.
Ich friere so sehr.
Und dann sehe ich sie wieder; die Massen.
Ich bin so winzig und die so groß. Kein Wunder, dass sie mich immerzu zu übersehen scheinen.
Allein ihre Anwesenheit lässt meine Knie vor Angst schlottern.
Mit kleinen, unsicheren Schritten, stapfe ich hinaus auf die Straße. So viele Geräusche, Gerüche und Lichter. Dinge, die mir Angst machen.
Meinen eigenen Oberkörper mit den Armen umschlingend, sehe ich mich um. Jemand rempelt mich an und ich taumle einen Meter zurück.
Kaum stehe ich sicher, werde ich erneut gestoßen.
Das weiße Kleid das ich trage ist mittlerweile von Schmutz übersät, nass vom Regen und zerrissen von den Mauern und dem Müll an diesem unheimlichen Ort.
Und dann … ist es plötzlich still. Die Tropfen bleiben einfach aus.
Verwundert sehe auf; schaue hoch in den Himmel, erwarte die Sterne zu sehen, doch dem ist nicht so.
Stattdessen wurde über mir eine dunkle Blockade errichtet. Und da ist einer von ihnen.
Eine Frau. Sie bleibt einfach vor mir stehen.
So fremdartig für mich; so wie all die anderen auch.
Ist sie wie ich? Oder bin ich wie sie? Sind wir gleich?
Ich erkenne das Objekt über mir, das das Wasser vom Himmel abhält, nicht wirklich wieder. Ist es eine Art Schutzschild, den sie über uns beiden ausbreitet? Magie?
Dann geht sie vor mir in die Knie, beschmutzt den hellen Mantel mit dem feuchten Dreck am Boden, um mich genauer ansehen zu können. Doch diese Nähe erschreckt mich.
»Was ist denn los mit dir, Kleine? Wo ist deine Mutter?«
Für mich könnte die Dame genauso gut ein Monster sein. Eine zähnefletschende Bestie, die mich jeden Moment zu verschlingen droht. Innerlich sehe ich bereits vor mir, wie das nett anmutende Lächeln zu einer verzerrten Fratze der Bosheit verkommt.
Doch ich laufe nicht davon … denn sie wirkt wie ich; irgendwie verloren. Ziemlich einsam. Ob sie sich wohl auch verirrt hat? Nicht mehr weiß, wo sie hingehört?
Ich schüttle den Kopf und weiche doch ein paar Schritte zurück.
»Sie ist nicht hier«, flüstere ich mit hörbarem Unmut, »nicht hier …«, so lange, bis ich es selbst erkenne.
›Nicht hier‹, doch…
Wo ist ›hier‹ überhaupt?
Chapter 1:
And the Sky is Distant
Huntsville, Florida, USA
23. Oktober 2014
Finsternis.
Finsternis und Schatten um mich herum.
Ja, obwohl der Schatten selbst doch auch Finsternis ist, oder nicht? Es fühlt sich an, als wäre es hier anders. An diesem geheimnisvollen Ort.
Als gäbe es nur hier einen feinen Unterschied; einen, den ich weder zuordnen, noch auf irgendeine Art benennen kann.
Ich kann ihn aber doch ganz klar spüren. Ist das nicht seltsam?
»…«
War dort ein Geräusch?
Ich kann nichts verstehen, würde am liebsten einfach weiterhin gar nichts hören; gar nichts sehen. Man könnte sagen, es sei fast unheimlich, wie geborgen ich mich hier fühle.
Es wäre zumindest mit Sicherheit unheimlich für mich, wenn ich den Nerv hätte, mich darum zu scheren.
»Wa … au …«, vernehme ich es erneut, diesmal deutlicher.
Spricht da etwa jemand? Ich kann nicht entziffern, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Nicht einmal, ob es eine junge Person ist, oder eine Alte. Die Laute wirken überlagert und schrill.
»Wach auf …!«
Die letzte Aufforderung durchzuckt mich wie ein stummer Schrei, während die seltsame Stimme in Wahrheit nur gedämpft, wie durch dicke Watte oder tief unter Wasser, an meine Ohren dringt. Endlich öffne ich langsam die Augen.
»Wer ist da?« Desorientiert versuche ich zu antworten.
Doch als ich den Mund öffne, klingen die Worte seltsam dumpf.
Wie, als würde man einen Radiosender hören, der nahezu keinen Empfang hat. Mein nächster Impuls ist, die Augen aufzureißen und zu schreien.
Aber diese Augen sind bereits geöffnet, sie sehen bloß nichts.
Meine Ohren hören – vernehmen nichts.
Ich spreche … doch ich sage nichts.
So schreie ich lauter, bis meine Kehle vor Anstrengung schmerzt.
Kein Ton will mehr meine Lippen verlassen, obwohl ich fühlen kann, wie die Stimmbänder in meinem Hals vibrieren. Alles ist so taub, während das Flüstern um mich herum immer lauter wird; das wirre Summen sich in meinen Verstand bohrt. Das Gefühl der Geborgenheit ist wie weggeblasen; als hätte es nie existiert.
Stattdessen trifft mich eine Welle aus Gefühlen, die nicht Meine sind. Sie durchströmen mich auf eine Weise, die mir gänzlich unbekannt ist; drohen mich zu ersticken.
Gefühle, geprägt von Einsamkeit. Von Dunkelheit. Von Kälte. Angst. Trauer. Wut.
Von Schmerz.
Ohne Vorwarnung ruckelt es plötzlich unter mir; alles, was mich hält, ist auf einen Schlag fort.
Und wie mein Klagen unaufhörlich von der tiefen Dunkelheit in diesem bodenlosen Abgrund verschlungen zu werden scheint, beginne ich zu fallen.
Erschrocken spüre ich einen plötzlichen, dumpfen Aufprall, dessen Resonanz durch meinen gesamten Körper vibriert.
Hämmernder Schmerz breitet sich binnen Millisekunden in Schulter, Hüfte und Hinterkopf aus. Letzteres bringt mich dazu, gar nicht erst die Umgebung und Situation erfassen zu wollen, sondern mich einfach wie ein kleines Kind in Embryonalstellung zusammenzurollen, um Linderung abzuwarten.
Es dauert entsprechend eine ganze Weile, bis ich mich betont langsam aufraffe. Die an meinen kurzen, rosa Haarschopf gepressten Hände nutze ich, um mich auf dem Boden unter meinem Schreibtisch, wie ich verwirrt feststelle, hochzustemmen und ächzend wieder auf meinen Stuhl zu hieven.
Nur knapp lande ich darauf, ehe er ein Stück zur Seite rollt. »Verdammte Scheiße«, murmle ich zerknirscht.
Offenbar bin schon wieder am Tisch eingepennt.
Der nächste Gedanke, der mir verworren durchs Gehirn zischt, lässt mich für einen Moment wie gelähmt zurück. Meine nächste Amtshandlung ist ein schneller Blick zu meinem Wecker.
»Oh, verdammte Scheiße!«
Ich stürme los, reiße dabei noch fast die Staffelei neben mir zu Boden und sprinte auf die weiße Tür meines Zimmers zu. Wäre ich besonders sportlich, würde das bestimmt weniger dämlich aussehen.
So oder so ist das Ergebnis aber dasselbe, weshalb ich kurz darauf im Badezimmer lande. Ich lasse den Pyjama in hellem Rosé einfach auf den Boden segeln und springe unter den Strahl der Dusche, welcher bereits voll aufgedreht ist, noch bevor ich die Kabine hinter mir schließe. Der Schlafanzug ist mein Liebling, jedoch muss ich gerade daran denken, nicht zu viele Gedanken daran zu verschwenden, dass ich auf dem weiten
Oberteil einige rote Farbklekse verteilt habe. Und eigentlich verschwende ich die Gedanken damit ja bereits … zählt das?
Egal. Ich hoffe einfach, man bekommt das wieder raus.
Es dauert glücklicherweise keine zehn Minuten, bis ich blitzsauber vor dem Spiegel stehe und seufze. Oder besser gesagt: Ich bin so sauber, wie man sich in zehn Minuten eben schrubben kann.
Alles klar … unerheblich. Nach der Zahnbürste in meinem auffällig violetten Becher greifen wollend, sehe ich mich kurz um. Irgendetwas irritiert mich.
Die Uhr auf der Ablage neben dem Waschbecken, die dort immer nur für mich zu stehen scheint, zeigt mir eine etwas schockierende Wahrheit; ein Horrorszenario am Morgen, sondergleichen.
Ich nehme die Uhr zur Hand, schüttle sie durch und durchbohre sie mit mordlüsternen Blicken. »Ist das dein verdammter Ernst?!«
Schnell lege ich das Teil zurück und stapfe genervt in den Flur, in dem sich eine weitere Uhr befindet. Und Überraschung, sie bestätigt es.
Um ehrlich zu sein kam ich mir schon lange nicht mehr so früh am Morgen schon so dämlich vor.
Wieder zurück im Zimmer, ein letzter Check. Jep, eine andere Zeit. Malerisch.
»Ein Fehlalarm, hm? Mistkreatur. Ich werde dich töten, verbrennen und vergraben, das hast du nun davon«, drohe ich ihm, doch dummerweise scheint ihn das gar nicht zu kümmern.
Schlimmer noch: es ändert auch rein gar nichts an meiner Situation.
Mein Vater liebt Uhren, ich dagegen… eher weniger. Aus ganz offensichtlichen Gründen, möchte ich meinen.
»Also manchmal… hasse ich mein Leben wirklich.«
Scheint, als hätte ich noch ein wenig mehr Zeit als angenommen. Wenigstens ein kleiner Trost für die sarkastische Stimme in meinem Kopf, die sich lauthals über mich kaputt lacht.
Immerhin werde ich so ausnahmsweise mal nicht zu spät kommen …
Naja, oder zumindest denke ich das.
Die Vögel zwitschern vor den offenen Fenstern; ich höre sie bis zu mir auf den Flur.
Müde und von leichter Schwermut erschlagen, schlurfe ich mit meinem misshandelten Schlafanzug unter dem Arm und einem großen Handtuch um den Körper geschlungen zurück, wo ich schließlich vor dem Kleiderschrank zum Stehen komme.
Alles klar soweit.
»Wenn ich jetzt wüsste, was ich nehme, dann wär ich wohl nicht ich, schätz ich mal …«, mutmaße ich und beiße mir auf Lippen, als ich das massive Zedernmonster vor mir betrachte.
Sollte ich ausziehen, erinnert mich daran das Ding nicht selbst vom Fleck bewegen zu wollen.
Seufzend öffne ich eine der Türen und krame dann wahllos eine Hose und ein Shirt daraus hervor, denn nur ein Blick aus dem Fenster verrät, dass das Wetter sich gebessert hat.
Selbst wenn es nachher wieder regnen sollte, wieso das Risiko eingehen? Es ist schon Oktober, aber immer noch warm, dank des Klimawandels vermute ich, aber was ist, das ist eben. Und einem geschenkten Gaul guckt man bekanntlich nicht ins Maul.
Selbst wenn der Gaul dir vom Teufel persönlich überreicht wird … Okay, dann vielleicht schon, aber ihr müsst zugeben, der Vergleich hinkt auch gewaltig.
Den Kopf über meinen eigenen Unsinn schüttelnd, besehe ich mir die vermutlich fragwürdig ausgefallene Wahl. Zu einer Art lachsfarbenem Oberteil gesellen sich eine sehr kurz und unsauber abgeschnittene Latzhose aus verwaschenem Jeansstoff und eine Strumpfhose, die in Rot, Orange und Braun von oben bis unten quer gestreift ist.
Wieso ich überhaupt so etwas besitze? Keinen Schimmer. Es gefällt mir irgendwie.
In gewisser Weise sind die Farben ein Zeichen von Freude. Und bereits als ich noch jünger war, hatte ich realisiert, dass andere Menschen fröhliche Mitbürger einfach viel seltener schief ansehen.
Also zumindest dann, wenn nicht gerade irgendwo ein Turm in die Luft gesprengt wird oder bei dreißig Grad im Schatten überall in der Stadt der Strom ausfällt. Letzteres hatten wir hier jedenfalls schon.
In so einem Fall sollte man besser überhaupt gar keinem mehr begegnen, egal mit welcher Laune.
Mit einem Lächeln auf den Lippen und neuerlichem Kopfschütteln, diesmal wegen der Erinnerung an diesen heißen Tag im Juni letzten Jahres, schlüpfe ich in frische Unterwäsche und ziehe mein zusammengewürfeltes Outfit darüber, woraufhin ich ein weiteres Mal im Familienbad lande.
Mein nicht einmal ganz schulterlanges Haar ist noch immer klatschnass; tropft dunkle Flecken auf den Stoff der meine Schultern bedeckt. Als ich es spielerisch nach vorn und wieder zurückwerfe, in dem ich den Kopf schüttle, spritzt das Wasser nur so gegen die, ohnehin noch von der vorigen Dusche beschlagene, Scheibe.
Mit einem Handtuch wische ich also über den Spiegel, da ich mich ja so und so gegen das Trocknen meiner Haare entscheide; ich mag sie unordentlich. Der Film weicht langsam den dünnen Striemen von Wasser, die ich immer nur weiter zu verteilen scheine, anstatt sie abzutragen. Und auf einmal halte ich inne.
Ich halte den Atem an und wische nur noch ganz langsam. Es wirkt, als wäre ich tief in Gedanken, doch mein Puls rast.
Aus den Augenwinkeln nehme ich etwas wahr; eine Bewegung. Im Spiegel erkenne ich den Schatten. Nicht meiner. Die Dusche hinter mir ist halb verdeckt durch den Vorhang, das Licht der Lampe neben mir an der Wand beleuchtet ihn schräg.
Schluckend jagt ein Gedanke den Nächsten; Gedanken, die unangenehme Schauer über meinen Rücken huschen lassen.
Plötzlich zucke ich zusammen, als der Schatten sich hastig bewegt, und drehe mich blitzschnell herum. Ich reagiere auf ein flinkes Etwas hinter mir an der Badezimmerwand, um dort … bloß meinen Schatten zu sehen?
Einen Moment starre ich stur zur Wand. Ich blinzle und sehe über meine Schulter zurück in den Spiegel. Nichts.
Was?
Verwirrt gucke ich mich mehrfach in dem kleinen Raum um, ehe ich ratlos zurück in reflektierende Glas sehe.
»Eindeutig zu wenig Zucker im Blut …«, schlussfolgere ich nüchtern und kann nicht glauben, was hier gerade geschehen ist.
Oder war es einfach zu wenig Schlaf?
So muss es sein, entscheide ich, während ich die Achseln zucke und erleichtert den Atem entweichen lasse, den ich zuvor ungewollt zurückgehalten habe. Das Handtuch, das ich immer noch fest umklammere, werfe ich derweil über den Haken.
Im Sinne der zurückgekehrten Normalität, bestaune ich meine kleine, zerzauste Haarpracht. Und das ohne Hilfsmittel, immerhin!
Es mag kein Kunststück sein, aber bei kurzen Haaren ist sowas wirklich schwerer, als es in all den Magazinen aussieht, das könnt ihr mir glauben.
Eigentlich war ich immer der Meinung, Dinge wie diese seien nicht besonders anspruchsvoll, doch so gesehen … Mann, wenn Liv das gerade hören könnte, dürfte ich mir ihre Sticheleien deswegen vermutlich noch anhören, bis die Hölle zufriert.
Tja, ich hasse es jedenfalls, wenn sie glatt herunterhängen. Denn dann sieht es irgendwie so aus, als seien sie tot.
Vielleicht ist es ein innerer Antrieb. Auffällig, könnte man meinen, obwohl ich paradoxerweise eigentlich nur ungern auffalle.
›Rebellion‹ wurde es zudem bereits genannt, doch das ist ebenfalls lächerlich.
Eine Rebellion ist etwas anderes. Wenn man wirklich rebelliert, dann fließt für gewöhnlich Blut.
Und eine Menge Tränen.
Das was ich tue, ist keine Rebellion, sondern einfach mein eigenes Zeichen. Es ist mein Zeichen an die Welt, dass ich noch lebe; dass ich nicht tot bin.
Und das ist alles, was ich möchte.
Noch ein letzter Blick in mein eigenes Gesicht, dann zucke ich ein weiteres Mal gleichgültig die Achseln und wende mich ab.
Mit einer leisen Melodie auf den Lippen, springe ich, mit der Schultasche aus meinem Zimmer, buchstäblich die Stufen hinunter ins Erdgeschoss.
Mal sehen, wer noch da ist.
»Mom? Dad? Ist jemand zu Hause?«
Ich rufe es zwar aus, so allein im Gang stehend, doch kann mir im Prinzip schon denken, was ich zur Antwort erhalten werde.
Stille.
Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl und will dem gerade Nachgehen, als mich ein kleiner Zettel am Kühlschrank anlächelt.
Wie immer am selben Platz.
Auf dem Weg dorthin komme ich an einem Glas auf der Anrichte vorbei, aus dem etliche kleine, weiße Stiele in die Luft ragen. Ich greife mir ein paar davon, reiße von einem die Schutzfolie ab und lasse die restlichen dann in den Känguru-Beutel an meiner Hose gleiten.
Gleichzeitig danke ich meiner Mutter im Geiste, dass sie immer an all das denkt, was ich selbst vergesse. Wie zum Beispiel daran, die Lutscher im Haus nachzufüllen.
»Das Essen für heute Abend steht im Backofen; das für die Schule auf der Anrichte. Wir kommen heute beide spät, wegen einer Konferenz, aber morgen sind wir zum Frühstück wieder anwesend, versprochen.
Wir lieben dich«
Sogar mit einem kleinen Herzchen verziert. Ganz klar von meiner Mutter. Und das, obwohl ich bald siebzehn werde, also im Prinzip offiziell schon fast eine junge Frau sein sollte. Erwachsen … zumindest auf dem Papier.
Obwohl ich mich selbst oft noch als Kind betrachte, was in dieser Gesellschaft nicht besonders gern gesehen wird.
Ob es mir also etwas ausmacht, das meine Eltern so drauf sind? Nein, eher nicht.
Es erfüllt mich mehr mit einer gewissen Wärme, zu sehen, dass ich noch immer ihr kleines Mädchen sein darf und bin. Obwohl sie davon ja eigentlich nie allzu lange etwas hatten, zumindest nicht so lange wie die meisten Eltern von ihren Kindern.
Gleichzeitig muss ich gestehen, dass es mir manchmal doch ein wenig peinlich ist. Nicht unbedingt, weil mich die Meinung anderer interessiert; vielleicht würde ich es nicht einmal wirklich als ›peinlich‹ bezeichnen.
Nein, eher als … unangenehm. Weil ich nicht als die Erwachsene angesehen werde, die ich sein sollte. Und man mir so den Freiraum lässt, das Kind zu sein, das ich gerne noch wäre.
Es ist eben schwer, der Versuchung zu widerstehen. Besonders, da mir so viele Jahre meiner Kindheit fehlen, dass ich manchmal das Gefühl habe, diese Extrajahre stünden mir zu, was aber natürlich Quatsch ist.
Jeder muss irgendwann erwachsen werden – das sollte, bei Gelegenheit, vielleicht auch mal jemand meinen Eltern mitteilen.
Wenn ich mal zu lange weg bin, rufen sie mich noch immer sofort an und machen sich Sorgen, sobald etwas außerplanmäßig aufkommt und ich mich nicht im selben Moment bei ihnen melde. Außerdem … Oh.
Mit der flachen Hand gegen meine Stirn schlagend, wird mir bei dem Gedanken auch klar, dass ich noch einmal nach oben muss.
Mit eiligen Schritten nehme ich die Stufen nach oben, bis ich in meinem Zimmer stehe. Dort schnappe ich das Handy von seinem Platz, um es zusammen mit den Kopfhörern einzustecken. Ich wusste, etwas war komisch.
Auf dem Weg sehe ich nochmal zu dem unordentlichen Schreibtisch in der Ecke. Ich habe immer noch ein seltsames Gefühl. Hab ich noch mehr vergessen, oder was?
Doch ich kann nichts dergleichen entdecken, egal wie konzentriert ich mich umsehe. So groß ist der Raum ja nun auch nicht und die Stellen, an denen ich wichtige Dinge bunkern könnte, sind stark begrenzt.
Am Ende zucke ich nur resignierend die Schultern und packe meinen Kram an. Was soll‘s.
»Es wird schon alles in der Tasche sein«, entscheide ich nach einem Blick auf das Display meines Mobiltelefons.
Denn so langsam wird die Zeit wirklich knapp, wie ich erkenne, und so mache ich mich ein weiteres Mal auf den Weg nach unten, schnappe meinen kleinen Rucksack, mit den vielen Buttons an der großen Lasche, und verlasse damit schließlich das Haus.
Nur noch die Stöpsel in die Ohren und die Playlist auf meinen aktuellen Lieblingssong von The Ready Set stellen.
Mein violettes Fahrrad steht wie immer neben der Einfahrt zur Garage, auf der Wiese unseres Vorgartens, als ich es mir schnappe und mich direkt auf den Sattel schwinge. Ich lasse mich auf die Straße rollen, um mich in den langsamen Tagesablauf meiner kleinen Stadt einzugliedern und ein Teil davon zu werden.
Im Hintergrund höre ich dabei einer euphorischen Männerstimme dabei zu, wie sie über den ›besten Song aller Zeiten‹ und natürlich irgendein schönes Mädchen sinniert. Wie sollte es auch anders sein?
Zwar lächle ich bei dem Gedanken in mich hinein, doch lasse meinen ausdruckslosen Blick schweifen. Diese Sorge von heute Morgen will mich irgendwie nicht recht loslassen. Wenn es nicht das Handy war, was dann? Geht es überhaupt um einen vergessenen Gegenstand?
Habe ich denn abgeschlossen, als ich das Haus verlassen hab? Ja, ich denke schon, außerdem hatte ich das Gefühl ja bereits bevor ich gegangen bin. Was könnte es sonst sein?
Und warum stört mich das überhaupt so sehr? Es ist zum Haare raufen, denn normalerweise hätte ich es längst abgehakt.
Es ist als ob ich gar nicht anders könnte, als-
Mit einem Mal schlage ich den Rücktritt ein, als ein ohrenbetäubendes Hupen mich geschockt zusammenfahren lässt. Zeitgleich ziehe ich die Handbremsen an, da ich automatisch die Finger verkrampfe; wodurch das Fahrrad mit all seinem Schwung auch noch um Haaresbreite vorn über kippt.
Meine Augen sind weit aufgerissen und ich atme rasant vor Schreck, mein Lutscher fällt mir dabei mit einem stummen Ploppen aus dem Mund, was mir jedoch nur am Rande auffällt. Das Herz schlägt mir von einer Sekunde zur Nächsten bis zum Hals.
Ich kann nicht anders als zu zittern und mit leicht schwitzigen Händen hastig die Kopfhörer aus meinen Ohren zu reißen, um mich, noch immer orientierungslos, umzusehen.
Es kam so plötzlich, dass ich mich völlig aus der Bahn geworfen fühle; gleichzeitig fühle ich mich aber auch total dämlich. Wie ein schreckhaftes Huhn, das bloß dumm herumsteht. Mitten auf der Straße.
Eine Gänsehaut überkommt mich. Ich drehe mich nervös in alle Richtungen herum – bei dem Versuch, den Ursprung des Lauts zu ermitteln – und schlucke. Mein Mund ist wie ausgetrocknet.
Ein roter Wagen, der just in diesem Moment hinter mir zum Stehen kommt, müsste der sein, der auch gehupt hat.
Doch weshalb?! Ein anderes Fahrzeug kann ich bei aller Liebe nirgends erkennen. Aber er muss es gewesen sein.
Dort ist ansonsten bloß ein weiterer Mensch, am Rande des Feldes zu meiner Rechten. Ich denke mal nicht, dass diese Person mit den Arschbacken hupen kann.
Scheinbar verändert der abwegige Gedanke gerade meinen Gesichtsausdruck. Besagter Passant jedenfalls, starrt mich nun seinerseits äußerst verwirrt an. Großartig, wird ja immer besser.
Gleichzeitig wirkt alles um mich herum so normal, egal wie ich es betrachte.
So, als wäre ich die Einzige, die diesen Lärm vernommen hat. Die einzige, die erschrocken ist. Wie zum Teufel soll das möglich sein?
Als ich wie angewurzelt dastehe, offensichtlich im Weg, hupt der Rote erneut. Mein erster Instinkt ist, herumzufahren und ihn aggressiv anzufauchen, was ihm denn einfiele, hier so sinnlos Welle zu machen.
Doch ich tue nichts dergleichen, denn im selben Augenblick wird mir wird etwas klar, das mir alle Haare zu Berge stehen lässt.
Der Fahrer tuckert seinerseits nur langsam an mir vorbei, während er mir den Mittelfinger zeigt und sich meine Chance zur Rache mit ihm verabschiedet. Ich reagiere nicht einmal darauf. Es ist mir ehrlich gesagt völlig gleichgültig.
Denn dieses Hupen eben war vollkommen anders. Und diese Erkenntnis lässt nicht viele Schlüsse zu. Keine, wenn sie einen Sinn ergeben sollen.
Ich verstehe ja nicht wirklich viel von Autos, das gebe ich offen zu, doch das Gefühl und der Klang …
Nein, rückblickend schien es, als käme es von einem viel größeren Fahrzeug, nicht von einem solchen Flitzer. Außerdem derart laut, dass es durch die Musik noch mehr als deutlich hörbar war. Nicht nur einfach hörbar, so wie sonst, sondern eben vollkommen klar.
Dröhnend und deutlich, als hätte ich in dem Moment gar nichts anderes gehört – oder als käme es direkt aus meinen Kopfhörern! Der Lärm ging mir ja nicht umsonst durch Mark und Bein.
Unsicher greife ich nach dem kleinen Gerät in meiner Tasche und den Kopfhörern. Ich spule unsicher durch den Song. Schluckend.
Nein, was erwarte ich hier zu finden? Die Musik in kleinen Abschnitten spielend, zappe ich die Minutenzeile hindurch. Nichts.
Ich würde erleichtert aufatmen, doch das würde voraussetzen, dass ich irgendetwas erwartet habe. Habe ich das? Nein, nicht wirklich. Doch es schadet auch nichts, Dinge zu überprüfen, wenn sie einem seltsam erscheinen, nicht wahr?
Das Hupen muss einfach von Außerhalb gekommen sein. Aber woher? Es ist kein ansatzweise passender Wagen in der Nähe.
Mein gesamter Rücken kribbelt und das Gefühl lässt mich erneut erzittern.
Wie kann ich einen Wagen hupen hören, der überhaupt nicht existiert?
»Alles klar, Annie … Du siehst Gespenster«, will ich mich im Stillen selbst beruhigen.
Ich atme etwas ungleichmäßig ein und schließe dabei die Augen. Vielleicht ein besonderer Tinnitus? Gott, das ist so dumm.
Noch einmal versuche ich das mit dem Durchatmen, als ich mich etwas entspannter zurück in den Sattel setze. Gleichzeitig hole ich ein Bonbon aus meiner Tasche hervor.
Seufzend, jedoch langsam wieder ruhiger, sehe ich einen weiteren Autofahrer langsam an mir vorbeifahren. Er sieht mich an, doch scheint nichts zu entdecken das ihn interessiert. Ich stehe nur so da, auf meinem Fahrrad. Kein Unfall oder Ähnliches. Er fährt einfach weiter. Offensichtlich errege ich hier etwas mehr Aufsehen, als mir lieb ist. Ich sollte weiterfahren, es bringt doch nichts, hier zu stehen und mich verrückt zu machen.
Die Kreuzung vor mir liegt ansonsten absolut ruhig da. So wie jeden anderen Morgen auch.
Tief einatmen und wieder ausatmen. Alles ist gut.
Die Kopfhörer platziere ich jetzt ordentlich dort, wo sie meiner Meinung nach hingehören.
Ich sollte endlich früher ins Bett gehen. Wahrscheinlich bin ich auf dem Rad kurz eingenickt. Anders kann ich es mir nicht erklären. So oder so darf sich das auf keinen Fall wiederholen.
Ich hätte eben vielleicht fast einen Unfall verursacht, wer weiß? Der Schrecken den diese Einsicht allein in mir auslöst, ist weitaus schlimmer als das Hupen. Ich meine, einschlafen auf dem Fahrrad … Das ist echt ein neues Level.
Doch trotz der zittrigen Hände und wackeligen Knie, setze ich mich langsam in Bewegung, nachdem ich sicher bin, dass kein Fahrzeug meinen Weg kreuzen wird.
Wenn ich doch nur nicht so ein mieses Gefühl dabei hätte.
Ich möchte eigentlich nur noch an der Schule ankommen; mich in die Klasse setzen und meine Gedanken auf den Schulstoff konzentrieren.
Und Gott weiß, das will wirklich etwas heißen.
Eine leichte Brise pfeift mir um die kurzen Haare, als ich nach oben sehe. Das Fahrrad rüttelt mich einmal kräftig durch, während ich auf dem Gehweg auffahre, der sich direkt vor meiner Schule erstreckt.
Erst an den Ständern steige ich schwungvoll von meinem alten Drahtesel herunter. Gerade noch rechtzeitig, wie mir ein Blick auf die große Turmuhr in der Nähe verrät.
Doch der Gedanke an eine Verzögerung lässt mich wieder abschweifen. Das vorhin war wirklich verdammt merkwürdig. Aber ich sollte es einfach vergessen und dafür sorgen, dass es nicht noch einmal geschieht.
Mit einem erneuten Seufzen schiebe ich meinen violetten Freund bis zur Mauer, an der sich die Haltestangen zum Festketten der Räder befinden. Ich schenke der Handlung meine gesamte Aufmerksamkeit, bis mich eine Hand auf der Schulter dazu bringt, überrascht herumzufahren.
»Was«, beginne ich zu fragen, da ich mir nicht sicher bin, wer mich hier ansprechen würde, doch staune nicht schlecht, als ich mich umsehe.
Prima.
Das leere Nichts um mich herum scheint mich geradewegs zu verspotten. Wieder einmal friemle ich die Hörer aus meinen Ohrmuscheln. So langsam fühle ich mich verarscht. Doch wer wäre in der Lage, mich auf diese Weise hereinzulegen? Abgesehen von meinem eigenen Verstand.
»Was soll das, verdammt?!«, fluche ich lauthals.
Völlig verwirrt sehe ich mich ein ums andere Mal um, doch es scheint nicht einmal jemand in meiner Nähe zu sein. Gut, es könnte vielleicht Einbildung gewesen sein. Nur mein Oberteil, das sich bewegt hat. Aber die Zufälle heute … Erst das Bad, dann die Sache auf der Fahrt und nun das? Wenn es denn nur heute wäre. Alles was heute geschieht, scheint mir sagen zu wollen, dass ich heute Morgen am besten im Bett hätte bleiben sollen.
Musik dringt noch immer aus den kleinen Lautsprechern in meinen Händen, als erneut ein eigentlich angenehmer Wind aufkommt. Ich nutze die Gunst der Stunde, um meine Gedanken zu ordnen, während die Brise in meinem Haar spielt und einige Strähnen davon über meine Wangen bläst.
Ich bestaune, wie so oft, die alten Eichen um mich herum. So ruhig und doch so unheilvoll, wenn ich sie so betrachte. Als würden auch sie mir sagen wollen, dass ich für heute lieber nach Hause gehen sollte.
Aber erklär das mal einem Lehrer. Ich bezweifle, dass sie das als Entschuldigung akzeptieren.
Die Zweige der Bäume, die noch immer einige grüne Blätter tragen, scheinen mir etwas zuflüstern zu wollen.
Flüstern …
Ein Gedanke, der mich an die Träume erinnert, die ich in letzter Zeit so oft habe. Doch kann ich auch hier kein Wort verstehen. Erkenne nur die Krähen, die dort sitzen.
Auch auf der Mauer hinter mir; auf der großen, steinernen Mauer, die meine Schule umgibt.
Die Luft um mich herum scheint zu knistern und die Hände, nahe an meinem Kopf, in denen ich noch immer meine Ohrstöpsel halte, sind wie versteinert. Ich bin praktisch gelähmt, als ich so dort stehe und sich immer mehr der verheißungsvoll schwarzen Vögel um mich auf herum auch in den Baumkronen versammeln.
Eine ist ganz nah. Wie hypnotisiert schaue ich in die kleinen, pechschwarzen Perlen, die ihre Augen darstellen. »Hallo«, sage ich, doch es klingt wie das Wispern des Windes, als der Laut in der Atmosphäre verschwindet.
Unverständlich. Wie in einer längst vergessenen Sprache.
Es ist, als gäbe es in diesem Moment nur mich und sie.
Woher ich weiß, dass es kein ›Er‹ ist? Bloß so ein Gedanke.
Ich strecke die Hand nach ihr aus, doch plötzlich scheint der Abstand immer größer zu werden. Komm, nur noch dieses kleine Stück …
»Hey!«
Erschrocken mache ich beinahe einen Satz. Und wenn nicht äußerlich, dann auf jeden Fall innerlich. Mein Kinnlade klappt unwillkürlich ein Stockwerk tiefer und die Hand schnappt automatisch zu.
Mein Herz hat derweil einen solch hastigen Sprung gemacht, dass ich es gerade sogar in meinem Hals pochen spüre.
Noch einmal sehe ich zu der Krähe auf, die eben noch so nah schien, doch ich realisiere jetzt, wie fern sie doch in Wahrheit ist. Weit oben sitzt sie auf der Mauer, sieht zu mir herab.
In diesem Augenblick empfängt uns ein erschlagendes Konzert aus Kreischlauten, zusammen mit Flattergeräuschen und dem leichten Aufwind etlicher, schlagender Flügel. Ich nehme schützend die Hände vor mein Gesicht, doch als ich aufsehe, bietet sich mir ein majestätischer Anblick.
In einem kleinen Wirbel aus Federn und Flattergeräuschen heben diese erhaben anmutenden Wesen wie auf Kommando ab und verschwinden in einer schwarzen Wolke gen Himmel.
Einen Moment sehe ich ihnen noch nach, dann wird mir klar weshalb ich eigentlich hier bin.
Unverwandt schüttle ich den Kopf und versuche mich endlich wieder zurück in die Realität zu ziehen. Mit diesem Gedanken wende ich mich blinzelnd an den Störenfried, der diesen besonderen Augenblick gerade so glorreich ruiniert hat.
»Ja …?«
Diesmal steht sogar tatsächlich jemand vor mir, als ich das tue, allerdings nicht einfach irgendwer. Und in dieser Sekunde wünschte ich, es wäre wieder nur der Heilige Geist gewesen.
Ehrlich.
»Oh, Mr. O’Farrell, Sie … Was tun Sie hier?«
Ich fühle mich plötzlich erleuchtet und dumm wie ein Huhn, dafür dass ich so eingenommen war, dass ich nicht einmal seine Stimme erkannt habe.
Ich könnte mich ohrfeigen und würde am liebsten im Boden versinken.
»Das fragen Sie mich? Ich habe Sie hier stehen sehen, während alle anderen bereits im Gebäude sind. Warten Sie zuerst auf schöneres Wetter oder wollten Sie die erste Stunde etwa schwänzen, Ms. Dowell?« Er wirkt belustigt.
Doch ich sehe mich erst einmal verwirrt um. Eben hatte ich schließlich noch genug Zeit, also kann ich doch jetzt nicht schon zu spät dran sein, oder? Das glaube ich einfach nicht.
Als ich allerdings erneut auf die große Uhr sehe, welche nur einige Meter zu meiner Linken in den Himmel aufragt, bekomme ich fast einen Infarkt, nach all dem was heute bereits war.
»Oh, verdammt! Wann ist es denn so spät geworden?!«
»Nun, ich denke, das ist schleichend passiert. Vermutlich hat es vor einigen Millionen von Jahren begonnen. Doch die Zeit fliegt nun mal, wie sie eben fliegt. Und ich rate Ihnen, sich ein wenig zu beeilen, sonst fliegt dem lieben Professor noch vor Wut das Toupet davon. Und das wollen Sie doch nicht, oder?«
»Nein«, entgegne ich mit leichter Verzögerung und ein wenig langgezogen, »also bis später, Mr. O’Farrell.«
Woher weiß er eigentlich, welche Stunde ich jetzt habe? Zugegeben, er ist auch ein Lehrer, er wird es vermutlich irgendwo gesehen haben. Viel wichtiger ist doch wohl, dass diesem verschrobenen alten Zausel nicht tatsächlich noch das Haarteil explodiert.
Ich will heute echt noch nicht sterben.
»Wirklich nett, dass Sie uns auch noch mit Ihrer Anwesenheit beehren, Ms. Dowell«, wird eine kratzige Stimme in der Umgebung laut, als ich gerade versuche, mich unbemerkt in den Klassenraum zu schleichen.
Ich lokalisiere den Ausgangspunkt sofort und blicke in eine wutverzerrte Miene.
Mist! Hätte ja klappen können …
»Tut mir leid, Professor Dura. Wird nicht wieder vorkommen.«
»Oh, meinen Sie? Gehen wir jetzt unter die Hellseher? Ich hoffe doch sehr für Sie, das Sie diesmal richtig liegen. Anders als das letzte Mal etwa. Oder das davor«, meint er, »Geschichte wiederholt sich nämlich meist nur auf negative Weise. Denken Sie an meine Worte, wenn Sie diesen Kurs im nächsten Jahr noch einmal besuchen müssen, weil Sie von nichts eine Ahnung hatten.«
Darf ich vorstellen? Professor Kegan Jo Dura. Der schlimmste und langweiligste Lehrer der Schule, möchte ich wetten. Auf jeden Fall der mit dem schlimmsten Namen.
Und er unterrichtet Geschichte, das sagt wohl alles.
Wortlos lasse ich mich auf meinen Stuhl fallen und seufze; dabei setze ich die Tasche zu meinen Füßen ab zücke daraus und einen Stift plus Papier.
Das Thema ist der kalte Krieg. Und wenn man bedenkt wie oft ich dieses Thema bereits durchgekaut habe, könnte man meinen, dass die Geschichte der Welt doch nicht so lang ist wie alle immer meinen. Denen scheint hier jedenfalls gewaltig der Stoff auszugehen. Also, entweder das oder die Geschichtssäle sämtlicher Lehranstalten der Welt stecken kollektiv in einer nie endenden Zeitschleife fest.
Wie das Schicksal es so will, zwingen sie einem schließlich jedes Jahr aufs Neue auf, sich denselben Kram wieder und wieder anzuhören, bis man ihn schon schnarchen kann.
Vielleicht heißt der Mist ja deshalb ›kalter‹ Krieg – wie in ›kalter Kaffee‹. ›Abgestanden‹ würde vermutlich genauso passen.
Ich schwöre, noch ein einziges Mal, und ich zettle höchst persönlich einen neuen Krieg an, nur damit sie endlich mal was anderes zu Berichten haben.
Genervt wende ich mich ab, ohne weiter darauf zu achten, was vor sich geht. Meine Augen beginnen zu wandern; gedankenverloren. Bis sie letztlich am Fenster zu meiner Linken kleben bleiben. Der blaue Himmel scheint so weit und friedlich.
Wie schön meine Welt doch wäre, wäre ich ein Vogel.
Apropos … Ich verstehe noch immer nicht wirklich, was da vorhin geschehen ist.
Mit zusammengezogenen Augenbrauen, führe ich den Kugelschreiber in der Hand an meine Lippen.
Seltsam war es auf jeden Fall. Aber diese Krähen … Sie waren so schön.
Ihre tiefschwarzen Flügel schienen das Licht der Sonne geradezu zu verschlucken und die Augen waren wie kleine, endlos tiefe Ozeane.
Was sie wohl für einen Grund hatten, sich alle an der Schule zu versammeln? Braucht es für so etwas überhaupt einen Grund?
Ich merke gerade, dass ich absolut nichts über diese Kreaturen weiß. Vielleicht sollte ich bei Gelegenheit mal ein wenig Recherche betreiben.
Zu schade, dass mir deshalb jedoch nicht ebenfalls Flügel wachsen werden. Egal was passiert, ich bleibe hier unten.
Ich werde sie also wohl nie wirklich verstehen können. Die Freiheit dieser Tiere.
Mein Blick fällt aus den Wolken herab, zurück auf den Boden; in den Garten vor der Schule, genau genommen. Den begrenzten Raum, der mir zur Verfügung steht. Ich, die nicht fliegen kann.
Am Ende bleibe ich so doch noch an dem Ort hängen, an dem ich sonst immer hängen bleibe, wenn ich hier sitze.
Der große Hof innerhalb der Schulmauern. Direkt vor dem Gebäude.
Die Wolfen Crest Academy steht ganz im Zeichen ihrer Namensgeber, und das sieht man auch.
Atemberaubend schöne Wolfsstatuen zieren den Vorhof. In der Mitte ein Brunnen, dessen Zentrum ebenfalls Wölfe darstellen.
Das Wappentier der Gründerfamilie unserer Schule.
Schon bei der Ankunft auf dem Grundstück grüßen einen zwei mit der Schnauze zum Heulen in den Himmel gereckte Wölfe, wenn man durch das hoheitsvolle Tor in den Hof schreitet. Die beiden steinernen Statuen sitzen direkt auf den Säulen, die die großen Torflügel halten.
Es ist, als würde man sich auf heiligem Grund befinden, wenn man einen Fuß auf das Gelände setzt. Das alte Gemäuer scheint einem dabei die Geheimnisse der vergangenen Jahrhunderte zustecken zu wollen.
Ich habe diese Tiere schon gefühlte hunderte von Malen gezeichnet, seit ich diese Schule das erste Mal von außen bestaunen durfte.
Doch noch nie hatte ich das Gefühl sie so eingefangen zu haben, wie es sein sollte. Es ist zum verrückt werden.
Aber irgendwann …
Irgendwann werde ich es schaffen.
Es tönen die Pinsel, die sanft über die Malgründe gleiten. Seufzer von jenen, die nicht weiterwissen. Wispern überall um mich herum und der Geruch von Farbe hängt in der Luft, wie ich ihn am liebsten mag, auch wenn ich dabei lieber allein wäre.
Ich selbst sitze wie gelangweilt an meinem Platz vor der ausgewählten Leinwand. Dabei langweile ich mich aber gar nicht.
Die Kunst ist das Einzige, für das ich aktuell wirklich lebe. Ich würde mich mit ihr nie langweilen.
Sobald sich Mr. O’Farrell jedoch an die Klasse wendet, kann ich nicht anders, als von meinem unfertigen Werk aufzusehen, wie die meisten anderen Anwesenden auch.
Er läuft zwischen den Staffeleien hindurch, um die Arbeiten von uns, seinen Schülern, mit klarem Blick zu erfassen.
»Ms. Hinkle, bitte achten Sie darauf, dass das Helligkeitsverhältnis stimmt. Sie ist eine Tänzerin, nicht wahr? Dann schenken Sie ihr doch ein wenig Rampenlicht!« Er gestikuliert dabei wild mit den Armen. »Bei Ihnen ebenso, Mr. Foley!«
Freie Kunst. Wir malen, was auch immer uns Freude bereitet. Das grobe Thema lautet: ›Träume‹.
Man hört das Getuschel deutlich. »Eine Tänzerin? Wie alt ist diese Stacey eigentlich? Sechs?«
Einige lachen daraufhin, was jedoch schnell verstummt, als sie dafür einen mahnenden Blick von O’Farrell ernten.
Ich für meinen Teil finde es niederträchtig. Träume sind das, was jedem von uns selbst gehört. Sie sind unser Schatz. Wir müssen ihn nicht teilen. Und wenn wir es tun, dann sicher nicht um ihn zerstört zu sehen.
Natürlich hat jeder das Recht darauf, zu träumen, von was auch immer er möchte. Die Gedanken sind schließlich frei.
Ohne diesen Gänsen weiter Beachtung zu schenken, male ich weiter. Das hier wird schön. Es wird … etwas. Auch wenn ich noch nicht sicher weiß was.
Ich male konzentriert, bis mich ein weiterer Ausruf meines Lehrers zusammenfahren lässt, beinahe hätte ich auch noch das Bild verhunzt.
»Auch Sie …!«
Ich erschrecke, während ich gespannt seiner Stimme lausche, als diese plötzlich laut neben mir zu hören ist und dann in einer merkwürdigen Pause abbricht.
Unsicher kaue ich auf einem Bonbon herum, das ich seit geraumer Zeit von einer Wange in die andere schiebe. Zum Glück ist mir der Mund nicht wieder aufgeklappt.
Für heute habe ich aber auch echt genug. Mein Herz macht das so nicht mehr lange mit.
»Ja, Mr. O’Farrell?«
Ich frage nur leise, als ich realisiere dass es mein Bild ist, auf das er so fixiert ist.
Auch das noch.
»Nun, ich würde Sie ja fragen, ob Sie nicht ein wenig Licht in die Sache bringen wollen, doch mir scheint, mehr Licht wird es in dieser Szene wohl nicht geben.« Er legt eine Hand an sein Kinn und vermisst mein bisheriges Ergebnis, als würde er es in einem Museum sehen und seinen Wert einschätzen wollen.
Mir rutscht derweil vor Angst das Herz in die Hose, was mich verzweifelt schlucken lässt, wobei ich mich auch noch beinahe an meinem Kirsch-Bonbon verschlucke.
»Was sagen Sie dazu?« Ich hüstele ein wenig beim Sprechen.
Eine kleine Weile vergeht in der er nichts sagt, ehe er monoton das Wort an mich richtet, doch ohne mich dabei direkt anzusehen. Er antwortet dabei mit einer Gegenfrage, welche mich dazu bringt, vor Scham im Erdboden versinken zu wollen.
»Was genau soll das darstellen, Ms. Dowell?«
»Äh …« Die richtigen Gedanken wollen einfach nicht kommen, als ich nach ihnen fische. »Flügel, Mr. O’Farrell.«
Über diesen dürftigen Hinweis muss ich ehrlich selbst die Stirn runzeln.
»Das stimmt auffallend. Doch wo ist ihr Himmel?«
Die Frage trifft mich zugegeben unerwartet.
»Bitte?« Verwirrt sehe ich ihn mit glühenden Wangen an.
Peinlich. Nicht einmal seine eigenen Werke erklären zu können … Es ist leider nicht das erste Mal.
Ein leises Kichern hinter uns ist zu hören. Es würde mich nicht einmal stören, wüsste ich nicht, dass auch er mich nun für eine Idiotin halten muss.
»Der Himmel«, stellt er fest. »Flügel brauchen doch Freiheit und Wind, wo ist also der Himmel, in dem diese großen Flügel sich ausbreiten können?«
»Es- Es gibt keinen … Himmel in diesem Bild, Mr. O’Farrell«, stammle ich meinen Salat zusammen.
Einen Moment herrscht Stille.
»Mhm«, ist danach alles was ich von ihm vernehme. Wieder starrt er das Gemälde an.
Die Dunkelheit, aus der zwei Flügel wachsen.
Diese wunderschönen, schwarzen Flügel … wie die der Krähen; wie heute Morgen.
Flügel, die aus der Finsternis entstehen. Ein Gedanke, der mich nicht mehr loslassen will.
Einen Himmel gibt es auf der Erde nicht. Die Flügel die hier unten wachsen, wachsen nicht in den Himmel. Sie müssen ihn erst mit Mühe erreichen.
»Ist das deine Antwort?« Er scheint nicht überzeugt.
Doch diesmal schlucke ich nicht aus Nervosität, sondern um die Nervosität komplett zu verjagen. Ich bleibe so selbstbewusst, wie ich kann, als ich ihm in die Augen sehe.
»Ja. Diese Flügel haben keinen Himmel. Sie müssen ihn sich erst erkämpfen. Sie gehören zu keinem Vogel.« Eine Antwort die mich selbst überrascht.
Wenn es nicht um einen Vogel geht, um was geht es dann? Ein fixer Gedanke, so schnell verschwunden, wie er gekommen ist.
Daraufhin sieht er mich recht skeptisch und mit hochgezogener Augenbraue an; das Getuschel im Raum wird mir langsam doch zuwider.
»Ein Vogel? Was haben denn plötzlich Vögel damit zu tun?«
»Naja … nichts, offensichtlich.« Gott, was plappere ich hier eigentlich schon wieder für einen Mist?
Einen Rückzieher kann ich jedoch auch nicht mehr machen. Meine Stimme bebt mit leichter Verunsicherung, doch ich versuche sie im Zaum zu halten.
»Den Vögeln gehört der Himmel, schon von klein auf können sie zu den Wolken fliegen. Meine Flügel gehören keinem Vogel. Sie müssen erst wachsen und sich ihren Himmel verdienen. Ihnen gehört nur die Dunkelheit.«
So wie jedem von uns von Geburt an. Alles andere müssen wir uns erst erkämpfen.
Zu meiner grenzenlosen Verwunderung nickt er. Ich denke, ich war selten so erleichtert.
»Ja, genau so will ich das hören! Glaubt an euer Bild und eure Wünsche, egal was es ist oder was man euch erzählt.« Er kommt meinem Ohr näher, um leise Worte hinzuzufügen.
Worte, nur für mich bestimmt.
»In gewisser Weise sind wir doch alle wie diese Flügel. Geboren in der Dunkelheit; alles andere müssen wir uns erst erkämpfen … Nicht wahr?«
Sekunde … Wie bitte?
Mit einem Zwinkern, auf das ich nie und nimmer schnell genug reagieren könnte, tritt er zurück vor die Klasse.
»Erinnert euch an das, was ich euch immer zu sagen pflege«, beginnt er laut. »Eure Träume sind wichtig. Ihr seid Künstler. Und Kunst ist nichts anderes, als Träume wahr werden zu lassen; euer Bild kann nur so gut sein, wie ihr glaubt, dass es ist. Also glaubt auch daran, dann kann gar nichts schief gehen. Merkt euch das: Träume sind immer das, was unerreichbar scheint und genau das soll euer Ziel sein.«
»Also sollen wir uns Dinge wünschen, von denen wir wissen, dass wir sie so und so nie erreichen werden? Ist das nicht deprimierend?«
Die Schülerin, die diese verwirrte Frage in den Raum wirft, heißt glaube ich Mandy.
»Guter Einwand, doch ihr sollt ja auch gar nicht denken, dass ihr es nie erreichen werdet. Im Gegenteil. Ihr sollt euch eure Ziele so hoch stecken, dass ihr sie nur mit viel Arbeit erreichen könnt. Denn das ist es, was einen Traum zu einem Traum macht. Und nur so ein wahrer Traum kann auch wahre Freude bringen, wenn er endlich erfüllt ist«, verkündet er. »Denkt immer daran: Die reine Vorstellung von dem, was ihr vielleicht tun könntet, ist noch immer nicht das Limit von dem, was ihr wirklich tun könnt. Also seid bereit, über die von eurem Verstand und der Gesellschaft gesetzten Grenzen hinaus zu gehen; findet dort den Traum, für dessen Erfüllung ihr alles geben würdet, sogar euer ganzes Leben. Noch seid ihr jung, ihr habt die Zeit, also findet es heraus…«
Und da schlägt auch schon der Gong, der das Ende dieser Stunde mehr als deutlich einläutet.
Sein Vortrag ist damit für so ziemlich jeden Schüler im Raum beendet, was ihn etwas entmutigt.
»Also gut, das war’s für heute. Vergesst hier nichts. Und vergesst bitte niemals das Gesetz von Licht und Schatten, okay? Ohne Licht und Schatten funktioniert einfach nichts. Nicht nur Bilder, sondern alles auf der Welt folgt dieser Regel. Kein Licht ohne Schatten und ohne Schatten auch kein Licht, alles klar?«
Leider hört ihm tatsächlich bereits keiner mehr zu, als er noch weiter spricht. Es ist zu schade, da ich so gut wie alles was er sagt, für wichtig halte.
Selbst wenn es das einmal wirklich nicht sein sollte.
Dennoch beeile ich mich ebenfalls, all meine Sachen zusammen zu raffen, ehe ich meine Staffelei abräume und durch das Zimmer husche, auf dem Weg zur Tür.
»Warten Sie bitte noch einen Augenblick, Ms. Dowell«, werde ich dabei jedoch von meinem Lieblingslehrer unterbrochen, was mich zu einem jähen Halt bewegt.
»Wir müssen etwas Wichtiges besprechen.«
Chapter 2:
As I Watch You Burn
Etwas nervös sehe ich ihn an. Dann entscheide ich, dass der Boden unter meinen Füßen doch interessanter ist und senke beschämt den Blick.
Was könnte er wollen? Hab ich irgendwas verbockt?
Als sein ohnehin schon ernster Gesichtsausdruck sich noch verstärkt, bin ich bereits dabei all meine Verfehlungen der letzten Wochen vor meinem geistigen Auge zu sehen. Ach du je …
Bedächtig setzt er die schmale Brille ab, die seine Nase ziert, womit er meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich komme nicht umhin, seine Mimik zu verfolgen und ihn dabei zu bewundern. Er ist gutaussehend, das ist nicht zu leugnen.
»Ich wollte nur nachfragen, ob Sie denn bereits angefangen haben. Es wäre jedenfalls besser so.«
Ein wenig irritiert von seiner Aussage wandert eine meiner Augenbrauen wie von ganz allein nach oben, gefühlt bis in den Haaransatz. Mir bleibt kaum etwas anderes, während ich einen Moment darauf warte, dass er noch etwas sagt. Eine Pointe beispielsweise oder wenigstens irgendetwas, das mir klar macht, was er gerade meinen könnte.
Doch leider warten bleibt vergebens.
»Was … äh, was genau meinen Sie? Mit was soll ich angefangen haben? Hab ich was nicht mitgekriegt?«
Nun ist er es, der irritiert wirkt. Er sieht mich geradewegs an, als wäre ich irgendwie begriffsstutzig.
»Na, die Bilder«, meint er gleich darauf, als müsse ich doch genau wissen, worauf er damit hinaus will.
Klar gesagt: dem ist nicht so. Aber wie mache ich ihm das am besten deutlich, ohne dumm dazustehen? Offensichtlich sollte ich ja wissen, worum es geht.
Die Nervosität steht mir sichtlich ins Gesicht geschrieben. Eine Hausarbeit vielleicht? Doch dann liefert er mir schließlich die Erlösung.
»Für die Ausstellung auf der großen Halloweenparty«, stellt er monoton fest.
Statt erleichtert aufzuatmen, verschlucke ich mich auf diese Anmerkung jedoch am Rest meines Bonbons, was mich für einige Sekunden in einen so extremen Anfall von Husten verwickelt, dass mir die Tränen kommen.
Es dauert einen Augenblick, dann erkenne ich, wie mich Mr. O’Farrell ein wenig besorgt mustert.
»Geht es Ihnen gut?«
Ich schlucke und wische hastig über mein Gesicht; versuche mich wieder zu fangen.
»Ja, alles in Ordnung. Ich lebe noch«, krächze ich, ehe ich mich räuspere und zum Thema zurückkehre.
Es gibt Wichtigeres zu bereden, als meine Überlebenskünste.
»Mr. O’Farrell, was haben Sie damit eben gemeint?«
»Na, die Ausstellung«, wirft er ein, wirkt jedoch weiterhin in Sorge, »Geht es Ihnen tatsächlich gut?«
Letzteres stellt er dabei ganz sachlich infrage und beobachtet mich dabei kritisch.
Bei jedem anderen würde mich das sicher ankotzen. Hier schüttle ich jedoch nur den Kopf.
»Aber ich dachte, das wäre bloß ein Scherz gewesen!« Es kann nur ein Scherz gewesen sein.
Ich starre ihn mit unverhohlenem Schock an.
Er nickt erst, schüttelt dann aber den Kopf, als könne er sich nicht entscheiden.
»Oh nein, das war keineswegs ein Scherz«, versichert er, weiter recht tonlos – sodass es beinahe witzig erscheint – und erwidert meinen Blick dabei stoisch, wie gewohnt. »Ich würde Ihre Bilder sehr gerne auf dem Hauptgang im ersten Quadranten aushängen sehen. Direkt bei der großen Tür.«
Junge … Zerknirscht muss ich mir eine Antwort überlegen, die nicht allzu dumm klingt.
»Aber«, beginne ich, zupfe dabei abwesend am Stoff meiner Jeans, »ich bin nur eine von Vielen. Meine Bilder sind für sowas nicht bestimmt, glauben Sie mir.«
Mein Gegenüber seufzt zur Antwort und legt mir eine Hand auf die Schulter. Ich widerstehe dabei dem Drang, bei der Berührung zusammenzuzucken oder aus Nervosität zurückzuweichen.
»Ms. Dowell, Sie sind nicht hier in meinem Kurs, weil ich denke, dass Sie gut sind«, beginnt er und seine Worte versetzen mir einen leisen, aber schmerzhaften Stich, noch bevor sie ganz ausgesprochen sind.
Eine kleine Pause entsteht, ehe er weiterspricht.
»Ich habe für Ihr Stipendium meine Stimme gegeben und Sie mit offenen Armen willkommen geheißen, weil Sie selbst daran glaubten, dass Sie gut genug dafür sind. Und weil Sie der Kunst den Respekt entgegen bringen, der ihr gebührt. Wo ist diese Person gerade? Sie ist doch hier, oder nicht? Ihr Talent steckt nicht nur in Pinsel und Farbe, es steckt viel tiefer. Sie müssen es der Welt nur zeigen! Und wo beginnen, wenn nicht direkt hier, auf der großen Halloween-Ausstellung? Von der ich übrigens, unter uns gesagt, keinen wüsste, der passenderes Material bereitstellen könnte, wenn ich mir Ihren Stil ansehe.«
Ich mache große Augen und lasse erneut einige Sekunden ins Land ziehen. Es scheint eine Ewigkeit zu vergehen, bevor ich wieder in der Lage bin, zu antworten. Mein Mund und Rachen sind wie ausgetrocknet, darum räuspere ich mich vorsichtig.
Die Hand, die noch immer auf meiner Schulter ruht, strahlt dabei eine Wärme ab, der ich mir von Sekunde zu Sekunde bewusster werde.
So ein großes Lob war das doch gar nicht, also komm mal klar, Annie.
»Okay«, versetze ich schnell, während ich Angst habe, dass meine Stimme brechen könnte. Ich trete einen Schritt zurück, wobei seine Hand automatisch von meiner Schulter rutscht.
Schnell zieht er sie weg.
Kommt es mir bloß so vor oder ist er für einen Wimpernschlag wirklich ein wenig verlegen gewesen? Sicher bloß Einbildung.
»Ich werde darüber nachdenken. Zwar weiß ich nicht, ob meine Bilder wirklich dem Anlass gerecht werden können, aber ich denke darüber nach und gebe Ihnen dann Bescheid. Ist das in Ordnung?«
Der Schwarzhaarige nickt großmütig und räuspert sich dann seinerseits.
»Das klingt fair. Ich gebe Ihnen noch Zeit bis in einer Woche, wenn Sie sich denn dafür entscheiden. Die Entscheidung sollte allerdings schnell fallen, immerhin ist heute bereits der Vierundzwanzigste und sollten Sie doch absagen, müssen wir Ersatz auftreiben.« Lächelnd sieht er auf seine Uhr, als könne sie ihm beim Datum behilflich sein, dabei ist es eine einfache Quarz-Uhr. »Und Sie sollten in drei Tagen besser bereits angefangen haben, immerhin brauche ich mindestens zehn Bilder, wenn nicht mehr, um ein bisschen Auswahl zu haben.«
Ich beiße mir auf die Unterlippe, während ich hin und her überlege, ob ich das Folgende sagen soll, doch es ist schon raus, ehe ich es verhindern kann.
»Glauben Sie wirklich, dass ich dafür ausreiche?«
Er seufzt und sieht sich dann um, zu den Bildern an der Wand hinter sich. Besonders dieses eine, das einen Gang aus einem der schönsten Museen der Welt zeigt: der Eremitage.
»Weißt du, auch Pablo war einst nur ›einer von Vielen‹«, merkt er wie nebensächlich an, sieht dann jedoch mit einem vielsagenden Blick in meine Richtung.
Es dauert eine Sekunde, ehe ich kapiere wen er damit meint.
»War er nicht seiner Zeit voraus?«
»Ja, doch er war dennoch nur ein Mensch mit Talent, wie viele andere auch. So lange, bis jemand erkannt hat, dass etwas an ihm herausragend war und er letztlich zu Picasso wurde.«
Er macht eine kurze Pause, als würde er überlegen was er als nächstes sagen soll.
»Annie …fast jeder Mensch hat irgendetwas Besonderes. Man muss es nur erkennen und fördern, damit es nicht verwittert und verloren geht. In der Vergangenheit wurden diese Besonderheiten meist erst dann für andere sichtbar, als der Künstler längt gestorben war. Doch das muss nicht sein.«
Schweigend bleibe ich vor ihm stehen und denke über die Aussage nach, die seinen Worten folgt.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich denke …
»Müssen die Bilder denn sehr neu sein?«
Für einen Augenblick überlegt er und lächelt mit einem leichten Glanz von Selbstzufriedenheit und, wenn ich mich nicht irre, sogar ein bisschen Stolz. Er lehnt sich dabei an den Rand seines Pults und verschränkt die Arme vor der Brust.
»Es sollte noch nicht jeder kennen, mehr erwarte ich gar nicht.«
Schnell schenke ich ihm ein Lächeln und umgreife den Gurt meiner geschulterten Tasche etwas enger.
»Okay… vielen Dank.«
»Schlafen Sie drüber, dann sehen wir uns morgen wieder«, gesteht er mir zu, wendet sich jedoch bereits ab. »Haben Sie noch einen schönen Tag und überlegen Sie gut, was Sie tun wollen. Es würde sogar eine Note für alle Ausgestellten herausspringen. Die vor ein paar Tagen angesprochene Projektnote, die für jeden im Laufe des Halbjahres fällig wird.«
Ich nicke und drehe mich um. »Ich werde darüber nachdenken, vielen Dank. Ihnen auch noch einen schönen Tag .«
Nur einen Atemzug lang verharre ich in der Bewegung, ehe ich mich doch noch einmal zu ihm herumdrehe. »Und nochmal vielen Dank für … Für diese Chance.«
Erst in diesem Moment realisiere ich endlich, dass er mich vorhin bei meinem Vornamen genannt hat. Und diese Erkenntnis treibt mir eine spürbare Röte ins Gesicht.
Ungewollt wie ein Frosch lächelnd, verlasse ich daraufhin fluchtartig den Kunstraum, da mir dieses Verhalten bereits nach drei Atemzügen lebensbedrohlich peinlich ist. Verhalten, das ich von mir eigentlich gar nicht kenne, doch mein Herz schlägt schneller als es sollte. Vielleicht ist es das Adrenalin, doch meine Schritte werden automatisch noch schneller, ohne dass ich es zunächst bemerke.
Erst draußen, bei den Fahrradständern, komme ich wieder zum Stehen.
Und muss dort erst einmal eine Runde nach Luft japsen. Verdammt …
Schande über mein Haupt.
Meine Nervosität und die Aufregung von vorhin, für die ich mich jetzt schon wieder ohrfeigen könnte, haben mittlerweile nachgelassen. Die Fahrt ist ruhig und angenehm, auf der gähnend leeren Straße zwischen den Maisfeldern.
Doch meine Gedanken sind verwirrt, von allem was heute war und ich will nichts, als einfach nur zu Hause ankommen. Meinen Frieden finden und dann so schnell ich kann ins Bett gehen.
Okay, Letzteres vielleicht nicht zu früh, immerhin muss ich noch über das Angebot von Mr. O’Farrell nachdenken. Besonders weil ich ihn ja nicht enttäuschen will.
Von all dem Stress heute kribbeln sogar meine Handflächen wie verrückt. Zumindest glaube ich, dass das der Grund ist.
Unwillkürlich umfasse ich die Griffe meines Rades enger, um das Gefühl zu betäuben und seufze. Ich höre das Rauschen des Windes, der sanft an mir vorbeizieht. Ziemlich ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass ich in solch einem Moment normalerweise Musik hören würde. Doch nicht heute.
Ich konnte es einfach nicht. Plötzlich war da diese Angst … als würde etwas Schlimmes geschehen, wenn ich auch nur ein wenig unaufmerksam bin.
Durch die Erfahrung heute Morgen muss ich unterschwellig ein bisschen traumatisiert sein. Dieser Gedanke über das berühmte ›was wäre wenn‹ lässt mich einfach nicht mehr los, besonders jetzt, da ich wieder in derselben Lage bin wie zuvor.
Außerdem habe ich Hunger und wünschte, ich hätte wenigstens noch einen Lutscher in der Tasche.
Im einen Augenblick atme ich noch tief ein, im Nächsten bleibt mir alle Luft weg, als ein lautes, markerschütterndes Hupen mein Trommelfell attackiert.
Mit einem heftigen Donner rast mein Puls erneut; ein Déjà-vu. Daraufhin erfasst mich unwillkürlich eine Angst, die mir den Hals zuschnürt. Sie erschüttert mich in den Grundfesten und zwingt mich, anzuhalten.
Es geht dabei alles so schnell, dass ich kaum realisiere was ich tue, geschweige denn, was gerade überhaupt geschieht.
Alles was ich weiß, ist, dass ich stillschweigend dastehe, so wie heute Morgen, während mein Blick automatisch nach vorn fällt, um das Grauen zu bezeugen.
Die Kreuzung liegt erneut vor mir, nur diesmal von der anderen Seite aus.
Mit lähmender Panik in den Gliedern beobachte ich, wie ein großer, schwerer Lastwagen zum Bremsen gezwungen wird, es jedoch nicht rechtzeitig schafft. Eine kleine schwarze Limousine wird damit über mindestens fünf Meter auf der Straße vor dem großen Ungetüm her geschoben, nachdem dieser in dessen Seite hineingeprescht ist.
Stahl ächzt; Glas zerbricht. Die metallene Karosserie schlittert kreischend über den Asphalt, als wäre sie nicht mehr als ein Spielzeug.
Wie ein Pulsschlag in der Atmosphäre fegt die leichte Druckwelle des Aufpralls über mich hinweg und nimmt mir mit einem Mal erneut den Atem. Das Nächste was ich hören kann, ist das schrille Pfeifen einer angesprungenen Alarmanlage. Ein bisschen zu spät, wie ich feststelle. Es ist so surreal, dass ich fast das Gefühl habe, lachen zu wollen.
Die Sirene bringt nun auch nicht mehr viel, schätze ich.
Doch meine Ohren klingeln so sehr, dass ich sie mit zittrigen Händen zu verschließen versuche, nur ganz kurz, gerade lange genug, um das Rauschen meines eigenen Blutes zu hören.
Ist das gerade wirklich geschehen?
Binnen eines Wimpernschlags züngeln erste, kleine Flammen im Heck des zerdrückten PKW und ich zucke erneut zusammen. Ein Anblick wie aus einem Alptraum, den ich nie erleben wollte.
Ich schlucke trocken, während ich äußerlich zu schwitzen beginne.
Der Fahrer ist nicht zu sehen. Die Beifahrerseite wurde völlig zerquetscht. Es lässt das Auto in einer unförmigen, schon fast bananenartigen Gestalt an der Schnauze des Trucks zurück und nur der dicke Rauch vermag dieses groteske Bild ein wenig zu verschleiern.
Im Lastwagen scheint der Mann ebenfalls bewusstlos. Leider sehe ich ihn kaum und hören kann ich auch nichts, abgesehen von dem Zischen der heißen Materialien und anderen, nervenaufreibenden Nebengeräuschen.
Wie ferngesteuert schwinge ich mich von meinem Zweirad, auf dem ich lächerlicherweise noch immer sitze, werfe es in das Feld neben mir und renne so schnell ich kann. Das Mobiltelefon reiße ich indes von meinen Kopfhörern los und wähle dort die Nummer des Notrufs.
Polizei? Krankenwagen? Feuerwehr? Ich weiß es nicht. Die Nummern wollen mir nicht einfallen.
Keine Ahnung was ich mache oder was ich tun soll. Alles ist irgendwie schwarz. Alles ist plötzlich so leer.
Ich weiß nur, dass ich dort hin muss. Dass ich wenigstens versuchen muss … was zu tun? Selbst das weiß ich nicht. Helfen vielleicht. Was könnte ich schon zu geben haben?
Darüber denke ich nicht einmal eine Sekunde nach.
Das Auto qualmt noch immer stark, als ich es endlich erreiche und das Telefon in meiner Hand gibt ein Freizeichen; tutet quälend lange vor sich hin, ehe sich endlich eine Frauenstimme zu Wort meldet.
»Notdienst. Was ist Ihr Problem?«
»Ich brauche Hilfe«, rufe ich ihr entgegen, als wäre das nicht bereits von vornherein klar gewesen. »Hier sind ein Lastwagen und ein Auto zusammenkracht. Aus dem Auto tropft irgendwas und ein kleines Feuer ist ausgebrochen. Ich weiß nicht was mit den Fahrern ist. Ich weiß nicht was ich tun soll …!« Den Tränen bitter nah, warte ich eine Meldung ab.
»Okay, beruhigen Sie sich erst einmal. Wo genau sind Sie gerade?«