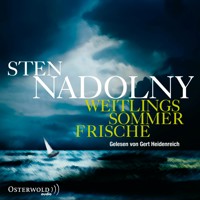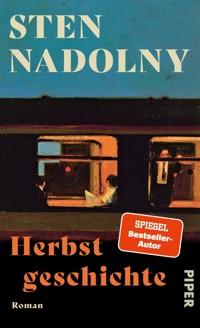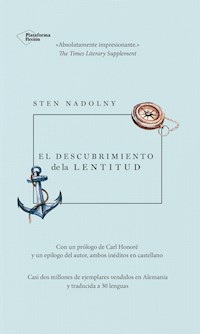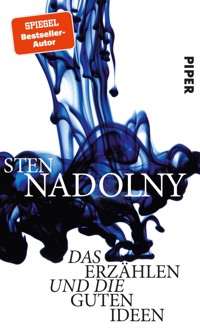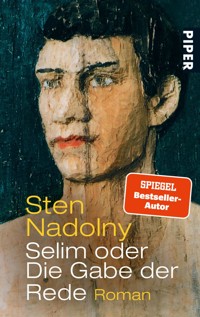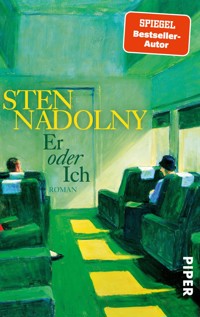
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ole Reuter, alt gewordener Stratege, Humorist und Melancholiker, nimmt sich einen Monat Auszeit: Er reist erneut mit einer Netzkarte per Bahn durchs Land, um zum früheren Lebensgefühl zurückzufinden. Das Ergebnis sieht eher nach einem Teufelspakt aus. Denn diesmal begleitet ihn auf Schritt und Tritt – irgendwann merkt er es – ein kühl analysierendes Alter ego. Wird dieser Beobachter ihn ins Verderben bringen? »Zwischen dem Schreiben über einen einzelnen und dem Schreiben über eine Generation, zwischen Schrift, Ironie, Scherz, Trauer und Ernst läßt Sten Nadolnys Buch eine wunderbare Balance.« (Bernhard Schlink in der »Welt«)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Hartmut von Hentig
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2004
ISBN 978-3-492-95791-5
© 1999 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Kornelia Rumberg, www.rumbergdesign.de
Bildmotiv: Chair Car, 1965 (oil on canvas) by Edward Hopper (1882–1967) und Private Collection / Photo © Christie’s Images / The Bridgeman Art
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Erstes Kapitel
Netzkarte
6. August, früher Nachmittag, auf dem S-Bahnsteig in Halensee. Ein etwas zu langer Blick in meine Augen, zwei junge Leute scheinen mich erkannt zu haben. Ich beachte sie nicht und beginne mit meinen Notizen. (Kein Wort über Wirtschaft und Politik!)
Jenseits der Gleise wird in einer Drehtrommel Kies gewaschen. Aus großen Haufen schmutzigen Gerölls wird brauchbarer Schotter, ein verständlicher und produktiver Vorgang, eine Gebetsmühle mit Resultat. Was wäre, wenn dabei Gold anfiele? Lustloses Grübeln über den Goldpreis.
Hier mein Filzstift, hier das erste der rasch noch gekauften sechs Schreibhefte, es ist aufgeschlagen und der Länge nach in der Mitte gefalzt, damit es in die Jacken- oder Hemdtasche paßt. Der Filzstift ist ungeeignet. Seine Schrift färbt durch, bei feuchtem Papier sowieso, ich schwitze zu sehr. Ich kann jedes Blatt nur von einer Seite beschriften. Vielleicht sollte ich das Heft ins Außenfach des »Pilotenkoffers« stecken. Ein unpraktisches Ding aus starrem Kunststoff, ich habe es, fürchte ich, seiner Bezeichnung wegen gekauft.
Am 6. August 1996 stellte ein großer, schwerer, vor Anstrengung schwitzender Mann im S-Bahnhof Halensee zwei Koffer auf den Bahnsteig. Er legte seine Rechte ins Kreuz, richtete sich ächzend auf, blinzelte in die Nachmittagssonne und ähnelte dabei, das war ihm nur zu klar, dem Bild des durstigen Dicken in einer Reklame für Dosenbier. Als Wartende ihn starr anlächelten, blickte er unwirsch weg. Jenseits der Gleise leierte eine Art Kieswaschmaschine, der Mann starrte hinüber, das Geräusch schien ihn zu beruhigen. Er wischte mit dem Handrücken Schweiß von der Stirn, zog aus der rechten Innentasche seines Jacketts ein längs zusammengefaltetes blaues Schulheft, dann aus einer anderen Tasche einen Filzstift, und wollte etwas aufschreiben. Das Heft war feucht geworden, er fand erst weiter innen ein trockenes Blatt, auf dem sich Notizen machen ließen. Immer wieder blickte er in beide Richtungen, aus denen ein Zug kommen konnte, schien sich also zwischen Süden und Norden noch nicht entschieden zu haben. Dann befiel ihn erneut Unruhe, er beugte sich zu den Koffern, tastete in den Außentaschen des kleineren, öffnete den größeren, ohne diesen aber flachzulegen, wodurch Krawatten, Gürtel und Hemdsärmel herausdrängten.
Man kann, wenn man eine Beobachtung notiert, das ICH zum Subjekt machen, aber auch ein ER, obwohl man ICH meint. ICH macht die Gedanken schneller, ER läßt ihnen, des Abstandes wegen, mehr Erfindungsfreiheit. ICH kann nicht so leicht eine ausgedachte, rundweg märchenhafte Geschichte behaupten wie ER. »Ich bin« und »Er ist« – das sind Gefäße sehr verschiedener Art. »Er ist strategischer Berater bedeutender Klienten aus Wirtschaft und Politik«, das macht weniger argwöhnisch als ein »Ich bin …«. Sofort drängt sich die Frage auf: Was ist das für einer, der so von sich spricht? Ist es denn wahrscheinlich, daß ein ernstzunehmender Mann der Wirtschaft oder Politik sich so anhört? Wir sagen von so einem Ich, es rede reichlich geschwollen, und ziehen unsere Schlüsse daraus. ICH und ER sind zweierlei Netze; mit dem einen fängt man viele kleinere, mit dem anderen wenige und größere Fische.
Entscheidungen empfinde ich fast immer als verfrüht oder, wenn sie bereits getroffen wurden, als falsch. Aber die eigene Unentschiedenheit aushalten zu können, gerade das prädestiniert für den Beraterberuf. Wartenkönnen, regungsloses Lauern, das Element des Skorpions. Warten, bis der Zeitpunkt zum Handeln gekommen ist. Die K. wird sich noch wundern! Ich weiß einiges über sie, über ihre Schwächen und Ausrutscher – und sie hat keine Ahnung, wieviel ich weiß. Ich habe ein gutes Gedächtnis für alles, was mir zugemutet worden ist (da fallen mir ohne Verzögerung sogar Namen ein), und für alles, was der Rache dienen könnte.
Schluß. Sonst formuliere ich wieder stundenlang die Vernichtungsrede gegen die K.
Jetzt kam der Zug, hastig stopfte der Dicke alles zurück und schloß den Koffer. Nach Norden also. Nicht weit übrigens, er stieg am Westkreuz um: Richtung Bahnhof Zoologischer Garten, Friedrichstraße, Hauptbahnhof. Er wirkte weiter nervös, Furcht schien ihn immer wieder von neuem zu befallen wie einen auf der Flucht.
Nichts vergessen? Ich vergesse immer irgend etwas. Längeres Tasten und Sinnen. Brieftasche mit vierhundert Mark, Kreditkarten, Scheckkarte, Schecks, Personalausweis, Netzkarte erster Klasse für alle deutschen Strecken, ausgenommen leider die Privatbahnen, die Schiffahrts- und alle Buslinien, die nicht »Schienen-Ersatzverkehr« sind. Vor zwanzig Jahren konnte ich sogar mit der »Kraftpost« übers Land fahren. Alles dahin. Wenn es wenigstens das Wort noch gäbe. Aber da ist mehr untergegangen, so viel, daß Einzelheiten unwichtig werden.
Die Netzkarte sieht aus wie ein normaler Fahrschein, nur das Photo gibt ihr einen Rest von Niveau. Sie gilt einen Monat lang von Mitte August bis Mitte September 1996. In den Hosentaschen: Wohnungsschlüssel, Portemonnaie, Kreislaufmittel. Im Pilotenkoffer: Diktaphon, Hefte, Funktelephon (aber nicht, um auf Empfang zu sein!), Kleinradio mit Ohrhörer, Pillen, Ampullen, Spritzen, Bücher über Gedächtnistraining, elektronisches Adreßbuch, Stadt- und Landkarten, Zeitungen. Im großen Koffer mit den ausklappbaren Rädern: Laptop, Adapter, Abspielgerät zum Diktaphon, Zigarren, Ersatzbatterien fürs Hörgerät, Kassetten, Disketten, weitere Bücher über das Gedächtnis, eine Flasche Whisky als Aufheller, falls es zum Äußersten kommt. Auch die Pistole steckt hier, nicht eben griffbereit, aber ich will nicht ihretwegen ständig die Jacke anbehalten müssen. Verbleibende Hohlräume sind mit dem Üblichen ausgestopft: Anzug, Socken, Unterwäsche, Schuhe, Waschbeutel, Rasier- und Verbandszeug, Pyjama … irgend etwas habe ich doch vergessen, vorhin fiel es mir wenigstens ein, jetzt ist es auch aus dem Kopf verschwunden. Wie kann einer, der so schwer zu schleppen hat, noch Dinge vergessen haben? Wieso hat man, je weniger jung und stark man ist, desto mehr Gewicht zu transportieren? Und wieso gibt es keine Diener mehr?
Mein Gedächtnis hat gelitten, ich könnte es auf der Reise ein wenig trainieren. In Wohnung und Firma, in allen Umgebungen, an die man sich gewöhnt hat, wird man vergeßlich. Man legt die Brille gedankenlos irgendwo ab, vergißt, vermißt und sucht sie verzweifelt, denn man hat hier schon so viele Wege zurückgelegt, so viele Bewegungen gemacht, daß sie schlicht überall sein könnte. Deshalb sollten ältere Leute ihr Zuhause verlassen, solange sie irgend können: Im Hotelzimmer wählen wir für alles bewußter einen Platz, verabschieden uns von den Dingen mit einem anhänglichen Blick, finden sie zuverlässig wieder. Ohne Abschied kein Erinnern.
Beim Umsteigen Knieschmerzen. Der Rücken meldet sich auch, das Unternehmen kann rasch vorbei sein. Verkrautete S-Bahnlinien, dann ein uraltes Stellwerk, halb zugewachsen (ein Seniorenheim für Dämonen, ein Stück Berlin). Jetzt der Bahnhof Charlottenburg. Blauer Himmel, ein paar Lämmerwölkchen. Hoch über den Gleisen steht auf einer Rohrbrücke in hingesprühter Schrift das Wort: »bitterness«. Wie kann man dort überhaupt schreiben, und dann noch von oben, in umgekehrter Schrift?
Wenn ich sitzenbleibe, gerate ich nach Neuenhagen. Reklame aus der Zeit vor der Wende: »Fahre Ihre Pappe ab, Krüger Neuenhagen.« Die Information stammt von – Name entfallen – einer Freundin jenes Ostberliner Beraters – Name entfallen –, der mich über Geschäftspraktiken der Firma Panta Rhein aufgeklärt hat. Hörte den Spruch im Frühjahr 1990. Müßte nach Neuenhagen fahren, um herauszufinden, ob er dort noch irgendwo steht. Im übrigen bedarf er einer gereimten Ergänzung aus dem Westen.
Das hier wird, wenn ich nicht aus irgendeinem Grund zu schreiben aufhöre, die Geschichte von der Erholung, ja Wiederbelebung eines in der Öffentlichkeit nicht unbekannten Beraters (er selbst nennt sich »Consultant«) namens Ole Reuter. Es handelt sich um den jüngeren Sohn Friedhelm Reuters, des Münchener Firmengründers. Ole Reuter berät Manager und Politiker.
Ich muß eine Liste aller mich bewegenden Fragen anlegen, angefangen mit der, wie das präzise Ergebnis dieser Reise aussehen soll. Das Ergebnis könnte sein, daß ich die alte strategische und taktische Geistesgegenwart wiederfinde und meine Feinde aufs Haupt schlage, besonders L. und P. Von hinten. Ein Mann meiner Position geht kein Risiko ein.
Zurück zu den Fragen: ich notiere sie in jedem Heft von der Rückseite her, schreibe also berichtend von vorne nach hinten, fragend von hinten nach vorn. Sehr passend auch zu einer Reise durch den unbekannten Osten – ich fahre zum ersten Mal hin. Bis zum heutigen Tag ließ ich mich ständig vertreten.
Die späteren Betrachter werden fast alles, was in und mit Ole Reuter vorgegangen ist, aus seinen Reiseheften erschließen können. Zu Beginn hat er ein paar kleine Sorgen, auch eine große, die sich irgendwann erledigen wird. Die kleinen hält er für alters- und berufstypisch: Er glaubt, sein Gedächtnis werde schwächer, hält sich mitunter für kränker, als Ärzte einsehen wollen, fühlt sich übertrieben beneidet und dabei ungeliebt. Vor allem hat er schwere Träume, knirscht die ganze Nacht mit den Zähnen und wacht gegen Morgen mit Angstzuständen auf. Das wird sich geben, denn er hat sich eine einmonatige Radikalkur verordnet: Kein Wort über Politik, Wirtschaft oder Finanzen! Nicht einmal denken will er an die Arbeit. Schon aus Vorsichtsgründen, denn wer denkt, macht auch Notizen, und die kommen oft in falsche Hände. Also wird er nichts notieren, was Rückschlüsse auf Klienten und Geschäftswege erlaubt. Alle Termine hat er abgesagt, fast alle: Eine Festrede vor Optionsschein-Emittenten in Frankfurt am Main ist geblieben, aber für die wird er sich nicht überanstrengen.
Am Ende der Reise dürfte er gut erholt sein, ja so etwas wie glücklich, wenn –? Ja, wenn.
Weiter mit der Bahnfahrt. Ich kriege nicht allzuviel mit. Wer zugleich reist und schreibt, nimmt nur etwa alle zwei oder drei Minuten etwas wahr. Bis Bahnhof Zoo so gut wie nichts gesehen. Dort blicke ich auf, weil so viele zusteigen. Ein dicker Mann mit stechendem Blick (kennt er mich?) und eingebundener Hand (gebrochen?) sucht seinen Bauch durch schlechte Körperhaltung nach innen zu verlegen, er krümmt sich über ihm zusammen. Das verbirgt nicht viel – gut, es kommt auf den Bauch an. Ich trage meinen, wo er hingehört, eingerahmt zwischen bestickten Hosenträgern, das heißt man den Bauch mit Fassung tragen. Kann es aber immer noch nicht vermeiden, Männer meines Alters mit scheelem Blick zu streifen, wenn sie es wagen, gertenschlank zu sein. Hinter offensiver Schlankheit vermute ich eine besonders raffinierte Art von Dicke – eine innere! Eine als Fitneß daherkommende Wampe aus selbstgefälliger Moral.
Lehrter Stadtbahnhof. Fühle mich beobachtet, aber von wem? Das Wort »Weiberhaushalt« dringt an mein Ohr, in einem genuschelten Satz, der mit dem Seufzer »Der Sommer ist vorbei« endet. So viel über Hörgeräte, sie vermehren die Zahl der rätselhaften Sätze, statt sie zu verringern. Eine müde Frau in müder Kleidung, die zum Fenster hinausgesehen hat, birgt plötzlich das Gesicht in den Händen. Als sie es wieder freigibt, ist sie zum Mord entschlossen, der Blick kalt, die ganze Person ein vielstöckiges Rachegebäude.
Am Reichstag eine Art Baubrücke über die Spree, mit spinnenartigen Knickebeinen. Bahnhof Friedrichstraße. Gerüste, wohin man sieht. Die Fenster von S-Bahn-Wagen werden jetzt mit Glasschneidern zerkratzt, ein Künstler namens »KRR« hat hier kaum eines ausgelassen. Am Hackeschen Markt weist ein Schild auf eine Ausstellung hin: »Die Wüste ist in uns«.
Schon wieder denke ich daran, daß ich schwachsinnig werden könnte. Menschen, die diese Sorge haben, werden ja sehr oft wirklich schwachsinnig, haben also Grund zur Sorge, wodurch diese noch größer wird, wodurch wiederum –! Mein Schwachsinn ist unvermeidlich.
»Herr Reuter!« wird die Krankenschwester vorwurfsvoll sagen. »Ich habe versucht, das zu lesen. Warum haben Sie denn so vieles doppelt geschrieben, mal mit Ich und mal mit Er? Es ist – durcheinander!«
»Deshalb bin ich hier«, werde ich antworten, »ich selbst bin durcheinander. Ich kann mich zwischen Ich und Er nicht entscheiden. Krankmachende Unentschlossenheit. Buridans Esel.«
»Aha. Und einmal schreiben Sie: ›Ich habe mich umgebracht.‹ Sie leben doch!«
»Es ging nicht anders.«
»Ich muß das dem Arzt zeigen!«
»Es wäre sinnlos«, werde ich antworten, »Ärzte gehen zuwenig aus sich heraus.«
Ich habe sieben Operationen hinter mir und eine Steuerprüfung. Das Älterwerden hat Vorteile. Man sieht einem Arzt oder Steuerberater binnen Sekunden an, was von ihm zu erwarten ist.
Nur bin ich ein bißchen aus dem Tritt gekommen und innerlich gealtert. Man will mir helfen, vor allem Frauen wollen mir helfen, damit ich nicht doch irgendwann in Wehleidigkeit, Unrasiertheit, Suff und unbezahlten Rechnungen untergehe. Sie versuchen mich zu erhalten, denn ich gehöre zu ihrer Umwelt. Keine Sorge. Geld schützt ziemlich lange vor der Wahrheit und dem Lärm um sie.
Die Ichform produziert Peinlichkeiten. Schreibt jemand: »Ich bin aus dem Tritt gekommen, ich bin gealtert«, dann denken wir: Der Arme, es muß ihm schwerfallen, das zu bekennen. Mutig, gewiß, aber was soll man da antworten?« ICH eröffnet ein Gespräch mit einem DU, es will Antwort. Jedes ICH neigt dazu, uns etwas vorzujammern und Mitleid zu erpressen. Lesen wir ER, können wir gelassen bleiben. »Es war einmal ein Mann« – eine Geschichte von einem älteren Herrn in Schwierigkeiten, na und? Wir vergleichen kurz die Eckdaten und fühlen uns in jedem Fall jünger als er.
Ole Reuter war nahe Fünfzig, »nahe« von der anderen Seite, also einundfünfzig. Er trug Jeans, um sich von seinen Auftraggebern zu unterscheiden, darüber wehte ein Zweireiher von Armani, den er offen trug wie ein Politiker. Seine Spreizfüße steckten in Maßschuhen, deren Preis nur von Empfangschefs richtig geschätzt wurde, und am Handgelenk trug er eine vierunddreißig Jahre alte Mido »Ocean Star«, Selbstaufzug durch die Körperbewegungen, vermutlich die schönste Uhr aller Zeiten. Ole Reuter liebte Schönes, anmutige Gesichter, Körper von Ebenmaß. Vor Jahrzehnten hatte er oft sich selbst angesehen und für »einigermaßen unwiderstehlich« gehalten. Geblieben war davon, nach jahrelangen Freß- und Sauforgien, nur der verzweifelte Versuch, seinen Wanst, seine wäßrigen Augen und sein Prälatenkinn hinter allerlei gekaufter Schönheit zu verschanzen, von der Büroeinrichtung bis zur »klassisch-eleganten« Brille. Wenn er lächelte, dann mit Jacketkronen, die weder zu groß noch zu weiß waren, ein etwas steinernes, aber makelloses Grinsen. Es paßte, davon war zumindest er selbst überzeugt, zum findigen Berater, zur Unbefangenheit des typischen jüngeren Bruders, zur kontrollierten Aggressivität des Skorpiongeborenen, und daß er all diese Eigenschaften besaß, glaubte er fest. Oder hatte es bis vor kurzem geglaubt. Denn neuerdings waren Zweifel und Sorgen über ihn gefallen. Sie bescherten am hellen Tage Hypochondrien, Höhenkrankheit, Gleichgewichtsstörungen, Verfolgungsangst, Impotenz aus Überzeugung (alles Genannte immer auch in intellektuellen Varianten). In der Nacht wurde es noch ärger: ausweglose Träume, nach dem Aufwachen um etwa drei Uhr Klaustrophobien sowie abwechselnd Todesangst und Selbstmordwünsche. Er versuchte sich durchzukriseln, dies und jenes zu verbessern, aber in den Nächten war ihm klar, daß er sich verlaufen hatte, nicht anders als die Welt um ihn herum. Gegen Morgen fürchtete er ganz zu verschellen oder – die Präsensformen des Verbums »verschellen« sind dahin – sich und anderen abhanden zu kommen.
Als Kind, in den Wäldern östlich des Starnberger Sees, hatte er sich nie verlaufen. Im Wald hatte er jederzeit gewußt, woher er kam und wohin er wollte. Erst in Vaters Firma verlor er die Orientierung, irrte durch endlose Gänge voll hastiger Leute und weinte herzbrechend, bis einer der Ingenieure ihn in das Büro von Papa brachte. Der schaute ihn kopfschüttelnd an, die Füße wie üblich im Papierkorb, und fragte sanft: »Du bist doch ein kluger Junge, was gibt es zu weinen?« Papa verkörperte den Zusammenhang des Wortes »Ingenieur« mit »Genie« und wurde nicht müde, auf diesen hinzuweisen. Jeder Ingenieur, auch wenn er klein war, fand mit Leichtigkeit Lösungen und Auswege. Und allemal den Rückweg.
Das merkte Ole sich, es wurde zum Programm. Sein ganzes Leben lang arbeitete er weiter daran, immer den Ausweg aus mißlichen Lagen zu finden, aus Spielen, die er nicht gewinnen konnte, aus Situationen, in denen andere mehr über ihn wußten als er über sie – irgendwann traten solche Situationen nicht mehr ein. Was wußten die Gegner über den Mann mit den labyrinthisch vielen Eigenschaften und Berufen? Er war eine Schachtel in der Schachtel in der Schachtel, wer ihn suchte, verirrte sich in all der Pappe. Um so mehr Kontrolle gewann er selbst über andere, er entwickelte ein Kampfgedächtnis, Vorbild: Fouché. Ein gefährlicher Mann, dem nichts passieren konnte, solange er sich nicht in sich selbst verhedderte. Denn hin und wieder hatte er Anfälle von cholerischer, nicht mehr zu bremsender Wut gegen einzelne oder ganze Gruppen von Menschen, hieb die Faust auf den Tisch, spitzte Wörter zu und versuchte sie jemandem ins Herz zu stechen, den er gerade haßte. Wortlos war seine Wut nie, nicht einmal grundlos. Aber sie war ohne Nutzen und im nachhinein bemerkenswert peinlich. Ole Reuter zuckte zusammen, wenn ihm solche Ausbrüche wieder einfielen, manchmal stöhnte er laut auf.
»Umbaubedingt« fahren nur sehr wenige Züge vom Hauptbahnhof ab. Erst in einer Stunde gibt es einen über Cottbus nach Frankfurt an der Oder. Ich schlendere herum. Ein Backwarenkiosk pustet einladende Fettdüfte ins Publikum, ich nehme eine Käsebaguette, dann eine Schinkenbaguette, dann suche ich vergeblich nach einem Glas Wein. Als ich dies mürrisch aufschreibe, verweigert mir der Filzstift, ohnehin ungeliebt, den weiteren Dienst. Ein Fingerzeig. Ich sollte umkehren und mich daheim zum Italiener setzen. Morgen dann zurück in die kühlen Konferenzräume. Ich will es davon abhängig machen, ob hier ein Bleistift zu bekommen ist. Wenn nicht, fahre ich zurück. Dann kann ich wenigstens den Eröffnungsvortrag für Frankfurt am Main vorbereiten.
Kein Bleistift im Zeitungsladen, die Verkäuferin will mir ihren eigenen »leihen«, also gleich wieder zurückhaben. Aber auf der Galerie gibt es einen Laden »Reisebedarf« und dort einen Stift. Er ist eigentlich eine Röhre, in die man kleine, in Plastik eingefaßte Minenstückchen ein- und nachschieben kann. Ist das vorderste abgeschrieben, steckt man es hinten hinein und bringt damit vorne das nächste, unverbrauchte Stück zum Vorschein. Made in Taiwan, 1.50 DM. Das Ding heißt »Camouflage« und hat militärische Tarnfarbe. Das letztere leuchtet ein: Man lasse niemals Bleistifte in die Hand des Gegners fallen! Ich werde, ausgestattet mit felddiensttauglichem Schreibgerät, die neuen Bundesländer besichtigen. Kaufe mir auch ein Deodorant und Papiertaschentücher.
Stiche in den Knien. Aber ich muß ja ein Held sein.
Steige ich in die erste Klasse oder suche ich Gespräche? Kein langes Fackeln jetzt, in der Ersten sitzen die, die es sich etwas kosten lassen, ungestört zu bleiben, zu denen gehöre ich längst. Es gibt ein Tischchen für meinen Laptop. Ich schreibe ins Heft: »Ab hier weiter auf Diskette.«
Mit zehn Fingern schrieb er: »Die Eisenbahn verschafft uns einen melancholischen, gleichwohl behaglichen Blick aufs Vaterland. Der Schaffner bringt kühlen Wein. Im sattgelben Kornfeld steht eine Herde Glockenblumen. Man lebt.«
Ich lebe, aber nicht so bahnvergnügt wie 1976. Die Natur begeistert kaum, sie erinnert nur ab und zu (schwach) an jenen Ole, der sich vor zwanzig Jahren mit ihr verwandt fühlte. Damals fiel mir zu jeder Glockenblume irgend etwas ein, was ich in der Welt vollbringen könnte, vor allem, wenn ich aus dem Zugfenster, ja wenn ich nur ins Kursbuch schaute! Schon als Kind phantasierte ich mich in die vorüberziehende Landschaft hinein, war der Riese auf dem Berge, der Fahrer des Cadillac, spielte zum Takt der Gleisfugen virtuose Musik und war genauso schnell wie der Zug, in dem ich saß, denn ich war der beste Radfahrer und Läufer der Welt, fuhr oder lief neben dem Zug her, überwand auftauchende Hindernisse blitzschnell und mit Glück (im Tunnel wurde es zu eng, ich mußte droben über den Vogelsberg spurten). Als junger Erwachsener war ich immerhin Besitzer all der Kornfelder, Villen und Fabriken, manchmal erkannte mein Personal mich am Zugfenster und winkte mir zu. Irgendwann – ich war über vierzig und versuchte mich gerade im Zugrestaurant am »Leitfaden durch das Wertpapiergeschäft« von Dieter Ungnade – stellte ich fest, daß die Musik von damals nicht mehr zu hören war, daß das Spiel nicht mehr gelang. Heute habe ich die Gegenstände der Sehnsucht, die sich einst um Kornfelder, Heuschober, Glockenblumen gruppierten, vergessen. Ich habe andere Freuden entwickelt, von Wertpapieren abgesehen. Etwa die Kunst »to make others feel like shit«. Wobei mir wieder die K. einfällt.
Pech: ich habe im Hauptbahnhof die Plastiktüte mit den Taschentüchern und dem Deodorant stehen lassen, und – natürlich hatte ich das Diktiergerät kurz zuvor dort hineingesteckt. Neues enthielt das Band noch nicht, nur erledigte Erledigungspunkte und zweifelhafte Zornesoder Beruhigungssätze, zur Nachtstunde für gut befunden und ins Dunkle geflüstert, um Judith nicht zu wecken. Nein, ich fahre deswegen nicht zurück, dann wäre die Reise vorbei und ich säße beim Italiener. Das Allerweltsgerät für 69, – DM gibt es auch in Frankfurt an der Oder. Dennoch, ein Stück Besitz, verschlampt, vergeigt – ein neuer Kratzer im ohnehin matt glänzenden Selbstbewußtsein.
Müdigkeit. Hätte nicht die letzte Nacht am Computer verbringen und »Myst« spielen sollen. Aber ich hatte Angst vor der Nacht. Zwar schlafe ich stets rasch ein, aber dann beginnen die Traumkatastrophen. Das Unglück setzt sich beim Aufwachen um drei oder vier Uhr mit der bleiernen Gewißheit baldigen Todes fort. Gegen sechs läßt sich mein schmähliches Ende wieder um ein paar Wochen, gegen acht Uhr sogar um Jahre hinausschieben. Ich bezahle nachts für etwas, was ich falsch gemacht haben muß, bezahle reichlich, halte eine ganze Runde von Teufeln frei. Strafe, wofür? Wer straft? Und wie um Gottes willen bringe ich es zu ermutigenderen Träumen? Kann man vielleicht den Tag so leben und steuern, daß die Nacht stärkt und nicht zermalmt?
Woher stammt der Satz: »Was spricht die tiefe Mitternacht?« Irgendein Gedicht. »Lenore fuhr ums Morgenrot empor aus schweren Träumen« kann es kaum sein. Eine Frage, ich drehe zum Notieren das Heft um. Und jetzt möchte ich, wie in den alten Zeiten, genüßlich im Kursbuch – peng, das war’s, was ich vergessen hatte! Ich merkte etwas später, daß dies geschehen war, vergaß aber dann, daß ich’s gemerkt hatte.
1976 war Ole Reuter erstmals mit Netzkarte einen Monat lang in der Bundesrepublik Deutschland (damals war auch sie noch recht schlank) nach Zufallsprinzip kreuz und quer gefahren. Fast zwanghaft hatte er alles niedergeschrieben, was ihm auf- oder einfiel, und schon damals rätselte er, warum er sich überhaupt auf diese Verrücktheit eingelassen hatte, fand gegenüber jedem neuen Gesprächspartner eine andere Erklärung – Aufbruch, Flucht, Selbstfindungsversuch, Nostalgie, erotischer Nachholbedarf, Verstandesschulung durch ungestörtes Herumgrübeln. (Ole Reuter gab seit der Pubertät die Hoffnung nicht auf, durch raffinierte Übungen oder besondere Lektüre ein anderer und Besserer, dazu mächtig zu werden.) Oder war die Fahrt ein traurig-alberner Blödsinn, mit dem er sich vom Einfluß seines 1976 eben verstorbenen Vaters zu lösen versuchte? Witze, Kalauer zumal, sind oft nur die schiefmäulige Revolte gegen Logik, Vernunft und – Väter. Aber die Reise war auch eine Befreiung: In irgendeinem Moor zwischen Bayern und Übersee strömten seine Tränen, er trauerte um den geliebt-gehaßten Vater, der ein großer Erfinder gewesen war, zugleich auch ein Verklemmter, heillos Gepanzerter, ein Tyrann, in dem sich Wärme nur mit List, auf dem Umweg über technische Fragen, entfachen ließ.
Aber schon als Ole Reuter den Trauerkloß noch im Hals hatte, tat die Reise ihre seltsame Wirkung: Die Welt begann neu zu riechen und zu schmecken. Plötzlich schien alles möglich, jede Verweigerung, jede Frechheit. Er empfand zunächst wie ein Darsteller, der die Eitelkeit als Motor entdeckt: Seine Person schien ihm jetzt möglich, ja interessant. Mit Glück wurde er alles Mögliche. Dazu lernte er in Köln die siebzehnjährige Judith kennen, die beim Sprechen mit den Augenlidern klimperte und das rechte immer eine Spur länger geschlossen ließ als das linke, wodurch etwas Schelmisches in alles hineingeriet, was sie sagte. Tatsächlich meinte sie es sehr ernst, und der Ernst reichte für Jahrzehnte. Im Rest der unerwartet liebenswerten Republik fand Ole Reuter ein paar Gesichter, die wenig sprachen und ihn dadurch ermutigten. Da gab es eine Telephonistin (oder war sie Stenotypistin?) aus Stade (oder Oldesloe?), eine Malerin, die ihn nackt malte, einen Aufnahmeleiter mit vor Scharfblick rötlich glitzernden Augen, ferner einen alten Mann in Treuchtlingen, der aussah wie ein Revolutionär. Wirklich glückliche Momente blieben in Erinnerung und Bilder, auch solche der unverwirklichten Phantasie – da war etwa eine Bäkkerstochter in einem Ort, eher einem Fahrplan-Fund namens Jerxheim. Nie hat Reuter diese Frau getroffen, nie hat er sie vergessen. Nun muß man sagen, daß auch der erwachsene Ole zeitlebens die magischen Gewißheiten des kleinen Jungen nicht ablegte: Was er phantasierte, wurde Wirklichkeit. Sobald er haßte, starb jemand, und wo immer er Berater war, traten Erfolge ein. Seit den Netzkartenreisen war alles gewachsen: sein Glück, seine Treffsicherheit (ununterbrochen fielen ihm Botschaften aus dem Ärmel, von anderen gierig aufgelesen), er war offen für Wagnisse mit anstrengungslosem Gewinn. Er verbrachte ein Jahr in Amerika, ritt Pferde und Drehbücher zu, entdeckte die Ratlosigkeit der Manager. Sein älterer Bruder führte die Münchener Firma, Ole erhielt regelmäßig Zahlungen ohne Gegenleistung, und was immer seine Fehler sonst sein mochten, er nahm Geld ohne jede Hemmung. Judith kehrte, nach Konflikt und Trennung, 1981 mit Erfahrungen und neuer Sicherheit zu ihm zurück. Sie war eine Fünfminutenfrau: Jede Freude wußte sie mit dem Satz »noch fünf Minuten!« zu verlängern. Fünf Minuten waren immer möglich, und danach noch einmal fünf Minuten, so verstand sie zu leben. Sie aß gern und schlief gern (mit einem zarten Zwergenschnarchen, das Ole mit Entzücken hörte und herzlich liebte). Was immer sie tat, tat sie gern, denn es fiel ihr nicht ein, etwas anderes zu tun. 1977 kam eine Tochter zur Welt: Es gab nun zwei Fünfminutenfrauen, nur war Karoline achtzehn Jahre jünger und noch sehr rund. Ole Reuter konnte nichts passieren, er behielt, behütet vom Schlaf seiner Frauen, auf Jahre den Überblick.
Ja, ich will es wieder probieren! Die Reise von 1976, verrückt und ratlos wie sie war, hat mir Tag um Tag mehr Vertrauen gegeben. Fahren und alles aufschreiben, per »ich« und auch damals hin und wieder per »er«, das half weiter. Aber was damals Geschenk war, muß diesmal Rettung sein. Moment, Reuter, übertreiben Sie da nicht?
Schluß mit dem Thema. Ich weiß nicht ganz genau, warum ich reise, aber zweierlei Gründe sind auszumachen: große Sorgen, die sich nur durch Abwarten erledigen lassen, und Ermüdungserscheinungen, Gedächtnis inbegriffen, denen Abwechslung guttun wird.
Dazu Leiden, die ich nur zum Teil begreife. Dicke Füße. Atemnot. Gelenkschmerzen. Hüsteln. Blähungen. Die Fingerspitzen wären zum Blättern im Kursbuch kaum noch fähig, weil sie eine Art Ausschlag haben: Sie pilzen und weißeln, rissig und schuppend. Birkenrindenfinger sind das. Dagegen sollen die Spritzen helfen, homöopathisches Zeug, alle zwei Tage in den Oberschenkel. Ferner diese seltsamen Schmerzesschreie, innerlich, die aber manchmal laut werden. Es ist, was man einen Tick nennt: Irgend etwas reißt mich und tut mir in der Seele weh, aber noch während ich aufstöhne, vergesse ich bereits, was es war. Irgendwelche Peinlichkeiten, Worte aus dem eigenen Mund zumeist, Jahrzehnte zurückliegende Wutanfälle, Kontrollverluste. Sie werden von meiner präzise arbeitenden Erfolgsmaschine verdrängt, aber auch die kann das erste Aufzucken des Erinnerungsblitzes nicht verhindern. Ich komme noch dahinter, wie das zugeht, liege geduldig auf der Lauer. Ich sollte eine Liste führen, um dieses Leiden richtig begreifen zu lernen. Aber das überladene und belästigte, lustlose Hirn findet immer wieder Gründe, diese Arbeit hinauszuschieben.
Wenn ich mir ansehe, was ich per ER über Ole und Judith geschrieben habe, wird mir klar, daß die ER-Form zur Lüge neigt. Kein Wort davon, daß mit mir schwer zu leben ist, daß Judith mit mir nicht mehr glücklich sein kann. Ich müßte es schaffen, ihr die Freiheit wiederzugeben, ohne sie zu verletzen. Im Grunde warte ich darauf, daß sie von selbst genug hat. Aber je miserabler meine Seelenlage ist, desto fester hält Judith zu mir. Irgendwann waren wir so etwas wie glücklich. Ich verstehe vom Glück nichts oder habe, was mir darüber bekannt war, vergessen – groß war meine Bildung nie.
Was nicht nur Nachteil sein muß. Bildung kostet Geld, vor allem wenn man sie hat, sie sorgt für immer teurere Wünsche. Zweitens leiden gebildete Menschen sehr, wenn sie vergeßlich werden.
Alles, was nicht mit Strategie zu tun hat, kann ich mir nicht mehr merken. Nicht einmal die simpelsten Dinge: Der Alkoholtupfer ist vor der Injektion zu benutzen, nicht danach – ich verwechsle es jedesmal. Oder die Uhrzeit: Ich schaue dreimal mit wichtiger Miene auf die Uhr wie ein Schiedsrichter zur neunzigsten Minute, vergesse dreimal, was sie anzeigte. Am vergeßlichsten macht die Angst vor der Vergeßlichkeit. Ich habe vieles, was mir gegen Ängste helfen könnte, gelesen. Aber wo habe ich es dann hingetan, wo ist es?
Ende der Leseprobe