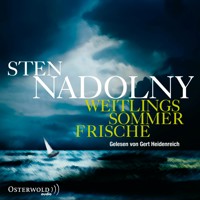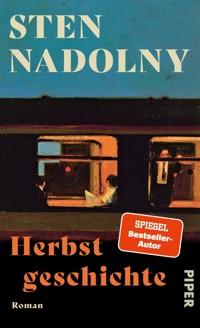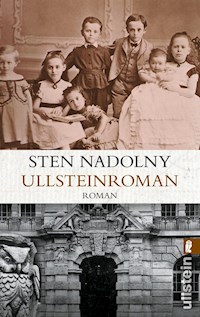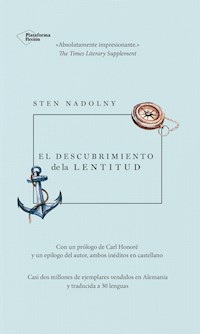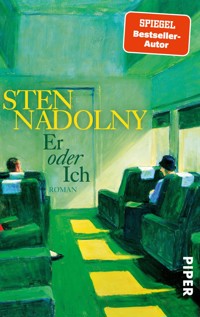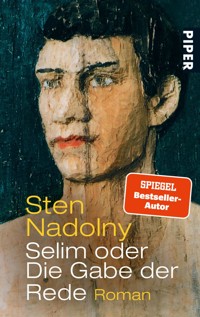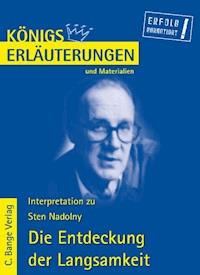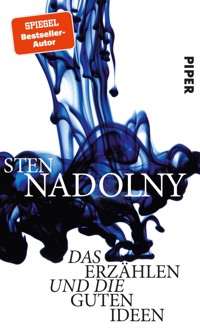
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sten Nadolny, Autor des Weltbestsellers »Die Entdeckung der Langsamkeit«, erteilt in seinen kurzweilig-respektlosen Poetik-Vorlesungen den guten Absichten und Ideen als Basis für Literatur eine energische Absage. Anhand eigener Erfahrungen zeigt er, daß es beglückt, wenn sich der Schreibende dem Stoff überläßt. Ein vergnüglicher Einblick in die Schreibwerkstatt eines großen Erzählers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de/literatur
Die Münchener Poetik-Vorlesung »Das Erzählen und die guten Absichten« erschien erstmals 1990 (Serie Piper 1319).
ISBN 978-3-492-95787-8
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2001
Covergestaltung: Kornelia Rumberg
Covermotiv: irin-k / shutterstock.com
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Cover & Impressum
Vorbemerkung
Das Erzählen und die guten Ideen - Die Göttinger Poetik-Vorlesung (2000)
Erster Abend: Ideen über Ideen
Zweiter Abend: Erzählen und Erfahrung
Dritter Abend: Über den Erzählfluß
Das Erzählen und die guten Absichten - Die Münchener Poetik-Vorlesung (1990)
Erster Abend: Glashütte bis Hautflügler
Zweiter Abend: Jerxheim und die Bäckerstochter
Dritter Abend: Veras Motive
Vierter Abend: Der Zweitleser
Fünfter Abend: Das Buch ist fertig
Anhang
Reden übers Schreiben
Roman oder Leben (1993)
Zeitgemäße Literatur – Wunschziel, Unding, Selbstverständlichkeit (1993)
Was heißt hier Chancen? (1997)
Anmerkungen zu »Das Erzählen und die guten Absichten«
Quellen
Vorbemerkung
Heinz Ludwig Arnold überzeugte mich Anfang 2000 davon, daß zehn Jahre ein guter Abstand seien, um angesichts gewandelter Verhältnisse und meines eigenen Älterwerdens – er nannte es höflich »Erfahrungszuwachs« – noch einmal öffentlich über das Erzählen nachzudenken.
Als der Göttinger Termin heranrückte, steckte ich mitten in den Vorbereitungen zu einem neuen Roman, näherte mich dem Schreiben des ersten Satzes, befand mich im Anflug, sah schon verschwommen die Begrenzungsleuchten der Landebahn – für Vorträge nicht der ideale Moment.
In den Münchener Vorlesungen hatte ich vor dem Einfluß »guter Absichten« gewarnt – vor Relevanzgeboten der Gesellschaft und sonstigem Meinungsdruck bis hin zur political correctness, die man damals bei uns noch nicht so nannte. Das war und ist ein Druck, der auf dem Erzählen lasten und ihm Augenmaß und Balance rauben kann. Was aus ihm, der mir 1990 eine Gefahr schien, geworden ist, habe ich in Göttingen noch einmal gestreift, konzentrierte mich aber vor allem auf das Dreieck Idee – Erfahrung – Erzählen.
Was ist inzwischen in meinem eigenen Leben geschehen? Ich habe die gute Aufnahme meines Romans »Die Entdeckung der Langsamkeit« weiter, oft wie ein staunender Unbeteiligter beobachtet und mir Gedanken darüber gemacht, noch mehr Romane geschrieben und versucht, mit der stiff upper lip des geborenen Fregattenkapitäns zu durchleiden, was sie auslösten. Ich hielt ab und zu Reden oder Vorträge übers Schreiben, weil ich nicht ungern vor Versammlungen spreche – Poetik on demand. Ich operierte dabei zwischen zwei interessierten Gruppen (wißbegierigen Gruppen, nicht Interessengruppen!) der Gesellschaft: den auf Schreiben und Kreativität Neugierigen (da war ich des Erfolges wegen ein Ausstellungsstück), sodann den an Zeitmanagement, Lebensrhythmus, Langsamkeit Interessierten. Was noch? Ich ließ mich auf das Romanschreiben als Beruf endgültig ein und nahm in Kauf, daß diese Hingabe mich dem Publikum nicht immer nur näherbringen mußte.
Was ist »draußen« geschehen, in meinem Land und seiner Gesellschaft? Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten, zunächst euphorisch begrüßt, wurde vom Alltag eingeholt, produzierte allerhand Enttäuschungen und Empfindlichkeiten in Ost und West. Golfkrieg und Balkankrise machten auf sich aufmerksam, mehr noch, erzeugten eine Art Betroffenheits-Infotainment, das mit den Interessen und Zielen der eingreifenden westlichen Exekutiven in vielfältig gemischter Wechselbeziehung stand – Otto Normalverbraucher blieben gemischte Gefühle.
Eine weitere Wechselwirkung bestand zwischen Ausbildungsnotstand, Arbeitslosigkeit und Ratlosigkeit einerseits, Rechtsextremismus, Fremdenhaß und anonymen Attacken andererseits, vor allem in der Provinz. Noch viel mehr wäre aufzuzählen: eine neue Regierung, der Siegeszug der Computer und des Internet, Globalisierung, Verlagssterben – ich höre lieber auf.
Als Hintergrund dieses Buchs ist vor allem der Siegeszug des Ideen- und Kreativitätskults wichtig, der nicht nur Designer- und Managementforen, sondern auch Volkshochschulen und Selbsterfahrungsgruppen erreicht hat. Man müßte einmal feststellen, wie allein der Gebrauch von Begriffen wie »Erfolg«, »Kreativität« oder »Strategie« in den letzten zehn Jahren zugenommen hat. Staunenswert vor allem die von Vernunft, Zusammenhang, Lebensentwurf und »Stoff« im weitesten Sinn abgelöste Überschätzung der »guten Ideen«. Man entgeht bei Gesprächen über Mensch und Menschlichkeit, natürlich auch in denen über Literatur, diesen seltsamen Glaubensbekenntnissen nur noch mühsam.
Das war und ist, denke ich, der am Horizont sichtbare Wolkenhintergrund dessen, was ich in München 1990, dann in einigen darauffolgenden Reden über das Schreiben und schließlich neu in Göttingen 2000 zu sagen versuchte. Ich halte es daher für sinnvoll, daß die ausführlichsten Wortmeldungen in diesem Buch vereint sind – lese sie, wer mag.
Sten Nadolny, im Sommer 2001
Das Erzählen und die guten Ideen
Erster Abend:
Ideen über Ideen
Meine Damen und Herren, als ich die Einladung bekam, ein weiteres Mal über meinen Beruf zu sprechen, waren seit dem letzten Versuch zehn Jahre vergangen: »Das Erzählen und die guten Absichten« war 1990 meine erste Poetik-Vorlesung in München gewesen. Ich nahm die Göttinger Einladung an, weil ich es für möglich hielt, seit meinen ersten drei Romanen etwas dazugelernt zu haben. Dieser Gewagtheit ließ ich eine zweite folgen: Ich entschied mich für einen Titel.
Vortragstitel müssen meist lange vor der eigentlichen Arbeit bekanntgegeben werden, damit Informationsblätter gedruckt werden können. Ankündigungen sind Glückssache, andererseits sind meine Ankündigungen oft schon mein Bestes. In diesem Falle nicht. Ich wählte, weil heute jeder von »Strategie« redet und ich das Wort hartnäckig durch »Navigation« zu ersetzen versuche, den Titel »Navigation des Erzählens« und dachte mir, der passe auf jeden Fall. Sie ahnen, worauf es hinausläuft: Jetzt, da ich nachgedacht und gearbeitet habe, scheint mir der Titel nicht mehr ganz zutreffend. Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens: ich verfehle das Thema. Zweitens: ich interpretiere es auf verwegene Weise um. Drittens und das Ehrlichste: ich nenne ein neues.
Mit den Poetik-Vorlesungen, zu denen Autorinnen und Autoren immer wieder ermuntert werden, ist es so eine Sache. Manchem fällt es leichter, manchem schwerer, über das Schreiben zu reden. Mancher hat sich die gesittete Gedankenführung, sozusagen das Essen mit Messer und Gabel, mit Recht oder Unrecht ganz abgewöhnt. Ich spüre leichte Probleme, wenn ich zum Theoretisieren aus der Arbeit an einem Stoff auftauchen muß (daß ich heute, Dezember 2000, tief in einem solchen stecken würde, wußte ich bei meiner Zusage noch nicht). Wie auch immer: Wenn es gerade darum interessant werden sollte, ist es mir recht, und wenn ich den Faden verliere oder gar nicht erst finde, sehen Sie es mir bitte nach.
Beim Wiederlesen meiner Münchener Bekenntnisse hatte ich den Eindruck, daß ich heute zwar dies und jenes anders formulieren würde, aber alles, was beim Entstehen eines Romans eine Rolle spielt, wahrscheinlich so beschreiben würde wie damals. In diesem Punkt kann das, was ich heute sage, wohl nur Ergänzung sein. Hingegen sind mir die – ironisch so genannten – »guten Absichten«, gegen die ich damals so etwas wie eine Unabhängigkeitserklärung abgab, man kann auch sagen: die political correctness, für mich heute weniger bedrohlich. Ich denke nicht mehr angestrengt darüber nach, wer meine Sachen für löblich halten könnte und wer nicht. Also stört mich der Faktor auch weniger. Daß er nach wie vor Einfluß hat und Erzählwerke mit unliterarischen Verpflichtungen befrachten kann, läßt sich dennoch nicht bezweifeln.
Was mir heute aktueller und bedenkenswerter erscheint (und keineswegs nur bei der eigenen Arbeit), ist das Schielen nach sogenannten guten Ideen. »Gut« soll auch hier eher ironisch klingen. Ich meine damit solche, die etwaigen Auftraggebern, Verlegern und Produzenten – ab und zu auch mir selbst – »in die Landschaft zu passen« und Aufmerksamkeit zu versprechen scheinen, Auflagen, Quoten, nette Besprechungen auch, und zwar weil sie auf einem mehrheitsfähigen Niveau Unterhaltungserwartungen wecken und befriedigen könnten.
Wenn wir im Alltag von einer guten Idee reden hören, ist in der Regel entweder etwas Praktisches gemeint, eine Vereinfachung, Abkürzung, Problemlösung – oder es ist eine Geschäftsidee, die in die Landschaft paßt. »Landschaft« bezeichnet mittlerweile, insbesondere in Zusammensetzungen, oft eine strategische Lage oder einen Markt. Betrachten wir speziell den »Erzählmarkt« (das häßliche Wort darf ruhig ein wenig irritieren), dann hängt das, was ich mit »guten Ideen« meine, wohl mit den Bedürfnissen und Glaubenssätzen der »Medienlandschaft« zusammen, mit Unterhaltung um jeden Preis, mit »Entertainismus«. Letztgenannten Begriff habe ich neulich in einem Artikel gelesen und finde, er läßt sich hin und wieder schön boshaft verwenden, etwa gegen die Ansicht, Literatur habe in erster Linie leicht verständlich und ein Lesevergnügen für jedermann zu sein.
Von dieser Art Ideen will ich natürlich die echten, wirklich guten oder schlicht hervorragenden Ideen trennen! Oder aber bei Platon Hilfe suchen, in dessen Ideenlehre es »gute« Ideen nicht gibt, nur eben »die« Ideen. (»Gute Ideen« gibt es auch bei anderen Philosophen kaum, allenfalls den Engländern sind sie immer zuzutrauen.)
Es geht mir aber nicht nur einfach um Anspruch und »Höheres«, sondern um die eigene, also nicht von Entertainer-Ideen oktroyierte Fortbewegungsart des Erzählens und der Literatur. Insofern möchte ich dann eben doch irgendwie – mutatis mutandis – von einer Navigation des Erzählens sprechen, aber nicht in dem Sinne, daß der Erzähler der Navigator sei. Sie sehen, jetzt kommt doch noch ein kleiner Versuch der Uminterpretation des bereits ersetzten Vorlesungsthemas.
Es könnte, so die Behauptung, ja wirklich eine navigatorische Logik geben, die vom System »Erzählen« selbst, in eigener Sache, angewandt wird, und zwar im Umgang mit der Welt, mit den Erzählern, dem Publikum und sich selbst. Die These wird uns zwar irgendwann wieder im Stich lassen, vielleicht aber bis dahin ein paar Gedanken anregen. Demnach navigiert sich die Literatur selbst, lenkt die Bearbeitung von Stoffen, sucht sich Leute aus, die dann als die Erzähler und Urheber auftreten und das zwecks Lebensunterhalt auch dürfen sollen. Nur das Erzählen selbst kennt seine Interessen und Bedürfnisse genau, es hält sich durch richtige Mischung aus Bewahren und Verändern in guter Form und im Geschäft. Und es könnte ja sogar geschäftlich nicht uninteressant sein, der Bewegungsweise des Erzählens selbst einfühlsam zu folgen.
Ein deutscher Drehbuchautor, den es nach Hollywood verschlagen hatte, erhielt einmal weit nach Mitternacht den Anruf eines mächtigen Produzenten, mag er Goldwyn, Meyer, oder Selznick geheißen haben: »Kommen Sie herüber, ich habe eine gute Idee!« Benommen und fröstelnd, aber neugierig eilte der Autor zum Mogul, der mit Denkerstirn in seinem Sessel saß, vom Kaminfeuer beflackert, ein Glas Whiskey in der Rechten, einen großen flauschigen Rassehund zur Linken, den er kraulte. »Also, was ist es?« fragte der Autor und ließ sich nieder. Der Magnat nahm einen Schluck und kraulte weiter, bevor er das bedeutende Wort aussprach: »Zigeuner!« Der Autor war sprachlos. Der Herrscher sah ihn erwartungsvoll an: »Wie finden Sie’s?« Und fügte mit einer wedelnden Handbewegung hinzu: »Musik, Tanz, Pferde, Leidenschaft!« Der Autor fand die Sprache wieder, bat um einen Whiskey und sagte gedankenvoll: »Klingt gut!«
Die gute Idee, die Klingt-gut-Idee, besteht hier darin, daß eine Richtung angegeben wird, und dafür genügt ein Wort. Heute hieße so eine Richtungsangabe vielleicht »Internet«, »Graffitisprayer« oder »Extremsport«. Es zeichnet die Klingt-gut-Ideen aus, daß sie sich das Bedürfnis nach Geschichten zunutze machen wollen, ohne auch nur danach zu fragen, wie das Erzählen bei diesem oder jenem bestimmten Stoff zu Werke gehen muß. Für emotionalen Klimbim und Spannung und Bedeutsamkeiten zu sorgen wird zur handwerklichen Frage. Daß Hollywood damit packendes Starkino machen konnte und kann, ist offenkundig. Interessant wäre auch die Frage, was es damit nicht kann.
Es gibt inzwischen eine große Zahl von Anleitungen, auch von Seminaren, Schreibschulen oder Drehbuch-Workshops, die uns damit vertraut machen, wie man mit Erzählen viel Geld verdienen kann. Während erfahrene Autorinnen und Autoren meist raten, nur entweder Literatur oder Vermögensbildung ins Auge zu fassen, wächst die Zahl der Cleveren, die uns von plot, pitching, creative writing und vom leicht erlernbaren Bestsellerschreiben erzählen. Da schwappen gewiß Macher-Gesichtspunkte aus anderen Branchen herüber. Ich habe einige solcher Anleitungen gelesen und festgestellt, daß die Größe des Projekts Literatur sich sogar in solchen Anleitungen widerspiegelt – keiner, der sich mit Literatur beschäftigt, kann den Ozean zum Ententeich machen. Erzählen ist nicht nur eine Frage von Kniffen und Pfiffigkeiten, das erkennen auch die Ratgeber. Also wird man Brauchbares auch in solchen Büchern finden. Schaden können sie allenfalls dadurch, daß sie eilige Hoffnungen erzeugen.
Das Thema, über das ich sprechen will, heißt also: »Das Erzählen und die guten Ideen«. Und natürlich will ich nicht nur über Klingt-gut-Ideen, sondern auch über wirklich gute Ideen sprechen – die nenne ich ab jetzt zur besseren Abhebung auch »Erzählchancen« und werde noch erklären, wie das gemeint ist.
Ich will auch den einzelnen Vorlesungen Titel geben: am heutigen Abend »Ideen über Ideen« und morgen »Erzählen und Erfahrung«. Den Titel des dritten Vortrags wage ich noch nicht festzulegen – womöglich muß ich in ihm einiges wieder zurücknehmen.
Letzte Vorüberlegung: Ich frage mich, ob ich nun fast in jedem Satz von »Ideen« werde sprechen müssen. Es gibt ja auch Regungen, Einfälle, Eingebungen, Erkenntnisse, Vorstellungen, Muster, Visionen, es gibt den Wahn und den Begriff. Aber keine dieser Vokabeln ist ein genaues Synonym für »Idee«.
Idee, das ist ein Bild von einer Sache, einem Zusammenhang, einer Möglichkeit des Handelns oder Schreibens. Ein Bild, eine Idee wird vor allem gesehen und kann sprachlich abgegrenzt, sozusagen gemalt und gerahmt werden. Regung und Einfall sind spontaner, sie stellen sich ein, ohne schon ein Bild dessen zu geben, was daraus werden könnte. Sie sind oft etwas Erfreuliches, eben wegen der Spontaneität, und machen Gespräche lebendig. Nützlich sind sie auch, wir lernen durch sie Menschen kennen, und sogar dem Psychoanalytiker sind die Einfälle des Analysanden bei weitem wichtiger als seine Ideen (diese nennt er Rationalisierungen). Eine »Eingebung« ist wieder etwas anderes, scheint mir ohne Gott oder wenigstens Gottheiten nicht denkbar, die uns was flüstern. Gäbe es eine Gottheit des Erzählens, wäre das Wort gut zu verwenden. »Erkenntnis« ist Idee insofern, als sie ein neues Bild herstellt. Eine Idee ist aber nicht schon Erkenntnis. Die Idee ist unabhängiger von einer »realen« Grundlage, von Wirklichkeits- oder Wahrheitsbegriff.
Es wird hier also doch oft von »Idee« die Rede sein müssen. Vielleicht gelingt es, die ärgste Monotonie zu vermeiden: Erzählerische Ideen lassen sich in bestimmten Fällen auch »Figur«, »Stoff« oder »Handlung« nennen – am besten wird das in Negativaussagen über ein Erzählprojekt sichtbar: Da wird dann etwa gesagt, ein Exposé enthalte keine (tragende) Figur, da sei kein Stoff zu erkennen oder keine Handlung – und das Fazit lautet: Wo ist die Idee? Oder im Jargon der Geschäftsleute des Erzählens: »Ich seh’ die Kurve nicht!« Dies war auch der nächste Satz des Drehbuchautors in jener Nacht in Hollywood – er selbst hat es so erzählt.
Ich will das ein wenig unter dem Mikroskop anschauen: Wie kommen wir überhaupt zu Ideen? Ich frage nicht: zu guten, schlechten, hohen oder praktischen, zu Klingt-gut-Ideen oder Erzählchancen. Sondern einfach zu Ideen, deren Echo etwa sein könnte: »Ja, so könnte man es versuchen.« Oder: »Ja, das sollte man wirklich mal schreiben.« Oder: »Stimmt, so könnte das alles zusammenhängen.«
Ideen entspringen aus bemerkenswert vielen Quellen. Fast jeder Autor sammelt in irgendeinem Pappkarton Notizen, aus denen vielleicht, später einmal, etwas werden könnte. Um zu Beispielen zu kommen, öffne ich also die eigene Seemannskiste, in der sich Ideen, daneben auch Ideen über Ideen befinden, ein ziemlicher Haufen Papier. Und bei der einen oder anderen Notiz werde ich mich daran zu erinnern versuchen, wie es zu ihr gekommen ist.
Beobachten wir einen Menschen, der gerade eine Idee hat. Sich selbst beobachtet man in dem Moment, wenn sie über einen kommt, kaum. Da geht ein Leuchten über das Gesicht, und der Beobachtete ruft: »Ich hab’s!« Meist folgt eine Enttäuschung, weil die Zuhörer die Idee nicht »sehen«, vielleicht haben sie nicht einmal zugehört, jedenfalls bezweifeln sie den Erfolg. Eine gute Idee ist immer die, aus der etwas werden kann – und aus dieser, meinen sie, könne nichts werden. Deshalb lächeln sie milde und sagen: »Klingt gut« – sie haben eigene Ideen. All das schmälert aber nicht das Glück des ersten Augenblicks, in dem man eine Idee »sieht«.
In welcher Situation passiert das? Oder in welcher ist es am wahrscheinlichsten?
Selten dann, wenn jemand mit gefurchter Stirn vor einem weißen Blatt Papier sitzt. Diese Situation ist ziemlich aussichtslos. Die Muse küßt im Grunde gern, selten aber die, die sich Ideen erhocken und erbrüten wollen, das ist ihr zu unerotisch.
Es könnte aber eine Geschichte so anfangen: Der Schriftsteller und Ich-Erzähler sitzt und grübelt, in seinem Kopf passiert leider gar nichts, aber es passiert doch etwas – um ihn herum. Vielleicht klingelt das Telefon: »Es ist alles verloren, alles entdeckt, fliehen Sie, solange Sie können!« Er hastet nach den Koffern, packt, flieht und entgeht gerade so seinem Schicksal am allerwenigsten, er kann das Buch vor seinem Ende gerade noch fertigschreiben – ich war versucht, mein letztes Buch so beginnen zu lassen, fing dann aber doch anders an.
Oder: einer belauert verzweifelt das leere Papier und stellt dabei fest, daß es eine eigentümliche Farbe hat, dreht es um, und da steht etwas, rätselhafte Sätze von einer Hand des 18. Jahrhunderts. Das Rätsel lösend, schreibt er die Geschichte von der Lösung des Rätsels, sagen wir: dreihundert Seiten (im Titel müßte, finde ich, der Name »Saragossa« vorkommen).
Es gibt, ich glaube in bestimmten Gruppentherapien, das »propriozeptive Schreiben«. Wenn ich den Informationen aus dem Internet trauen kann, soll bei diesem Vorgehen nichts geplant und konstruiert sein, alles wird hingeschrieben, wie es herauskommt – die erste Regung führt direkt zum Schreiben. Ich habe leider kein Beispiel für das Ergebnis gefunden. Aber ebenso wie professionelle Legasthenie Werbeslogans erzeugt oder die mangelhafte Beherrschung der deutschen Sprache Texte von preisgekrönter Kreativität, so könnte auch hier Ulkiges und Putziges entstehen: Alles hinschreiben, nicht gefackelt, und Zufallsfindungen sind fast sicher. Ob bei solchem Alleshinschreiben, wegen der fehlenden Kontrolle, so etwas wie die unverstellte Wahrheit herauskommt oder wenigstens Ehrlichkeit, weiß ich nicht. Vielleicht hin und wieder, aber man braucht dann wohl einen guten Interpreten, der man nicht selbst sein kann. Eine nicht unwichtige Frage bleibt: Will es sonst noch jemand lesen?
Der Ausdruck »propriozeptiv« kommt, sagte man mir, aus der Orthopädie und betrifft dort Knorpel und Gelenke. Es gebe Bewegungen, die dem Zustand des Knochengestells angemessen, zum Beispiel langsam genug seien, und andererseits aufgenötigte Anstrengungen, die die Propriozeptivität des Gelenks überforderten, den Knorpel zermürbten – ein Problem etwa von Leistungssportlern. Propriozeptives Schreiben ist also vermutlich gesund und völlig unschädlich. Es entsteht ein Kaffeesatz von wahllos Hingeschriebenem, er begeistert, so vermute ich, alle leidenschaftlichen Kaffeesatzleser, aber ab und zu hakt sich doch etwas Brauchbares fest, ganz zufällig, gerade weil man schreibt, was man gar nicht schreiben wollte. Weiß jemand Genaueres über propriozeptives Schreiben? Nein? Ich denke jedenfalls, daß man es nicht zu Hause einsam am Schreibtisch probieren sollte, denn da gruselt man sich zu sehr, wenn zusammenhangloses Zeug herauskommt. In Gesellschaft könnte es gehen und vielleicht gemeinsame Ideen hervorbringen.
Generell ist es vielleicht doch besser, Ideen zu sammeln, die sich aus einem Grund, aus einer Situation heraus eingestellt haben. Sammeln heißt vor allem vieles aufschreiben, bevor man es wieder vergessen hat.
Ideen entstehen sehr oft aus Anlässen, und man kann mit etwas Routine einen Vorfall bewußt zum Anlaß nehmen, um Ideen zu entwickeln. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit Wutanfällen, und zwar solchen, die nach dem auslösenden Erlebnis noch ein wenig vorhalten. Nehmen wir den Straßenverkehr, die deutsche Autobahn zumal, die jederzeit für die Ausschüttung von Streßhormonen sorgt, weil man dort dem Mitmenschen so gefährlich ausgeliefert ist. Da gibt es etwa den Ärger, wenn man beim Überholen die zulässige Höchstgeschwindigkeit einigermaßen einhält, daß da prompt ein Rasender von hinten bis auf wenige Zentimeter heranjagt, einen mit seinen Scheinwerfern anbrät und, kaum daß man vor dem Lastwagen wieder nach rechts gezittert ist, mit röhrender Beschleunigung vorbeizieht. Mein Auto, phantasiere ich nun, ist mit einer nach vorne ausfahrbaren Vorrichtung ausgestattet, einem auf kleine Räder gestützten massiven Haken, mit dem ich jedem Raser unter die Hinterachse greifen kann, wozu ich ihn allerdings zunächst wieder einholen muß. Ich brauche dann nur wohldosiert abzubremsen bis zum Aussteigen. Letzteres muß sein – ich muß dem Mann ja sagen, was ich von ihm halte. Es ließe sich ein Film drehen, in dem jemand mit solchen Vorrichtungen herumfährt – auch anderen nützlichen Instrumenten der Rache und Belehrung, zum Beispiel einem riesigen, hydraulisch aufrichtbaren Mittelfinger auf dem Autodach. Nein, gut ist die Idee in keiner Weise, aber manchmal liegt etwas Lachreiz in einer besonders schlechten.
Oder der Zorn auf bestimmte Typen, genauer auf Menschen, die wir zürnend als Typen betrachten. Stellen wir uns einen Autor vor, der die Rechtschreibreform haßt. Haß meint stets die Typen zu kennen, die aus Wichtigtuerei, Stumpfsinn oder saudummen guten Absichten irgend etwas angerichtet haben. Ganz nahe liegt dem Autor nun die Idee, eine Art Bestiarium unter dem Titel »Die Rechtschreibreformer« zu errichten und diese darin wie Wachsfiguren in Madame Tussauds Kabinett zu London (Abteilung »Mörder« natürlich) aussehen zu lassen. Wut verleiht Ideen und Sprache, sobald man nicht mehr gelähmt ist von der Widerwärtigkeit des auslösenden Vorgangs. Es kann sogar vergnüglich und gesund sein, sich seine Wut durch schön erstunkene, brillant ätzende Charakteristiken vom Leib zu schreiben.
Mir fällt nebenbei auf, daß aus meinem Ärger über gewalttätige Ausländerhasser kaum je erzählerische Ideen geworden sind, sondern immer nur psychologische, polizeitaktische, detektivische, juristische. Liegt es daran, daß solche Leute nicht lesen, ich sie also durch Worte nicht werde beeindrucken können? (Wobei ich übrigens gar nicht weiß, ob »solche« nicht doch lesen, es fragt sich nur was.) Und vielleicht macht nur heller, frischer Zorn wirklich einfallsreich, nicht der festgefressene aus vielen Jahren.
Versuch eines Beispiels: Da ist jemandem die Scheibe seines Autos von einem Dieb eingeschlagen worden, der im Handschuhfach Wertvolles vermutete. Als er es bemerkt, ist der Dieb längst weg, alles ist voller kleiner Glaskörnchen drinnen und draußen und beim Fahren wird es kalt. Ach, der arme Dieb! Vielleicht drogenabhängig, vielleicht ein Kind, von armen Eltern auf einen bösen Weg geschickt. All diese Seelenübungen nützen nichts, es bleibt ein dicker, großer Ärger. Und ein Bild stellt sich ein: eine Falle, die blitzschnell den Arm des Diebes umschließt, sobald er durch die zerschlagene Scheibe greift – er kann nicht mehr weg. Die Schreibidee wäre nun, sich vorzustellen, was passiert, wenn der Autobesitzer zurückkehrt. Was macht er mit dem Dieb? Zur Polizei bringen? Er selbst hat sich der Freiheitsberaubung schuldig gemacht, geht also besser nicht zur Polizei! Was sagt er dem Dieb, wie wird der Dialog sein? Natürlich läßt er ihn laufen, was sonst, er gibt ihm womöglich noch Geld, damit der Ärmste heute keine Autos mehr aufbrechen muß. Wut bringt auf Ideen, und mit diesen, weil sie wandlungsfähige Bilder sind, läßt sich ebendiese Wut kleinarbeiten, ein erfreulicher Nebeneffekt des Geschichtenerzählens.
Viele, sehr viele Ideen verdanken sich ferner dem, was man in einer bestimmten Situation hätte tun oder sagen sollen, aber leider nicht gesagt und getan hat. Historisches Nachsitzen. Wer mit sich zu jeder Tages- und Nachtzeit zufrieden ist, hat vielleicht weniger Ideen als einer, der an seinen Mängeln herumnagt. Ständig höre ich, man müsse sich nur selbst genügend toll finden, um alles zu erreichen. Das mag sogar stimmen, es fragt sich nur, ob einem dann viel einfällt. Ich verderbe hoffentlich niemandem die gute Laune, wenn ich sage: Für Schriftsteller ist das nichts. Denen liegt es in der Regel mehr, aus einer Bekümmerung heraus zu starten, durch das Nachdenken über Fehler zu Ideen zu kommen und erst nach dem Umweg über diese wieder froh zu werden. Das Verb »nachdenken« müßte übrigens den Dativ regieren: Der Grübler denkt den Geschehnissen nach, so wie man jemandem nachgeht, der zu entschwinden droht, und irgendwann gelingt es dann, sie gedanklich einzuholen, verträglich zu stimmen und zu erhalten. So können auch Erzählideen und die Helden von Geschichten entstehen, denn was ist ein Held? Immer der, der ich in dieser und jener Situation hätte sein müssen, um zu helfen, zu retten oder mindestens nicht feige zu sein.
In jedem Fall scheint mir die Hauptquelle von Ideen nicht das Nachdenken als solches zu sein, sondern das Ereignis, dem einer nach-denkt. Goethe sagte, zum Schreiben gehörten zweierlei, »Talent und Ereignis«. Das letztere hat nichts mit Eigenheit, Eignung oder Aneignung zu tun, sondern mit dem Auge, dem Eräugen von etwas, es ist »Eräugnis« (das war den Rechtschreibreformern glücklicherweise nicht bekannt). Goethe würde heute wohl sagen, zur Schriftstellerei gehöre neben dem Talent die Fähigkeit, genau hinzuschauen. Ich behaupte, daß man, um das zu können, etwas Muße und Freude an der Bedächtigkeit haben muß. Um zu sehen, ob die Verkehrsampel auf Gelb springt, brauchen wir das nicht, wohl aber um zu sehen, daß die Kinder jetzt andere Drachen steigen lassen als früher. Das will ich erklären.
Die alten Papierdrachen, meist mit aufgemalten Augen, mit Nase und Mund und einem bunten Schwanz zur Stabilisierung, wurden an möglichst langen Schnüren so weit wie möglich in den Himmel hinauf geschickt, wo sie dann standen wie Sterne – je weiter weg, desto größer das Glücksgefühl. Heute bleiben sie in der Nähe und haben keinen Schwanz, denn sie sollen gar nicht still im Himmel stehen, sie sollen nervöse Kurven dicht über dem Boden drehen, manchmal bedrohlich auf ihn zurasen und dabei ordentlich Krach machen, damit die Hunde der Spaziergänger außer Rand und Band geraten.
Keine Idee, nur eine Beobachtung, aber es ließe sich daraus eine Idee entwickeln. Nehmen wir an, ein Mann im frühen Großvateralter, der wieder einmal so recht froh sein will – vielleicht weil er es gerade nicht ist, handelt nach dem schönen Spruch: »Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit«. Er baut einen Drachen, so wie er es als Junge gelernt hat. Damit geht er an einem stürmischen Herbsttag in die Auen am Fluß. Sein Drache steigt an langer Schnur und ruht im Firmament, er selbst hat Zeit zum Schauen und Nachdenken – und da merkt er, daß er die Welt nicht mehr versteht! Daß er steinalt geworden ist. Er merkt es an den anderen Drachen, denen der Kinder und jungen Familienväter, die tief unter seinem Niveau, aber mit viel action und Getöse gierig ihre Loopings drehen. – Aus der Beobachtung ist eine Vorstellung geworden, sie könnte zugleich ein Schlüssel zu einer Figur sein, und wir könnten munter losschreiben, wenn, ja wenn wir für diese Figur so etwas wie Liebe aufbringen. Das kann übrigens immer passieren: bei wirklich guten, bei Klingt-gut- und bei ausgesprochenen Schnapsideen.
Was kann nicht alles Auslöser einer Idee werden! Sekundenbilder vor dem Zugfenster, Traumfetzen, Gehörtes, Satzbruchstücke. Da bekommen Sie zum Beispiel mit, daß ein Mann und eine Frau sich siezen, obwohl sie deutlich ineinander verliebt sind. Der Mann versucht offensichtlich, das Wort »Sie« zu vermeiden, spricht es, wenn es doch sein muß, zögernd aus. Warum duzen sie sich nicht längst? Möglichkeit: Sie hat gemerkt, wie ungern er siezt, und bietet ihm das Du nicht an, damit er sie erst küssen muß, um es zu erlangen. Na ja, zu einer richtigen Idee langt es noch nicht – es ist nicht ausbaufähig, aber vielleicht irgendwo einbaufähig.
Oder man kommt aus dem Kino und hört aus unmittelbarer Nähe ein vorsichtig tastendes Gespräch zweier Leute über den Film mit an. Der hat, so vermuten wir, beiden nicht gefallen, aber jeder denkt, er habe dem anderen gefallen, sehr gut kennen sich die Gesprächspartner also noch nicht. Das ist ebenfalls nichts als Beobachtung und Hinhören, man könnte aber einen solchen Dialog irgendwo verwenden, weil er komisch ist. Es könnte auch die Idee zu einem Rahmen sein: Ein ganzer Film läßt sich auf diese Weise erzählen, es wird so auf komische und wegen der Rätselhaftigkeit des Dialogs auch einigermaßen spannende Weise eine Geschichte entwickelt (Seitenhiebe auf Kitsch und Pathos sind denkbar).
Ein Barkeeper in München, ein junger Franzose und Autodidakt von kindlichem Feuereifer, sagte mir, er lerne den ganzen Tag Wissenswertes, indem er den Gesprächen der Gäste zuhöre, und darum wisse er so viel. Er brachte Beispiele, redete und redete. Sein Problem waren nur die Namen: Wilhelm Tell habe Amerika erstaunlich gut beschrieben, obwohl er nie dort gewesen sei. Shakespeare sei einer der Größten, und das Beste von ihm wohl »Das doppelte Lottchen«. So ging es fort und fort.
Ich war versucht und bin es immer noch, einen fröhlichen Durcheinanderbringer als Monologhelden zu küren, und zwar nicht, um ihn lächerlich zu machen. Er sollte auch nicht kabaretthaft komisch sein, sondern poetisch komisch, will sagen: Die Irrtümer dürften nicht als Witze und Pointen daherkommen. Das wäre dann das Schwierige beim Schreiben. Frohgemute Unkenntnis kann rührend und tröstlich sein, sie kann erfrischen und fast so etwas wie anstecken, wir sehen gerade an dem naiven Unwissenden, wie schön und rätselhaft die Welt ist, und empfinden dabei nicht ihn als störend, sondern uns: unsere eigene ewige, verdrossene Besserwisserei. Nun gut, vielleicht eine Idee für mich, allgemein empfehlen kann ich sie nicht. Der Titel wäre: »Die Ohren des Barkeepers«.
Ideen stammen oft, sogar meistens aus Gelesenem und Wiedergelesenem, sofern es sich mit dem selbst Erlebten (mit den Ereignissen) verbindet. Wer seine Zeit mit Büchern verbringt und den inneren Ideensammler mitlesen läßt, findet ständig Geschichten, die sich in abgewandelter, vielleicht ins Gegenteil gewendeter Weise neu erzählen lassen. Vor allem das Lesen obskurer, kaum mehr bekannter alter Bücher heckt Ideen, auch weil gewisse Bedenken wegfallen, sie zu verwenden. Und man denke auch an Geschichten, durch die sich Sentenzen, Sprichwörter, Weisheiten erzählerisch entfalten lassen – sehr viele stecken etwa in den Lebensregeln des Balthasar Gracian aus dem 17. Jahrhundert, dem berühmten »Handorakel«!
Eine davon hat die Überschrift »Vom Versehen Gebrauch zu machen wissen« und geht so weiter: »Dadurch helfen kluge Leute sich aus Verwicklungen. Mit dem leichten Anstande einer witzigen Wendung kommen sie oft aus dem verworrensten Labyrinth. Aus dem schwierigsten Streite entschlüpfen sie artig und mit einem Lächeln. Der größte aller Feldherren setzte darin seinen Wert. Wo man etwas abzuschlagen hat, ist es eine höfliche List, das Gespräch auf andere Dinge zu lenken und keine größere Feinheit gibt es als nicht zu verstehen.«
Das birgt schon deshalb eine gute Idee, weil es in heutiger Zeit völlig rätselhaft wirken muß, und aus guten Rätseln werden oft gute Romane oder Stücke. In »Endstation Sehnsucht« von Tennessee Williams gerät die gebildete, problematische und übersensible Blanche, die die Realität nicht mehr aushält und bei ihrer hochschwangeren Schwester Zuflucht gesucht hat, mit deren Mann Kowalski zusammen, einem langsamen, beharrlichen jungen Arbeiter, der sich seinem jungen Glück zuliebe brutaler gibt, als er ist, um den störenden Gast loszuwerden. Blanche verkörpert Gracians Konversationsregeln, spricht ebenso geistvoll wie umweghaft, Kowalski hingegen würde in eine der heutigen Talkshows passen – er mißtraut den Feinheiten, zählt drei und eins zusammen und wird überdeutlich: vier sind zuviel!
Das Interessante an dem Stück scheint mir die Ambivalenz, die dem Zuschauer die Entscheidung abverlangt: Hält er’s mit Blanche oder mit Kowalski? Wer ist annehmbarer: die verhuschte Feinsinnige mit ihren Lebenslügen, die sich im kargen Leben der Kowalskis breitmacht, oder der Realist ohne Tötungshemmung, der die Schleier zerreißt? Wem gebührt unser Mitleid mehr? Blanche jedenfalls bleibt auf der Strecke, verliert den Verstand vollends. Wollte man Gracians Vorschrift zu einer Erzählung machen, man müßte immer sofort das Gegenprogramm hinzunehmen und einen Gegensatz herausarbeiten. Ich war mit vierzehn ein Anhänger von Blanche, von sechzehn bis dreißig von Kowalski, dann kam die Zeit, in der der Mensch wenig nachdenkt und liest, schon gar nicht alte Stücke. Heute würde ich Gracian siegen lassen und mit ihm Blanche, ich würde dafür sorgen, daß Kowalski durchdreht und in eine Anstalt muß, nicht sie.
Oft sind es auch nur rätselhafte Wörter aus unvertrauten Wissensgebieten, die durch den fremden Klang allein bereits Phantasie und den Anfang einer Idee entstehen lassen. Ich bin ein passionierter Leser von Lexika und habe stets gern so spezielle Fundstücke notiert wie: Palettenankerhemmung, Ritterschaftliches Kreditinstitut, Eposiopese und Propriozeption, Stampfstockstagen, die Bornholmsche Erkrankung alias Cokseki-Virus, Akzidenz-Hobelmaschinen, Toteiszone mit Stauchmoränen, Monaden, Carronaden, Rodomontaden und mein Liebstes: die Kaskarillenrinde. Meist ohne deutliche Ahnung, was damit anzufangen wäre – vielleicht kommt es aber einmal als Beigabe und Gewürz in Betracht.