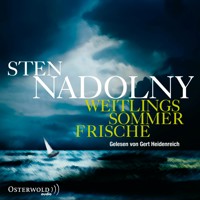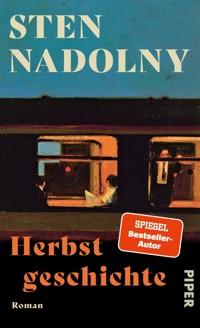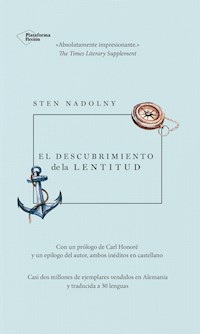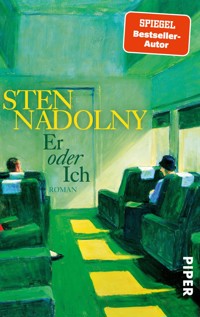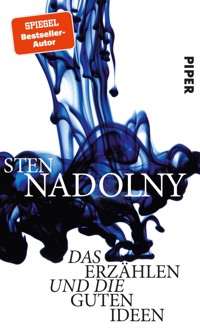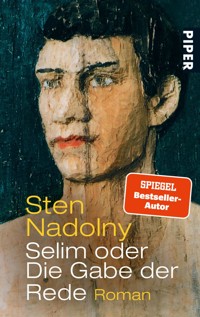9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Sten Nadolnys Roman ist Hermes, Gott der Kreuzwege und der Nacht, der Diebe und Kaufleute, der Held. Nach über 2000jähriger Gefangenschaft wird er vom neurotischen Technologie-Gott Hephäst befreit. Der erste Mensch, der ihm nach seiner Befreiung auf Santorin begegnet, ist die junge Helga aus Stendal in Sachsen-Anhalt, für die sich Hermes gleich entflammt. Diese befindet sich auf einer Kreuzfahrt, und Hermes folgt ihr, selbst über den Atlantik. Auf den Reisen lernt er nicht nur die Angebetete besser kennen, sondern macht sich auch seinen Reim auf die Veränderungen, die die Welt in den letzten 2000 Jahren erfahren hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deFür K. N. und Sagals Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 14. Auflage 2009 ISBN 978-3-492-95790-8 © 1994 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagabbildung: Todd Davidson / VEER Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Erstes Kapitel
Eine Art Auferstehung
Das Schiff durchquerte ein Gewässer von lauernder Ruhe. Hier war Schlimmes passiert, und vielleicht kehrte es wieder. Es war kalt. Noch zwei Tage bis zum griechischen Osterfest.
Außer der jungen Frau war niemand an Deck.
Das Ausflugsschiff näherte sich der Engstelle zwischen zwei Inseln von melancholischem Aussehen. An der einen ragte, wo sie der anderen am nächsten war, eine Steilwand aus schwarzem Fels auf, senkrecht fast, hoch wie eine Festung. Nicht die kleinste Pflanze schien dort zu gedeihen. Von weitem sah es aus wie eine Narbe, verhornt und verwachsen, beim Näherkommen bekam die Nacktheit des Gesteins einen metallischen Glanz. Von der Gegend ging Gewalt aus. Da stand etwas und drohte, überall zwischen Himmel und Wasser, vibrierend und unsichtbar. Eine Kraft vor dem Sprung, ein Blitz, noch lichtlos, kurz vor dem Aufzucken und Zuschlagen.
Sie nahm den Schal enger um den Hals und zog die Schultern hoch, denn sie fror. Sie versuchte in der schwarzen Wand zu lesen wie in einem Buch. Es gab dort durchaus Vorsprünge, Risse und Höhlen, Mulden und Nasen, Verfärbungen ins Rötliche oder Fahle, und je näher das Boot herankam, desto zerklüfteter und vielfältiger wirkte das Gestein. Aber in sich lesen ließ es nicht.
Da erkannte die Frau mitten in dem Irrgarten aus Basalt eine menschliche Figur. Sie fuhr hoch. »Du lieber Gott!« schrie sie und stand dann reglos mit aufgerissenen Augen, um zu sehen, ob die Gestalt sich bewegte. Nein, tot. Der Mann war schwarz wie der Hintergrund, aber Kopf, Schultern, Arme und Beine waren trotzdem deutlich zu erkennen. Er war nackt. Eine Kultfigur, eingemeißelt in den Stein? Aber das wäre ein seltsamer Kult, dachte sie, denn die Gestalt war angekettet. Der Mann trug schwere eiserne Schellen um Hand- und Fußgelenke und um den Hals. Ein Hingerichteter? Dann war sein Tod nicht lange her; die vielen hungrigen Vögel machten aus einem Leichnam gewiß rasch ein Skelett.
Sie hörte ein Geräusch, ein Dröhnen und Rumoren, von der Wand, nein, von überall her schien es zu kommen und nahm immer noch zu. Es schwoll zu einem Poltern und Grollen an. Die Frau löste den Blick von der Felsgestalt und sah angstvoll zu der anderen Insel hinüber, auf der es einen tätigen Vulkan geben sollte – brach der etwa jetzt aus, dieser Ausflugs- und Postkartenvulkan, um auf seine Weise die Saison zu beleben? Wahrscheinlicher war, daß sich ein neuer Kegel über die Wasseroberfläche schieben würde, eine dritte Insel, stinkend vor Neuheit und Schwefeldampf. Nichts davon geschah. Nur ein lautes Platschen war zu hören. Ein Gesteinsbrocken mußte ins Meer gefallen sein, sie sah noch, wie das Wasser zusammenschlug und emporschoß.
Sie drehte sich wieder zur Felswand, an die das Schiff jetzt nah herangekommen war. Von dort hörte sie ein Geprassel, begleitet von einem bohrenden Summen wie von Hornissen. Jetzt sah sie es: der Fels platzte auf. Ein Riß eilte quer durch die schwarze Fläche und verbreiterte sich, wo er begonnen hatte, bereits zum Spalt. Ein Federstrich, dachte sie und begann, Gutes zu erwarten – es machte jemand einen Strich durch diese Wand. Die Linie war trotz der Unebenheiten schnurgerade. Sie lief direkt auf die menschliche Gestalt zu und teilte sie auseinander – doch nein, das tat sie nicht. Sie ging hinter ihr hindurch, kehrte zurück, umfuhr sie in Zickzackbewegungen, lief dann so gerade weiter fort wie zuvor. Jetzt ein Klirren: Schellen und Ketten lösten sich, Eisenteile fielen herab, schlugen ein paarmal an der Wand an, klatschten ins Meer. Der leblose Körper rutschte ein wenig herab und blieb auf einem Vorsprung zusammengesackt sitzen.
Das Grollen und Stöhnen wurde leiser. Keine Flutwelle bisher. Aber was war das? Die Gestalt im Fels bewegte die Arme. Der Mann stützte sich ab, um sich aufzurichten. Und jetzt drehte er die Hände nach innen und nach außen – er prüfte seine Beweglichkeit.
Ja kam denn niemand, um zu sehen, was sie da sah? Geschah das alles nur für sie – das Beben, die Befreiung, das Aufrichten? Nein, die Reisenden im Schiffsinneren mußten taub sein, der griechische Skipper im Führerhaus blind. Sie stolperte zu ihm und klopfte an die Scheibe, aber der Mann lächelte nur mit hochgezogenen Brauen, sah wieder nach vorn. Sie waren jetzt über die Engstelle schon hinaus, die Felswand wurde optisch schmaler. Aber die Gestalt war immer noch deutlich zu sehen, denn sie war an die äußerste Kante des Vorsprungs getreten und breitete die Arme aus, sah mit erhobenem Kopf übers Meer. Und da kam etwas angeflogen, in niedriger Höhe von Osten her, eine kompakte kleine Wolke, wie ein angreifender Bienenschwarm, gerade auf den Mann zu und hüllte ihn ein. Er sah nun aus, als trüge er einen Pelz. Im selben Augenblick lösten sich seine Füße vom Boden, waagrecht lag er in der Luft. Einen Moment noch schwebte er neben der Felswand, dann driftete er von ihr ab, wurde davongetragen, immer schneller, und verschwand im Osten hinter der Vulkaninsel.
Es war still wie vorher, leer und tot, aber das Bedrohliche war vorüber, die vibrierende Kraft nicht mehr zu spüren. Die Reisenden kamen eben aus der Kajüte herauf und bedauerten, die berühmte »Schmidt-Wand« verpaßt zu haben. Sie hörten, was die junge Frau in rasender Geschwindigkeit von einer Gestalt im Fels erzählte. Sie lächelten nachsichtig. Der Skipper konnte sich nur daran erinnern, daß ein Stein herabgefallen war. Ein kleines Hin und Her jetzt: die einen wollten lieber sofort, wie vorgesehen, den Vulkan auf Nea Kaimeni besichtigen, um rechtzeitig zum Mittagessen in Phira zu sein, die anderen zurück und den Felsabsturz betrachten. »Die Ketten hängen noch am Felsen, ihr werdet sehen«, sagte die Zeugin. Das wollten sie denn auch. Der Skipper zwang sich zur Geduld und drehte um.
Niemand erwartete, daß an der Geschichte etwas Wahres dran sei. Die Frau kam aus der ostdeutschen Republik und machte ihre erste Reise ins westliche Ausland. Rasend schnell sprach sie immer, und sie las offenbar zuviel. Außer ihr gab es noch einen anderen Deutschen an Bord, das pure Gegenteil: ein schwerer Mann mit einem unerschöpflichen Vorrat an Dosenbier, aber gewiß nicht an Phantasie. Er besaß ein Fernglas, und mit dem suchte er jetzt die schwarze Wand ab. Nach einer Weile ließ er es sinken und reichte es an die holländische Lehrerin weiter.
»Es sind keine Ketten zu sehen«, sagte er. Der Skipper nickte mehrmals wichtig, als habe man ihm endlich das Vertrauen ausgesprochen. Er wandte sich wieder dem Ruderrad zu.
»Aber es sind bis vor kurzem welche angebracht gewesen«, fuhr der Deutsche fort. »Da waren fünf handgeschmiedete Kettenanker, drei davon sind noch halb dran. Solche hat man bei uns in den Ställen gehabt, für die Viehketten, es waren einfach Ösen, angeschlagen für schweren Zug. Diese hier sind nicht abgesägt, sondern weggebrochen nach Ermüdung oder Hin- und Herbiegen oder Vibration. Auf jeden Fall Schmiedeeisen. Gußeisen zerwackelt sich anders.« Noch nie hatte der Dicke so lang gesprochen.
»Es ist da jemand befreit worden«, sagte die junge Frau. »Einer, der lange gefangen war.«
»Woraus schließen Sie das?«
»Weil er sich kaum noch bewegen konnte.«
Alle suchten mit den Augen den Felsen ab – ohne Erfolg. Die Lehrerin am Glas runzelte die Stirn. »Also, ich sehe nichts. Wie wollen Sie denn da überhaupt Metall erkennen?«
Der Dicke maß sie mit einem melancholischen Blick. »Ich habe Schmied gelernt, in dem Beruf kenne ich alles. Sogar Pferde hab ich noch beschlagen, beim alten Münch in Freystadt.«
»So.«
»Meine Dame, wenn ich was Geschmiedetes sehe, kann ich den Mann beschreiben, der's gemacht hat.«
*
Vor über dreitausend Jahren hat an der Stelle der heutigen Caldera, der Bucht von Santorin, eine große, runde Insel gelegen, reich besiedelt, mit dem Namen Strongyli: Plato wußte noch von ihr und nannte diesen Namen. Ob sie das vielberedete Atlantis gewesen sein könnte, ist umstritten. Bei einem Vulkanausbruch oder Erdbeben um 1500 v. Chr. brach ihre Mitte ein, das Meer flutete in den entstandenen Riesenkrater, nur von den Inselrändern blieb etwas übrig. Man sagt, die bei dieser Katastrophe entstandene Flutwelle sei die Sintflut des Alten Testaments gewesen.
Die stehengebliebenen Randteile der Insel waren bald wieder besiedelt, der Hauptort hieß Thera – heute Phira. Die Bewohner ernteten auf dem Lavaboden guten Wein, waren auch kluge Seeleute und Händler und zeitweilig die Reichsten weit und breit.
Im Jahre 197 v. Chr. wuchs in der vor Hitze dampfenden Caldera ein glühender Kegel aus dem Meer, kühlte ab und wurde zu einer kleinen pflanzenlosen Mittelinsel, welche die Griechen »Hiera«, die Heilige, nannten – sie bauten auf ihr einen Tempel für den Vulkan- und Schmiedegott Hephaistos oder Hephäst. Erst nach Jahrzehnten wurzelten die ersten Pflanzen in den Ritzen des schwarzen Gesteins.
Mehr als anderthalb Jahrtausende später begann abermals die Geburt einer Insel: Ein Vulkankegel hob sich östlich der Hiera aus dem Meeresgrund, so daß diese entzweibrach. Heute nennt man die östliche, neue Insel »Nea Kaimeni« oder »Volkano« (weil es auf ihr nach wie vor raucht) und die Reste der alten Hiera »Paläa Kaimeni« – die »alte Verbrannte«.
»Schmidt-Wand« oder »Kap Schmidt« heißt der fast senkrechte, vierzig Meter hohe Felsabsturz, die Abbruchkante der Insel Paläa Kaimeni nach Osten hin. Ein deutscher Geologe Schmidt hatte sie im 19. Jahrhundert untersucht und vermessen und ein deutscher Maler, der ebenfalls Schmidt hieß, auf einer Studienreise um 1850 tagelang skizziert und später für den »Griechischen Saal« des Neuen Museums zu Berlin gemalt. Das Bild ist vermutlich 1945 verbrannt, vielleicht auch nach Auslagerung verschollen. Der Maler ist vergessen, der Geologe wird noch genannt – aber nur deshalb, weil er mit größerer Wahrscheinlichkeit der Namenspatron jener Steilwand ist.
Die Insel Paläa Kaimeni bietet am Nordende den Fischerbooten einen kleinen Nothafen. Touristen werden nur vorbeigefahren, aber nicht an Land gebracht. Die Insel ist, sieht man von etwa fünfzehn Schafen ab, unbewohnt. Vom Tempel des Hephäst wurden keine Reste gefunden. Daher ist zu vermuten, daß er auf dem nach Phira zu gelegenen östlichen Teil gestanden hat und mit diesem 1457 ins Meer gestürzt ist.
*
Die alten Götter gibt es noch, denn sie sind unsterblich. Athene, Zeus, Apollon, Hephäst – solange noch Menschen leben, können Götter nicht sterben, nicht einmal, wenn sie wollen. Es sei denn, sie begehen diesen Selbstmord durch Vernichtung der Menschenwelt. Dann aber würden sie gründlicher sterben als die Menschen: an diese mag sich bei Ratten oder Bienen noch eine gewisse Erinnerung halten, die Götter hingegen wären gelöscht, spurlos wie nie gewesen.
Ewiges Leben bringt Beschwerden mit sich. Das erotische Vergnügen kann unmöglich Jahrtausende lang bleiben, was es einmal war. Dann der Ärger mit den Gelenken – täglich müssen Sülze oder Gelee verzehrt werden, um sie gangbar zu halten. Schließlich alle zehn bis zwanzig Jahre der Wechsel des äußeren Erscheinungsbildes und der Identität, ein strenges Muß, um das Fehlen des Älterwerdens zu verbergen. Meist sind es wohlgeplante »plötzliche Todesfälle«, die das Leben einer Gottheit scheinbar beenden, in Wirklichkeit aber seine Fortsetzung in anderer Gestalt ermöglichen. Lebten die Götter noch auf dem Olymp, dann hätten sie diese Sorge nicht. Aber sie sind heute aus guten Gründen mitten unter den Menschen, ihre Tarnung muß standhalten. Mit den Menschen müssen sie leben, mehr denn je: schließlich gilt es, den eigenen Kult aufrechtzuerhalten. Die göttliche Existenz ist heute, da kaum mehr Tempel gebaut und gepflegt, keine Rinder mehr geopfert werden, elend genug. Wenigstens die Namen müssen aber so oft wie möglich genannt, alte und neue Geschichten über Götter erzählt werden. Altertumsforscher sind dafür wichtig, vor allem aber Leute, die von den Göttinnen und Göttern träumen – und nicht nur allgemein. Geschieht dies nicht ausreichend, dann werden Götter stumpf, sie verkümmern trotz Götternahrung und Sportlichkeit und tragen zum Leben der Menschen nur eines bei: unsterbliche Schlechtgelauntheit.
Die Schicksale der Götter während der letzten Jahrtausende sind sehr unterschiedlich. Von manchen weiß niemand mehr, was aus ihnen geworden sein könnte, man hofft aber noch immer, daß sie wiederkehren. Von anderen kennt die Menschheit zwar die Namen, glaubt aber irrtümlich, es habe sich um Sterbliche gehandelt. Und einige Götter sind ganz und gar vergessen, etwa Anteros, der Gott der erwiderten Liebe. Tätig blieb nur Eros, der Sohn von Aphrodite und dem Kriegsgott Ares. Er entzündet Liebe, wo es ihm paßt, und kümmert sich nicht um Erwiderung. Im Gegenteil, der ungebärdige Knabe spielt gern mit Eifersucht und Rachedurst.
Götter können ohne ein Ende der Menschheit nicht sterben. Wohl aber können sie dahinvegetieren, äußerlich und innerlich verwahrlosen, zur Ungestalt verkommen. Und einige sind ganz verschollen, warten tief unten im dunklen Tartaros auf bessere Zeiten. Ohne Folge bleibt nichts von alledem.
*
Die Menschen hatten keine Ahnung davon, daß die Götter zu ihrem Pessimismus beitrugen. Sie sahen diesen gewöhnlich wohlbegründet durch Ereignisse und allgemeine Lage. »Die Welt ist da angekommen«, sagte einer in Bebra nach dem Frühstück beim Bezahlen seiner Hotelrechnung, »wo nur noch ein Schelm sie retten kann.« Er meinte, daß, wer sie jetzt noch retten wolle, nur ein Aufschneider sein könne.
Europa war zu der Zeit aufgeregter als sonst, sowohl politisch als auch unpolitisch, alles schien in Bewegung geraten, gewaltige Möglichkeiten sah man aber auch solche des Untergangs, und in keinem Fall eine sichere Zukunft. In dieser Situation verwirrten sich zuallererst denen die Sinne, die in ruhigen Zeiten anderen zu sagen pflegten, was gut und was böse sei. Sie wurden ratlos, empfindlich, spitzten Hoffnungen oder Befürchtungen blindlings zu, denn mit irgend etwas mußten sie sich und anderen Eindruck machen. Das war ihre Methode, um nicht zu verzweifeln. Auf Schriftstellerkongressen war es am schlimmsten, die Götter wußten es: »Wir hätten ihnen die Sprache gar nicht erst geben sollen.«
Nur noch ein Schelm könne retten, hatte an einem Frühlingsmorgen in Bebra einer vor sich hin geschimpft und keine Ahnung davon gehabt, daß dieser Satz, meißelte man ihn in Stein, ebensogut eine große, zuversichtliche Wahrheit bedeuten konnte. Aber irgend etwas ahnten sie doch, die Menschen. Im Europa des Frühjahrs 1990 fiel so etwas wie eine Götterdämmerung auf, und zwar eine morgendliche des Aufbruchs. Von Mythen war mehr die Rede als in den letzten zwei Jahrtausenden zusammengenommen, von der Wiederverzauberung, von Metamorphosen, Erhabenheit und letzten Welten, vor allem eben von Göttern. Und einige begannen sich auch an Hermes zu erinnern, obwohl der offensichtlich nichts zum Aufleben seines Kults beitrug.
Aber selbst die, die auf ihn vage Hoffnungen setzten, wußten nicht wirklich, wer Hermes gewesen war: Schelm von Anfang an, Welt-Schelm und doch Sohn des Zeus. Kaum hatte ihn die Nymphe Maia in einer Grotte des Gebirges Kyllene geboren, da schälte er sich in einem unbeobachteten Augenblick aus den Windeln, schweifte umher, stahl dem Apollon eine Rinderherde, führte sie mit List von dannen und versteckte sie. Wenig später lockte er eine Schildkröte durch kühl kalkulierte Komplimente, bis sie ihren Kopf herausstreckte und er sie packen und töten konnte, denn er wollte aus ihrem Panzer und einem Kuhdarm jenes Musikinstrument bauen, das später »Lyra« hieß. Als Apollon ihm wegen des Rinderdiebstahls doch auf die Schliche kam und bei Mutter Maia anfragte, lag Hermes schon wieder als Säugling unschuldig in den Windeln, als könne er kein Wässerlein trüben. Apollon packte ihn dennoch, wollte ihn vor den obersten Richter Zeus schleppen, doch Hermes log weiter und ließ währenddessen einen so gewaltigen Furz, daß der vornehme Apollon ihn schockiert losließ – fast hätte er ihn nicht bis zu Zeus gebracht. Auch dort leugnete der Tunichtgut weiter, und zwar so frech und geschickt, daß sein Vater Zeus sich das Lachen nicht verbeißen konnte und stolz auf ihn war. Hermes war seitdem der Gott all derer gewesen, die sich unauffällig ihr Glück stahlen, statt zu warten, bis es ihnen zugeteilt wurde.
Die Welt, so fühlte man 1990, war an dem Punkt, an dem sie vielleicht mit göttlicher Hilfe verspieltes Glück zurückstehlen konnte. Aber die alten Götter wurden dennoch nicht verehrt, die Sehnsucht nach ihnen blieb begriffslos. Der Name »Hermes« war zwar noch verbreitet, aber die Pflege eines ernstzunehmenden Kults wurde dadurch eher gestört. Sein römisches Pseudonym »Merkur« war als Name von Zeitungen und Schiffen, Reisebüros, Botendiensten und kaufmännischen Liedertafeln bekannt. Mit dem vornehmeren griechischen Namen waren so verschiedene Dinge bezeichnet wie Raumfährenprojekte, Kreditversicherungen, Versandhandlungen, Vitamintabletten, Seidentücher. Auch ein Raddampfer in Magdeburg hatte so geheißen und war noch in Erinnerung.
Jetzt kam immerhin einiges wenige hinzu, was schwerer wog: Hermes als Titel philosophischer Werke in Frankreich und Deutschland, als Figur in Theaterstücken und Romanen. Eine Zwei-Mann-Band (Harfe und Gitarre) nannte sich »Hermes« – ihr Album »Wildsau mit Gespür« führte die Hitlisten an. Und in Paris pflegte ein Chirurg zu sagen »Operieren wir à 1'Hermès!« Man argwöhnte erst Zynismus, aber es war nur eine Abwandlung jener seltsamen Redensart, die sich gerade jetzt in Ost und West verbreitete: »Fort von hier mit Hermes!« Immer mehr Menschen sagten es, keiner hatte eine Erklärung dafür. Die Bedeutung konnte ironisch-pessimistisch bis feierlich-zuversichtlich sein.
An den verschiedensten Orten Europas – auf einem Golfplatz in England, bei einem Management-Seminar in Frankfurt, in einer psychiatrischen Anstalt Madrids, im litauischen Parlament, sogar einmal bei der Krisensitzung eines Geheimdienstes, dem seine Regierung abhanden gekommen war – sprachen Sterbliche plötzlich von Hermes. Tauchte er vielleicht doch wieder auf, der Gott der Kaufleute, Diebe, Redner und Ringer, Hermes der Seelenführer ins Totenreich und Götterbote mit den Flügeln an Hut und Sandalen? Der Gott des Sprungs, des raschen Griffs, des glücklichen Fundes und der Frechheit – war er im Kommen? Die übrigen Götter, ebenfalls vernachlässigt, waren gespannt darauf, denn sie kannten sein Schicksal während der letzten zweitausend Jahre. Vielleicht begann da bei Übersensiblen, Verrückten und bei den notorischen Selbstdarstellern des alten Europa etwas Neues. Frechheit war eine Art Wahrheitsliebe. Sie räumte alle tröstlichen Lügen weg, sie war kalt. Hermes war der Gott einer Kommunikation, die auf mystische Nebel verzichtete.
Einige Autoren hatten über Hermes etwas geschrieben oder waren gerade dabei. Kerenyi, Thomas Mann, Ranke-Graves und Walter F. Otto hatten ihn im Auge gehabt; Rombach ging zum Angriff über, ohne daß es hinreichend bemerkt wurde; Serres sah kristallklar, verstörte aber dann durch Brillanz; Nadolny war sich noch nicht schlüssig, bat sich Zeit aus; Pictor dichtete eine vorsichtige Hymne, die auch ironisch verstanden werden konnte (auf Altgriechisch, was ihrer Verbreitung einen Riegel vorschob); Freya Zangemeister verfaßte einen Beitrag im archäologischen Fachblatt und teilte unaufgefordert mit, daß Hermes nicht erscheinen werde. Denn seine Präsenz liege stets nur darin, daß sein Fehlen bemerkt werde. »Immer wieder in den letzten zwei Jahrtausenden«, so Zangemeister, »hat es den Ruf nach Hermes gegeben, zeitweilig sind ganze Gesellschaften davon erfaßt worden. Wer dann ausblieb, war Hermes.« Das sei eben sein Prinzip: immer der kommende Gott zu sein, aber nie zu kommen.
Dann gab es noch etliche Brieffreundinnen, die »mit Hermes leben« wollten. Wie das praktisch aussah, blieb abzuwarten.
Und es gab die junge Frau in der Bucht von Santorin. Sie war die einzige Zeugin der Befreiung. Daß es sich um Hermes handelte, ahnte sie. Jedenfalls hatte sie ihn gesehen, schwarz und ungelenk, wie er aufstand und sich zu bewegen suchte und dann von einem Bienenschwarm zur Hauptinsel hin getragen wurde übers Meer. Sie hätte gern bewiesen, was sie gesehen hatte, aber niemand half ihr. Der dicke Schmied war wieder in Lethargie versunken – schon während der Besichtigung des schwefelstinkenden Vulkans auf der Nea Kaimeni hatte er an der Geschichte nur noch Desinteresse gezeigt. Warum, blieb trotz des vielen Dosenbiers rätselhaft.
*
Es gab auf der Insel einen Spezialisten für Götter. Die Wirtin im »Selini« wußte sogar, wo er wohnte. Henry Pictor hieß der Mann, ein dem Alkohol verfallener Engländer, der hier hängengeblieben war. Er besaß ein Haus in Pyrgos hoch am Berg, wo es kein Wasser gab – was ihm nun wirklich nichts ausmachte. Als sie ihn aufsuchte, bestätigte er ihr sofort, daß ihre Beobachtungen stimmten. »Oh. natürlich, das war Hermes. Er ist also endlich freigekommen? Great! Dann war er – Moment – genau 2187 Jahre lang gefangen, davon die ersten dreihundert Jahre mitten im Rauchfang. O ja, das macht schwarz!« Er erzählte ihr von Hermes und von seinem eigenen Versuch einer Hermes-Hymne. »Verlieben Sie sich nicht in ihn«, sagte er. »Götter betrachten Menschen mit Ironie.«
Er war zu betrunken oder zu faul, um mit der jungen Frau zur Schmidt-Wand zu fahren. »Die kenne ich doch. Hundertmal habe ich sie skizziert und oft gemalt, sogar auf die Wand im griechischen Saal …« Er trank sein Glas aus, hatte danach den Faden verloren und interessierte sich für ihren Ohrschmuck – sie trug Clips, deren halbmondförmige Scheiben fast das ganze Ohr bedeckten. Er meinte: »Ihre Ohren sind hübsch, wozu die Panzerung?« Da sie kaum Englisch konnte, verstand sie nur, daß er nicht mitkommen wollte.
Knidlberger, ein bayerischer Entdecker und Kenner Santorins, der für immer auf der Insel wohnte, empfing die junge Frau, gab aber nicht zu erkennen, daß er verstand, wovon sie sprach. Statt dessen machte er ihr Komplimente: ihre Augen hätten so ein flachländisches Blau, wunderbar. »Sie sollten hierbleiben«, sagte er. »Ich komme aus Rott am Inn und geh auch nicht zurück. Die Götter wohnen halt hier. Wo fahren Sie als nächstes hin? Waren Sie schon in Athen?«
Sie zuckte die Achseln. »Ich wollte. Aber mein Reisebüro – eine unerfreuliche Geschichte, lassen wir das. Ich muß nach Venedig, und dann zurück nach Stendal.«
Er lächelte und schenkte ihr Wein nach. »Und dann heißt es doch nur: ›Fort von hier mit Hermes‹. Übrigens, hören Sie denn noch gut mit diesen Halbmonden auf den Ohren?«
Für weitere Versuche ließ der Reisefahrplan keine Zeit. Am Tag nach Ostern sollte das große Schiff wieder abfahren. Die Sache mit Hermes, eine Schnapsidee, ein Traum? Warum hatte der Schmied plötzlich das Interesse verloren? Schwefeldampf schien seinen Geist zu ernüchtern oder im Gegenteil zu verdunkeln; beides führte zum gleichen befremdlichen Ergebnis.
*
Schwarz und verkrustet kauerte Hermes zwischen zwei kleinen Gebüschen aus dornigem Wolfsmilchkraut, den Rücken an einen Stein gelehnt, und versuchte mit den Händen seine Füße hin und her zu drehen, um die Gelenke beweglich zu machen. Sie knisterten und knackten wie Feuersglut. Immerhin, er konnte das hören. Dazu die Stimmen der Möwen. Und Schwalben gab es: ein kaltes Frühjahr also, sie waren noch nicht nordwärts geflogen. Sie schienen sich von ihm fernzuhalten, er konnte keine von, ihnen fragen, wie es im Norden sei.
Ein wenig Erinnerung kam in Gang. Wie gern hatte er als Kind in Wäldern und Sümpfen, an Quellen und in prächtigen Wiesen gesessen, vor allem an den Wegkreuzungen der Menschenwelt, regungslos und einsam wie ein Steinkegel, und sich vorgestellt, er wäre unsichtbar. Später hatte er den Stab bekommen, der dies bewirken konnte, und er war gern unsichtbar. Faul daliegen, für niemanden erkennbar, den salzigen Wind spüren und mit kühlem Amüsement das Leben der Käfer und Libellen, der Menschen und Götter beobachten, das wollte er, das mußte wiederkommen.
Gerade mit dem Sehen ging es leider noch schlecht: die Augen waren vertrocknet wie Dörrobst. Er blickte auf die Caldera hinaus und versuchte die vulkanischen Mittelinseln zu sehen, die so lange sein glühendes und steinwälzendes, schwefelstinkendes Gefängnis gewesen waren. Er erkannte nur eine schwarze Riesenkröte, die in der Mitte der Bucht lag, einen öde lauernden Dreckhaufen. Was in nächster Nähe war, sah er etwas besser: Fenchel, Rosmarin, rote und violette Kräuterblüten, Disteln, Kakteen – alles, was kaum Wasser brauchte. Es war dürr und staubig hier. Einige Schritte von ihm entfernt – die er sich noch nicht recht zutraute – lagen Steine übereinander, gewiß nicht zufällig. Es gab also noch Menschen, die ihn, Hermes, verehrten? Aber womöglich hatten Steinpyramiden inzwischen eine andere Bedeutung.
Die Bienen hatten eine ihm unbekannte Weisung befolgt und ihn nicht zu menschlichen Behausungen oder göttlichen Tempeln bringen wollen. Sie hatten ihm keinerlei Nachrichten zugesummt und wußten nicht einmal, daß er einst ihr Herr gewesen war. Jetzt hatten sie jedenfalls einen anderen. Demeter vielleicht? Bedenklich war auch, daß niemand von den Göttern kam, um ihn zu begrüßen und ihm zu helfen. Sicher war Iris in seiner Abwesenheit Götterbotin gewesen, wie während des Trojanischen Kriegs, als er keine Lust gehabt hatte. Oder war es inzwischen der traumhäuptige Pan? Aber der erschrak zu oft, vor allem vor sich selbst. Vielleicht Athene – aber auch das war unwahrscheinlich. Sie mischte sich zu sehr ein, sie war nicht Diplomatin genug. Was sie zu überbringen hatte, wurde zuverlässig zu ihrer eigenen Botschaft. Wie bei mir, dachte Hermes, aber bei mir hat es niemand gemerkt.
Beißender Qualm drang ihm in die Nase. Es war mit Sicherheit kein Opferrauch, aber auch kein vulkanischer Gestank. Jenes Feuer vielleicht, von dem ihm die Möwen erzählt hatten. Diese Möwen! Statt von Göttern und Menschen zu erzählen, rühmten sie die warmen Aufwinde eines Dauerfeuers auf einem Abhang nahe der Stadt, und wie man sich davon emportragen lassen konnte. Oder sie beklagten sich über Katzen in Thera, die ihnen Fischreste weggekrallt hatten. Was wußten schon Vögel. Sonst war niemand gekommen, nicht einmal Athene, auch sie vielleicht aus Angst vor Zeus und dem Urteilsspruch. Die ersten Jahrhunderte war er noch tief innen in der Vulkaninsel eingeschlossen gewesen, es gab höchstens hin und wieder einen Fisch, der ihm durch eine Felsritze aus dem Wasser eine kleine Nachricht von Poseidon zublitzte. »Bald wirst du wieder frische Luft atmen.« Ein übler Scherz im Grunde. Zwar brach die Insel entzwei, aber seine Fesseln blieben. Von dem Platz an der neu entstandenen Steilwand konnte er dann immerhin noch einige Zeit die hellgetünchten Häuser Theras sehen, bis Hephäst, mit dem üblichen Aufwand an Rauch und Feuer, eine neue Insel wachsen ließ zwischen Hermes und den Menschen. Die Augen waren ohnehin trübe geworden aus Mangel an Feuchtigkeit. Die letzten Bewegungen, die er in der Ferne hatte erkennen können, waren die von Segelschiffen. Sie belieferten eine Garnison auf dem Berg.
Die Fußgelenke ließen sich jetzt ohne äußeren Zugriff bewegen, wenigstens das! Unsterblichkeit war nichts als Last. Er dachte an den armen Tithonos, für den die Göttin Eos von Zeus Unsterblichkeit erbeten hatte, ohne daran zu denken, daß auch ewige Gesundheit, Schönheit und Jugend nötig waren, um den Geliebten in der von ihr geschätzten Form zu erhalten. Tithonos war immer älter und grauer und runzeliger geworden, zusammengeschrumpft, bekam eine Fistelstimme. Im Schmuckkästchen hatte sie ihn schließlich mit sich geführt. Unsterblich, wie er war, krabbelte er wohl noch heute irgendwo herum, als die absolut müdeste Grille der Welt.
Er machte ein paar Schritte. Was er zuvor für einen Steinhaufen gehalten hatte, war ein kleiner Berg von dünnwandigen Metallbehältern, aus denen es nach verdorbenen Speisen stank. Dazwischen Fischköpfe, halbverwest, mit lückenhaften Skelettkämmen und Schwanzflossen. Ein bleicher Katzenschädel. Rostige, sechseckige Metallstücke mit einer interessanten Gewindebohrung in der Mitte. Außer Schmeißfliegen und Eidechsen kein lebendes Wesen. Wehmütig dachte er daran, wie er früher Eidechsen mit den Augen verfolgen und in der Zeit eines Lidschlags alle Punkte auf ihrer Haut hatte zählen können. Sein Puls wurde allmählich etwas schneller, und mit ihm das Denken und Erinnern. Im Vulkanfels hatte sein Herz langsamer geschlagen als bei Hamstern im Winterschlaf. Jetzt sah er ein Büschel Thymian, beugte sich schweratmend nieder, riß es aus und fraß es im Stück. Ja, Mut brauchte er jetzt, und Thymian, möglichst vermischt mit dem Kraut des Hyperion, konnte ihn liefern.
Wie war denn die Situation? Er war an einem Anfang, der wahrscheinlich das Ende von allem war.
Nach weiteren zwanzig wackligen Schritten stieß er auf ein rostiges Metallgestell, verbogen und halb überwachsen – eine Tierfalle? Und überall lagen Räder, kleine oder große. Die Menschen hatten in der Zwischenzeit eine Menge erfunden, und Hephäst, der in die Menschen als Gattung auf so ungöttliche Art verliebt war, hatte ihnen gewiß seine Künste beigebracht. Wenn Hephäst jemanden liebte, war Flucht angeraten. Wenn er einen haßte, ebenso. Alle Götter wußten: bei Hephäst gab es zwischen Liebe und Haß zu wenig Unterschied. Auf Erpressung lief beides hinaus.
Von Hephäst stammte die Idee, das Rad sei mehr als ein Symbol oder Folterinstrument, man könne in dieser Form einen neuen Menschen schaffen. Er hatte einen menschenähnlichen Körper gebaut, aber nicht mit zwei Beinen und zwei Armen, sondern mit acht Beinen. Die Füße, extra groß, ausgestreckt nach allen Richtungen, bildeten wirklich ein Rad. Der künstliche Mensch ging oder lief nicht dadurch, daß er die Füße abwechselnd nach vorn hob und belastete, sondern er drehte sich selbst immer weiter fort wie ein Knäuel trockenen Seetangs vor dem Sturm. Zeus hatte kopfschüttelnd abgelehnt, diesem Radmenschen Leben einzuhauchen – zu wenig erotisch schien ihm denn doch ein Geschöpf mit acht Beinen. Hephäst konnte offenbar nicht einsehen, daß für die Augen von Göttern nicht der schnellste, sondern der hübscheste Gang interessant war. Unwirsch murmelnd und zischelnd hatte er sich zurückgezogen und weiter Räder gebaut. Was er nicht mehr »Bein« nennen durfte, hieß fortan »Speiche«. Er hatte dann immerhin den Karren erfunden, womit er bei Helios Begeisterung auslöste und bei vielen anderen, die schwer zu schleppen hatten. Unterschätzen durfte man Hephäst nicht, auch wenn er der geborene Angeschlagene war. Sofort nach seiner Geburt hatte seine Mutter Hera ihn wegen seiner Häßlichkeit aus dem Olymp geworfen – sein Verhältnis zu ihr war seither gestört –, und er war ins Meer gefallen. Später, als er schon Schmied war, ärgerte sich sein Vater Zeus über ihn und warf ihn abermals hinunter. Diesmal schlug er auf der Insel Lemnos auf und blieb ein Krüppel, lernte aber dort die letzten Feinheiten seiner Kunst, bevor er in den Olymp zurückkehrte. Großes Können besaß er, blickte aber voll Haß, Gier und Götterverachtung auf das heitere olympische Leben, das an ihm vorüberging. Er hielt sich lieber an die Menschen. Von ihnen erwartete er Ordnung, Treue, Achtung vor der Kunst – alles, was Götter vermissen ließen.
Was ihm am deutlichsten fehlte, war Zartheit in der Begierde und damit, kein Wunder, irgendeine Anziehungskraft für die Zärtlichkeit anderer. Sowohl Eros als auch Anteros, der Gott der erwiderten Liebe, machten um Hephäst seit jeher einen großen Bogen. Daher war auch Aphrodite der von Zeus befohlenen Ehe mit dem verschwitzten Hammerschläger so rasch überdrüssig geworden. »Schönheit und Handwerk, symbolisch vereint« – eine bessere Formel für Langeweile gab es doch kaum! Sie hatte sich lieber heimlich von der bei weitem angenehmsten Lanze des Ares verwöhnen lassen. Außer Hephäst selbst war darüber niemand so recht entsetzt oder auch nur verwundert gewesen. Und Zeus war damals noch keineswegs auf die Seite des Hephäst getreten, sondern hatte völlig normal reagiert: vor Lachen gewiehert und sich auf die Schenkel geschlagen. So war Zeus gewesen, bevor seine ängstliche Verdrießlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit reichte. Diese allein war auch der Grund für das harte Urteil gegen Hermes gewesen. Die Verführung Aphrodites, von allen ohnehin erwartet, hätte noch in eine erstarrende und sich verdüsternde olympische Welt hineingepaßt. Nicht aber Hermes selbst, der Gott der quecksilbrigen Beweglichkeit und des Schabernacks.
Das Metallgestell war keine Falle, sondern ein ehemaliges Bett. Die auf ihm gespannte Kuhhaut war verwittert. Wieso schliefen die Menschen jetzt auf metallenen Spiralen? Ein unwissender, zurückgebliebener Gott zu sein war bitter. Aber der Thymian tat Wirkung, er mußte das auch. Ein Gott ohne Mut, was war das schon?
Die Möwen hatten mit einemmal andere Stimmen, sie bellten. Doch nein, da kamen ja wirklich Hunde, fleckige Hunde mit hängenden Zungen. Hunderte von Hunden – scheußlich. Und natürlich mittendrin Hekate, die Hundsgöttin, mit Säbelbeinen und Damenbart. Sie trug des Hermes Schwungsandalen und seinen Flügelhut, sogar den Schmetterlingsstab, das Phalaion. Die als Götterbotin? War Iris etwas zugestoßen?
Hekate versuchte sich mit ihren O-Beinen in jenem schwebenden Gang, mit dem Boten nach der Überlieferung vor die Empfänger hinzutreten hatten. Gut, sie wollte ihm Zeus' Aufhebung des Urteils verkünden und die Hermes-Insignien aushändigen, den Zauberstab eingeschlossen. Er nickte ihr freundlich zu. Schließlich mußte sie aufgeregt sein: dem Hermes eine Botschaft des Zeus zu überbringen, weiß Gott und Göttin, so was macht befangen.
Hekate stellte sich so erhaben wie möglich in die staubige Gegend und begann zu sprechen. Die Hunde setzten und langweilten sich gehorsam. Hekates Sprache war einfach und plump – Hermes konnte sie kaum verstehen. Vielleicht sprach sie sonst nur mit ihren Hunden?
»Guten Tag, Hermes. Der Herr der Welt schickt mich. Du bist frei und kannst dich auf den Weg machen. Meide aber das Festland von Hellas und meide vor allem Athen! Wenn du diese Verbote mißachtest, kommst du wieder in den Rauchfang. Folge der ersten Menschenfrau, die du triffst, zum Mittelpunkt der Welt. Dort wirst du erfahren, was der Herr mit dir vorhat. Hut, Stab und Sandalen bekommst du jetzt noch nicht – du erfährst es, wann es so weit ist. Hier ist eine Wegzehrung für den Anfang. Alles weitere mußt du dir selbst besorgen.«
Sie stellte einen Korb hin, in dem sich zittriger Geleepudding, Nektar und Ambrosia befanden, übrigens nicht allzuviel davon. Die Hunde schnüffelten und wollten sich auf den Korb stürzen, Hekate mußte sie anschreien, um sie zurückzuhalten.
»Ist das alles?« fragte Hermes.
»Ja.«
»Das heißt, ich kann noch nicht fliegen, nicht unsichtbar sein, niemanden in Schlaf versetzen mit dem Stab? Was, bitte, kann ich eigentlich?«
»Alles, was du ohne Sandalen, Hut und Stab immer konntest. Ich gebe zu, daß das nicht viel ist, aber es dauert ja nicht ewig. Leb wohl. Und vergiß nicht: du darfst nicht nach Athen, das wäre ein schnelles Ende deines Ausflugs.«
Die Hunde spürten, daß sie jetzt wieder belfern, schubsen, beißen und hecheln durften, ihre Herrin brach auf. Hermes hätte bei dem Lärm ohnehin keine Frage mehr stellen können, obwohl er viele parat hatte. Wo war denn der Mittelpunkt der Welt? Um so einen Unsinn hatte er sich nie gekümmert, Fragen der Mitte waren Sache Apollons. Aber da war sie auch schon wieder dahin, die überforderte Alte, die fehlbesetzte Hundsgöttin. Wie hatte Zeus sie aus der Unterwelt herausreißen und ausgerechnet zur Götterbotin machen können?
Und wieso nannte sie Zeus ständig nur »den Herrn«?
Hermes merkte, daß er einige Arme voll Thymian brauchen würde, um nicht melancholisch zu werden über der ganzen Armseligkeit seiner Wiederkehr. Jetzt gab es noch eine Hoffnung: die Menschen. Sie waren immerhin von den Titanen geschaffen, und eine Titanin war auch seine Mutter. Andererseits war er viel zu sehr Olympier geworden, um in ihnen etwas anderes zu sehen als ein Spielzeug. Sie hatten mitunter hübsche Schenkel, es war lustig, sie zu verführen. Auch veränderte sich das Spielzeug ständig selbst und sorgte so für Überraschungen, sogar bei gelangweilten Unsterblichen.
Inzwischen war zwar auch allen Olympiern deutlich geworden, daß sie ohne die Gehirne von Menschen nicht existieren konnten. Aber deren gab es ja genug.
Hermes machte sich mühsam, Bein vor Bein, auf den Weg nach Norden. Hoffentlich war der Mittelpunkt der Erde nicht zu viele Schritte entfernt.
*
Die helläugige junge Frau, die angab, die Befreiung des Hermes gesehen zu haben, stammte aus Stendal in der Altmark und hieß Helga Herdhitze. Den Nachnamen verwünschte sie. Er symbolisierte so gut wie alles, was sie hinter sich lassen wollte. Mit ihrem Vater verband sie eine Haßliebe – sie haßte ihn, weil er so weit hinter dem zurückblieb, was sie an ihm liebte. Er konnte auf seine wortkarge Weise fast jeden brauchbaren Gegenstand ausrechnen und herstellen, aber er konnte nicht lieben und nicht leben.
Ihr Nachname war für Helga der einzig erwägenswerte Grund zu einer frühen Heirat. Fehlte nur der passende Mann. Die, die ihr am beharrlichsten den Hof machten oder nachstellten, kamen am wenigsten in Frage. Es lag eindeutig daran, daß keiner von ihnen der kleinen Statue im Winckelmann-Museum, die sie schon mit zehn Jahren für sich entdeckt hatte, auch nur entfernt ähnlich sah. Von der Heiterkeit und Klugheit des Gesichts abgesehen – sie konnte und wollte sich nicht vorstellen, jemals einen Mann anzufassen, der nackt anders aussah als genau dieser Hermes aus Bronze.
Seit dem 9. Dezember 1989 war sie neunzehn. In ihr herrschte eine alles bedrohende Sehnsucht – mit der Gefahr der Haltlosigkeit –, vielleicht eine versteckte Kraft. Darüber wollte sie mehr herausfinden.
Sie liebte nichts, was gleich blieb oder sich nur auf eine vorhergesagte Weise veränderte, dagegen alles Überraschende, und wäre es der Tod. Langeweile tat ihr physisch weh. Um Langweiliges nicht hören zu müssen, pflegte sie sich im Unterricht die Ohren zuzuhalten. Sogar im Schlaf wechselte sie ständig die Lage; morgens sah ihr Bett aus, als hätten in ihm Kämpfe stattgefunden. Und ihr Interesse an der Geologie war nur des Vulkanismus wegen entstanden und auf mögliche Erdbeben oder Ausbrüche gerichtet. Darauf konnte sie hier allerdings lange warten. Stendal lag in einer sogenannten »letzteiszeitlichen Niederterrasse«, beschrieben auch als »Toteisdepression mit Stauchmoränen« – da regte sich nichts.
In Stendal war am 9. Dezember 1717 Johann Joachim Winckelmann geboren worden, der »beredte Verkünder der Kunst des Altertums«, so stand es auf seinem Bronzedenkmal in der Nähe des HO-Kaufhauses »Magnet«. Helga, die sich schon seit der Kinderkrippe fragte, ob die Welt überhaupt von ihr Kenntnis nehme, war oft zu Winckelmann gegangen, um wenigstens ihr eigenes Geburtsdatum, wenn auch nicht mit dem richtigen Jahr, in Bronze geschrieben zu lesen. Manchmal dachte sie auch daran, wie es wäre, wenn sie wirklich schon seit 1717 auf der Welt wäre und entsprechend viel wüßte. Ihre kindliche Gestalt und Sprechweise wären dann nur Tarnung einer riesigen Überlegenheit.
Ganz klein stand auf der Rückseite des Denkmals »LAUCHHAMMER« und »FUDIT«. Lauchhammer war eine Stadt und eine Gießerei, also mußte ein Mann namens Fudit die Figur gegossen haben. Ihr Vater konnte so etwas sicher auch, er verstand sich auf alles, was aus Metall zu machen war. Schade, in seiner Werkstatt am Tangermünder Tor waren Esse und Amboß selten in Funktion: er mußte Betriebsschlosser in einem landwirtschaftlichen Kollektiv sein und war fast nur noch dort. Arbeitete er wirklich einmal in der Schmiede, dann wurden neue Achsfedern für alte Autos daraus, aber niemals edle Gliedmaßen und kluge Gesichter. Und er war so mutlos geworden, hatte Mutters Tod vor elf Jahren nie verkraftet und sprach immer wieder offen vom »Schlußmachen«.
Inzwischen wußte sie, daß »fudit« die Perfektform eines lateinischen Verbs war: Lauchhammer, die Gießerei, »fudit« – hatte gegossen. Ferner war sie gegen Winckelmann eingestellt. Der hatte eine Art ewiger und allgemeiner Schönheit erfunden, und der mißtraute sie wie jeder anderen Allgemeinheit. Sie witterte sogar Direktverbindungen zwischen der »edlen Einfalt« Winckelmanns und einer erlogenen Einheit ringsum. Und »stille Größe«, das war doch immer die des Opfers! Sie wollte lieber sterben als Opfer sein.
Sie war stets »die Dünne« gewesen, wirkte fast magersüchtig, war blaß, sommersprossig und in ihren Bewegungen so spinnenartig schnell, daß ihr Gesicht sich nur ganz wenigen wirklich einprägte. In der Schulzeit gehörte sie zu den besten Tischtennisspielerinnen, träumte dann von schweren Motorrädern und machte den Führerschein, wurde aber trotzdem nur lernend oder lesend angetroffen, oft auf den Bänken bei den Denkmälern Winckelmanns und Lenins. Sprach man sie an, redete sie so schnell, daß man zweimal um Wiederholung bitten mußte. Sie saß immer öfter in der leeren Schmiede des Vaters, sogar nachts im Lichtkegel einer grellen Arbeitslampe.
Nach der Schule arbeitete sie eine Zeitlang in der Bibliothek des Reichsbahn-Ausbesserungswerks. Sie wollte mit Büchern zu tun haben, vielleicht Geologie oder Archäologie studieren – denn Interessantes war hierzulande bestimmt nur noch unter der Erde zu finden –, außerdem reisen, um zu sehen, ob die Welt jenseits der Grenzen mehr mit ihr zu tun hatte als die um sie herum. Sie lernte die Sprachen der Länder, in die sie vielleicht einmal fahren konnte: Polnisch, Ungarisch, sogar Serbokroatisch, obwohl sie kaum Hoffnung hatte, je nach Jugoslawien zu kommen – das war ja schon wie Westen. Sprachen zu lernen fiel ihr leicht, und wenn sie einen Ausländer zu fassen bekam, konnte sie seine Sätze bald fehlerlos nachsprechen.
Sie saß in der Werkstatt, weil sie hier den Beginn und Mittelpunkt allen Unglücks sah, auch des eigenen. Die angerosteten oder fettglänzenden Werkzeuge, deren Namen ihr von Kind an vertraut waren, der Bodenbelag aus Ruß, Staub und Feilspänen, der unter den Schlägen der Hämmer bucklig gewordene Amboß mit dem mächtigen Dorn und dem viereckigen Loch, in das der Meißel zum Abschroten gesteckt wurde, Setz- und Vorschlaghämmer, Gesenke, langstielige Zangen – Denkmäler vergangener Geschäftigkeit, stumpf und blind jetzt, eisentot wie der Lenin am Tangermünder Tor.
Wenn ein Geruch zum Selbstmord führen konnte, dann der nach kaltem Schmierfett und Kohlenasche. Aber gerade hier wollte sie lesend Anlauf fürs Leben nehmen. »Fort von hier«, sagte jeder Gegenstand in diesem Raum. Angefangene Reparaturstücke und gerissene Ketten, der geborstene Karren, hohe Haufen von Hufeisen längst toter Pferde, starre Türme aus kaputten Autofedern, das war jene einst ehrwürdige Vergangenheit, die von irgendeinem Zeitpunkt an nur noch in Richtung Einsamkeit, Langeweile und Verrotten unterwegs gewesen war. Irgendwann hatten die Schmiede ihren großen Verrat an Esse und Amboß begangen. Als Kind hatte sie ihren Vater noch Gartentore schmieden sehen. Er hatte sogar Neues erfunden, ein fußgesteuertes Schwungfahrrad für einen Armlosen und eine noch nie dagewesene Fuchsfalle. Und er machte alles aus Resten, sah sofort Möglichkeiten, improvisierte. Er konnte alles, aber jetzt sah er keinen Sinn mehr darin, und das war Verrat am Können, aus Mutlosigkeit.
Ende der Leseprobe