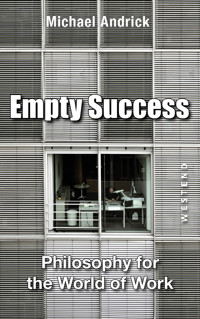Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Eigensinn und Ideale stören, wo der Ehrgeiz regiert. In unseren »Arbeitswelten« sind konforme und strebsame Funktionäre erfolgreich. So produzieren wir Brot, Bücher und Bomben mit derselben abgeklärten Professionalität. Was wird dabei aus unserer Welt – und aus uns? Michael Andrick, bekannt u.a. aus Süddeutsche Zeitung, stern, Deutschlandfunk Kultur und WDR, durchleuchtet unser Dasein in der Industriegesellschaft schonungslos und zeigt: Wer unter Anpassungsdruck selbstbestimmt leben will, der muss das Philosophieren lernen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Andrick
Erfolgsleere
4., überarbeitete Auflage 2021© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2022Alle Rechte vorbehaltenwww.herder.deUmschlaggestaltung: Verlag HerderUmschlagmotiv: © werayuth/GettyImages/iStockSatz: SatzWeise, Bad WünnenbergHerstellung: GGP Media GmbH, PößneckPrinted in GermanyISBN (Print) 978-3-451-39377-8ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-82802-7ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-82801-0
Inhalt
1. Das Rätsel unserer Normalität
2. Handwerk des Lebens
Der Zeitgeist
Wertvorstellungen
Sich selbst erzählen
Philosophieren ist das Handwerk des Lebens
Was ist Moralität?
Die Entstehung unserer Lage
3. Moralität und Anpassung
Mitglied werden und selbständig bleiben
Die stille Macht des Nachdenkens
Wie Funktionäre ums Leben kommen
Wie Menschen am Leben bleiben
4. Die Ordnung des Ansehens
Unsere Selbstverständlichkeitenund ihre Vorgänger
Der Druck von Jahrhunderten
Sprachfindungsstörung
Das Gehäuse des Ehrbegriffs
Respekt als Autoritätskult
Zugesprochene Persönlichkeit
Soziale Navigation
5. Erlösung im Erfolg?
Ablenkungsstress
Karriere als Standardidentität
Lauwarme Erlösung und Funktionärsreligion
Mythos des Erfolgs
Würde des Profits
Die pseudomoralische Fassade des Betriebs
6. Arbeitswelt statt Wirklichkeit
Arbeitswelt, oder: Ein Teil spielt Ganzes
Der Weg in die Teilwelten-Welt
Verdrängung des Wirklichen
Rationalität und Vernunft
In der Wirklichkeit leben
7. Professionalität und Führung des »Humankapitals«
Professionalität als befreiender Gehorsam
Führung als Veränderungskunst
Wer kann führen?
Moralische Tücken der Veränderung
Die moralische Dauerkriseder Führungskraft
Das Alibi des Relativismus
8. Ehrgeiz und Erstarrung
Die Wahrheit sagen
Annäherung an den Ehrgeiz
Die Leere der Ehre
Ehrgeiz ist pseudomoralischer Wahnsinn
Das übliche Verhängnis
Der eigene Ausweg
Die Gefahr, dass die Maschinen die Menschen verwandeln, ist nicht besonders groß; größer ist die Gefahr, dass gleichzeitig mit den Maschinen verwandelte Menschen auf die Welt kommen werden: Menschen wie Maschinen, die Impulsen gehorchen, ohne die Möglichkeit zu haben, diese auf ihre Art zu untersuchen.
Harry Mulisch
Man ist zu – mir fällt kein anderes Wort ein – ein zu großes Massentier geworden … Ja, ein Massentier, ein Gewohnheitstier; man ist – hat man Befehl bekommen, hat man automatisch die Hacken zusammengeschlagen und »Jawohl!« gesagt.
NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann;aus Prozessprotokollen zitiert bei Harry Mulisch
Kannst du dir selber dein Böses und dein Gutes geben und deinen Willen über dich aufhängen wie ein Gesetz?
Friedrich Nietzsche
Rebecka – Ich danke Dir von ganzem Herzen für Deine immense Geduld mit mir und meinen exzentrischen Vorhaben. Und für den Buchtitel!
1. Das Rätsel unserer Normalität
Warum geschieht in der Welt so vieles, das die einzelnen Menschen je für sich verabscheuen und bedauern? Diese Frage sprang mich als Jugendlicher aus den Büchern und aus den Nachrichten an; seitdem blieb sie immer bei mir. Als ich dann ins Berufsleben eintrat und Familienvater wurde, stellte sich immer bestimmter eine gewisse Ahnung ein: Irgendwie muss die richtige Antwort auf meine Frage nach dem Rätsel unserer Normalität damit zu tun haben, was unsere Arbeitswelt mit uns anstellt. Ich beschloss also mir klarzumachen, was im Arbeitsleben genau mit uns passiert. Das Ergebnis ist ein Buch für jeden, der Arbeiten geht. Es begann als ein längerer Tagebucheintrag; es wurde eine Philosophie für die Arbeitswelt.
Am Anfang steht Verwunderung über mich selbst und über uns. In der industrialisierten Welt führen wir heute ein Alltagsleben, das auf der Entrechtung und körperlichen Ausbeutung von Menschen (als »Human Resources«) und auf der planmäßigen Zerstörung des Ökosystems beruht. Wir zahlen Spottpreise für die Spielzeuge unseres Konsumzeitvertreibs und für die Kellner- und Laufburschenstaffage unserer Pauschalurlaube an den Küsten der Ozeane und an den Trögen der Frühstücksbuffets. Die Rechnung für unsere immense »Kaufkraft« wird an den verlängerten Werkbänken der westlichen Staaten, im »Globalen Süden« der Ausgebeuteten, für uns beglichen – nicht in Geld, sondern in menschlichem Leid, in Perspektivlosigkeit und Verzweiflung.
Eine parteilich-koloniale Handels- und Subventionspolitik der reichen Länder stellt diese Verhältnisse auf Dauer, wann immer nötig mit der Gewalt des Militärs und des Finanzsystems. In den Routinen unseres Arbeitslebens bespielen wir das so bereitete Feld und freuen uns kollektiv in den Abendnachrichten, wenn der Gesamtumsatz dieser »Weltwirtschaft« Jahr um Jahr wächst. Es ist nicht so, dass die menschengemachte Maschine der Industriegesellschaft unsere Mitmenschlichkeit überwältigt hätte. Aber wir werden sehen, dass sie die Ansprache unserer mitmenschlichen Solidarität stark erschwert hat.
Wir sind erstaunliche Kulturwesen; die Besatzung eines beliebigen U-Bahnabteils in unseren Städten bringt jeden Tag die unterschiedlichsten Dinge unter den einen Hut unserer Zivilisation. In der Summe vieler kleiner Handlungen exekutieren wir in der industrialisierten Welt jeden Tag einen gewissenlosen Betrieb, der menschliches Leid und die sich entfaltende ökologische Katastrophe routiniert ignoriert. Was hat nicht alles in der Normalität unserer Industriegesellschaften Platz?
Blicken wir uns um. Wir verbreiten irreführende Propaganda zum Schutz von Profiten etwa in der Tabak-, Öl- oder Zuckerindustrie; wir verwenden generell einen großen Prozentsatz unserer gesamten Wirtschaftstätigkeit auf systematisches Aufbauschen und Irreführen (Marketing) und überfluten dabei z. B. Kleinkinder mit Werbung für gesundheitsschädliche »Lebensmittel«, die sie umsatzsteigernd früh chronisch krank machen; wir produzieren Personenminen, die dann weniger Soldaten töten als spielende Kinder verstümmeln; wir erfinden Papiere, mit denen wir auf den Wertverfall genau der Papiere spekulieren, die wir unseren eigenen Bankkunden gestern noch als Geldanlage verkauft haben, und vernichten dabei deren Ersparnisse; jüngst in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und der Türkei (und früher auch in Deutschland) fälschen wir »Beweise« zur Rechtfertigung von Angriffskriegen, die hunderttausende Unschuldige töten, vertreiben und sie Folter und Vergewaltigung aussetzen, um den Zugang zu Rohstoffquellen zu sichern und die heimische Militäroligarchie zu pflegen; wir fahren als einzelne Personen in tonnenschweren Blechkonstruktionen mit Verbrennungsmotoren durch die Gegend; wir nutzen nie verrottende Wegwerfprodukte für alltägliche Mahlzeiten und geben das Plastik damit den Fischen der Meere zu fressen; wir subventionieren unsere Agrarprodukte so, dass Bauern in ärmeren Erdteilen konkurrenzunfähig werden, und lassen die oft vor diesem Elend Flüchtenden in unseren Grenzmeeren ertrinken, während wir die Überlebenden mit Grenzzäunen aus Rasierklingen willkommen heißen; wir machen mancherorts Gesundheitsvorsorge zu einem Geschäft und lassen deshalb unzureichend reiche Menschen einfach bankrottgehen und verrecken, wenn sie krank werden usw.
Das ständige »wir« in diesen Ausführungen kann beleidigend wirken, aber halten wir das für den Moment einmal aus: Viele Ergebnisse unserer Zivilisation sind eben grauenvoll. Manche Phänomene können wir vielleicht abnorm grausamen Einzelnen, verbrecherischen Politikern und der Imperialpolitik der gerade herrschenden Großmächte zuschreiben. Aber die meisten dieser Missstände bringen wir selbst durch unsere Arbeit und durch unser Konsumverhalten mit zustande. Und wir autorisieren unsere Repräsentanten dazu, sie fortzuschreiben – sei es im Einzelfall auch nur aus Lethargie, Desinteresse und Ignoranz. Alle oben genannten Praktiken sind in unserer Gesellschaft als unterschiedliche Ebenen der Politik- und Erwerbsarbeit etabliert oder stellen legales Freizeitverhalten dar.
Deshalb entsprechen den aufgeführten Tatbeständen auch an jeder Stelle Berufsbezeichnungen, die in den westlichen Gesellschaften vollkommen »seriösen« Status haben: Public Relations Berater, Marketingexperte oder Vertriebsstratege, Wehrtechnikingenieur und Rüstungsmanager, Anlageberater oder Investmentbanker, President of the United States, Sicherheitsdienstleister, Autoingenieur, Bauernverbandsvertreter, Innen- oder Heimatminister, Reisekaufmann usw. Diese Berufe werden fast nie von Verbrechern ausgeübt, und doch erzielen sie im Zusammenspiel ihrer unterschiedlichen »Arbeitswelten« mit bürokratischer Zuverlässigkeit beschämende Ergebnisse.
Aber wie? Wie erreicht die Industriegesellschaft unseren Konformismus – unser praktisch vorbehaltloses Tun zu allen nur möglichen Zwecken? Denn wir üben die gerade aufgeführten Berufe aus. Wir betreiben die Industriegesellschaft, die diese katastrophalen Ergebnisse hervorbringt, in der vagen und behaglichen Einbildung, für das Elend der Welt selbst unzuständig zu sein. Dabei sind wir offenkundig allein dafür zuständig; es gibt außer dem Menschen kein moralisches Wesen auf der Erde, das Verantwortung tragen kann. Wie verbergen wir unser tatsächliches Tun also vor uns selbst und voreinander? Wie machen wir einander das, was wir über uns selbst und unser Tun doch wissen, alltäglich unbewusst, so als lebten wir in einer moralischen Anästhesie? Dies ist das Rätsel unserer Normalität.
Und diese Normalität ist nicht kürzlich entstanden, sie ist eine langsam gewachsene geschichtliche Gemengelage. Auf den jüngeren Etappen dieser Entwicklung im 20. und 21. Jahrhundert stechen Kriege, Völkermorde und Vertreibungen nur als Inseln besonders intensiver Vernichtung hervor. Die Antwort auf die Frage, wie unser heutiger, individueller Konformismus des Alltags möglich ist, muss deshalb auch ein neues Licht auf diese Geschichte werfen. Sie verschafft uns einen neuen Zugang auch zu Fragen wie diesen: Wie waren die gnadenlosen, zynisch kalkulierten Vernichtungsfeldzüge gegen unschuldige Menschen möglich, auf deren furchtbare Serie unser Schulunterricht bloß einige wenige Schlaglichter wirft? Wie konnte eine Wirtschaftsordnung über die Welt verbreitet werden, die auf schnellstmöglichem Verbrauch von Rohstoffen basiert – und die damit rational kalkuliert die Umwelt zerstört und radikale Ungleichheit produziert?
Mit dieser knappen Skizze unserer rätselhaften Normalität haben wir einen gewaltigen Erklärungsbedarf in den Raum gestellt. Wer so drastisch »A« sagt, der muss nun auch »B« sagen. Wir müssen herausfinden, wie diese Lage des Großen und Ganzen entstehen konnte, die sich für uns westliche Wohlstandsmenschen dabei so unverschämt annehmlich anfühlt – und wir müssen verstehen, was diese Lage für unser persönliches Leben bedeutet. Ein naheliegender Ansatzpunkt dieser Klärung wäre, die Überlegungen historisch anzulegen. Der Geschichtsforscher will zum Beispiel wissen, wie genau bestimmte Verbrechen begangen worden sind und welche speziellen Umstände sie jeweils erlaubt oder befördert haben. Irgendwann einmal sozial akzeptierte Verbrechen – genau wie die, die heute Teil unserer globalen Normalität sind – werden in einen weiteren Zusammenhang gestellt und so mehr oder minder nachvollziehbar gemacht.
Dieses Buch will dagegen philosophisch an das Rätsel herangehen und es aufklären. Wir werden hier und da zwar historische Geschehnisse ansprechen, aber unsere leitende Frage lautet nicht, wie genau etwas historisch geschehen ist. Die uns interessierende philosophische Frage ist, ob die typischen Muster des Geschehens eine eigene Logik zu erkennen geben. Wir suchen das Prinzip unserer rätselhaften Normalität, ihre treibenden Motive, Denk- und Verhaltensmuster – und deren Ursprung. Auf Grundlage welcher bekannten Kräfte und ihres Zusammenwirkens sind die dramatischen Missstände unserer Normalität zu erwarten? Inwiefern haben die unmenschlichen Aspekte der Industriegesellschaft ebenso System wie mancherorts die pünktliche Auszahlung ihrer Sozialleistungen? Wie sind wir in dieses System einbezogen, wie können wir uns vor seiner Gewissenlosigkeit bewahren, und wie können wir es verändern?
Eine philosophische Nachforschung entwickelt sich bei mir immer aus einigen mehr oder minder verknüpften Anfangsvermutungen, gepaart noch mit einer bohrenden Neugierde oder Empörung – in jedem Fall gibt es eine Art Klärungswut, die mich antreibt. Die konkrete Mischung von Annahmen, Ahnungen und Absichten, die dieses Buch motivieren, ergibt sich aus den »Erfahrungszutaten« meines Lebens. Ich will sie kurz erwähnen, weil sie etwas Licht auf den Stil und die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Textes werfen. Ich stecke als Manager in einem typischen Berufsleben und habe dabei den untypischen Studienhintergrund von Philosophie und Geschichte. Deshalb kenne ich die gnaden- und ausweglose Langeweile sinnloser Abstimmrunden unter Kollegen ebenso wie die nicht minder drückende Langeweile verquaster Seminare zu Platon und Hegel; ich kenne aber auch den Spaß an guter Zusammenarbeit in gelingenden Projekten der Wirtschaft und die Faszination einer Seminardiskussion, in der die Studenten tatsächlich etwas von Bedeutung einsehen.
Mein Alltag ist geprägt von rationaler Arbeit im Betrieb mit meist klaren Zielvorgaben, aber meine Ausbildung ist vernünftiges Nachdenken abseits aller Zielvorgaben (Philosophie). Ich habe mich deshalb an der intellektuellen Aufarbeitung von weit gefassten Fragen ebenso versuchen können wie an der pragmatischen Auflösung wirtschaftlicher Probleme. So habe ich aus eigener Anschauung etwas über die Strukturen und Kräfte gelernt, die dabei in unseren Institutionen jeweils im Spiel sind. Die begriffliche Gymnastik des Philosophiestudiums, die ich einmal eifrig absolviert habe, prägt mein Nachdenken genauso wie meine Erfahrungen als Führungskraft. Meine Hoffnung ist es, dass sich auf dieser Grundlage ohne Fachjargon und Fremdworthagel ein neues Licht auf unsere Welt aus Arbeitswelten werfen lässt. Versuchen wir es also.
Dazu treten wir zunächst einen Schritt zurück von den einleitenden Bemerkungen; wir nehmen den nötigen Anlauf und machen eine Folge von Gedankenschritten, die zusammengenommen ein geschärftes Verständnis unserer Gegenwart ergeben. Es ist nicht so, dass wir »den Faden« der Anfangsdiagnose nun »fallenlassen«, um ihn dann einige Kapitel später »wieder aufzunehmen«. Im Gegenteil: Wir sehen uns nun die Fasern an, aus denen dieser Faden gesponnen ist, dessen Gewebe unsere Wirklichkeit wurde.
Die begrifflichen Mittel, mit denen wir die Machart und das Muster dieses Gewebes klarer erkennen können, erarbeiten wir uns schrittweise. Dabei spielen unterschiedliche Aspekte der Anfangsbetrachtung zum Rätsel unserer Normalität laufend eine Rolle; es geht aber gerade am Anfang dieses gedanklichen Wegs auch um die Einführung einiger philosophischer Grundüberlegungen. Mit ihnen im Rücken können wir die gesuchte Logik unserer verhängnisvollen Normalität dann Zug um Zug herausarbeiten.
Kapitel 2 und 3 bilden eine kurze Einführung in die lebenspraktische Bedeutung der Philosophie für jeden, der in Gesellschaft lebt. Besonders wichtig ist mir dabei der Nachweis, dass Philosophieren keine abgehobene Expertentätigkeit ist, sondern eine natürliche Tätigkeit jedes Menschen. Der vierte Abschnitt zeigt historisch, wie die Logik von Ansehen und Status entstanden ist, die den Alltag in unseren Industriegesellschaften bestimmt und unser Verhalten strukturiert. Dann geht es in vier Kapiteln um unterschiedliche Aspekte unseres Lebens in Arbeitswelten: Um die eigentümliche Art von Erlösung, die das rationale Streben nach Erfolg uns zu verschaffen scheint (»Erlösung im Erfolg?«); um die Distanz zur Wirklichkeit, in die wir dabei geraten (»Arbeitswelt und Wirklichkeit«); um das Wechselspiel von Professionalität und Führungshandeln, das den charakteristisch limitierten menschlichen Umgang in unseren Institutionen prägt (»Professionalität und Führung des ›Humankapitals‹«) – und schließlich um den Ehrgeiz, der die Karrieren antreibt und der sich bei näherer Analyse als eine bestimmte Art von Wahnsinn erweisen wird (»Ehrgeiz und Erstarrung«).
Der schrittweise Aufbau der Überlegung ist nicht einfach nur nützlich zur Auflösung des Rätsels unserer Normalität. Er entspricht auch der lebensphilosophischen Aufgabe, vor der jeder einzeln steht. Ob man zu einem zufriedenen Eigensinn seiner Lebensführung gelangen kann oder nicht, hängt stark davon ab, wie man sich seine Lebensumstände vorstellt. Und die Gegenwart, in der ein Mensch sich findet, ist immer komplizierter, als er verstehen kann.
Erlittene Schmerzen und durchfieberte Euphorie, der fadenscheinige Flickenteppich unserer Erinnerung, das Eintauchen in unsere (papiernen oder digitalen) Filterblasen Gleichgesinnter, schließlich noch die halb verdauten, halb vergessenen Wissensbrocken unserer Schulzeit – all das macht uns zwar zu dieser oder jener bestimmten Person. Es führt uns aber sicherlich nicht auf einen objektiven, d. h. den Dingen und Menschen gerechten Standpunkt der Betrachtung und Beurteilung. Dazu kommt, dass es die Gegenwart und ihre großen und kleinen Machthaber sind, die Posten und Sicherheiten zu verteilen haben. Wir haben deshalb einen starken Anreiz, die gegenwärtigen Verhältnisse als »die Lösung« oder »das Richtige« zu akzeptieren – da wollen wir nicht in erster Linie fragen, mäkeln, unser Verständnis schärfen. Wir wollen mitmachen dürfen.
Es ist deshalb unrealistisch zu meinen, dass wir unsere eigene Gegenwart einfach so verstehen und sie realistisch betrachten. Trotzdem müssen wir uns selbst im Zusammenhang unserer Gegenwart begreifen. Denn wer sich auf den Weg machen will, muss erstmal herausfinden, wo er eigentlich gerade ist. Um sich seine Umgebung richtig vorzustellen, ist ein Ausgriff in die Vergangenheit und ein gezielter Umweg über das Nachdenken nötig; man muss sich bewusst ein Bild machen, um eingeschliffene »Kurzschlüsse« und Vorurteile hinter sich zu lassen. Im Verlauf des Buchs greifen wir deshalb immer wieder gewohnte Begriffe und Denkweisen auf, durchleuchten sie und verwenden sie in etwas anderem Sinne weiter. Das macht ein wenig Arbeit, aber Aufklärung ist eben Arbeit – wie ja auch ein gelingendes Leben in Arbeit besteht; in der Arbeit an sich selbst im Lichte der Erfahrung.
2. Handwerk des Lebens
Der Zeitgeist
Nähern wir uns der Philosophie von der Sprache, also von ihrem Werkzeug und Medium her. Unsere Sprache ist die Wohnung unserer Gedanken und Gefühle. Die Zimmer, Flure und Erker dieser Wohnung sind uns vertraut. Wir haben sie aber nicht selbst entworfen und gebaut, sondern uns einfach in ihnen eingelebt. Manche Aussichten und Einblicke macht der Grundriss unserer Sprache uns leicht. Andere Erkenntnisse aber sind uns wie durch Mauern verstellt, weil unsere Sprache uns keine Begriffe und Bilder anbietet, mit denen wir diese Einsichten zu fassen bekommen könnten.
In ihrer Gesamtheit betrachtet enthält unsere Sprache ein bestimmtes Bild der Wirklichkeit. Zum Beispiel zeigt uns eine Erkundung unseres Gebrauchs großer Worte wie »Freiheit« oder »Recht«, was wir uns unter Freiheit und Recht eigentlich konkret vorstellen. Aber es sind ebenso sehr Analysen »kleinerer« Sprachgewohnheiten, die unser gewohntes Weltbild und seine kleinen Absurditäten aufdecken können. Zum Beispiel nennen wir uns selbst »Arbeitnehmer« und die Institution, die uns beschäftigt, »Arbeitgeber«. Dabei ist es genau umgekehrt, wie Friedrich Engels einmal anmerkt: Wir geben gegen Geld unsere Arbeitskraft einer Institution, die Institution nimmt unsere Arbeit entgegen. Wir sind die Arbeitgeber; Unternehmen, Verwaltungen und viele andere Einrichtungen sind die Arbeitnehmer. Diese Einsicht verstellt uns die gewohnte Sprache.
Jeder unserer Sätze baut auf die ganze Wirklichkeit, die unsere Sprache als Ganze betrachtet darstellt; jeder Satz führt uns an einen festen Punkt in den Grenzen dieser Weltsicht. Wie wir unsere Worte zu setzen gelernt haben zeigt, in welcher geistigen Wohnung unser Denken, Fühlen und Tun sich eingerichtet hat. Der Grundriss unserer Sprache zeigt deshalb den Zeitgeist unserer Gegenwart. Der Zeitgeist sagt uns, wer wir sind, wie wir in die Welt und unter andere Menschen passen und was wir zu erwarten haben. Er regiert die Welt durch unser Denken, Sprechen und Tun. Zum Beispiel macht der Zeitgeist uns glauben, wir seien (zum Dank verpflichtete?) Arbeitnehmer und andere die (großzügigen?) Arbeitgeber. »Ein Wort an die Stelle eines anderen setzen heißt, die Sicht der sozialen Welt zu verändern und dadurch zu deren Veränderung beizutragen« (Pierre Bourdieu).
Nachdenken heißt, gegen den Zeitgeist Einspruch einlegen. Eine Frage stellen bedeutet eigentlich, den Aufstand gegen unsere Sätze proben: gegen den Anspruch ihrer vorgeblichen Tatsachen auf unseren Glauben und unsere Gefolgschaft. Fragen ist das Innehalten im Sprechen und Denken, die Unterbrechung des normalen Gangs der Dinge am Geländer des Zeitgeistes zugunsten des Nachdenkens. Viele Fragen stellen heißt, den Aufstand gegen die ganze Weltsicht unseres Zeitgeistes proben.
Mit diesem Nachdenken erst fangen wir an, als Personen zu existieren und nicht bloß als Resultat unserer Lebensumstände. Nachdenken ist die Selbstbehauptung des Geistes gegen die Gewohnheit, die uns in ihrer Gewalt hat. Anders gesagt: Erst Fragen und Nachdenken macht dieses empfindende Ich, in dem alle möglichen Wahrnehmungen aufkommen, sich regen und wieder schwinden, zu mir selbst. »Persönlichkeit (…) ist das einfache, beinahe automatische Ergebnis von Nachdenklichkeit« (Hannah Arendt).
Um selbst zu leben – d. h. nach eigener Regel und nicht einfach als menschgewordener Ausdruck unserer Zeit –, müssen wir der Regierung des Zeitgeistes unseren persönlichen Freiraum abringen. Viele schaffen dies ohne besondere Anstrengungen und Grübelei, einfach durch eine gute Fügung ihrer Erfahrungen und Begegnungen: Sie erleben in der Familie, dass sie gewollt und geliebt sind, und so entwickeln sie ein sicheres Gefühl dafür, wer sie als Erwachsene werden wollen, und gehen ihren Weg mit Kraft, Sicherheit und Ruhe. Es zeigt sich ihnen mit der Zeit, wofür es sich zu arbeiten lohnt; was andere sagen und wollen, ist für sie zwar interessant, aber nicht entscheidend. Viele aber haben dieses Glück nicht – etwas stört ihre Kreise oder fehlt in ihren Kreisen, das ihnen diese ruhige Selbstbestimmung geben könnte. Ein leitendes Gefühl für Sinn und Richtung ihres Lebens stellt sich nicht ein, sondern es stellt sich vielmehr eine Frage: Was ist mit mir, dass ich so bin und nicht zufrieden mit mir selbst werde?
Um dieser Frage beizukommen, um zu uns selbst zu kommen, brauchen wir eine Erklärung unseres Zeitgeistes – eine Philosophie unserer Gegenwart, die uns sagt, wie wir gelernt haben zu denken, zu sprechen und zu leben, wie wir es jetzt tun. Erst auf dieser Grundlage können wir dann selbst fragen, nachdenken und handeln, um unserer Gesellschaft einen eigenen Lebensweg und auch, zusammen mit anderen, eine eigene Politik abzutrotzen. Haben wir keine Philosophie unserer Gegenwart, so spricht aus uns allein der Zeitgeist. Wir leben dann als Marionetten der Vergangenheit und vielleicht, wenn wir ehrgeizig sind, als die Puppenspieler der Gegenwart, ohne aber dabei zu uns selbst zu kommen. Beginnen wir deshalb unsere Überlegungen am Ziel des philosophischen Nachdenkens, bei uns selbst.
Wertvorstellungen
»Zu sich selbst kommen« – das klingt so, als wäre das Selbst schon da, wie ein besonders kostbarer Gegenstand in unserem Seelenhaushalt, und man müsste sich ihm nur zuwenden, nachdem man den Unfug gewisser Ablenkungen einmal eingesehen hat. So ist es aber nicht. Mein Selbst ist nicht schon da, und es ist deshalb verkehrt zu meinen, man könne sich einfach etwas mehr darauf konzentrieren, um auf den »rechten Weg« zu kommen. Wir sagen zwar alle »Ich«, aber kein Ich ist ohne weiteres auch gleich ein Selbst.
Erst das von sich selbst erzählende Ich macht das Selbst; mein Selbst ist die Geschichte davon, wer ich bin. Nur in diesem Sinne ist es »schon da«: Ich kann es mir wie einen Schattenriss aus meiner Erinnerung wieder und wieder zeichnen, jedes Mal ein wenig anders. Diese Erzählung bedeutet alles. Sie zeigt meine Vorstellung davon, was meine Mühe lohnt, auf welchem Weg mein Leben mir gelingt und wie es mir entgleiten könnte. Meine Geschichte ist nur im stillen Gespräch des Nachdenkens und im vertrauensvollen Austausch mit anderen lebendig; sie ist Ausdruck meiner Wertvorstellungen und hat keinen Maßstab, kein Richtmaß außer diesen. Auf die Wertvorstellungen einer Person kommt für ihr Leben alles an, denn sie leiten ihre Bestrebungen, sie begründen ihre Ängste und bestimmen ihre Ambitionen.
Ich stelle mir dabei das Wertvolle, auf das es uns im Leben ankommt, als abwesend oder zumindest undeutlich vor – deshalb spreche ich von Wertvorstellungen anstatt einfach von Werten. Diese spezielle Wortwahl zeigt an, dass ich den Wert gewisser Dinge, gewisser Verhaltensweisen und Einstellungen, nicht direkt und sicher erkenne. Ich stelle mir nur vor, sie hätten einen Wert. (Eine Ausnahme bildet allein, was ich liebe; dazu mehr ganz am Ende des Buchs.) Diese Schwierigkeit mit Wertvorstellungen ist nicht nur mein persönliches Problem; dass ich so zu reden und zu denken gewohnt bin, bringt vielmehr ein bestimmtes Wissen unserer Kultur zum Ausdruck.
Betrachte ich nur mich selbst, so meine ich zu wissen, welchen Dingen ich Wert beimesse und warum. Aber vom Standpunkt eines anderen Menschen aus betrachtet kann diese, kann meine Überzeugung nüchtern nur als Wertvorstellung betrachtet werden. Denn es fällt tatsächlich unterschiedlich aus, was unterschiedliche Menschen als Wert erkannt zu haben meinen. Wir leben also mit der Schwierigkeit, dass unsere subjektiven Einsichten in das Wertvolle ständig durch die Werturteile anderer Leute in Frage gestellt werden. Diese Anderen urteilen dabei in gleicher Weise wie wir selbst aufgrund ihrer speziellen Lebenserfahrung. Wir können diese Unterschiede erkennen, sofern wir in derselben geistigen Wohnung, in derselben Sprache beheimatet sind wie die Anderen; aber es bleiben echte, substantielle Unterschiede.
Aus dieser Wirklichkeit lernen wir, von unseren Wertvorstellungen zu reden und sie damit schon, jeder möglichen Diskussion vorauseilend, zu relativieren. Wir sprechen von unseren Werten, also davon, worauf es uns im Leben ankommt, und wir stellen sie zugleich in Frage. Keinem anderen bedeutenden Begriff, mit dem wir uns in der Welt orientieren, tun wir dies an; wir sprechen z. B. nicht mit der gleichen Geläufigkeit von unserer »Freiheitsvorstellung« oder unserer »Rechtsvorstellung« – wir sprechen einfach von Freiheit und Recht. Aber wir sprechen von Wertvorstellungen.
Diese zögerliche, problematisierende Haltung in Hinsicht auf unsere persönlichen Werte hat ihre Stimmigkeit und Berechtigung. Anders als z. B. bei Feststellungen über die uns gemeinsame Welt der materiellen Dinge – der Tische, Stühle und Aschenbecher – trauen wir unserer Gesellschaft in Wertfragen keinen naturwüchsigen Konsens der Auffassungen zu. Deshalb trauen wir auch uns selbst nicht ohne weiteres klares Wissen in Wertfragen zu und lernen in unserer Gesellschaft auch nicht, in erster Linie solches Wissen zu wünschen und zu suchen. Das aber steht in Spannung zu der früheren Feststellung, dass es für unser Leben als Person entscheidend auf unsere Wertvorstellungen ankommt.
Wie oft haben wir jemanden fragen hören: »Was ist in dieser Situation das Richtige? Was soll ich tun?« So oft wir solche Fragen auch immer gehört und diskutiert haben mögen – diese Erlebnisse verblassen sicherlich angesichts der unendlichen Verhandlungen der Frage »Was will ich (wirklich)?«, die wir mit uns selbst und anderen erlebt haben. Berichten wir vom Verlauf unseres Lebens mit seinen Wendungen, so sprechen wir oftmals davon, was uns zu welchem Zeitpunkt gefallen hat – was uns angenehm war, was uns angenehm wurde oder was aufhörte, uns zu behagen. Daraus erklären wir, was wir in der Folge taten oder bleiben ließen.
Ich spreche hier von einer Mentalität, von einer angewöhnten Geisteshaltung, die sich an uns beobachten lässt – nicht von einem »Fehler«, den wir begehen. Denn diese Geisteshaltung ist nicht abwegig. Wir fahren in der Wertfrage »auf Sicht«. Im Laufe unseres Lebens zeigen uns erst konkrete Erlebnisse den speziellen, unersetzlichen Reichtum, den eine bestimmte Haltung, ein bestimmtes Verhältnis zu anderen oder ein bestimmtes Gut uns verschafft. Man hat Erfahrung, nachdem man sie gebraucht hätte. Z. B. ist es nicht vorab zu verstehen, dass eigene Kinder alles verändern – und dass deshalb die Frage, ob es mit oder ohne Kinder »besser« sei, eine unsinnige Frage ist.
Die Geisteshaltung, in der man das eigene Leben am ehesten als die Geschichte sich wandelnder Vorlieben und Abneigungen erzählt, ist verständlich; sie ist aber völlig im Zeitgeist befangen: Wenn wir bloß erklären, was uns gefällt, so erklären wir in Wahrheit nur, was man uns an Wertvorstellungen beigebracht hat – oder wir offenbaren, was wir einfach unbewusst übernommen haben. Wir rezitieren sozusagen den Zeitgeist (so wie wir ein auswendig gelerntes Gedicht aufsagen würden) und lassen uns von ihm im Laufe unserer sich wandelnden Erfahrungen an diesen oder jenen Ort führen. Die Frage, wohin es sich zu gehen lohnt – die Frage nach dem Wertvollen also, das ich verfolgen will –, stellen wir so noch nicht. Deshalb erlernen wir auf diese Weise nicht das Handwerk, als ein Selbst, als wir selbst zu leben.
In manchen Zeiträumen unserer europäischen Geschichte mag ein solches Handwerk, sich selbst zu erfinden, gar nicht notwendig gewesen sein. Vielleicht konnte in früheren Epochen eine starke und dicht verwobene Gemeinschaft dem Einzelnen die Frage nach dem Wertvollen glaubhaft beantworten, bevor er sie stellen musste. In jedem Fall müssen wir aber begreifen, was das Handwerk des Lebens heute und für uns ist. Dazu müssen wir vor allem über unsere eigenartige Entfremdung vom Wertvollen nachdenken, von der wir gerade schon sprachen. Sie hängt damit zusammen, wie der Einzelne den Wert der Dinge für sich erfahren kann.
Eine engräumige Stammes- oder Ständegesellschaft vermittelt den lebenspraktischen Sinn bestimmter Anforderungen an den Einzelnen direkt; die Rechtfertigung dieser Anforderungen liegt auf der Hand und stiftet damit die Vorstellung, etwas sei von Wert. Respekt und Gehorsam gegenüber Vater und Mutter z. B. sind nicht strittig, wenn nur sie uns ernähren können und wenn die einzige Religion, die uns je bekannt wird, diesen Gehorsam befiehlt. Verlässlichkeit bei der Befolgung seiner Pflichten verschafft dem Mitglied einer solchen Gesellschaft die Akzeptanz derer, mit denen es auf lange Zeit, wenn nicht sein ganzes Leben lang, verbunden sein wird.
Demgegenüber sind wertstiftende Erfahrungen in der europäischen Neuzeit in der Regel nicht mehr in dieser Weise kleinräumig, unmittelbar und direkt überzeugend. Vor allem sind sie nicht so regelmäßig mit konkreten Menschen verknüpft, die für unser Wohlergehen dauerhaft von Bedeutung sind. Die Menschen, die heute ein Stück unseres Weges bei uns bleiben – etwa Schulkameraden, Vereinskollegen, Nachbarn –, sind wie Fahrgäste in einer Straßenbahn, die unerwartet zu- und wieder aussteigen, die uns in der Zwischenzeit vielleicht nahe sind, die aber in aller Regel nicht unseren dauerhaften Lebenskreis bilden werden. Selbst zwischen Eltern und ihre Kinder hat der Rechtsstaat Gesetze eingefügt, die bestimmte Ansprüche unabhängig von der Qualität persönlicher Beziehungen garantieren sollen.
Die gesellschaftliche Arbeit ist in oft eng gefasste Expertenbereiche aufgeteilt; alle konkreten Gegenstände und Tätigkeiten werden durch ihre Bewertung und Verhandlung in Geld abstrakt; selbst das bescheidenste moderne Leben hat einen gewaltigen räumlichen Aktionsradius. Damit geht, ob eingestanden oder nicht, eine gewisse Freundlosigkeit unseres Lebensvollzugs einher. Wir scheinen keine natürliche, intime Heimatsphäre mehr zu haben, wenn wir sie uns nicht selbst zu schaffen verstehen. Noch dazu gibt es eine Vielfalt sehr unterschiedlicher und gleichwohl oft auch je für sich vernünftiger Betrachtungsweisen dieser Gemengelage. All dies sind die Kennzeichen einer Lebenssituation, in der wir miteinander in aller Regel von Wertvorstellungen sprechen und nicht einfach und direkt von Werten.
So zu reden bedeutet noch nicht zu behaupten, es gäbe keine tatsächlichen (und nicht bloß vorgestellten) Werte, also auch keine wahre Moral. Diese Frage unseres zweifelnden, mit unüberschaubarer Vielfalt konfrontierten Zeitalters müssen wir in der hier entwickelten Philosophie nicht beantworten. Die Rede von Wertvorstellungen zeigt ein Arrangement auf, das wir angesichts der Uneinigkeit über letzte Wahrheiten entwickelt haben, um den Frieden wahren zu können. Nur auf diese Einsicht kommt es für uns an.
Sich selbst erzählen
In unserer geistigen Lebenssituation kommen wir nur durch Nachdenken zu einer persönlichen Vermutung darüber, was für unser Leben wesentlich sein sollte. Genau dies bedeutet es für den Einzelnen, in der Neuzeit zu leben: Die meisten von uns ererben kein solides Wissen um das Wertvolle, dessen Beachtung wir dann in Gemeinschaft mit anderen einüben könnten. Die Gemeinschaften, die solches Wissen zu haben glauben, die es vermitteln und kultivieren, sind seit Jahrhunderten auf dem Rückzug. Deshalb müssen wir unser Wissen um das Wertvolle selbst für uns stiften; wir müssen es uns erleben, so wie wir uns vielleicht eine fremde Stadt erlaufen.