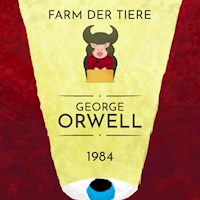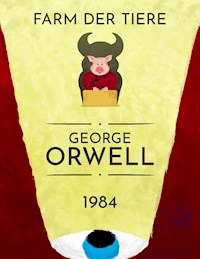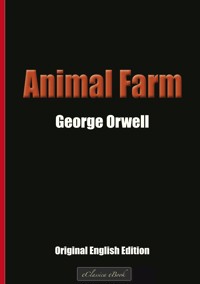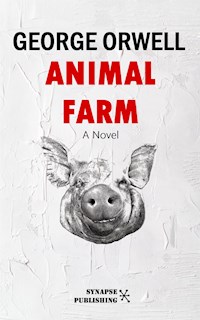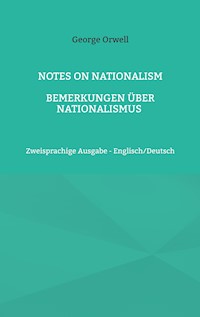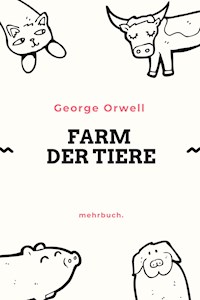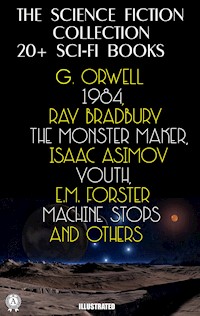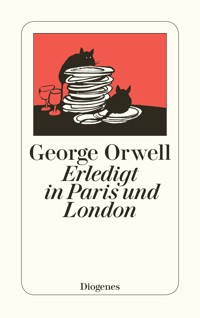
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Nach seiner Demission als Polizeioffizier in Burma landet Orwell 1933 in den Slums: bei den Arbeitslosen, Asozialen in Paris, wo er sich als Küchenhilfe in einem Luxusrestaurant verdingt; bei den Pennern von London, mit denen er durch die Gossen und Asyle pilgert. Der unsentimentale, erschütternde Bericht eines Betroffenen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Ähnliche
George Orwell
Erledigt in Paris und London
Aus dem Englischen vonHelga und Alexander Schmitz
Die Originalausgabe erschien 1933
in London unter dem Titel
›Down and Out in Paris and London‹
Copyright © by The Estateof the late Sonia Brownell Orwell
Die deutsche Erstausgabe
erschien 1978 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration von
Tomi Ungerer
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 20533 6 (12.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60246 3
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5]
[7] I
Die Rue du Coq d’Or, Paris, morgens um sieben. Mehrere wütende, würgende Schreie von der Straße her. Madame Monce, die das kleine Hotel gegenüber führt, war herausgekommen, um sich an einen Mieter im dritten Stock zu wenden. Ihre nackten Füße steckten in Holzpantinen, und ihr langes graues Haar war ungekämmt und hing in Zotteln herab.
Madame Monce: »Salope! Salope! Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, daß Sie die Wanzen nicht auf der Tapete zerdrücken sollen? Glauben Sie denn, das ist Ihr Hotel, eh?! Warum können Sie sie nicht wie jeder andere aus dem Fenster werfen? Putain! Salope!«
Die Frau im dritten Stock: »Vache!«
Dann ein ganzer bunter Chor von Schreien; auf beiden Seiten der Straße werden eilig die Fenster geöffnet, und die halbe Straße mischt sich in das Gezänk ein. Zehn Minuten später plötzlich Stille, als eine Abteilung der berittenen Polizei vorbeitrabt. Die Leute verstummen und starren ihr nach.
Ich beschreibe diese Szenerie, weil ich glaube, daß sie typisch für den Geist der Rue du Coq d’Or ist. Nicht, daß solches Gezänk das einzige wäre, was hier passiert, und doch – kaum ein Morgen vergeht ohne mindestens einen solcher Temperamentsausbrüche. Das war die Atmosphäre dieser Straße: Streitereien, die [8] hoffnungslosen Rufe der Straßengauner, die Rufe der Kinder, die auf dem Pflaster nach Orangenschalen jagen, und nachts der laute Gesang und der säuerliche Gestank von den Wagen mit den störrischen Pferden…
Sie war eine schmale Straße – eine tiefe Schlucht voller großer lepröser Häuser, die sich in sonderbaren Höhen aneinanderlehnen, gerade so, als wären sie in dem Moment erstarrt, als sie im Begriff waren, umzustürzen. Alle Häuser hier waren Hotels und bis unter das Dach vollgepackt mit Mietern, meistens Polen, Arabern und Italienern. Neben den Eingängen zu den Hotels befanden sich winzige bistros, wo man sich für den Gegenwert eines Schillings total betrinken konnte. Regelmäßig samstagnachts war etwa ein Drittel der männlichen Bevölkerung dieses Viertels betrunken. Da gab es Kämpfe um Frauen, und die arabischen Straßenarbeiter, die in den billigsten Hotels wohnten, waren dafür bekannt, mysteriöse Fehden zu inszenieren und sie mit Stühlen und gelegentlich auch Revolvern auszutragen. Nachts pflegte die Polizei nur jeweils zwei Mann auf Streife zu schicken: Das hier war ein regelrechter Sündenpfuhl. Und doch lebten mitten in diesem Lärm und Schmutz die ganz gewöhnlichen, respektablen französischen Ladeninhaber, die Bäcker und Wäscherinnen; sie und ihresgleichen blieben unter sich und machten auf ihre Weise ihr kleines Glück. Das ganze war eine Art repräsentativer Pariser Slum.
Mein Hotel hieß Hôtel des Trois Moineaux, ein düsteres, rachitisches Wildgehege mit fünf Stockwerken, die durch hölzerne Trennwände in vierzig Räume aufgeteilt worden waren. Die Zimmer waren klein und seit eh und je schmutzig, denn so etwas wie ein [9] Stubenmädchen gab es nicht, und Madame F., die patronne, hatte keine Zeit, sich um das Aufwischen zu kümmern. Die Wände waren dünn wie Zündhölzer, und um die Risse zu verdecken, waren sie immer wieder mit neuen Schichten von rosa Papier bepflastert worden, die sich gelöst hatten und unzählige Wanzen beherbergten. Unterhalb der Decke marschierten den ganzen Tag lang Schlangen von Wanzen wie ein Heer kleiner Soldaten entlang, und nachts kamen sie gierig herab, so daß man alle paar Stunden aufstehen und sie massenhaft erledigen mußte. Manchmal, wenn die Wanzen allzu aufdringlich wurden, brannte man Schwefel ab und trieb sie so in das Zimmer nebenan; woraufhin der Nachbar beleidigt zu reagieren pflegte und seinerseits sein Zimmer einschwefelte, um die Wanzen wieder zurückzutreiben. Es war schmutzig hier, aber heimelig, denn Madame F. und ihr Mann waren gute Leute. Die Miete für die Zimmer schwankte zwischen dreißig und fünfzig Francs pro Woche.
Die Mieter waren ein ständig fluktuierendes Völkchen, Ausländer zumeist, die für gewöhnlich ohne Gepäck kamen, eine Woche blieben und dann wieder verschwanden. Sie kamen aus allen erdenklichen Berufssparten – Schuhflicker, Maurer, Steinmetze, Kanalarbeiter, Studenten, Prostituierte und Lumpensammler. Einige von ihnen waren unfaßbar arm. In einem der Mansardenzimmer wohnte ein bulgarischer Student, der für den amerikanischen Markt Phantasieschuhe herstellte; den Rest des Tages verbrachte er in Vorlesungen an der Sorbonne. Er studierte die Kirche, und seine theologischen Bücher lagen aufgeschlagen auf dem mit Lederstücken übersäten Fußboden. In einem anderen [10] Zimmer wohnte eine Russin mit ihrem Sohn, die sich selbst als Künstlerin bezeichnete. Die Mutter arbeitete täglich sechzehn Stunden und besserte für fünfundzwanzig Centimes das Stück Socken aus, derweil ihr Sohn akkurat gekleidet in den Cafés am Montparnasse die Zeit totschlug. Ein Zimmer war an zwei Mieter vergeben worden: der eine arbeitete am Tag und der andere nachts. In noch einem anderen Zimmer teilte ein Witwer das Bett mit seinen zwei erwachsenen schwindsüchtigen Töchtern.
Es gab exzentrische Typen in diesem Hotel. Die Slums von Paris sind überhaupt ein Sammelbecken für alle Arten exzentrischer Leute – Leute, die in vereinsamte, halbverrückte Lebensbahnen geworfen worden waren und aufgegeben hatten, normal oder gepflegt sein zu wollen. Die Armut befreit sie von den gewöhnlichen Normen des Verhaltens, genauso, wie das Geld manche Leute von der Arbeit befreit. Kurzum: Einige der Mieter in unserem Hotel lebten ein Leben, das so seltsam war, daß man es mit Worten nicht zu beschreiben vermag.
Da gab es zum Beispiel die Rougiers, ein altes verlumptes und zwergenhaft gewachsenes Paar, das einem höchst ungewöhnlichen Beruf nachging: Sie verkauften Postkarten auf dem Boulevard St.Michel. Das Witzige daran war, daß diese Postkarten wie pornografische Bilder in versiegelten Päckchen verkauft wurden, in Wirklichkeit aber tatsächlich die Schlösser an der Loire zeigten; die Käufer merkten das immer erst, wenn es zu spät war, aber natürlich beschwerte sich niemand. Die Rougiers verdienten pro Woche an die hundert Francs, und mit Hilfe einer ausgeklügelten Buchführung [11] vollbrachten sie das Kunststück, ständig halbverhungert und halbbetrunken zu sein. Der Dreck in ihrem Zimmer war so gewaltig, daß man ihn im Stockwerk darunter ohne Mühe riechen konnte. Nach Aussage von Madame F. hat keiner der Rougiers seit vier Jahren auch nur einmal die Kleidung gewechselt.
Dann gab es da Henri, der in den Abwässerkanälen arbeitete. Er war ein großgewachsener, melancholischer Mann mit lockigem Haar, der in seinen langen Kloakenstiefeln schon fast wieder romantisch aussah. Das Besondere an Henri war, daß er nicht sprach, und wenn, dann nur bei der Arbeit; aber normalerweise schwieg er ganze Tage hintereinander. Kaum ein Jahr zuvor war er als Chauffeur in einem guten Arbeitsverhältnis tätig gewesen und hatte Geld gespart. Eines Tages verliebte er sich, und als das Mädchen sich ihm verweigerte, verlor er die Nerven und schlug sie. Daraufhin verliebte sich das Mädchen ganz hoffnungslos in Henri, sie lebten vierzehn Tage und Nächte zusammen und gaben tausend Francs von Henris Erspartem aus. Dann wurde ihm das Mädchen untreu; Henri steckte ihr ein Messer in den Oberarm und wanderte für sechs Monate hinter Gitter. Auf den Messerstich hin verliebte sich das Mädchen noch mehr in Henri, diesmal mehr denn je, die beiden beendeten ihren Streit und kamen überein, daß Henri nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis sich ein Taxi kaufen sollte und daß sie heiraten und sich niederlassen würden. Aber weitere vierzehn Tage später wurde ihm das Mädchen wieder untreu, und als Henri nach Hause kam, war sie schwanger. Henri stach sie nicht noch einmal. Er griff sich sein ganzes Erspartes, unternahm einen feucht-fröhlichen Zug durch die Gemeinde, und der [12] brachte ihm nochmals vier Wochen Knast ein; danach ging er dann zur Arbeit in die Kanäle. Nichts konnte Henri zum Sprechen bringen. Wenn man ihn fragte, warum er denn nun in der Kloake arbeitete, biß er die Zähne zusammen und kreuzte ganz einfach seine Handgelenke, um Handschellen anzudeuten und drehte seinen Kopf nach Süden, in die Richtung des Gefängnisses. Das Pech scheint ihn innerhalb eines einzigen Tages blödsinnig gemacht zu haben.
Oder da war R., ein Engländer, der sechs Monate im Jahr bei seinen Eltern in Putney und sechs Monate in Frankreich lebte. Wenn er in Frankreich war, konsumierte er pro Tag vier Liter Wein und an Samstagen sechs; einmal ist er auf die Azoren gereist, weil da der Wein billiger ist als irgendwo sonst in ganz Europa. Er war ein freundliches, häusliches Geschöpf, niemals brutal oder streitsüchtig und niemals nüchtern. Er pflegte bis zum Mittag im Bett zu liegen, und von Mittag bis Mitternacht saß er in seiner Stammecke des bistro und ließ sich wortlos und mit Methode vollaufen. Während er sich vollaufen ließ, redete er manchmal mit feiner, fast fraulicher Stimme über antike Möbel. Außer mir war er der einzige Engländer im Viertel.
Es war da noch eine Menge mehr Leute, die ebenso exzentrisch lebten: Monsieur Jules, der Rumäne, der ein Glasauge hatte, aber diese Tatsache niemals zugab, Furex, der Steinmetz aus Limousin, Roucolle, der Geizhals – er starb vor meiner Zeit –, der alte Lumpensammler Laurent, der seine Unterschrift von einem Stück Papier, das er mit sich in der Tasche herumtrug, abzumalen pflegte. Es müßte Spaß machen, einige dieser Biographien aufzuschreiben – wenn man nur die Zeit [13] dazu hätte. Ich versuche, die Menschen in unserem Viertel nicht nur ihrer Kuriosität wegen zu beschreiben, sondern weil sie alle zu der Geschichte gehören. Die Armut ist es, über die ich schreiben will, und gerade in diesem Slum traf ich zum erstenmal auf wirkliche, echte Armut. Dieser Slum mit all seinem Schmutz und seinen verqueren Schicksalen war zunächst eine nüchterne Lektion in Sachen Armut, dann aber wurde er zum Hintergrund meiner eigenen Erfahrungen. Das ist der Grund dafür, warum ich versuche, eine Idee davon zu vermitteln, wie das Leben hier war.
II
Das Leben im Viertel. Unser bistro beispielsweise, unten im Hôtel des Trois Moineaux. Ein winziger Raum mit Steinfußboden, halb unter der Erde, mit weindurchtränkten Tischen und der Fotografie einer Beerdigung mit der Inschrift »Crédit est mort«; und Arbeiter mit roten Binden, die mit roten Taschenmessern die Wurst bearbeiten; und Madame F., eine imposante ländliche Frau aus Auvergnat mit dem Gesicht einer überdurchschnittlich intelligenten Kuh, die den ganzen Tag ihren Malaga »dem Magen zuliebe« trinkt; und Würfelspiele um apéritifs; und Lieder von »Les Fraises et Les Framboises«, und von Madelon, die sagte: »Comment épouser un soldat, moi qui aime tout le régiment?«; und von außergewöhnlichen Liebeleien in der Öffentlichkeit. Abends traf sich das halbe Hotel in dem bistro, und ich [14] wünschte mir nur, es gäbe in London ein Pub, in dem es nur ein Viertel so lustig zuginge.
Im bistro konnte man die merkwürdigsten Unterhaltungen verfolgen. Als Beispiel erzähle ich von Charlie, einer der lokalen Attraktionen.
Charlie war ein Junge aus guter Familie und mit guter Erziehung, der von zu Hause weggelaufen war und von gelegentlichen Geldanweisungen lebte. Man stelle ihn sich sehr rosig und jung vor, mit den frischen Backen und dem weichen braunen Haar eines netten kleinen Jungen, und mit Lippen, die außergewöhnlich rot und feucht wie Kirschen waren. Seine Füße sind winzig, seine Arme anomal kurz und seine Hände verschrumpelt wie die eines Babys. Es war seine Art, herumzutanzen und Freudensprünge zu vollbringen, während er erzählte, ganz so, als wäre er zu glücklich und zu voll von Leben, um auch nur einen Augenblick stillsitzen zu können. Es ist drei Uhr nachmittags, und außer Madame F. und ein oder zwei Männern, die nicht zur Arbeit gehen, ist sonst niemand im bistro; aber es ist Charlie im Grunde völlig egal, mit wem er spricht, wenn er nur von sich selber reden kann. Er deklamiert wie ein Redner auf den Barrikaden und rollt die Wörter auf seiner Zunge und fuchtelt mit seinen kurzen Armen. Seine kleinen Schweinsäuglein glitzern voller Freude. Auf irgendeine Weise ist es total widerlich, ihm zuzusehen.
Er spricht von seinem Lieblingsthema, der Liebe. »Ah, l’amour, l’amour! Ah, que les femmes m’ont tué! Alas, messieurs et dames, Frauen waren mein Ruin, mein unvermeidlicher Ruin. Ich bin zweiundzwanzig und total fertig, total am Ende. Aber was habe ich nicht [15] alles gelernt, in welche Abgründe der Weisheit bin ich nicht schon hinabgestiegen! Wie herrlich das ist, die wahre Weisheit erworben zu haben, im besten Sinne des Wortes ein zivilisierter Mensch geworden zu sein, raffiné, vicieux«, usw. usw.
»Messieurs et dames, ich begreife, daß Ihr traurig seid. Ah, mais la vie est belle – Ihr müßt nicht traurig sein. Seid fröhlicher, ich flehe euch an!
Füllt auf dän Kroog mit Samoswein
und laast uns allhier freehlich sein!
Ah, que la vie est belle! Leihen Sie mir Ihr Ohr, messieurs et dames, aus dem vollen Born meiner Erfahrung will ich schöpfen und Euch von der Liebe erzählen. Ich will Euch erklären, was die wahre Liebe eigentlich bedeutet – was das wahre Empfinden ist, das höhere, raffiniertere Vergnügen, das nur dem zivilisierten Menschen, und nur ihm, zugänglich ist. Ich will Euch erzählen von dem glücklichsten Tag meines Lebens. Ach ja, aber die Zeit entschwand mir, als ich gelernt hatte, solches Glück zu erfahren. Für immer ist es hin – die Möglichkeit und die Gier danach, das alles ist hin.
Also hört mir zu. Vor zwei Jahren war’s; mein Bruder war gerade in Paris – er ist Rechtsanwalt –, und meine Eltern hatten ihm aufgetragen, mich aufzustöbern und mit mir zum Essen auszugehn. Wir hassen uns, mein Bruder und ich, aber wir folgten doch lieber unseren Eltern. Also aßen wir zu Abend, und von drei Flaschen Bordeaux wurde er schon beim Essen kreuzbetrunken. Ich brachte ihn in sein Hotel und besorgte mir auf [16] dem Weg eine Flasche Weinbrand, und als wir ankamen, da sagte ich ihm, er solle einen schönen, großen Schluck trinken – ich sagte, das würde ihn wieder komplett auf die Beine bringen. Er trank, und sofort fiel er um wie einer, der einen Anfall hat und war da erst richtig betrunken. Ich richtete ihn auf und lehnte ihn mit dem Rücken gegen sein Bett; dann durchsuchte ich seine Taschen. Ich fand elfhundert Francs, nahm sie an mich, machte, daß ich aus dem Hotel kam, sprang in ein Taxi und floh. Mein Bruder wußte nämlich meine Adresse nicht – ich war in Sicherheit.
Wo geht ein Mann schon hin, wenn er Geld bei sich hat? Natürlich in die bordels. Aber Ihr nehmt ja wohl nicht an, daß ich mich den Ausschweifungen gewöhnlicher Kanaler hingab! Mein Gott, man ist ja schließlich ein zivilisierter Mensch! Ich war sehr wählerisch und anspruchsvoll, Ihr versteht, und tausend Francs wert. Es ging auf Mitternacht, als ich endlich fand, was ich suchte. Ich war mit einem reizenden Jungen in einem ruhigen bistro ins Gespräch gekommen, einem Achtzehnjährigen mit einem Haarschnitt à l’américaine und en smoking gekleidet. Weit ab von den Boulevards saßen wir da, sprachen über dies und das und darüber, wie man sich am besten unterhalten könnte. Auf der Stelle nahmen wir uns ein Taxi und ließen uns wegfahren.
Das Taxi hielt in einer engen, einsamen Straße, die am hinteren Ende gerade von einer flackernden Gaslaterne erleuchtet wurde. Das Steinpflaster war voller Pfützen. An der einen Straßenseite erhob sich die kahle, hohe Mauer eines Nonnenklosters. Mein Führer brachte mich zu einem halbverfallenen Gebäude mit [17] Fensterläden und klopfte einige Male an die Tür. Unmittelbar darauf hörte man Schritte, dann das Geräusch von Türbolzen, die zurückgeschoben werden, und dann öffnete sich die Tür einen Spalt weit. Eine Hand kam um die Türkante, eine große, gekrümmte Hand, die, direkt unter unseren Nasen geöffnet, Geld begehrte.
Mein Begleiter stellte seinen Fuß zwischen Tür und Schwelle.
›Was soll’s kosten?‹ fragte er.
›Tausend Francs‹, sagte eine Frauenstimme. ›Bezahlung sofort, oder Sie kommen hier nicht herein.‹
Ich drückte tausend Francs in die geöffnete Hand und gab meinem Begleiter die restlichen hundert. Er sagte Gute Nacht und verschwand. Ich konnte von drinnen die Stimme hören, wie sie das Geld nachzählte, und dann steckte eine dünne alte krähenhafte Erscheinung von Frau in einem schwarzen Kleid ihre Nase heraus und prüfte mich mißtrauisch, bevor sie mich einließ. Drinnen war es sehr dunkel: Ich konnte nichts erkennen – außer
einem flackernden Gaslicht, das ein Stück von einer Stuckwand erhellte und alles andere in noch dunkleren Schatten hüllte. Es roch nach Ratten und nach Staub. Wortlos entzündete die Alte eine Kerze an dem Gaslicht und humpelte dann vor mir her einen steinernen Durchgang entlang, bis wir zu einer Flucht steinerner Treppen gelangten.
›Voilà!‹ sagte sie, ›gehen Sie da in den Keller hinunter und tun Sie, was Ihnen Spaß macht. Ich werde nichts sehen, nichts hören, nichts wissen. Sie sind frei, verstehen Sie – völlig frei.‹
Ha, messieurs, ich muß Euch wohl kaum – forcément, Ihr wißt ja selbst – diesen Schauer, diese [18] Mischung aus Angst und Freude beschreiben, die man in solchen Augenblicken empfindet. Also tastete ich mich hinunter. Ich konnte meinen eigenen Atem und das Geräusch hören, das meine Schuhe auf den Steinstufen machten. Aber ansonsten war alles still. Unten angekommen, berührte ich mit der Hand einen elektrischen Schalter. Ich drehte ihn herum, und ein großer elektrischer Kronleuchter aus zwölf roten Kugeln tauchte den Keller in rotes Licht. Ihr werdet es kaum glauben, aber was ich für einen Keller gehalten hatte, war ein Schlafzimmer! Ein großes, verschwenderisch eingerichtetes, prunkvolles Schlafzimmer – und rot von der Decke bis zum Boden. Versucht es Euch vorzustellen, messieurs et dames! Auf dem Boden ein roter Teppich, rote Tapeten an den Wänden, roter Plüsch über den Stühlen, sogar die Decke rot; rot, überall rot, das sich in die Augen einbrannte. Es war ein herbes und erstickendes Rot, das wie Licht durch Schalen voller Blut zu kommen schien. Am hinteren Ende des Zimmers stand ein großes, viereckiges Bett voller genauso roter Kissen, und auf dem Bett lag ein Mädchen, das ein Kleid aus rotem Samt trug. Als sie mich sah, schrak sie zusammen und bemühte sich, ihre Knie unter dem kurzen Kleid zu verbergen.
Ich war bei der Tür stehengeblieben. ›Komm her, mein Kleines‹, rief ich ihr zu.
Sie gab nur ein ängstliches Wimmern von sich. Mit einem Sprung war ich am Bett; sie versuchte, mir auszuweichen, ich aber faßte sie an der Kehle – so, seht Ihr?! – ganz fest! Sie wand sich, sie fing an, unter Tränen um Gnade zu flehen, aber ich hielt sie weiter ganz fest, zwang ihren Kopf aufs Kissen und starrte ihr in die [19] Augen. Sie war vielleicht zwanzig Jahre alt; ihr Gesicht trug die breitflächigen, stumpfsinnigen Züge eines dummen Kindes, aber es war bedeckt mit Farbe und Puder, und ihre blauen, stumpfen Augen, die in diesem roten Licht so merkwürdig leuchteten, hatten den schockierten, verzerrten Ausdruck, den man nirgends außer bei diesen Frauen entdecken kann. Es gab keinen Zweifel: Sie war ein Mädchen vom Lande, das von seinen Eltern in die Sklaverei verkauft worden war.
Ohne ein weiteres Wort zog ich sie vom Bett herunter und warf sie zu Boden. Und dann fiel ich über sie her wie ein Tiger! Aach, dieses Glück, dieser unvergleichliche Taumel solcher Stunde! Das ist es, messieurs et dames, was ich Euch erklären will – voilà l’amour! Es gibt die wahre Liebe, es gibt das eine im Leben, nach dem zu streben sich lohnt; es gibt dieses Ding, neben dem alle Eure Künste und Ideale, alle Eure Philosophien und Glaubensbekenntnisse, all Eure wohlgesetzten Wörter und hohen Ansprüche verblassen zu wertloser Asche. Wer einmal die Liebe erfahren hat, die wahre, große Liebe, was kann es für den im Leben noch geben, was nicht ein bloßer Abklatsch der Freude wäre?
Immer und immer wieder ging ich zum Angriff über, immer wütender wurde ich. Und immer und immer wieder versuchte das Mädchen, sich mir zu entwinden und schrie wieder um Hilfe und flehte um Gnade. Ich aber lachte sie nur aus.
›Gnade!‹ sagte ich, ›glaubst du denn, ich bin hierher gekommen, um Gnade zu zeigen?! Denkst du denn, ich hätte dafür tausend Francs bezahlt?‹ Ich schwöre euch, messieures et dames, wenn es nicht dieses verdammte [20] Gesetz geben würde, das uns unsere Freiheit nimmt ich hätte sie in diesem Moment umgebracht.
Ach, und wie sie schrie, wie sie in schriller Todesangst quiekte. Aber es gab niemanden, der sie hören konnte; da unten, unter den Pariser Straßen, waren wir so sicher wie in der Spitze einer Pyramide. Die Tränen liefen dem Mädchen nur so über das Gesicht und wuschen ihr den Puder in langen, schmutzigen Bahnen herunter. Ach, unwiederbringliche Zeit! Ihr, messieurs et dames, habt die feineren Nuancen der Liebe nicht erprobt, für euch ist solche Lust ja fast schon nicht mehr zu begreifen. Und ich, jetzt, wo meine Jugend – ach, Jugend! dahin ist, auch ich werde das Leben nie wieder in solcher Schönheit sehen. Es ist vorbei.
Ach Gott, ja, es ist vorüber, aus und vorbei. Ach, diese Armut, diese Kürze, diese Enttäuschung des menschlichen Glücks! Denn in Wirklichkeit – car en réalité… was dauert in Wirklichkeit denn schon der erhabenste Moment der Liebe? Er ist ein Nichts, ein Augenblick, vielleicht eine Sekunde. Eine Sekunde der Ekstase, und danach – Staub, Asche, Nichts.
Und so habe ich für einen winzigen Augenblick die höchste Offenbarung des Glücks erfahren, die erhabensten und feinsten Gefühle, deren der Mensch fähig ist. Und schon im selben Augenblick war wieder alles vorbei, und ich blieb allein – womit? All meine Wildheit, meine Leidenschaft – in alle Winde verstreut wie Rosenblätter. Allein war ich, frierend und schlaff und voll leeren Bedauerns; und in meinem Stimmungsumschwung empfand ich sogar eine gewisse Art des Mitleids für das weinende Mädchen vor mir auf dem Boden. Ist es nicht widerlich, daß wir zur Beute solch [21] gemeiner Gefühle werden können? Ich sah das Mädchen nicht mehr an; mein einziger Gedanke war, hinauszukommen. Ich hastete die Treppen des Gewölbes hinauf und gelangte hinaus auf die Straße. Es war dunkel und bitterkalt, die Straßen waren wie ausgestorben, die Steine klangen unter meinen Sohlen mit hohlem, einsamem Echo. Mein ganzes Geld war ausgegeben, ich hatte nicht einmal mehr genug für ein Taxi. Allein ging ich zurück auf mein kaltes, vereinsamtes Zimmer.
Aber seht, messieurs et dames, das ist es eben, was ich euch zu erklären versprach. Das ist die Liebe. Und dieser Tag war der glücklichste meines Lebens.«
Er war schon ein seltsames Exemplar, dieser Charlie. Ich beschreibe ihn eben nur, um zu zeigen, was für unterschiedliche Typen im Coq d’Or-Viertel gediehen.
III
Im Coq d’Or-Viertel lebte ich etwa anderthalb Jahre. Eines schönen Tages im Sommer stellte ich fest, daß ich gerade noch genau vierhundertfünfzig Francs hatte. Das war alles, abgesehen von den sechsunddreißig Francs pro Woche, die ich mir mit Englischstunden verdiente. Und bis zu diesem Punkt hatte ich nicht weiter über meine Zukunft nachgedacht, aber plötzlich wurde mir sonnenklar, daß ich unbedingt sofort etwas unternehmen mußte. Ich beschloß, mich nach einer Beschäftigung umzusehen, und außerdem zahlte ich – und das [22] war mein Glück, wie sich heraussteilen sollte – vorsichtshalber erst einmal zweihundert Francs Monatsmiete im voraus. Mit den verbliebenen zweihundertfünfzig Francs und dem Geld aus den Stunden konnte ich einen Monat leben, und innerhalb dieser Zeit sollte eigentlich eine Beschäftigung zu finden sein. Ich hatte eine Anstellung als Fremdenführer bei einem der Tourismus-Unternehmen oder einen Dolmetscherposten im Visier. Aber wie das nun so ist – ich hatte Pech, und so wurde nichts daraus.
Eines Tages tauchte im Hotel ein junger Italiener auf, der sich als Schriftsetzer vorstellte. Er war eine recht undurchschaubare Person, denn er trug Koteletten, die sonst eigentlich nur von Apachen oder Intellektuellen getragen werden, und so rätselte jeder daran herum, zu welcher Gruppe er nun gehörte. Madame F. gefiel sein Aussehen nicht, und darum ließ sie sich von ihm im voraus die Miete für eine Woche zahlen. Der Italiener also zahlte und blieb sechs Tage Gast. Während dieser Zeit hatte er sich mit Erfolg eine Anzahl von Zweitschlüsseln besorgt, und in der letzten Nacht plünderte er ein Dutzend Zimmer – meines auch. Gottseidank hatte er in meinen Taschen das Geld nicht gefunden, so daß ich nicht ganz ohne einen Pfennig dastand. Alles, was ich noch hatte, waren siebenundvierzig Francs – sieben Shilling zehn.
Aus war es mit dem Traum vom Beruf. Jetzt war ich gezwungen, von sechs Francs pro Tag zu leben, und von Anfang an war es fast ein Ding der Unmöglichkeit, noch an andere Dinge als das wenige Geld zu denken. Jetzt also war der Zeitpunkt gekommen, an dem meine Erfahrungen mit der Armut beginnen sollten – denn [23] sechs Francs pro Tag sind zwar noch nicht direkt Armut, aber damit befindet man sich schon sehr nah davor. Sechs Francs sind ein Shilling, und man kann schon von einem Shilling pro Tag in Paris leben, man muß eben nur wissen, wie. Aber das ist eine schwierige Angelegenheit.
Eine höchst merkwürdige Sache – solch ein erster Kontakt mit der Armut. Soviel hat man über die Armut nachgedacht – sie ist das, was man im Leben immerzu gefürchtet hat, das, von dem man weiß, daß es früher oder später eintreffen würde; und dann ist es so alltäglich, so durch und durch anders als die eigenen Vorstellungen. Man dachte, es wäre alles ganz einfach; es ist außergewöhnlich kompliziert. Man dachte, es wäre schrecklich; es ist nur schmutzig und langweilig. Es ist das so besonders Erniedrigende, das man an der Armut zu allererst bemerkt; die Veränderungen, denen sie einen unterwirft, die komplizierte Filzigkeit, das Entkrusten.
Man entdeckt beispielsweise die Geheimniskrämerei, die mit dem Armsein eng verbunden ist. Plötzlich und auf einen Schlag ist man auf ein Tageseinkommen von sechs Francs reduziert worden. Aber natürlich wagt man das nicht zuzugeben – man hat so zu tun, als lebe man ganz wie immer. Von Anfang an wird man in ein Netz aus Lügen verwickelt, und sogar mit diesen Lügen ist das ganze kaum zu bewerkstelligen. Man hört auf, Wäsche zur Wäscherei zu geben; also trifft einen bald die Wäschefrau auf der Straße und fragt nach dem Grund; man murmelt irgendetwas, und sie, die natürlich glaubt, man gäbe die Wäsche woandershin, wird für einen zum lebenslangen Feind. Der Tabakhändler fragt immer und [24] immer wieder, warum man seine Ration heruntergeschraubt habe. Da sind Briefe, die beantwortet werden sollten, aber man kann nicht, weil die Briefmarken zu teuer sind. Und dann die Mahlzeiten – die Mahlzeiten sind überhaupt das größte Problem. Tag für Tag geht man zur Essenszeit aus dem Haus und betont natürlich, daß man auf dem Weg zum Restaurant wäre, aber statt dessen treibt man sich im Jardin Luxembourg umher und schaut den Tauben zu. Danach schmuggelt man seine kleine Ration in der Manteltasche ins Hotel hinein. Das Essen besteht aus Margarine und Brot oder Brot und Wein, und sogar was das angeht, regieren die Lügen. Man muß Roggenbrot statt normales, anderes Brot kaufen, denn die Roggenbrote sind rund und manteltaschenfreundlich im Format. Dafür geht schon ein Franc drauf. Manchmal muß man, um gesehen zu werden, sechzig Centimes für einen Drink ausgeben, was wiederum bedeutet, daß man dafür beim Essen den Gürtel enger schnallen muß. Das Bettzeug wird immer schmuddeliger, und Seife und Rasierklingen gehen aus. Das Haar müßte geschnitten werden, und man versucht, es sich selber zu schneiden – aber was dabei herauskommt, ist dann so erschreckend, daß man schließlich erst recht zum Friseur gehen muß, der seinerseits den Gegenwert einer Essensration für einen Tag verschlingt. Den ganzen Tag erzählt man Lügen, teure Lügen.
Man entdeckt die äußerste Unsicherheit, die mit diesen sechs Francs pro Tag verbunden ist. Mittlere Katastrophen, die dann natürlich erst recht eintreffen, rauben einem das Essen. Die letzten achtzig Centimes hat man zum Beispiel gerade für einen halben Liter Milch ausgegeben, und man macht sie sich über der Spiritusflamme [25] heiß. Während sie heiß wird, läuft eine Wanze den Unterarm hinunter; man schnipst die Wanze mit dem Fingernagel weg, und sie fällt, flopp!, genau in die Milch. Was bleibt einem übrig, als die ganze Milch wegzuschütten und weiter zu darben.
Man geht zum Bäcker, um sich ein Pfund Brot zu kaufen, und man wartet, während das Mädchen hinterm Ladentisch für einen anderen Kunden ein Pfund abschneidet. Sie ist ungeschickt und schneidet mehr ab als ein Pfund. »Pardon, monsieur«, sagt sie, »es macht Ihnen doch nichts aus, zwei Sous mehr zu bezahlen?« Ein Pfund kostet nun aber gerade einen Franc, und dieser Franc ist auch schon alles, was man bei sich hat. Wenn man dann glaubt, man selber könnte gefragt werden, ob man zwei Sous drauflegen könne, stürzt man schließlich doch in panischer Angst aus dem Laden.
Man geht zum Gemüsemann, um sich für einen Franc zwei Pfund Kartoffeln zu besorgen. Aber eine der Münzen, die zusammen den einen Franc ergeben, ist belgisch, und die nimmt der Gemüsemann nicht: Man schleicht sich hinaus – auf Nimmerwiedersehn.
Man ist gedankenlos umherspaziert und in einem der besseren Viertel gelandet. Man sieht natürlich schon von weitem, daß sich ein wohlhabender Freund auf geradem Kurs zu einem hin befindet und türmt darum in das nächste Café. Wenn man nun schon mal in dem Café ist, muß man auch etwas verzehren, also gibt man seine letzten fünfzig Centimes für eine Tasse Kaffee schwarz mit eingelegter Fliege aus. Man könnte diese Beispiele mit Leichtigkeit mal hundert nehmen. Sie gehören ganz einfach und natürlicherweise zum Pleitesein.
Man entdeckt, was es bedeutet, Hunger zu haben. [26] Den Magen mit Brot und Margarine zugestopft, geht man auf Schaufensterbummel. Es wimmelt von Eßwaren in beleidigenden, großen und verschwenderischen Stapeln; ganze Tauben, Körbe voller Brote, große, gelbe Butterblöcke, ganze Ketten aus Würsten, Berge von Kartoffeln, riesige Gruyère-Käse in Mühlstein-Format. Beim Anblick solcher Eßmassen kommt einen das heulende Selbstmitleid an. Man spielt mit dem Gedanken, einfach einen Laib Brot zu klauen und wegzurennen, bevor sie einen erwischen können; aber dann macht man es doch nicht – aus purer Angst.
Man entdeckt die mit der Armut untrennbar verbundene Langeweile; die Zeiten, in denen man nichts zu tun hat und in denen man, weil man unterernährt ist, für nichts Interesse hat. Halbe Tage lang liegt man auf seinem Bett und fühlt sich wie das jeune squelette aus Baudelaires Gedicht. Nahrung würde einen wieder hochbringen. Man entdeckt, daß ein Mensch, der eine ganze Woche hintereinanderweg immerhin von Brot und Margarine gelebt hat, kein Mensch mehr ist, sondern nur noch ein Bauch mit einigen organischen Accessoires drumherum.
Das – und man könnte es noch ausführlicher beschreiben, nur läuft das alles ja aufs selbe hinaus – ist das Leben mit sechs Francs pro Tag. Tausende in Paris leben so – sich abmühende Künstler und Studenten, Prostituierte, die keiner will, Arbeitslose jeder Art. So sehen sie aus, die Randzonen der Armut.
Das ging in diesem Stil so etwa drei Wochen weiter. Die siebenundvierzig Francs waren alsbald aufgebraucht, und ich mußte halt sehen, mit meinen sechsunddreißig Francs von den Englischstunden wohl oder übel [27] zurandezukommen. Da ich damit keinerlei Erfahrung hatte, ging ich falsch mit dem Geld um und hatte manchmal ganze Tage lang nichts im Magen. Wenn das der Fall war, verkaufte ich einige meiner Kleidungsstücke, die ich dann in kleine Pakete verpackt aus dem Hotel schmuggelte und in einen Gebrauchtwarenladen in der Rue de la Montagne St.Geneviève trug. Der Ladenbesitzer war ein rothaariger Jude, ein außergewöhnlich unangenehmer Mann, der beim Anblick eines Kunden für gewöhnlich in unkontrollierte Zornesausbrüche verfiel. Aus seinem Benehmen mußte man schließen, daß man ihm einen Tort antat, wenn man zu ihm kam. »Merde!« pflegte er zu brüllen, »Sie schon wieder? Was glauben Sie eigentlich, was das hier ist? ’ne Suppenküche vielleicht?« Und er zahlte unbeschreiblich schlechte Preise. Für einen Hut, der mich seinerzeit 25 Shilling gekostet und den ich kaum getragen hatte, gab er mir gerade fünf Francs; für ein guterhaltenes Paar Schuhe fünf Francs; pro Hemd einen Franc. Er tauschte lieber, als daß er kaufte, und er beherrschte den Trick, einem irgendeinen völlig nutzlosen Artikel in die Hand zu schummeln und dann zu behaupten, man hätte ihn bereits angenommen. Einmal sah ich, wie er einer alten Frau einen gut erhaltenen Mantel abknöpfte, ihr zwei weiße Billiardkugeln in die Hand drückte und sie dann blitzschnell aus dem Laden drängte, so daß sie keine Zeit zu protestieren fand. Es wäre sicher ein Vergnügen gewesen, dem Juden die Nase einzuschlagen, nur konnte sich das eben niemand leisten.
Diese drei Wochen waren ekelhaft und ungemütlich, und offensichtlich stand noch größeres Übel ins Haus, denn es würde nicht mehr lange dauern, und meine [28] Miete mußte gezahlt werden. Trotzdem war alles nicht ein Viertel so schlimm, wie ich es eigentlich erwartet hatte. Denn, wenn man sich dem Zustand völliger Verarmung nähert, macht man eine Entdeckung, die viele andere aufwiegt. Man entdeckt Langeweile und unangenehme Komplikationen und die Anfänge des Hungers, aber man entdeckt auch den großartigen, versöhnenden Aspekt der Armut: die Tatsache, daß sie die Zukunft vernichtet. Innerhalb bestimmter Grenzen trifft es tatsächlich zu, daß mit dem Geld auch die Sorgen schwinden. Wenn man hundert Francs besitzt, ist man der Welt bis zur demütigendsten Panik verpflichtet. Wenn man nur drei Francs hat, ist einem alles egal; denn drei Francs machen einen gerade bis zum nächsten Morgen satt. Und weiter als bis dahin kann man nicht denken. Man langweilt sich, aber man hat keine Angst. Man denkt unbestimmt: ›In ein, zwei Tagen werde ich verhungern – doll, was?!‹ Und dann denkt man an andere Dinge. Eine Diät aus Brot und Margarine liefert bis zu einem gewissen Grade ihr eigenes schmerzstillendes Mittel gleich mit.
Und die Armut vermittelt noch ein anderes Gefühl, ein Gefühl großen Trostes. Ich glaube, daß jeder, dem es schon einmal selber so ging, das auch gehabt hat. Es ist ein Gefühl der Erleichterung, fast ein Gefühl des Vergnügens darüber, daß man sich schließlich auch in diesem Zustand echten Erledigtseins kennt. Man hat so oft vom Vor-die-Hunde-Gehen gesprochen – naja, da sind nun die besagten Hunde, man hat sie vor sich, und man kann es ertragen. Sowas nimmt einem viele Ängste.
[29] IV
Eines Tages war ganz plötzlich Schluß mit meinen Englischstunden. Die heiße Jahreszeit war angebrochen, und einer meiner Schüler, der sich für den Unterricht allzu träge fühlte, schickte mich wieder fort. Ein anderer war ohne eine erklärende Nachricht aus seiner Wohnung verschwunden und schuldete mir noch zwölf Francs. Und ich stand da – mit nur dreißig Centimes und keinem Krümel Tabak mehr. Anderthalb Tage lang hatte ich nichts zu essen und zu rauchen, und dann – ich war zu hungrig, als daß ich mich selbst hätte davon abbringen können – packte ich an Kleidungsstücken zusammen, was noch übrig war und brachte den ganzen Koffer zum Pfandleiher. Aus war’s mit allem Theaterspielen, daß es mir finanziell gut ginge, denn schließlich konnte ich die Sachen nicht aus dem Hotel bekommen, ohne Madame F. um Erlaubnis zu bitten. Vielmehr erinnere ich mich, wie erstaunt sie über mich war, daß ich meine Sachen nicht hintenherum weggeschafft hatte, zumal es in dieser Gegend gang und gäbe war, daß man sich nachts verdrückte.
Es war das erste Mal, daß ich in eine französische Pfandleihe kam. Man mußte durch ein grandioses Portal (das natürlich überschrieben war mit »Liberté, Egalité, Fraternité« – in Frankreich schreibt man das sogar über Polizeireviere) in einen großen, kahlen Raum wie ein Klassenzimmer samt Katheder und Bankreihen gehen. Vierzig oder fünfzig Leute warteten vor mir. Man reichte seine Pfandsachen über den Schalter und setzte sich. Sofort, wenn der Angestellte dort den [30] Wert geschätzt hatte, rief er laut: »Numéro soundso, sind Sie mit fünfzig Francs einverstanden?« Manchmal waren es nur fünfzehn Francs oder zehn oder fünf egal, um was es ging, der ganze Raum wußte Bescheid. Als ich hereinkam, rief der Mann mit beleidigter Miene: »Numéro 83 – hier!« pfiff und winkte jemand heran, als riefe er einen Hund zu sich. Numéro 83 ging nach vorne; er war ein alter, bärtiger Mann mit einem Mantel, der bis zum Hals zugeknöpft war und mit einer Hose, deren Umschläge ausgefranst waren. Wortlos stieß der Ausrufer das Bündel über den Schalter zurück – offenbar war es nichts wert. Es fiel zu Boden, ging auf und brachte vier wollene Unterhosen zum Vorschein. Alle im Raum mußten lachen. Die arme Numéro 83 sammelte ihre Unterhosen auf und torkelte murmelnd hinaus.
Die Sachen, die ich versetzen wollte, waren in gutem Zustand und hatten, zusammen mit dem Koffer, über zwanzig Pfund gekostet. Ich dachte, sie müßten noch so um die zehn Pfund bringen, und ein Viertel dessen (man muß im Pfandhaus immer etwa mit einem Viertel des Wertes rechnen) würde etwa zweihundertfünfzig oder dreihundert Francs ergeben. Ich wartete ohne Besorgnis und rechnete mit garantierten zweihundert Francs mindestens.
Schließlich rief der Schreiber meine Nummer auf: »Numéro 97!«
»Ja«, sagte ich und erhob mich.
»Siebzig Francs?«
Siebzig Francs für Sachen, die zehn Pfund wert waren! Zu diskutieren hatte keinen Sinn; ich hatte gesehen, wie ein anderer zu handeln versucht hatte, worauf [31] der Schreiber ihn ohne Umschweife wieder fortschickte. Ich nahm also das Geld und den Pfandschein und ging. Jetzt hatte ich nichts mehr anzuziehen außer den Sachen, die ich auf dem Leib trug – der Mantel war an den Ellbogen schon gefährlich durch –, einen Überzieher, mäßig verpfändbar, und ein weiteres Hemd. Dann, als es bereits zu spät war, erfuhr ich, daß es weiser war, am Nachmittag zur Pfandleihe zu gehen. Die Leiher sind Franzosen und haben, wie die meisten Franzosen, schlechte Laune, wenn sie nichts im Magen haben.
Als ich nach Hause kam, scheuerte Madame F. gerade den Boden im bistro. Sie kam zu mir die Treppe hinauf. In ihren Augen konnte ich sehen, daß ihr meine Miete zu schaffen machte.
»Na«, sagte sie, »was gab’s denn für die Klamotten? Wohl nicht so sehr viel, äh?«
»Zweihundert Francs«, sagte ich prompt.
»Tiens!« sagte sie überrascht, »naja, das ist nicht übel. Diese englischen Sachen scheinen ja einiges wert zu sein!«
Die Lüge hatte mir allerlei Probleme erspart, und seltsamerweise wurde sie alsbald Wahrheit. Denn schon einige Tage später erhielt ich genau zweihundert Francs für einen Zeitungsartikel, und obwohl es mich zu tun schmerzte, investierte ich sofort alles bis auf den letzten Heller in die Miete. So traf es sich, daß ich in den folgenden Wochen zwar dem Hungertod direkt ins Auge sehen mußte, dafür aber so gut wie immer ein festes Dach über dem Kopf hatte.
Jetzt mußte ich unbedingt Arbeit finden, und ich erinnerte mich eines Freundes, eines russischen Schriftstellers mit Namen Boris, der mir möglicherweise behilflich sein [32] konnte. Ich hatte ihn in einem Krankenhaus kennengelernt, wo er wegen einer Arthritis im linken Bein behandelt wurde. Er hatte gesagt, ich könnte immer zu ihm kommen, wenn ich in Schwierigkeiten steckte.
Lassen Sie mich einiges zu Boris sagen, denn er war ein faszinierender Typ und lange Zeit mein engster Freund. Er war ein großer, militärisch auftretender Mann um die fünfunddreißig und gutaussehend, bis ihn seine Krankheit ans Bett fesselte und er dadurch mächtig aus den Fugen ging. Wie die meisten russischen Flüchtlinge hatte auch er ein abenteuerliches Leben hinter sich. Seine Eltern, die in der Revolution umgekommen sind, waren wohlhabende Leute, und er hatte während des Krieges bei den Zweiten Sibirischen Schützen gedient – dem Regiment, das nach seiner Auskunft das beste der russischen Armee überhaupt gewesen sein muß. Nach Kriegsende hatte er erst in einer Bürstenfabrik und dann als Packer in Les Halles gearbeitet, war dann Tellerwäscher geworden und hatte sich schließlich zum Kellner hinaufgearbeitet. Zu der Zeit, als er krank wurde, war er im Hôtel Scribe beschäftigt gewesen und hatte pro Tag hundert Francs an Trinkgeldern eingestrichen. Seine Ambitionen zielten darauf, ein maître d’hôtel zu werden, fünfzigtausend Francs auf die hohe Kante zu legen, um damit ein kleines Spezialitätenrestaurant am rechten Seine-Ufer zu eröffnen.
Vom Krieg erzählte Boris immer als der glücklichsten Zeit seines Lebens. Krieg und Soldatendasein waren seine ganze Leidenschaft; er hatte eine Unzahl von Büchern über Strategie und Militärgeschichte verschlungen und konnte alles über die Theorien von Napoleon, Kutuzoff, Clausewitz, Moltke und Foch daherbeten. [33] Alles, was mit Soldaten zu schaffen hatte, machte ihm Spaß. Sein Lieblingscáfe war die Closerie des Lilas am Montparnasse – und das einzig deshalb, weil das Standbild des Marschalls Ney davorstand. Später gingen Boris und ich hin und wieder zur Rue du Commerce. Und wenn wir mit der Métro fuhren, stieg Boris schon immer an der Cambronne-Station statt an der Commerce aus: Er genoß die Aura des Generals Cambronne, der bei Waterloo aufgefordert worden war, sich zu ergeben und dazu nichts weiter zu sagen hatte als: »Merde!«
Das einzige, was Boris von der Revolution noch übrigbehalten hatte, waren seine Orden und einige Photographien seines alten Regiments; es waren die einzigen Dinge, die er vor dem Pfandleiher bewahrt hatte. Fast jeden Tag pflegte er die Bilder vor sich auf seinem Bett auszubreiten und über sie zu reden:
»Voilà, mon ami! Da kannst du mich an der Spitze meiner Kompanie erkennen. Tolle, große Kerle, äh?! Das ist was anderes als diese winzigen Ratten von Franzosen. Ein Hauptmann mit zwanzig – nicht schlecht, äh?! Tja, ein Hauptmann der Zweiten Sibirischen Schützen; und mein Vater war Oberst.
Ah, mais, mon ami, das ewige Auf und Ab im Leben! Erst Hauptmann in Rußlands Armee, und dann peng! die Revolution – keinen Penny mehr in der Tasche. 1916 war ich dann eine Woche im Hôtel Edouard Sept; 1920 versuchte ich dort Nachtwächter zu werden, Kellerist, Aufwisch-Mann, Tellerwäscher, Gepäckträger, Toilettenmann. Ich hab Kellnern Trinkgeld gegeben, und Kellner haben mir Trinkgeld gegeben.
Ach ja, ich habe erfahren, mon ami, was es heißt, wie [34] ein Gentleman zu leben. Ich sag das gar nicht, um anzugeben, aber erst neulich, da habe ich versucht, auszurechnen, wieviele Geliebte ich in meinem Leben gehabt hab, und ich bin auf über zweihundert gekommen. Jawohl, mindestens zweihundert… Ach ja, ça reviendra. Sieg dem, der am längsten im Kampfe ausharrt. Mut und Courage!« usw. usw.
Boris hatte eine sonderbare, unstete Natur. Er wünschte sich ständig die Zeit in der Armee zurück, andererseits aber war er auch lange genug Kellner gewesen, als daß er nicht über das Weltbild eines Kellners verfügte. Obwohl er nie mehr als einige tausend Francs gespart hatte, nahm er es doch als unumstößlich an, am Ende sein eigenes Restaurant zu eröffnen und ein reicher Mann zu werden. Alle Kellner, fand ich später heraus, reden und denken so; es ist genau das, was sie schließlich alle herzlich gerne Kellner bleiben läßt. Und Boris konnte interessant vom Hotelleben plaudern: