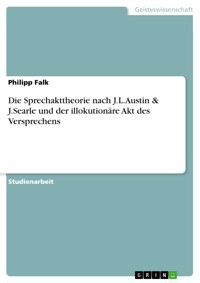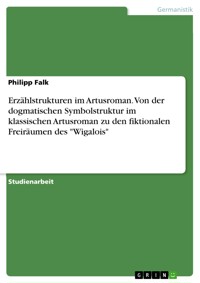
Erzählstrukturen im Artusroman. Von der dogmatischen Symbolstruktur im klassischen Artusroman zu den fiktionalen Freiräumen des "Wigalois" E-Book
Philipp Falk
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 1,0, Universität Paderborn, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Hausarbeit thematisiert die divergierenden Erzählstrukturen im klassischen und nachklassischen Artusroman. Dabei liegt ein Fokus auf der von der älteren germanistischen Artusforschung angelegten Schablone des Doppelwegs mit Symbolstruktur, sowie der Verwerfung ebendieser übergeordneten Erklärungsstruktur zugunsten eines späteren Artusromans, der sich in jüngeren Forschungsansätzen durch seine Öffnung hin zu mehr fiktionalem Freiraum auszeichnet. Der Analyse zu dieser gattungsimmanenten Dynamisierung liegt – neben der verwendeten Sekundärliteratur – Wirnt von Grafenbergs „Wigalois“ als Fundament der Untersuchung zugrunde. Als hierbei entscheidendes Konstituens wird die Untersuchung der abweichenden Darstellungen des Protagonisten der Handlung eine Vorrangstellung einnehmen und der Versuch unternommen, den aufgrund seines linear verlaufenden Handlungsstrangs als defizitär ausgewiesenen „Wigalois“ zu einem progressiven Fortschritt innerhalb der literarischen Reihe auszuweisen. Der Aufbau der Arbeit gliedert sich in einen Dreischritt: In einem ersten Schritt gilt es, Besonderheiten und strukturelle Merkmale der früheren sogenannten Gipfelromanen der Artusliteratur ausfindig zu machen und forschungsgeschichtliche Etappen bezüglich der sinnvermittelnden Symbolstruktur zu untersuchen. Darauf folgend nehme ich Bezug auf kritische Schriften in der jüngeren germanistischen Mediävistik, welche die von Hugo Kuhn eingeführte Symbolstruktur zu relativieren und andere Zugänge zur Erschließung der intra- und intertextuellen Bezüge in den Artuswerken freizulegen versuchen. Der Hauptteil meiner Untersuchungen liegt in der Analyse des „Wigalois“ auf personenorientierte Indizien hin, die einen divergierenden Heldentypus offenbaren und die Erzähltechnik des Wirnt von Grafenberg als progressiven Fortschritt in der Artuserzählung plausibel erklären können. Dabei soll eine Argumentation entwickelt werden, die einer Zuschreibung als defizitär epigonales Werk entgegen wirken kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Gattungs- und Strukturmerkmale des Artusromans
3. Kritiken zur Symbolstruktur
4. Wigalois
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In der vorliegenden Hausarbeit beschäftige ich mich mit den divergierenden Erzählstrukturen in klassischem und nachklassischem Artusroman. Dabei setze ich einen Fokus auf die von der älteren germanistischen Artusforschung angelegte Schablone des Doppelwegs mit Symbolstruktur, sowie der Verwerfung ebendieser übergeordneten Erklärungsstruktur, zugunsten eines späteren Artusromans, der sich in jüngeren Forschungsansätzen durch seine Öffnung hin zu mehr fiktionalem Freiraum auszeichnet. Der Analyse zu dieser gattungsimmanenten Dynamisierung liegt - neben der verwendeten Sekundärliteratur - Wirnt von Grafenbergs Wigalois als Fundament der Untersuchung zugrunde. Als hierbei entscheidendes Konstituens wird die Untersuchung der abweichenden Darstellungen des Protagonisten der Handlung eine Vorrangstellung einnehmen und der Versuch unternommen, den aufgrund seines linear verlaufenden Handlungsstrangs als defizitär ausgewiesenen Wigalois zu einem progressiven Fortschritt innerhalb der literarischen Reihe auszuweisen.
Der Aufbau der Arbeit gliedert sich in einen Dreischritt:
In einem ersten Schritt gilt es, Besonderheiten und strukturelle Merkmale der früheren sogenannten Gipfelromanen der Artusliteratur ausfindig zu machen und forschungsgeschichtliche Etappen bezüglich der sinnvermittelnden Symbolstruktur zu untersuchen. Darauf folgend nehme ich Bezug auf kritische Schriften in der jüngeren germanistischen Mediävistik, welche die von Hugo Kuhn eingeführte Symbolstruktur zu relativieren und andere Zugänge zur Erschließung der intra- und intertextuellen Bezüge in den Artuswerken freizulegen versuchen. Der Hauptteil meiner Untersuchungen liegt in der Analyse des Wigalois
2. Gattungs- und Strukturmerkmale des Artusromans
Der deutsche Artusroman erfährt in der germanistischen Mediävistik oftmalig eine Einordnung in klassisch oder nachklassisch. Diese Unterscheidung beruht auf Grundlage besonderer Gestaltungsmerkmale und jeweiliger Abweichungen davon.[1] Die „klassischen Gipfelwerke“ hielten in der Forschung längere Zeit eine Vorrangstellung in Bezug auf die Befragung der Gattungsspezifik inne.[2] Viele spätere Werke erfuhren eine Abwertung aufgrund ihrer vermeintlichen „Epigonalität“[3] und wurden mit Attributen des „spät-“ in die „Denkformen des ‚nich mehr‘ […] eingespannt.“[4] Bezüglich dieser Ausdifferenzierung sei in einem ersten Schritt ein übersichtlicher Exkurs über forschungsgeschichtliche Etappen zur Artusliteratur gegeben.
Der französische Artusroman Erec et Enide von Chrétien de Troyes gilt gemeinhin als Gattungsbegründer des Artusromans. Chrétiens Vorlage diente nicht zuletzt Hartmann von Aue als Hauptquelle für seinen um 1180 entstandenen Erec, dem ersten deutschen Artusroman.[5]
Der im Artusroman vorbildlich und idealisiert konzipierte König Artus an seinem ritterlichen Hof, bildet im Roman gewissermaßen einen passiven Mittelpunkt. Artus selbst ist nicht Held und somit Träger der Handlung, sondern ein Ritter aus der Tafelrunde geht den „spezifischen Erfahrungsweg eines Einzelnen.“[6] Diesem Weg des Einzelnen in der Erzählung ist in der Forschung ein spezifisches Bauprinzip zu Grunde gelegt worden, welches aus zwei korrespondierenden Teilen im biographischen Weg des Helden besteht:
[…] ein Doppelweg durch die Abenteuerwelt, dessen erster Durchgang mit dem Erwerb von Ehre und Liebe in einer Krise endet, die zum Ausgangspunkt des zweiten Durchgangs wird, in dem eben die Fehler korrigiert werden, die beim ersten Mal zum Scheitern geführt hatten.[7]