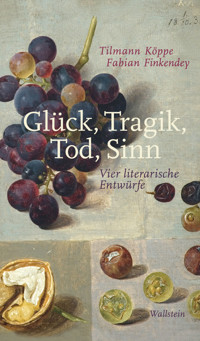14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Studienbuch Germanistik
- Sprache: Deutsch
Was ist eine Erzählung? Wie sind Aufbau und Präsentationsweisen von Erzähltexten zu beschreiben? Ausgehend von diesen Grundfragen bietet das Studienbuch eine umfassende Einführung in die Erforschung des Erzählens: Welche Besonderheiten hat das Erzählen in unterschiedlichen Medien? Haben fiktionale Erzählungen immer einen Erzähler? Was ist eine Figur? Wie lassen Schilderungen den Eindruck der Unmittelbarkeit entstehen? Und wovon hängt die Zuverlässigkeit einer erzählerischen Darstellung ab? Das Studienbuch stellt die Voraussetzungen, Strukturen und Funktionen des Erzählens vor, gibt einen Überblick über die Kernprobleme der Erzähltheorie und erläutert Verfahren der Einzeltextanalyse. Tabellen, Infoboxen, Analysebeispiele und Literaturempfehlungen runden den Band ab. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Tom Kindt / Tilmann Köppe
Erzähltheorie
Eine Einführung (Reclams Studienbuch Germanistik)
Reclam
2., erweiterte und aktualisierte Auflage
2022 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung nach einem Konzept von zero-media.net
Coverabbildung: Marc-Antoine Mathieu, 3 secondes (Ausschnitt). © Éditions Delcourt, 2011
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2022
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962057-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011358-5
www.reclam.de
Inhalt
Einleitung
1 Erzähltheorie
1.1 Die Bedeutung des Erzählens und die Anfänge seiner Erforschung
1.2 Was ist Erzähltheorie?
2 Die Erzählung
2.1 Von der erzählenden Ereignisverknüpfung zur Erzählung
2.2 Fiktionale Erzählungen
2.3 Erzählungen und Medialität
2.4 Literarische Erzählungen
3 Handlung und Ebenen
3.1 Die Handlung von Erzählwerken
3.2 Ebenen des Erzählens
4 Fiktive Erzählwelten
4.1 ›Interner‹ und ›externer‹ Standpunkt
4.2 Was ist der Fall in einer fiktiven Erzählwelt?
5 Figurenanalyse
5.1 Der ›interne‹ Standpunkt: Figuren als lebendige Wesen
5.2 Der ›externe‹ Standpunkt: Figurendarstellung
5.3 Funktionen von Figurendarstellungen
6 Zeitstruktur von Erzählungen
7 Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit erzählerischer Präsentation
8 Erzählperspektive
8.1 Fokalisierung
8.2 Autor, impliziter Autor
9 Unzuverlässiges Erzählen
9.1 Täuschend unzuverlässiges Erzählen
9.2 Offen unzuverlässiges Erzählen
9.3 Axiologisch unzuverlässiges Erzählen
Anhang
Eine kurze Geschichte der Erzähltheorie
Wegbereiterinnen und Wegbereiter der Erzähltheorie
Literatur
Namenregister
Sachregister
Zu den Autoren
[7]Einleitung
Beim vorliegenden Buch handelt es sich um eine Einführung in die Erzähltheorie. Es soll Antworten auf Fragen wie die folgenden geben: Was ist eine Erzählung? Aus welchen Grundbausteinen setzen sich Erzähltexte zusammen, und wie sind deren Aufbau und Präsentationsweisen zu beschreiben? Haben Erzählungen immer einen Erzähler? Was ist eine Figur? Wie lassen Schilderungen den Eindruck der Unmittelbarkeit entstehen? Und wovon hängt die Zuverlässigkeit einer erzählerischen Darstellung ab?
Die Überlegungen in den folgenden Kapiteln sollen sowohl der einführenden Orientierung als auch der weiterführenden eigenen Positionierung im Feld der Erzähltheorie dienen. Dabei werden also zwei Zielsetzungen zugleich verfolgt, die in vielen Publikationen zu diesem Feld als Alternativen verstanden werden, nämlich einerseits die, einen Überblick über bisherige Auseinandersetzungen der Erzähltheorie zu geben, und andererseits die, eigene Vorschläge zur Bestimmung ihrer Grundkonzepte und zur Klärung einiger ihrer Kernprobleme zu entwickeln.
Mit dieser doppelten Zielsetzung liefert das vorliegende Buch eine zusammenhängende Darstellung der Erzähltheorie. Seine verschiedenen Kapitel schließen an die jeweils vorangegangenen Abschnitte an und führen deren Überlegungen zumindest in einzelnen Punkten weiter – es lässt sich also sinnvoll von vorn nach hinten lesen. Zugleich sind die Kapitel des Buches und deren kleinere Unterkapitel in sich geschlossen und ohne große Mühe für sich verständlich, einschließlich der gelegentlichen vertiefenden Hinweise, die in Kästchen vom Haupttext abgesetzt sind – es lässt sich also auch als Aufsatzsammlung, Handbuch oder Nachschlagewerk nutzen.
Für die vorliegende Neuauflage von Erzähltheorie. Eine Einführung wurden die einzelnen Kapitel gründlich überarbeitet, hier und da wurde die Darstellung gestrafft, anderes wurde ausführlicher erläutert, neue Forschungsliteratur wurde durchgehend berücksichtigt. Die Kapitelstruktur wurde den neuen Inhalten angepasst.
Auch wenn wir die vorliegende Einführung verfasst haben, so wäre sie doch ohne die Unterstützung und Ermunterung durch eine Reihe von Personen nicht fertig geworden. Namentlich Matthias Aumüller, Anna Ertel, Claudia Hillebrandt, Tobias Klauk, Jonas Koch, Harry Müller und Jan Stühring möchten wir für zahlreiche Anregungen danken.
Zu danken haben wir auch Adrian Brauneis, Simone Lang, Victor Lindblom, Antonia Luiking, Evelyn Waldt und Julia Woest für Hilfe bei der Manuskripteinrichtung sowie die Durchsicht von Manuskriptfassungen; Adrian Brauneis war uns überdies bei der Erstellung des Literaturverzeichnisses und des [8]Namenregisters sowie der Liste mit Wegbereiterinnen und Wegbereitern der Erzähltheorie behilflich. Der Titanic danken wir für stilistischen Rat.
»Wenn man nur an sich denkt«, so sagt Brechts Figur Herr Keuner, »kann man nicht glauben, daß man Irrtümer begeht, und kommt also nicht weiter. Darum muß man an jene denken, die nach einem weiterarbeiten. Nur so verhindert man, daß etwas fertig wird« (Brecht 1929, S. 31). Im Sinne dieser Bemerkung hoffen wir, dass die vorliegende zweite Auflage der Einführung in die Erzähltheorie nicht fertig geworden ist.
[9]1 Erzähltheorie
1.1 Die Bedeutung des Erzählens und die Anfänge seiner Erforschung
Wer sich vergegenwärtigen will, welch große Bedeutung das Erzählen für den Menschen und das menschliche Zusammenleben besitzt, der sollte den Versuch unternehmen, sich eine Gesellschaft vorzustellen, in der nicht erzählt wird. Ein entsprechendes Vorhaben stellt unser Vorstellungsvermögen vor eine schwierige Aufgabe. Vermutlich liegt das nicht zuletzt daran, dass uns für ein solches Gedankenspiel die Vorbilder fehlen; wir wissen von keiner vergangenen Kultur, die ohne das Erzählen ausgekommen ist, und wir kennen weder eine gegenwärtige Gesellschaft noch eine erdachte Welt, in der dies der Fall ist. Wo immer Menschen zusammenleben, so lehrt die Erfahrung und bestätigen Geschichtsschreibung, Ethnologie und Soziologie, da wird auch erzählt. Es handelt sich beim Erzählen, kurz gesagt, um Anthropologische Universalie eine anthropologische Universalie.
Die Schwierigkeiten, die das skizzierte Gedankenspiel bereitet, erklären sich allerdings nicht allein daraus, dass das Erzählen – mit Roland Barthes gesprochen – »international, transhistorisch, transkulturell« (Barthes 1966, S. 102) ist.1 Entscheidend scheint noch etwas anderes zu sein: Erzählt wird nicht nur in allen Gesellschaften, sondern zudem in fast allen Bereichen jeder einzelnen Gesellschaft. Menschen erzählen sowohl in der Dichtung als auch im Alltag, unabhängig davon, ob sie allein sind oder in Gemeinschaft, schon in früher Kindheit und noch in hohem Alter, bei der Arbeit oder beim Essen, vor Gericht, in Film und Fernsehen, aber auch in Kirchenpredigten und im Wirtschaftsleben, wenn sie einen Arzt besuchen oder Sport treiben, Kaffee trinken oder Kinder ins Bett bringen, beim Spazierengehen ebenso wie in der Schule und in den Wissenschaften. Das Erzählen ist eine anthropologische Universalie, die im menschlichen Zusammenleben Ubiquitäres Phänomen ein ubiquitäres Phänomen darstellt, oder doch eines mit sehr weiter Verbreitung.
Versucht man also, sich eine Gesellschaft ohne Erzählen vorzustellen, bemerkt man, was in den vergangenen Jahren zusehends in den Blick gekommen ist – dass es einen engen Zusammenhang zwischen dem Erzählen und dem Menschsein überhaupt gibt. Man wird vielleicht nicht so weit gehen wollen [10]und aus den umrissenen Beobachtungen folgern, dass der Mensch als ›das erzählende Tier‹ einzustufen ist, wie in den letzten Jahrzehnten immer wieder vertreten wurde, zuletzt etwa von dem Schriftsteller Henning Mankell: »Eine angemessenere Bezeichnung für unsere Spezies als Homo sapiens scheint Homo narrans zu sein, […] wir sind Geschichten erzählende Wesen« (Mankell 2011; ähnlich schon Fisher 1984). Peter Brooks’ nüchterner Erläuterung der Bedeutung, die das Erzählen für den Menschen besitzt, kann man aber rückhaltlos zustimmen: »Die Erzählung ist eine der allgemeinen Kategorien und Methoden des Verstehens, die wir in unserer Auseinandersetzung mit der Realität nutzen, insbesondere in unserer Auseinandersetzung mit dem Problem der Zeitlichkeit, mit der menschlichen Zeitgebundenheit« (Brooks 1984, S. xi). Erzählen mag nicht das zentrale Wesensmerkmal des Menschen sein – ein markantes Alleinstellungsmerkmal ist es ohne Frage (vgl. vertiefend den Infokasten »Wo wird nicht erzählt?«).
Angesichts der großen Relevanz, die dem Erzählen im menschlichen Leben zukommt, kann es nicht überraschen, dass erste Ansätze zu seiner systematischen Reflexion und insofern Vorformen erzähltheoretischer Überlegungen in der Antike Vorformen erzähltheoretischer Überlegungen bereits in der Antike entstehen. Diese Ansätze nehmen das Erzählen freilich – und das sollte lange Zeit so bleiben – nur mittelbar und ausschnitthaft in den Blick. Betrachtet wird nicht das Phänomen als solches, im Fokus stehen vielmehr einzelne seiner Ausprägungen wie insbesondere das Erzählen in angesehenen literarischen Gattungen, und auch diese Ausprägungen nur insoweit, als sie in bestimmten systematischen Zusammenhängen interessant erscheinen, vor allem in Reflexionen zu den Formen der Dichtung und in der Theoriebildung zur Redekunst oder Geschichtsschreibung.
Einflussreiche Beispiele für entsprechende Überlegungen finden sich in PlatonsDer Staat (um 380 v. Chr.) und Aristoteles’ Poetik (um 335 v. Chr.): Beide Werke machen das Erzählen selbst nicht zum Thema; sie liefern aber, im Kontext von Betrachtungen zur Dichtkunst und ihren Spielarten, einige Ausführungen zur Gattung des Epos, die sich aus heutiger Sicht als frühe Beiträge zu einer allgemeinen Charakterisierung des Erzählbegriffs verstehen lassen. Platon unterscheidet das Epos mit Hilfe des sogenannten Redekriteriums von anderen Gattungen, d. h. unter Bezugnahme auf die Frage, wer in einem literarischen Werk spricht; für ihn ist die epische Dichtung durch eine Art der Redegestaltung charakterisiert, bei der einerseits – wie im Gedicht – der Autor selbst und andererseits – wie in der Komödie und Tragödie – die Figuren zu Wort kommen (vgl. Platon, Der StaatIII 394a–c). Aristoteles bestimmt das Epos als diejenige der beiden Grundformen dichterischer Handlungsdarstellung, die nicht auf Figurenhandeln, sondern auf der entweder ungebrochen [11]oder in einer Sprecherrolle vorgetragenen Rede des Autors beruht (vgl. Aristoteles, Poetik 1448a).
Zwischen Antike und Moderne durchläuft das Verständnis des Erzählerischen eine Reihe von Wandlungen (vgl. Scheffel 2010; Contzen/Tilg 2019, Kap. 1–3); seine theoretische Thematisierung erfolgt aber durchweg in der indirekten und selektiven Form, die sich bei Platon und Aristoteles beobachten lässt. Das ändert sich erst im späten 19. Jahrhundert. Im Zuge der Institutionalisierung der Kulturwissenschaften im 19. Jahrhundert Institutionalisierung und Professionalisierung der Text- und Kulturwissenschaften kommt es nun zu einer Neuausrichtung der Beschäftigung mit literarischen Texten und anderen kulturellen Artefakten (vgl. Kindt/Müller 2008), die auch in der Auseinandersetzung mit Erzählungen ihren Niederschlag findet und im Wesentlichen durch zwei Merkmale gekennzeichnet ist: Zum einen wird das Erzählen jetzt als Forschungsgegenstand eigenen Rechts entdeckt, es kommt also nicht mehr nur im Kontext der Untersuchung anderer Phänomene und Probleme in den Blick. Und zum anderen entsteht eine Form von Erzählforschung, die sich an strengeren Maßstäben von Wissenschaftlichkeit auszurichten versucht und an die Stelle der normativen Betrachtung von Erzählungen deren Deskriptiv-empirische Erschließung von Texten deskriptiv-empirische Erschließung treten lässt.
Im Zeichen dieser Neuausrichtung beginnt sich um 1900 das Forschungsfeld »Erzähltheorie« herauszubilden, das Gegenstand dieser Einführung ist. Ein Überblick über die Geschichte des Gebiets seit seiner Herausbildung und über seine Wegbereiterinnen und Wegbereiter findet sich im Anhang des vorliegenden Bandes. Die folgenden Unterkapitel (1.2.1 bis 1.2.3) betrachten Aufbau, Aufgaben und Bausteine der Erzähltheorie sowie ihr Verhältnis zu anderen Bereichen der Literatur- und Kulturwissenschaften.
Erstens: Der Ausdruck ›Narratologie‹ wird im Folgenden als gleichbedeutend mit dem Term ›Erzähltheorie‹ verwendet. Anders als es gelegentlich vorgeschlagen wird, sollen die beiden Ausdrücke also nicht zur Bezugnahme auf unterschiedliche Traditionen der systematischen Reflexion des Erzählens genutzt werden (vgl. etwa Nünning/Nünning 2002b; Meister 2009), beispielsweise zur Abgrenzung der ›deutschen Erzähltheorie‹ von der ›französischen‹ bzw. ›anglo-amerikanischen Narratologie‹ (so etwa Darby 2001). Entsprechende Verwendungen der Bezeichnungen gehen an deren Gebrauch in den Text- und Kulturwissenschaften vorbei und verdecken überdies die grundlegenden Gemeinsamkeiten und zahlreichen Verbindungslinien zwischen den jeweils unterschiedenen Forschungstraditionen (vgl. auch Fludernik 2003).
Zweitens: Von ›Erzähltheorie‹ oder ›Narratologie‹ wird hier nicht schon dann gesprochen, wenn in einem Text Erzählvorgänge oder Erzählungen thematisiert werden, sondern nur dann, wenn dies in theoretischer Weise geschieht (vgl. Kap. 1.2.1). In Abgrenzung von einigen neueren Vorschlägen (so z. B. Herman 1999) soll also zwischen der Theorie des Erzählens und der mehr oder weniger theoriegeleiteten Praxis der Erzählanalyse unterschieden werden, die hier als ›Erzählforschung‹, ›Erzähltextanalyse‹ o. Ä. bezeichnet wird (vgl. zu dieser Unterscheidung auch Cornils/Schernus 2003; Nünning 2003).
Drittens: Entgegen einer verbreiteten Einschätzung (vgl. etwa Herman 1999; Nünning 2001) sind wir der Überzeugung, dass von ›Erzähltheorie‹ und ›Narratologie‹ weiterhin auch im Singular und keineswegs nur noch im Plural die Rede sein sollte: Wer von ›Erzähltheorien‹ spricht, bezieht sich auf die Menge der mehr oder weniger unterschiedlichen Ausgestaltungen der Erzähltheorie. Die Frage nach dem Aufbau und den Aufgaben der Erzähltheorie wird durch die Pluralisierung des Theoriefeldes (vgl. Anhang) nicht überflüssig, sondern umso drängender.
[12]1.2 Was ist Erzähltheorie?
Nach den kurzen Hinweisen zu den Anfängen der Erzähltheorie könnte die Vermutung naheliegen, dass die Titelfrage dieses Unterkapitels bereits beantwortet ist und auf ihre weitere Erörterung verzichtet werden kann. Erzähltheorie ist, so lassen sich die einleitenden Bemerkungen auf eine Formel bringen, die systematische Beschäftigung mit dem Phänomen des Erzählens als solchem. Oder mit den Worten des Literaturwissenschaftlers Gerald Prince, einer wichtigen Stimme in der Erzähltheorie seit einem halben Jahrhundert: Narratologie ist »Eine Theorie der Erzählung qua Erzählung eine Theorie der Erzählung qua Erzählung« (Prince 1995, S. 127).
Eine solche Antwort auf die Frage nach der Erzähltheorie ist nicht falsch; sie erscheint aber, zumal in einer Einführung in den Theoriebereich, recht unbefriedigend, da sie stark erläuterungsbedürftig ist. Dies gilt vor allem für den Ausdruck ›Zum Theoriebegriff Theorie‹ im Kompositum ›Erzähltheorie‹, der sich weder grundsätzlich noch im vorliegenden Zusammenhang von selbst versteht. Wer eine Vorstellung davon gewinnen und vermitteln will, was Erzähltheorie ist, der sollte sich darum in zumindest umrisshafter Form mit zwei weitergehenden Fragen beschäftigen: Es gilt zum einen zu bestimmen, was im Fall der Erzähltheorie, und in den Text- und Kulturwissenschaften im Allgemeinen, mit dem Begriff ›Theorie‹ bzw. der Rede von ›theoretischer Beschäftigung‹ mit einem Gegenstand gemeint ist. Und es ist zum anderen zu klären, als was für eine Art von Theorie die Narratologie zu verstehen ist, worin also genau ihre [13]Zuständigkeiten, Aufgaben und Leistungen zu sehen sind (vgl. Prince 1990; Kindt/Müller 2003a; Schönert 2004; Meister 2009). Zunächst werden wir der Struktur und den Funktionen der Erzähltheorie nachgehen. Sodann soll deren Verhältnis zu anderen Theoriefeldern in den Text- und Kulturwissenschaften geklärt werden. Und schließlich wollen wir einige Hinweise zum Problem der Begriffsbestimmung geben, denn Begriffe sind so etwas wie die Grundbausteine der Narratologie.
Um Missverständnissen vorzubeugen, sei vorausgeschickt: In unseren entsprechend gegliederten Überlegungen gehen wir davon aus, dass eine adäquate Antwort auf die Frage ›Was ist Erzähltheorie?‹ nicht allein in einer historischen Bestandsaufnahme zur Forschungsdiskussion bestehen kann, sondern einen normierenden Vorschlag zum Theorieverständnis umfassen sollte. Unsere Betrachtungen wird also kennzeichnen, was Holmer Steinfath als grundlegendes Merkmal philosophischer Antworten auf ›Was ist …?‹-Fragen charakterisiert hat – dass es sich bei ihnen nämlich »um eine Sache zugleich von Aufdeckung und Auslegung, Entdeckung und Entscheidung« (Steinfath 2001, S. 13) handelt.
1.2.1 Aufbau und Aufgaben der Erzähltheorie
Der Ausdruck ›Theorie‹ dient zur Bezugnahme auf gedankliche Gebilde, die im Einzelnen eine recht unterschiedliche Gestalt haben können. So bezeichnet er beispielsweise Modelle zur Erklärung und Voraussage von Naturprozessen (wie etwa in der Aussage Die Elementarteilchen verhalten sich im Sinne der Quantentheorie), Aussagensysteme ohne unmittelbaren Realitätsbezug (Die Zahlentheorie beruht auf verschiedenen Axiomen), Vorgaben und Regeln, die den Umgang mit bestimmten Objekten steuern sollen (Eric hält sich in seiner Deutung an eine intentionalistische Interpretationstheorie), komplexe Auffassungen zu allgemeinen Fragestellungen (Studieren Sie Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit) oder auch simple Erklärungen bestimmter Sachverhalte (Ich habe eine andere Theorie darüber, warum sich Nicolas und Carla getrennt haben).
In der wissenschaftsphilosophischen Auseinandersetzung über den Theoriebegriff ist die Bandbreite seiner Verwendungsvarianten erst in der jüngeren Vergangenheit ernst genommen und so allmählich überwunden worden, was nach Ludwig Wittgenstein eine »Hauptursache philosophischer Krankheiten« ist, nämlich die »einseitige Diät: man nährt sein Denken mit nur einer Art von Beispielen« (Wittgenstein 1953, § 593). Mittlerweile bezieht die betreffende Debatte nicht mehr nur die Theoriebildung in den Naturwissenschaften ein, [14]sondern auch die in Alltagskontexten und anderen Wissenschaftstraditionen. Aus diesem Grund sind verschiedene Bestimmungen des Theoriekonzepts entwickelt worden, die einerseits so weit gefasst sind, dass sie die meisten Gebrauchsweisen des Ausdrucks einfangen können, und andererseits so gehaltvoll, dass sie als Grundlage einer Unterscheidung maßgeblicher Theorietypen zu dienen vermögen (vgl. etwa Charpa 1996; Eberhard 1999, Kap. 1). Die Begriffsbestimmung dieses Zuschnitts, die Bezugspunkt der weiteren Betrachtungen zum Status der Erzähltheorie sein wird, stammt von dem Wissenschaftsphilosophen Ulrich Charpa; er hat den folgenden allgemeinen›Theorie‹: Klärungsvorschlag Klärungsvorschlag gemacht: »Theorien sollen […] solche wissenschaftlichen Auffassungen heißen, die bestimmte Funktionen in bezug auf Daten erfüllen« (Charpa 1996, S. 94; Hervorhebungen im Original).
Vor dem Blick auf die Erzähltheorie, der von dieser Bestimmung ausgeht, sind zwei Erklärungen zu der in ihr verwendeten Formulierung »wissenschaftliche Auffassungen« sinnvoll: Erstens sollte darauf hingewiesen werden, dass in dem Vorschlag mit Bedacht recht allgemein von »wissenschaftlichen Auffassungen« gesprochen wird. Im Sinne der neueren Wissenschaftstheorie versteht CharpaTheorien nicht als Mengen von Aussagen, sondern als Modelle und d. h. als grundsätzlich nicht-sprachliche Gebilde, die sich mit Hilfe von sprachlichen Einheiten wie Begriffen oder Sätzen in unterschiedlicher Weise darstellen lassen (vgl. z. B. ebd., S. 99–101; für einen Überblick Winther 2021). Im Fall der text- und kulturwissenschaftlichen Theoriebildung ist diese Differenzierung ohne größere Bedeutung, aber auch hier besteht die Möglichkeit, dass es sich bei unterschiedlich erscheinenden Positionen lediglich um sprachliche Varianten desselben Modells handelt.
Zweitens sei darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Bestimmung, indem sie von »wissenschaftlichen Auffassungen« spricht, nur auf eine Teilmenge der Vorstellungen bezieht, die hier im Anschluss an den alltagssprachlichen Ausdrucksgebrauch als Theorien verstanden werden. Charpas Vorschlag setzt mit anderen Worten eine Unterscheidung voraus, die im vorliegenden Zusammenhang erst noch zu erläutern ist, nämlich die zwischen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Auffassungen. Unter den verschiedenen Kriterien, an denen der betreffende Unterschied gemeinhin festgemacht wird, sind die folgenden vier hervorzuheben: Von wissenschaftlichen Theorien wird verlangt, dass sie (1) allgemein sind, also einen Geltungsanspruch erheben, der über Einzelfälle hinausgeht, dass sie (2) widerspruchsfrei sind, dass sie (3) fundiert, d. h. empirisch geprüft oder argumentativ begründet sind und dass sie schließlich (4) systematisch und explizit sind, ihre Begriffe folglich hinreichend klar definiert sein und ihre Annahmen in einem transparenten [15]logisch-argumentativen Zusammenhang stehen sollten (vgl. dazu grundlegend Føllesdal [u. a.] 1988, Kap. 3–4).
Damit sind die Voraussetzungen geschaffen für eine gehaltvollere Antwort auf die Frage, was Erzähltheorie ist, als sie in den einleitenden Abschnitten umrissen wurde: Grundsätzlich betrachtet handelt es sich bei der Erzähltheorie um Ein Modell des Gegenstands Erzählung ein wissenschaftliches Modell des Gegenstands Erzählen bzw. Erzählung, also eines, das den Kriterien wissenschaftlicher Theoriebildung gerecht zu werden hat. Eine weitergehende Charakterisierung der Theorie kann nun über eine Bestimmung der Funktionen erfolgen, die das Modell im Hinblick auf mündliche oder schriftliche Texte und d. h. auf die Daten erfüllt, auf die es sich bezieht. Sichtet man die Auseinandersetzungen um die Aufgaben der Erzähltheorie seit den späten 1950er Jahren, also seit ihrer Entwicklung zu einem eigenständigen Forschungsfeld (vgl. hierzu Anhang), kann man feststellen, dass ihr im Wesentlichen Funktionen des Modells zwei allgemeine Funktionen zugeschrieben werden, nämlich erstens die einer deskriptiven Erfassung des Gegenstands Erzählen bzw. Erzählung und zweitens die eines heuristischen Beitrags zum Umgang mit dem Gegenstand, d. h. insbesondere zur Interpretation von Erzählungen, zu ihrem Vergleich mit anderen Texten sowie zu ihrer Einordnung in historische Kontexte. Beide Aufgaben und ihr Verhältnis zueinander sollen nun kurz näher betrachtet werden.
Die Deskriptionsfunktion erste Funktion bestimmt seit der einflussreichsten Zeit des Strukturalismus das Selbstverständnis der Erzähltheorie. Autoren wie etwa Gerald Prince, Gérard Genette, Tzvetan Todorov oder Seymour Chatman sehen die Narratologie im Sinne jener Funktionszuschreibung als Teilbereich der Literatur- oder Texttheorie, der die Grundelemente und Realisierungsspielräume von Erzählungen zu klären hat (vgl. Titzmann 2003). In entsprechend ausgerichteten narratologischenModellen geht es zunächst darum, die wesentlichen Eigenschaften zu bestimmen, die ein Gegenstand erfüllen muss, um unter den Begriff der Erzählung zu fallen; darüber hinaus sollen aber auch typische Züge des Gegenstands oder verschiedene wichtige Hinsichten benannt werden, in denen sich seine konstitutiven und charakteristischen Merkmale ausgestalten lassen. In Chatmans Buch Story and Discourse heißt es zu diesem Vorhaben knapp: »Ziel der Erzähltheorie ist es, durch die Bestimmung der minimalen Konstituenten von Erzählungen ein Raster von Möglichkeiten zu entwickeln. Sie bezieht einzelne Texte auf dieses Raster und fragt, ob deren Einordnung eine Anpassung des Rasters erforderlich macht« (Chatman 1978, S. 19).
Auch die Analysefunktion zweite Funktion prägt seit den 1960er Jahren das Selbstbild des Forschungsfeldes. In musterhafter Form wird sie etwa bei Erzähltheoretikern [16]wie wiederum Genette, Franz K. Stanzel oder der frühen Mieke Bal ausgeführt. Die Aufgabe der Narratologie besteht dieser Sichtweise zufolge darin, das Instrumentarium für eine Analyse von Erzählungen zu entwickeln, die bei deren weitergehender Untersuchung als heuristischer Bezugspunkt zu dienen vermag (vgl. Kindt/Müller 2003a). Erzähltheorie ist demnach ein Begrifflicher Werkzeugkasten begrifflicher Werkzeugkasten, durch dessen Nutzung sich zwar nicht zu einer umfassenden Erschließung von Erzählungen gelangen lässt, wohl aber zu Textbeobachtungen und Strukturbestimmungen, die zu einer solchen Erschließung in unterschiedlicher Weise beizutragen vermögen: Sie können etwa dazu dienen, Interpretationen einzelner Erzählungen anzuregen, abzusichern oder in Frage zu stellen, sie können aber auch helfen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Texten zu bestimmen, Muster in umfangreicheren Textkorpora und literaturgeschichtlichen Entwicklungsprozessen zu entdecken oder Wirkungen und Wirkungspotentiale von Texten bzw. Textstrukturen zu erläutern. Im Sinne dieser Sichtweise merkt beispielsweise Stanzel an, dass seine Theorie des Erzählens nicht zuletzt als »Dienerin der Literaturkritik und Interpretation« (Stanzel 1979, S. 300) zu sehen sei. Und er ergänzt in Unterwegs. Eine Erzähltheorie für Leser, er habe stets Begriffe entwickeln wollen, »die sich als ›discovery tools‹ am konkreten Werk auf die Weise bewähren, daß sie den Leser zu Einsichten führen, die ihm ohne dieses theoretische Rüstzeug […] nicht zugänglich geworden wären« (Stanzel 2002, S. 19 f.). Genette und Bal weisen der Narratologie die gleiche Funktion zu, indem sie ihre Beiträge zur Erzähltheorie als »Hilfe zur Entdeckung und Beschreibungswerkzeug Entdeckungshilfe« und »Werkzeug der Beschreibung« (Genette 1972, S. 190) bzw. als »Mittel zur Erläuterung und Klärung von Lektüreeindrücken« (Bal 1985, S. x) einstufen.
Zur Problematisierung des Verständnisses von Erzähltheorie als Erschließungsheuristik wird gelegentlich darauf hingewiesen, dass die narratologische Beschreibung eines Textes für dessen interpretative Erklärung weitgehend oder sogar vollkommen irrelevant sein kann. Dieser Beobachtung ist nicht zu widersprechen, sie stellt aber keinen Einwand gegen das umrissene Narratologieverständnis dar, sondern unterstreicht noch einmal, dass die Erzähltheorie eben nicht als methodischer Leitfaden, sondern nur als heuristischer Bezugspunkt der Textdeutung zu verstehen ist. Dass sich in einer Erzählung eine bestimmte Perspektivgestaltung oder eine bestimmte Handlungskomposition beobachten lässt, ist für ihre Bedeutung oftmals, aber nicht notwendigerweise wichtig. Kurz gesagt: Die Textstrukturen, die sich mit Hilfe des narratologischen Instrumentariums identifizieren lassen, haben im Rahmen der Textinterpretation hohes Relevanzpotential, jedoch keine Relevanzgarantie.
[17]Anders als es einige Stellungnahmen in der narratologischen Auseinandersetzung nahelegen (vgl. etwa Chatman 1978 oder Prince 1995), handelt es sich bei den Verständnissen von Erzähltheorie, die mit den betrachteten Funktionszuschreibungen verbunden sind, keineswegs um konkurrierende, sondern um einander ergänzende Sichtweisen. Ein Modell, das den Gegenstandsmodell und Analyseleitfaden Gegenstand Erzählung allgemein zu erfassen versucht, lässt sich selbstverständlich zugleich als Leitfaden der Analyse einzelner Erzählungen nutzen. Und die Anwendung des Objektmodells im Rahmen von Textanalysen ist der entscheidende Prüfstein für seine Stichhaltigkeit und Fruchtbarkeit. Die beiden bestimmenden Funktionen der Erzähltheorie stehen also – mit Todorov gesprochen – für zwei Tendenzen der Auseinandersetzung mit narrativen Texten, die sich ohne weiteres miteinander verknüpfen lassen (vgl. dazu Todorov 1971, Kap. 1).
1.2.2 Beziehungen zu anderen Theorien
Das Verständnis von Narratologie, das im vorangegangenen Abschnitt entwickelt wurde, liegt den Beiträgen zugrunde, die das Forschungsfeld etabliert haben, etwa den Ansätzen von Genette, Stanzel, Prince oder Chatman. Seit einiger Zeit wird der vertretenen Position allerdings zusehends mit Vorbehalten begegnet (vgl. dazu auch Anhang). Die Narratologie müsse, so eine weitverbreitete Forderung, aus ihrer Aus der ›klassischen‹ in eine ›postklassische‹ Phase?›klassischen‹ Phase in eine ›postklassische‹ übergehen (vgl. Herman 1999; Nünning/Nünning 2002b). Angesichts der Beachtung, die diese These im Forschungsfeld gefunden hat (vgl. Meister 2009, S. 339–341; Alber/Fludernik 2010), sei durch einen Blick auf die Beziehung zwischen der Erzähltheorie und anderen Bereichen der Theoriebildung in den Text- und Kulturwissenschaften kurz erläutert, weshalb im Folgenden an einem vergleichsweise traditionellen Verständnis von Narratologie festgehalten werden soll.
Die Kritik an ›klassischer‹ Erzähltheorie Kritik an einer entsprechenden Idee von Erzähltheorie und die Vorschläge zu deren Umgestaltung treten in verschiedenen Spielarten auf. Gemeinsamer Ausgangspunkt ist dabei allerdings die Unzufriedenheit mit der Reichweite und den Leistungen der vorliegenden Ansätze. Im Anschluss an [18]die obigen Hinweise zum Theoriebegriff lässt sich dieser Befund noch etwas genauer erläutern: Die postklassische Narratologie hält sowohl die Daten für unzureichend, auf die sich die klassische Narratologie bezieht, als auch die Funktionen, die sie hinsichtlich der betreffenden Daten zu erfüllen beansprucht. Gefordert wird in vielen neueren Diskussionsbeiträgen deshalb eine Ausweitung einerseits des Gegenstands- und andererseits des Aufgabenbereichs der Erzähltheorie.
Gegenstandsbezogene Erweiterungsforderung Die gegenstandsbezogene Erweiterungsforderung findet vor allem in dem seit einem Jahrzehnt intensiv verfolgten Projekt einer intermedialen Narratologie ihren Niederschlag. Gestützt auf die Beobachtung, dass Erzählen ein ubiquitäres Phänomen darstellt, setzen sich die Vertreter dieses Vorhabens für eine Erzähltheorie ein, die nicht allein textgebundenen oder gar literarischen Erzählungen, sondern allen medialen Ausprägungen des Narrativen gerecht zu werden vermag (vgl. etwa Wolf 2002; Ryan 2004; Kreiswirth 2005; Mahne 2007). Aufgabenbezogene Erweiterungsforderung Die aufgabenbezogene Erweiterungsforderung zeigt sich musterhaft in den zahlreichen Manifesten für eine historische oder kontextualistische Narratologie, die im Forschungsfeld seit Jahrzehnten für Diskussionen sorgen. Ausgehend von der Erfahrung, dass die Anwendung der Erzähltheorie nicht zu einer umfassenden Erschließung von Erzähltexten führt, wird hier die Idee entwickelt, die Narratologie aus einem Analyseinstrumentarium in eine Interpretationstheorie umzugestalten, die in der Lage ist, die Auslegung von Texten in allen für wichtig erachteten Kontexten anzuleiten (vgl. z. B. Lanser 1986; Nünning 2000; Darby 2001; Sommer 2007).
Die Forderungen nach einer Ausweitung der Datenbasis und des Funktionsspektrums der Erzähltheorie stützen sich auf einige durchaus einleuchtende Beobachtungen, sie gelangen vor deren Hintergrund aber zu wenig überzeugenden Folgerungen. Im Fall des Vorhabens, der Narratologie eine Intermediale Ausrichtung der Narratologie und ihre Grenzen intermediale Ausrichtung zu geben, ist es dabei nicht der Vorschlag selbst, der problematisch erscheint; zweifelhaft sind die mit ihm verbundenen Vorstellungen von der Gestalt und den Möglichkeiten einer entsprechend reformierten Erzähltheorie. Zumeist wird erheblich unterschätzt, wie groß die Unterschiede zwischen den Realisierungen des Erzählens in verschiedenen Medien sind und wie wenig erfolgversprechend darum das Vorhaben erscheint, die an Texten entwickelten erzähltheoretischen Begriffe so anzupassen, dass sie für eine medienübergreifende Verwendung geeignet sind (vgl. dazu auch die Hinweise zum Erzählen in visuellen und audiovisuellen Medien in Kap. 2.3). Angesichts der vielfältigen medienspezifischen Ausprägungen des Erzählens kann eine intermediale Erzähltheorie im strengen Sinne auf kaum mehr hinauslaufen als auf einen allgemeinen Begriff des Narrativen bzw. der [19]Narrativität, dessen Nutzen begrenzt ist (vgl. Jannidis 2003, S. 50 f.; Kindt 2009, S. 42 f.). So herausfordernd der Entwurf eines solchen abstrakten Konzepts des Erzählerischen sein mag – die theoretisch grundlegende und praktisch maßgebliche Modellbildung wird weiterhin in der Entwicklung medienspezifischer Erzähltheorien bestehen (vgl. Hausken 2004).
Gegen das Projekt einer aufgabenbezogenen Erweiterung der Narratologie sprechen noch grundsätzlichere Einwände: Wer fordert, die Kritik an Erzähltheorie als Interpretationsansatz Erzähltheorie in einen Interpretationsansatz umzuwandeln, der verfehlt schlicht die Stellung, die diese in der Theorienarchitektur und den Praxiszusammenhängen der Text- und Kulturwissenschaften einnimmt. Eine entsprechende Forderung verkennt nicht allein, dass die Erzähltheorie gerade in ihrem traditionellen Zuschnitt – also verstanden als begrifflicher Werkzeugkasten – im Rahmen unterschiedlich ausgerichteter interpretativer Erschließungen von Erzähltexten genutzt werden kann und wird (vgl. Kindt/Müller 2003a; 2003b). Sie übersieht zudem, dass es zur Erfüllung der Funktionen, die zum Umbau der Erzähltheorie Anlass geben sollen, bereits eine bemerkenswerte Bandbreite ebenso ausgearbeiteter wie effektiver Theorien gibt; wer eine Erklärung von Texten in Kontexten anstrebt, dem steht ein großes Arsenal an Literatur- bzw. Interpretationstheorien zur Verfügung (vgl. dazu Köppe/Winko 2013). Es ist nicht einzusehen, weshalb den betreffenden Theorien, die das vorhandene erzähltheoretische Instrumentarium zumeist produktiv einbeziehen, eine weitere hinzugefügt werden sollte, deren Anwendung zudem auf narrative Texte beschränkt ist. Der nur begrenzte Beitrag, den die Narratologie zur Textinterpretation zu leisten vermag, scheint also kurzum nicht für den Bedarf an einer erweiterten Erzähltheorie zu sprechen, sondern – wie Mieke Bal bemerkt hat – für den »Bedarf an weiteren Theorien neben der Erzähltheorie« (Bal 1985, S. 10).
Gegen die Klärung der Beziehung zwischen Erzähl- und Interpretationstheorie wird häufig der Einwand erhoben, dass sich Deskription und Interpretation, auf deren Unterscheidung die hier entwickelte Idee von Narratologie beruht, nicht in der vorgeschlagenen Weise voneinander abgrenzen lassen. Die narratologische Textbeschreibung sei, so wird geltend gemacht, immer schon Textdeutung (vgl. z. B. Schmid 2003; Sommer 2007; Petterson 2009).
Dazu ist zweierlei anzumerken: Erstens ist es richtig, dass die Anwendung eines narratologischen Begriffs auf einen Text (also etwa die Klärung der Frage, ob eine Textpassage intern fokalisiert ist oder nicht) mitunter keine offensichtliche Angelegenheit ist und einige Überlegung erfordert. Manche erzähltheoretischen Begriffe (etwa der des Plots, vgl. Kap. 3.1.1) setzen in ihrer Anwendung ein umfassendes Verständnis der Erzählung – und damit oftmals Interpretation – voraus. Zweitens bedeutet das aber nicht, dass sich die Deskription und Interpretation von Texten nicht grundsätzlich voneinander unterscheiden ließen. Grundlegend für die Unterscheidung zwischen Deskription und Interpretation ist hier die Zielsetzung der jeweils vorgenommenen Operationen (vgl. hierzu Kindt 2015): Beschreibungen sind Klassifikationsprozeduren. Sie versuchen zu klären, ob eine Textstruktur unter einen Begriff fällt, d. h., ob sie die Bedingungen erfüllt, die in der Definition des fraglichen Begriffs als notwendig (und hinreichend) angeführt werden (vgl. S. 22). Interpretation ist demgegenüber »das methodisch herbeigeführte Verstehen von Texten« (Spree 2000, S. 168; vgl. auch Spree 1995, S. 44–51), das diesen (je nach zugrunde gelegter Interpretationstheorie) etwa ein Thema, eine Aussageabsicht oder eine semantische Tiefenstruktur zuordnet. So verstanden, kann die Deskription eines Textes zwar mehr oder weniger umfassende und komplizierte Überlegungen voraussetzen (vgl. S. 141 f.), und die Interpretation eines Textes kann umgekehrt auf dessen mehr oder weniger genauer Deskription aufbauen – dies bedeutet aber nicht, dass sich die betreffenden Operationen nicht voneinander abgrenzen lassen (vgl. Titzmann 1991, S. 396; Kindt/Müller 2004, S. 294 f.; Kindt 2015, S. 98–102).
[20]In Abgrenzung von der expansiven bzw. Integrative vs. modulare Konzeption der Theoriebildung integrativen Konzeption, die in den betrachteten Erweiterungsversuchen der Narratologie zum Ausdruck kommt, treten wir für ein modulares Modell der Theoriebildung in den Text- und Kulturwissenschaften ein. Zielsetzung sollte es diesem Modell zufolge nicht sein, eine allgemeine Theorie zu entwerfen, die den Umgang mit bestimmten Gegenständen umfassend regelt; stattdessen wird empfohlen, von einem Nebeneinander verschiedener Theorien auszugehen, die auf unterschiedliche Zwecke bezogen werden können und deren mögliche Zusammenarbeit gesondert zu erörtern ist. Leitend ist dabei eine Beobachtung, die sich nicht zuletzt anhand der Geschichte der Narratologie und insbesondere ihres Verhältnisses zur Interpretations- und Fiktionalitätstheorie machen lässt – die Beobachtung nämlich, dass die Expansion und Integration von textwissenschaftlichen Theorien nicht selten zu Lasten des Niveaus ebenso der expandierenden wie der integrierten Modelle geht (vgl. Kindt/Müller 2006).
Im Sinne dieser Orientierung werden wir die Erzähltheorie in den folgenden Kapiteln als ein deskriptives Modell des Gegenstands Erzählung[21]vorstellen, das zur weitergehenden Erschließung einzelner oder umfangreicher Gruppen von Erzählungen einen heuristischen Beitrag zu leisten vermag. Bei der Theorie wird es sich näher betrachtet um Medienspezifisches Modell ein medienspezifisches Modell handeln, das zumeist am Beispiel von literarischen Erzählungen entwickelt und veranschaulicht wird, seinem Anspruch nach aber das textgebundene Erzählen in seiner Ganzheit erfassen soll. Bei der Erläuterung dieses Modells werden wir das Erzählen in anderen Medien aber immer wieder in kurzen vergleichenden Exkursen in die Betrachtung einbeziehen.
1.2.3 Begriffe und Begriffsbestimmungen
Es ist deutlich geworden, dass die wichtigsten Bestandteile der Narratologie deren Begriffe sind. Bei einem erzähltheoretischen Ansatz handelt es sich um ein begriffliches Modell des Gegenstands Erzählung, d. h. um einen Zusammenhang mehr oder weniger ausdrücklich definierter und systematisch aufeinander bezogener Begriffe zu dessen Erfassung und Beschreibung (vgl. Kindt 2009; s. o. Kap. 1.2.1). Wenn man Erzähltheorie betreibt, dann kommt man also nicht um das Geschäft der Begriffsbestimmung und die Klärung von Begriffsbeziehungen herum. Da dies auch für Einführungen in das Forschungsfeld gilt, dem Vorhaben der Begriffsdefinition in den Text- und Kulturwissenschaften aber noch immer oft mit Unkenntnis und Vorbehalten begegnet wird (vgl. Fricke 2010; Köppe 2010b), sei es zum Abschluss dieses Einleitungskapitels zumindest kurz etwas genauer betrachtet.
Ist von ›Begriffen‹ die Rede, kann es um unterschiedliche Dinge gehen; grundlegend scheinen allerdings die beiden folgenden Verwendungen des Wortes zu sein: ›Begriff‹ wird einerseits im Sinne von ›Ausdruck‹ gebraucht wie in dem Satz: Der Begriff ›Rhythmus‹ wird immer wieder falsch buchstabiert. Andererseits steht ››Begriff‹: Ausdruck oder semantischer Gehalt Begriff‹ aber auch für den semantischen Gehalt (oder die Intension oder Bedeutung) von Ausdrücken, genauer gesagt von Ausdrücken wie etwa ›rot‹, ›Pferd‹ oder ›Junggeselle‹, die in Logik und Linguistik als ›Prädikate‹ oder ›generelle Termini‹ bezeichnet werden (vgl. die hilfreiche Einführung bei Tugendhat/Wolf 1983, Kap. 8). In diesem Verständnis wird der Ausdruck ›Begriff‹ verwendet in Sätzen wie: Dieser Text fällt unter den Begriff des Bildungsromans. Oder: Was zeichnet Genettes Begriff des Erzählers aus?
Ausgehend von diesem Begriffsverständnis verstehen wir unter einer ›Definition‹: Angabe der Bedeutung eines Prädikats Definition im vorliegenden Zusammenhang die Angabe der Bedeutung eines Prädikats bzw. generellen Terminus. Wir müssen hier nicht das breite Spektrum [22]an Spielarten von Definitionen vorstellen, das in den Wissenschaften genutzt wird (vgl. dazu Føllesdal [u. a.] 1988, Kap. 56; Pawłowski 1980; Strube 1982). Zum besseren Verständnis der Bestimmungen erzähltheoretischer Begriffe, die wir in den folgenden Kapiteln vorschlagen werden, möchten wir aber die Ausgestaltungsmöglichkeiten von Definitionen zumindest in zwei Hinsichten näher beleuchten.
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Begriffsbestimmungen nicht an eine spezifische Form gebunden sind; ihnen können unterschiedliche Gestalten gegeben werden, von denen zwei Möglichkeiten kurz charakterisiert seien (vgl. auch Fricke 2010):
Die auf Aristoteles zurückgehende und bis ins 19. Jahrhundert vorherrschende Definitionsweise besteht in Angaben der Form genus proximum et differentia specifica (also »nächste Gattung und eigentümlicher Unterschied«). Diesem Muster folgend, wird etwa ›Mensch‹ seit der Antike oft als »das vernunftbegabte Tier« bestimmt. Begriffsbestimmungen wie diese folgen zugleich der noch heute maßgeblichen Definitionsform, die als Äquivalenzdefinition ›Äquivalenzdefinition‹ bezeichnet wird und Begriffsbedeutungen über die Angabe von notwendigen und (zusammen) hinreichenden Bedingungen abbildet. Um eine solche Bedeutungsbestimmung handelt es sich etwa bei der folgenden Definition des mathematischen Ausdrucks ›Primzahl‹: »Eine Zahl ist eine Primzahl genau dann, wenn es sich erstens um eine natürliche Zahl größer als 1 handelt und diese zweitens nur durch sich selbst und durch 1 ganzzahlig teilbar ist.«
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts werden Definitionen des letztgenannten Typs vielfach mit dem Hinweis in Frage gestellt, sie würden an der tatsächlichen Begriffsbildung und Begriffsnutzung in alltäglichen, aber auch wissenschaftlichen Zusammenhängen vorbeigehen. Ausgehend von dieser Kritik haben sich zwei alternative Definitionsformen etabliert: Zum einen gibt es Charakterisierungen im Anschluss an Ludwig Wittgensteins Konzept der ›Familienähnlichkeit Familienähnlichkeit‹ (vgl. Wittgenstein 1953, § 66). Die unter einen Familienähnlichkeitsbegriff fallenden Gegenstände ähneln sich in verschiedenen Hinsichten, aber es lässt sich kein Set von Eigenschaften angeben, das ihnen (und nur ihnen) gemeinsam ist. Zum anderen gibt es Charakterisierungen durch die Angabe von Prototypen Prototypen, also der ›besten Beispiele‹ für die Art von Gegenständen, die sich den betreffenden Konzepten zurechnen lassen (vgl. Kleiber 1998; Hinweise zur Kombination beider Ansätze geben Laurence/Margolis 1999, Kap. 3).
[23]Weiterhin ist zu beachten, dass sich Definitionen der unterschiedenen Spielarten mit verschiedenen Ansprüchen vornehmen lassen. Auch im Hinblick auf diesen Aspekt sollen drei Grundtypen voneinander abgegrenzt werden (vgl. Pawłowski 1980, Kap. 1; Köppe 2006, S. 156–162):
Feststellende Definitionen Definitionen können einen feststellenden Charakter haben; in diesem Fall versuchen sie einzufangen, wie ein Ausdruck von einer Gruppe von Personen verwendet wurde oder wird; definitorische Bestimmungen in diesem Sinne laufen also auf eine empirische Untersuchung eines spezifischen Sprachgebrauchs hinaus.
In Begriffsdefinitionen kann es aber auch um Festlegende Definitionen eine festlegende Bedeutungscharakterisierung gehen; in diesem Fall wird mit einer Begriffsbestimmung – in der Terminologie der Definitionstheorie gesprochen – eine ›Stipulation‹ vorgenommen, d. h., es wird eine Sprachregelung für den zukünftigen Ausdrucksgebrauch mit mehr oder weniger großer Reichweite getroffen.
Definitionen können sich schließlich darum bemühen, die feststellende und die festlegende Vorgehensweise miteinander zu verknüpfen; dies ist die Grundidee von Definitionen, die mit Rudolf Carnap als ››Begriffsklärungen‹ oder ›Explikationen‹Begriffsklärungen‹ oder ›Explikationen‹ bezeichnet werden; solche Definitionen versuchen, den Anschluss an das bisherige Verständnis eines Begriffs mit dessen Präzisierung für den Gebrauch in bestimmten Zusammenhängen zu verbinden (vgl. Carnap 1950, S. 1–18; Danneberg 1989, S. 50–68).
Für welche der vorgestellten Definitionsvarianten man sich entscheiden sollte, lässt sich nicht grundsätzlich, sondern nur bezogen auf den Einzelfall beantworten. Die Entscheidung hängt von einer Reihe von Faktoren ab, etwa davon, mit was für einer Art von Begriff man es zu tun hat, sowie davon, welche Ziele man mit einer Begriffsbestimmung verfolgt (vgl. Gabriel 1972). Wir werden die Begriffe der Narratologie im Folgenden zumeist in Form von Äquivalenzbestimmungen zu fassen versuchen, die als Begriffsexplikationen zu verstehen sind.
[24]2 Die Erzählung
Dieses Kapitel widmet sich einer Beantwortung der Frage »Was ist eine Erzählung?«. Zunächst müssen wir diese Frage präzisieren – denn die Ausdrücke ›Erzählung‹ und ›erzählen‹ sind mehrdeutig. Das wird schnell deutlich, wenn man sich Aussagen wie die folgenden vergleichend ansieht:
Anna erzählt eine Geschichte.
Eine Erzählung ist kein Roman.
Der Text enthält neben erzählenden auch beschreibende Passagen.
In (1) ist vom Akt des Erzählens die Rede. Erzählakt Ein Erzählakt ist etwas, das jemand tut, also eine Handlung, die sich in der Zeit erstreckt. In (2) wird ›Erzählung‹ als Gattungs- oder Textsortenbegriff ›ErzählungErzählende Ereignisverknüpfung ‹ als Gattungs- oder Textsortenbegriff verwendet. Unter den Begriff der Erzählung in diesem Sinne fallen Texte, die man u. a. aufgrund ihrer relativen Kürze von den erzählenden Langformen (Romane, Autobiographien usw.) unterscheiden möchte. In (3) ist von den ›erzählenden Passagen‹ eines Textes die Rede. Solche Passagen handeln von Ereignissen, die als in besonderer Weise verknüpft dargestellt werden – wir sprechen daher von der erzählenden Ereignisverknüpfung (im Anschluss an Noël Carrolls Bestimmung der narrative connection, vgl. Carroll 2001, S. 118–133). Der Begriff der erzählenden Ereignisverknüpfung ist für die Beantwortung unserer Ausgangsfrage zentral, und er ist auch für die Erläuterung der in (1) und (2) genannten Begriffe erforderlich (d. h. explanatorisch basal): Eine Sprachhandlung ist nur dann ein Erzählakt, wenn sie erzählende Ereignisverknüpfungen zum Inhalt hat; und Exemplare der Textsorte oder Gattung ›Erzählung‹ zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen eine Vielzahl erzählender Ereignisverknüpfungen dargestellt wird.
Im folgenden Kapitel 2.1 beginnen wir daher mit dem Begriff der narrativen Ereignisverknüpfung – gleichsam dem Nukleus des Erzählens; anschließend erläutern wir weitere Eigenschaften längerer und auch komplexerer Texte, die für den Eindruck verantwortlich sind, dass wir es mit ›vollgültigen‹ oder ›paradigmatischen‹ Erzählungen zu tun haben. Es handelt sich dabei um eine bestimmte Weise der Bezugnahme auf Ereignisse, das Vorliegen eines Spannungsbogens und die kommunikative Zweckmäßigkeit (tellability) von Erzählungen. Der Schwerpunktsetzung dieser Einführung entsprechend konzentrieren wir uns auf erzählende Ereignisverknüpfungen in textuellen (schriftsprachlichen) Medien. In Kapitel 2.2 erläutern wir die Fiktionalitätsdimension (insbesondere) literarischer Erzählungen, in Kapitel 2.3 gehen wir auf [25]Besonderheiten des Erzählens ein, die sich dessen medialer Präsentationsform verdanken.2 Kapitel 2.4 erläutert den Zusammenhang zwischen dem basalen Begriff der erzählenden Ereignisverknüpfung und komplexen literarischen Erzählwerken.
2.1 Von der erzählenden Ereignisverknüpfung zur Erzählung
Der Begriff der erzählenden Ereignisverknüpfung lässt sich wie folgt Definition definieren:
Eine erzählende Ereignisverknüpfung liegt genau dann vor, wenn mindestens zwei Ereignisse als chronologisch geordnet sowie in mindestens einer weiteren ›sinnhaften‹ Weise miteinander verknüpft dargestellt sind.
Wie aus der Definition ersichtlich ist, setzt das Erzählen voraus, dass von Ereignissen die Rede ist. Der Begriff ›Ereignis‹ wird in der philosophischen Metaphysik und Ontologie kontrovers diskutiert (wir folgen der Zusammenfassung in Henning 2009, S. 173–178). Strittig ist etwa, was Ereignisse eigentlich sind oder wie sie gezählt werden können. Dass diese Fragen schwierig zu beantworten sind, sieht man bereits anhand eines einfachen Beispiels: Bezeichnet der Satz »Anna niest« ein Ereignis? Wer diese Frage zu bejahen geneigt ist, muss sich dem Einwand stellen, dass der Satz etwas bezeichnet, das ebenso gut als mit einer Vielzahl von Ereignissen verbunden verstanden werden kann: Das Kribbeln in der Nase, das tiefe Einatmen und die Kontraktion des Zwerchfells können mit demselben Recht als Ereignisse gelten wie das Niesen selbst – und für jedes dieser Teil-Ereignisse gilt wiederum, dass wir sie in beliebig viele weitere Teil-Ereignisse zerlegen könnten. Wie feinkörnig eine solche Einteilung ausfällt, scheint also von unseren Interessen und nicht zuletzt auch von unseren sprachlichen Ressourcen abzuhängen. Auf diese Schwierigkeiten stoßen wir auch dann, wenn wir die Ereignisse bestimmen wollen, von denen eine Erzählung handelt: Auch hier stellt sich das Problem, dass man das Erzählte in beliebig viele Ereignisse unterteilen (und dass man dabei unterschiedliche Vokabulare verwenden) könnte.
Was ist ein Ereignis?Was also ist ein Ereignis? Wir können uns hier mit einer intuitiven Erläuterung begnügen (vgl. Henning 2009, S. 174). Zur Identifikation eines [26]Ereignisses benötigen wir mindestens dreierlei, nämlich einen Zeitpunkt, einen (physikalischen) Gegenstand oder einen Sachverhalt und etwas, das von dem Gegenstand oder Sachverhalt ausgesagt wird. Dass sich Anna (= der Gegenstand) morgen (= der Zeitpunkt) ein Auto kauft (= das vom Gegenstand Ausgesagte), ist demnach ebenso ein Ereignis wie das Steigen (= das vom Sachverhalt Ausgesagte) des Außenhandelsvolumens der Bundesrepublik (= der Sachverhalt) im Frühjahr (= der Zeitpunkt) oder das Klingeln des Weckers auf Annas Nachttisch um sechs Uhr früh.
Dass wir eine Frage wie »Von welchen Ereignissen handelt Thomas Manns Roman Der Zauberberg?« sinnvoll finden (und auch beantworten) können, liegt daran, dass wir uns bei der Benennung der Ereignis und PlotEreignisstruktur einer komplexen literarischen Erzählung meist auf bestimmte Ereignisse konzentrieren – und zwar auf genau die Ereignisse, die als temporal geordnete und sinnhaft verknüpfte die Handlung bzw. den Plot der Erzählung ausmachen. (Die Begriffe ›Handlung‹ bzw. ›Plot‹ werden in den Kapiteln 2.4 und 3.1 genauer eingeführt.) Diese Beobachtung legt nahe, dass sich die Konturen von Ereignissen in gewissem Sinne derjenigen Erzählung verdanken, in der sie auftreten: Die Erzählung legt demnach fest, was wir zu den relevanten Ereignissen hinzuzählen und was nicht; wir müssen, anders formuliert, erst eine Erzählung vor Augen haben, bevor wir die Konturen von Ereignissen sinnvoll bestimmen können. Um das oben gebrauchte Beispiel erneut zu bemühen: In einer Erzählung über Annas Schnupfen ist Anna niest ein erwartbares Ereignis: Die Erzählung steckt gleichsam den Rahmen ab, innerhalb dessen sinnvolle Ereignisbeschreibungen möglich werden. (Zur vertiefenden Diskussion vgl. MacIntyre 2007, S. 204–225, insbes. S. 206 f.; außerdem Danto 1985, insbes. Kap. VIII; Passmore 1987.)
Ereignisse haben eine unterschiedlich große zeitliche Ausdehnung, der Zweite Weltkrieg ist ebenso ein Ereignis wie das gestrige Ausfallen eines Haares auf Annas Kopf. Man kann nun lange und fruchtlos darüber streiten, ob wirklich beliebige Ereignisse geeignet sind, den Stoff einer erzählenden Ereignisverknüpfung zu bilden – dem hier entwickelten Begriff zufolge gibt es dafür keine Restriktionen. Auch der Text Erst hing der Apfel am Baum und dann fiel er herunter handelt von zwei Ereignissen, die definitionsgemäß den Stoff für eine erzählende Ereignisverknüpfung bilden können.
Der Definition gemäß muss, damit von einer erzählenden Ereignisverknüpfung die Rede sein kann, eine Chronologie Chronologie vorliegen, d. h., die Ereignisse