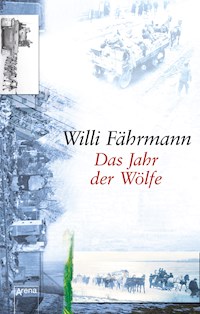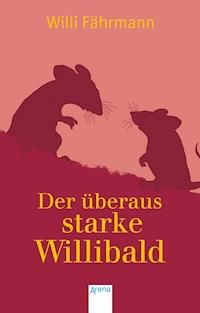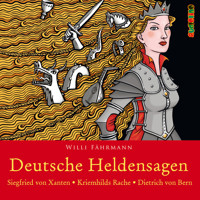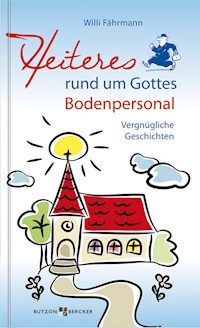4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ende des 19. Jahrhunderts in einem Dorf am Rhein: Ein Kind wurde ermordet. Der Täter bleibt unbekannt, und so richtet sich der Verdacht schnell auf den jüdischen Viehhändler Waldhoff. Gerede und Gerüchte bringen Waldhoff um seine Existenz, Fürsprecher hat er keine mehr. Nur ein Junge wagt es, gegen den Strom zu schwimmen, und steht felsenfest an der Seite seines Freundes Sigi Waldhoff. Diese Geschichte um einen gefährlichen Verdacht und eine unerschütterliche Freundschaft beruht auf einer wahren Begebenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Der Autor
Willi Fährmann,geboren 1929 in Duisburg, lebt heute in Xanten am Niederrhein.Mit seinem Gesamtwerk, für das ihm neben zahlreichen Einzelauszeichnungen der»Große Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur« verliehen wurde,gehört er zu den profiliertesten Autoren der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. Seine im Arena Verlag erschienenen Bücher haben die Millionenauflage überschritten.
Titel
Willi Fährmann
Es geschahim Nachbarhaus
Die Geschichte eines gefährlichen Verdachts und einer Freundschaft
Auf der Auswahlliste zumDeutschen Jugendbuchpreis
Auf der Ehrenliste desHans-Christian-Andersen-Preises
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2012 © 1968 Arena Verlag GmbH, WürzburgAlle Rechte vorbehaltenUmschlagillustration: Henriette SauvantUmschlagtypografie: Agentur Bachmann & SeidelISBN 978-3-401-80108-7www.arena-verlag.deMitreden under forum.arena-verlag.de
1
Der Junge saß auf der Treppenstufe. Einen Augenblick spielten seine Finger noch mit den kleinen Steinchen. Plötzlich schlossen sich die Hände zu Fäusten. Er hob den Kopf.
»Jean?«, flüsterte er. Doch das Mädchen lief bereits weiter. Die Nachbarinnen standen an diesem Peter-und-Pauls-Tag an der Pumpe beisammen. Hermines Nachricht zerriss ihr Lachen und Schwatzen. Die geschmückte Pumpe, eben noch Mittelpunkt fröhlicher Ausgelassenheit, ragte fremd und unpassend über die Köpfe der verstörten Frauen hinweg. Bunte Bänder flatterten im Wind, doch keine Hand haschte mehr danach.
Sigi warf die Steinchen auf das Pflaster, sprang auf, stürzte an den Frauen vorbei, rannte zum »Goldenen Apfel« und schlüpfte in den schmalen Flur, der längs durch das ganze Haus führte. Stimmen drangen aus der Gaststube. In das Hinterhaus gelangte er über den Hof. Dort kegelte Vater mit den Nachbarn.
Sigi riss die Tür auf. Stimmengewirr und Tabaksqualm schlugen ihm ins Gesicht. Seine Augen gewöhnten sich an das trübe Licht. Niemand beachtete ihn. Vater saß am breiten Ende des Tisches. Er redete auf Franz Nigge ein. Aus den Gesten und Satzfetzen verstand Sigi, dass er erklärte, mit welch geschickter Drehung der Kugel er den rechten Bauern aus allen neun herausgeschossen hatte.
Sigi drängte sich durch den schmalen Raum zu ihm hin.
»Was willst du?«, fragte der Vater verstimmt. Er liebte es nicht, dass Sigi sich zu den Männern gesellte.
Der Junge beugte sich zu ihm und sprach leise auf ihn ein.
»Was gibt es?« Als der Junge immer noch flüsterte, sagte er laut: »Sigi, du weißt, dass ich nicht gut hören kann. Sprich laut und deutlich.« Der Ärger stand ihm im Gesicht. Sigi schluckte und stieß dann hervor: »Jean Seller ist tot. Erstochen worden ist er. Er liegt in Schyffers’ Scheune.«
»Tot?«
In die plötzliche Stille hinein donnerte die Kugel gegen die Hölzer. »Kranz!«, schrie der Kegeljunge. Niemand blickte auf die rollenden Hölzer, keiner achtete auf diesen gelungenen Wurf von Huymann.
Die Männer starrten den Jungen an. Schließlich wischte sich Bernd Hegenstock den Bierschaum aus dem Schnurrbart und sagte: »Woher weißt du das, Sigi?«
Breuermann fügte hinzu: »Aber kein Gerede, hörst du?«
»Schyffers’ Hermine hat es gerade gesagt. Nora hat den Jean in der Scheune gefunden. Sie wollte das Futter für das Vieh holen. Jean liegt auf der Spreu.«
»Erstochen?«
»Das hat Hermine erzählt.«
Plötzlich kam Bewegung in die Schar. Die Männer drängten weg von der Kegelbahn, eilten den nahen Häusern zu und atmeten auf. Bei ihnen zu Haus saßen alle um den Tisch. Keiner fehlte.
Sigi und sein Vater gingen durch den Laden in die Stube. Frau Waldhoff, die den Tag über mit Kopfschmerzen im Bett gelegen hatte, war aufgestanden und reinigte und beschnitt den Docht der Petroleumlampe.
»Hast du es schon gehört, Hannah?«
»Was gibt es? Warum kommst du jetzt schon vom Kegeln zurück?«
»Der kleine Jean …«
»Was ist mit ihm? Haben sie ihn gefunden?«
»Ja. Aber er lebt nicht mehr.«
Frau Waldhoffs Händen entglitt die Schere. »Tot?«
»Ja. Er liegt in der Scheune. Sie sagen, er sei erstochen worden.«
»Der arme Junge.«
Eine Weile schwiegen sie. Dann fragte Frau Waldhoff: »Mehr weiß man nicht?«
»Ich glaube nicht.«
»Komm, wir wollen einmal nachfragen.«
Sie traten vor das Haus. Gerade bog Franz Nigge in den Pfortenweg ein, der zu Schyffers’ Scheune führte.
»Da soll er liegen, Waldhoff«, sagte er. »Komm, wir sehen uns die Sache an.«
Waldhoff wollte Franz Nigge in den Pfortenweg folgen, doch seine Frau hielt ihn zurück. Waldhoff zögerte, blieb stehen und sagte: »Geh du nur. Das ist nichts für mich.«
Aus dem gegenüberliegenden Haus kamen Dreigens.
»Sie haben ihm die Kehle durchgeschnitten«, berichtete Frau Dreigens. Sigi bemerkte die roten Flecken in ihrem Gesicht, die sich immer zeigten, wenn sie sich aufregte.
Eine plötzliche Schwäche überfiel Frau Waldhoff. Sie musste sich gegen die Hauswand lehnen. »Den Hals?«, stammelte sie.
»Was ist mit dir?« Waldhoff befürchtete, dass der Kopfschmerz sie wieder überfiel. »Du hättest heute im Bett bleiben sollen.«
Frau Waldhoff flüsterte: »Hoffentlich hängen sie uns das nicht an.«
Da wusste Waldhoff, was sie meinte. Es traf ihn wie ein Keulenschlag. Mit einem Male fiel ihm die Geschichte seines Schwiegervaters ein, der des Kindesmordes bezichtigt worden war. Obwohl er zur Zeit der Tat gar nicht am Ort gewesen war, lief ihm das Gerede nach bis in sein Grab.
»Ach, vielleicht ist Jean in das Häckselmesser gefallen.«
»Er hat oft geschaukelt.«
»Vielleicht ist er abgerutscht.«
So tauschten sie diese und jene Vermutung mit den Dreigens. Da kam Franz Nigge durch den Pfortenweg zurück. »Der Doktor ist da. Sie haben uns alle weggeschickt. Aber es stimmt. Der Junge ist ermordet worden, so wahr ich Nigge heiße, er ist ermordet worden.«
»Kann er nicht in das Häckselmesser gefallen sein?«, fragte Waldhoff.
»Unsinn. Das Messer stand in der Ecke. Und stumpf ist es auch. Man kann drauf nach Köln reiten.«
Franz Nigge grüßte kurz und ging weiter.
»Wir müssten eigentlich zu Sellers«, sagte Frau Waldhoff. »Ich weiß ja, was es heißt, Kinder zu verlieren.«
Waldhoff tastete nach ihrer Hand. Drei Kinder waren ihnen im Grippewinter vor sieben Jahren gestorben. Seine Frau war niemals darüber hinweggekommen.
»Ja, Hannah, lass uns das tun.«
»Aber wo steckt Ruth?«
»Sie ist noch ein wenig zu Gerd gegangen. Lass sie nur. Um acht ist sie wieder zurück.«
Sie bogen um die Ecke. Lärm schallte aus Schyffers’ Gaststube. Die Wirtschaft war voller Neugieriger. Huymann stand vor der Tür und winkte Waldhoffs zu. »Kommt doch auch herüber!«, rief er. Doch Waldhoff deutete mit dem Daumen auf Sellers Haus. Sie traten ein.
Im Flur war es dämmerig und kühl. Frau Waldhoff kannte den Weg und fand ohne Mühe die Tür zur Küche. Sie klopfte. Frau Seller hockte auf der Bank hinter dem Tisch. Als sie Waldhoffs erkannte, beugte sie ihren Kopf in die Arme und schluchzte. Gerd Seller saß beim Ofen und rührte sich kaum. Drei kleinere Kinder spielten in der Ecke am Fenster. Frau Waldhoff setzte sich zu der Nachbarin und strich ihr über den Rücken, sanft tröstend. Wieder öffnete sich die Tür und die Schwester der Frau Seller betrat die Stube. Die beiden Frauen umarmten sich. Etwas ruhiger begann Frau Seller zu erzählen, stockend und oft vom Weinen unterbrochen. »Mein Magen, mein Magen«, hörte Waldhoff sie stöhnen. Da gab er Sigi einen Groschen und schickte ihn zu Schyffers Natron holen. Er wusste, dass Natron der Frau ein wenig helfen konnte.
»Die Polizei und der Bürgermeister sind bei Schyffers«, tuschelte Sigi seiner Mutter zu, als er seinen Auftrag erledigt hatte. Waldhoff löste ein Löffelchen Natron in Wasser auf und reichte Frau Seller das Glas über den Tisch hin. Eine Weile blieben Waldhoffs noch, doch bald spürten sie, wie wenig nachbarlicher Trost vermag, und verabschiedeten sich. Sie blieben vor ihrer Haustür stehen, denn die Hitze des Tages hing noch in den Häusern. Dieser und jener kam die Mühlenstraße entlang und blieb ein wenig. Immer wieder wurde das traurige Ereignis besprochen. Vermutungen wurden laut, dass die Kinder vielleicht »Öchschenschlachten« gespielt hätten. Frau Waldhoff berichtete, wie Sigi vor Jahren mit einem großen Schlachtmesser ihres Mannes herumgefuchtelt habe. Ihr sei damals ganz anders geworden.
Im Laufe des Abends wurden die Einzelheiten des Todes bekannt und die sonderbarste war, dass bei der Leiche kaum Blut zu sehen gewesen sei. Erst als es dunkel wurde, ging einer nach dem anderen in sein Haus.
Waldhoff fand lange keinen Schlaf. Mitternacht war längst vorüber, als er schließlich merkte, dass auch seine Frau kein Auge zugetan hatte. »Hannah?«
»Ja.«
»Wie war das damals mit deinem Vater?«
»Nun, ein Kind wurde getötet. Wir kannten es nicht einmal. Es wohnte zwar in unserer Gegend, aber in einer großen Stadt, wer kennt da alle Kinder?«
Sie schwieg eine Weile und legte den Kopf ein wenig höher, damit ihr das Atmen leichter wurde. »Sie fanden keinen Täter. Du weißt, wie schlimm das für uns ist. Schließlich bleibt es am Zigeuner oder am Jud hängen. So war es auch damals.«
»Aber dein Vater konnte doch nachweisen, dass er am Mordtag gar nicht in der Stadt gewesen ist.«
»Natürlich konnte er das nachweisen. Aber die Menschen wollen keinen Nachweis, sie wollen einen Täter. Und zwar einen, der irgendwie anders ist als sie, der sich ein wenig von ihrer Gemeinschaft abhebt. Sei es auch nur, weil er ihren Glauben nicht teilt. Die Blicke, ängstliches Ausweichen auf dem Bürgersteig, das Ausspucken, die Furcht in den Augen der Kinder, die Bekannten ziehen sich allmählich zurück, die Geschäfte liegen darnieder …«
Wieder schwieg sie lange und schluckte an den Tränen.
»Das ist schlimmer als Urteil und Gefangenschaft, weißt du. Mein Vater hat es nur wenige Jahre ertragen. Er ist vor dieser Wirklichkeit in den Tod geflohen. Nicht, dass er den Strick genommen hätte oder in den Fluss gegangen wäre, nein, Sorgen, Missachtung, Einsamkeit inmitten der Menschen haben ihm den Atem genommen. Eines Tages konnte er nicht mehr aufstehen. Die Ärzte zuckten die Achseln und gaben ihn schließlich auf, so wie er sich schon lange aufgegeben hatte.«
Hannah richtete sich auf. Er sah ihren Schatten scharf vor dem nachthellen Fenster. »Hoffentlich finden sie den Mann, der Jean umgebracht hat.«
»Irrsinn«, sagte Waldhoff und drehte sich auf die Seite. »Kein Ding geschieht zweimal.« Doch in seinem Herzen zitterte Furcht vor dem neuen Tag.
2
In der Schule schwirrten die Gerüchte durch die Klassen. Die Kinder scharten sich in den Pausen immer wieder um Hermine Schyffers und Sigi Waldhoff. Das Bekannte war schnell erzählt. Jean war gegen elf zum letzten Mal gesehen worden. Er hatte im Pfortenweg gespielt. Von da an blieb er verschwunden. Zuerst hatte die Mutter geglaubt, er sei bis an die Landstraße gegangen. Dort waren die süßen Kirschen reif. Die Kinder der Stadt betrachteten diese Bäume seit eh und je als ihr Eigentum.
Der Polizist, ein zugewiesener Preuße, mochte anderer Meinung sein, aber ihm gingen sie aus dem Wege. Schließlich hielt er nicht den ganzen Tag Kirschenwache. Es war jedenfalls nichts Neues, dass diese Ernte nie versteigert werden konnte, weil zum festgesetzten Termin Kinder und Stare nur so wenig Kirschen übrig gelassen hatten, dass es sich nicht einmal lohnte, eine Leiter herbeizuschaffen.
Aber bei den Kirschen war Jean nicht. Als die Mutter ihn bei den Nachbarn suchte, da fand er sich weder bei Schyffers noch bei Nigges und nicht bei Huymanns. Auch bei Mehlbaums und Waldhoffs hatte niemand ihn nach elf Uhr gesehen.
Schließlich durchstreiften seine Geschwister die Straßen. Die Vermutung kam auf, er sei wegen der Hitze mit zum Rhein gegangen, doch niemand wusste Genaueres. Auch wollte dieser oder jener zwei Landstreicher in der Mühlenstraße gesehen haben, doch die waren gekommen und gegangen, wie das bei fahrendem Volk eben ist.
Die schreckliche Nachricht von dem Tod des Jungen hatte all diesen Gerüchten ein schnelles Ende bereitet. Aber gleich blähten sich neue auf. Wer war der Täter? Nach mancherlei Erwägungen kamen am ehesten die Landstreicher in Betracht. Die Kinder ließen ihrer Fantasie freien Lauf, zumal Hermine Schyffers wenig berichtete. Ihr Vater und der Lehrer hatten ihr den Mund verboten. Umso begehrter war das, was Sigi wusste, der als einer der ersten die Nachricht vernommen hatte und der in unmittelbarer Nachbarschaft der Fruchtscheune wohnte, in der Nora den kleinen Jean gefunden hatte.
Sigi hatte einmal, zweimal berichtet, was ihm zu Ohren gekommen war, doch als die Gier nach seiner Geschichte nicht nachließ, kam er auf den Gedanken, nur noch gegen Bezahlung zu wiederholen, was sich in den Abendstunden des vorangegangenen Festtages ereignet hatte.
So glitt in den Pausen allerlei Kindergut in seine Hände: weißer und brauner Kandiszucker, eine Handvoll Kirschen, frisch an der Landstraße gepflückt, ein beinahe neuer Lederriemen, ein gepresstes vierblättriges Kleeblatt …
Diese begehrten Schätze machten Sigis Bericht von Mal zu Mal farbiger. Das blühende Geschäft fand erst seinen unrühmlichen Abschluss, als Lehrer Coudenhoven davon erfuhr und Sigi wegen dummen Geschwätzes mit seiner fingerdicken Haselrute drei Streiche über den Hosenboden zog. Von da an schwieg auch Sigi. Erst auf dem Heimweg, als sich sein Freund Karl zu ihm gesellte, besprach er mit ihm noch einmal die ganze Geschichte, aber einen Täter fanden auch sie nicht.
»Wo bleibst du so lange?«, fuhr ihn die Mutter an, als er in den Laden trat.
»Ich war bei Karl.«
»Warte hier. Der Bürgermeister ist im Hause. Er will mit dir sprechen.«
»Der Bürgermeister?«
»Sag ihm alles, was du weißt. Aber denk nach, bevor du sprichst.«
Im hinteren Zimmer brummten die Stimmen der Männer, doch was gesprochen wurde, war nicht zu verstehen. Endlich wurde Sigi gerufen. Waldhoff hatte einen roten Kopf und eine steile Falte saß zwischen den Augen.
»Es ist ein Skandal«, schimpfte der Bürgermeister. »Am helllichten Tage wird ein Kind umgebracht, und keiner hat etwas bemerkt.« Er wandte sich dem Jungen zu.
»Sigi, wann hast du den kleinen Jean zum letzten Male gesehen?«
»Es war zu der Zeit, als die Leute aus dem Hochamt kamen. Da spielte er auf unser Straße.«
»Hast du mit ihm gespielt?«
»Er ist klein, Herr Bürgermeister. Ich musste auch zu Schloters.«
»Zu Schloters?«
»Ja, ich sollte ihm das restliche Geld bringen.«
Waldhoff schaltete sich ein: »Ich hatte Streit mit Schloters. Er hilft mir in der Werkstatt, die Grabsteine für die Juden zu schlagen.«
»Warum gab es Streit?«
»Ihm war es zu viel, an drei Tagen nichts verdienen zu können. Am Sabbat wird bei mir nicht gearbeitet, am Sonntag will ich es auch nicht. Gestern war Peter und Paul. Drei Ruhetage waren ihm zu lang. Er hat sein Geld verlangt. Sigi hat es ihm gebracht.«
»Warum schickten Sie Ihren Sohn?«
»Sigi hat sich mit Schloters gut vertragen. Der Junge will Steinmetz werden, und Schloters hat ihm manchen Griff gezeigt.«
»Soso, Steinmetz. Aber den Jean, Sigi, den Jean hast du später nicht mehr gesehen?«
»Nein, als ich zurückkam, war gar kein Kind mehr auf der Straße.«
»Woher weißt du das noch so genau?«
»Ich dachte mir: Die sind alle zu den Kirschen gegangen.«
»Am liebsten hättest du sicher auch Kirschen gestohlen?«, fragte der Bürgermeister. Doch dabei spielten ihm die Lachfältchen um die Augen. Sigi antwortete nicht.
Der Bürgermeister blätterte in einer Akte, seufzte, schlug den Deckel plötzlich zu und sagte: »Das andere weiß ich bereits. Ihre Frau und Ihre Tochter Ruth haben es ja berichtet.« Dann trat er näher an Waldhoff heran, der aus seinem Sessel aufgestanden war, und sagte: »Es ist eine scheußliche Sache, Waldhoff. Der Mehlbaum macht mit dummem Gerede die Leute wild. Überlegen Sie genau, wie Sie den gestrigen Tag verbracht haben, und schreiben Sie es auf. Sie wissen ja, wie leicht einer ins schiefe Licht geraten kann.«
Damit griff er nach seinem Hut, grüßte Frau Waldhoff und trat auf die Straße. Verwundert blieben einige Frauen stehen, die gerade vom Markt kamen.
»Was sucht der Bürgermeister beim Juden Waldhoff?«, fragte eine.
Waldhoff schloss ärgerlich die Tür und sagte: »Da geht es schon los. Der Mehlbaum streut aus, dass wir Juden das Blut von Christenkindern brauchen. Sein Sohn, der Medizinstudent, habe es ihm gesagt.«
»Blut? Wozu Blut, Vater?«, fragte Ruth.
»Ach, weiß der Kuckuck. Dummes Geschwätz. Es wird gemunkelt, dass wir Juden das Blut benützen, um daraus Wein zu machen, den wir beim Passah-Fest trinken.«
»Pfui! Eklig!«, rief Ruth und schüttelte sich. »Wie kann Mehlbaum sich so etwas Scheußliches nur ausdenken?«
»Er hat sich das nicht selbst ausgedacht. Eine alte, schaurige Lüge ist es, die er da ausgräbt. Oft und oft ist sie erzählt worden. So sollen Juden am 19. April 1287 in der Gegend von Oberwesel am Rhein ein Kind namens Werner gequält und um seines Blutes willen schließlich zu Tode gebracht haben. Dabei ist dies nur eine von vielen ähnlichen Geschichten.«
»Wenn Mehlbaum das wirklich glaubt, dann kann ich mir erklären, warum er und manche Menschen uns verachten«, sagte Ruth.
Heftig antwortete Sigi: »Ich weiß nicht, was 1287 wirklich geschehen ist. Aber selbst wenn die schrecklichsten Lügen Wahrheit wären, was hat das mit uns zu tun? Hier kennen uns doch alle. Keiner wird uns einen Mord zutrauen.«
»Ich hoffe das auch«, sagte Waldhoff.
Später liefen Sigi und Karl zu den Kirschen.
»Ist er weg?«, flüsterte Karl seinem Freund zu.
»Ja, er geht zur Stadt zurück.« Die Jungen schoben die Zweige des Gebüsches ein wenig zur Seite und blickten dem Polizisten nach, der nach den Kirschbäumen gesehen hatte. Ein Knecht hatte die beiden gewarnt, und sie waren rechtzeitig in die Büsche geschlüpft.
»Warum ist der Neue eigentlich so scharf hinter uns her, wenn wir in die Kirschbäume steigen?«, fragte Karl.
»Mein Vater sagt, er habe nichts Rechtes in unserem Städtchen zu tun. Hier leben eben anständige Leute.«
»Meiner sagt, dass die Kirschen den Kindern gehören, solange er denken kann.«
»Soll er doch die beiden Landstreicher fangen.« Sigi saß bereits wieder im Baum und ließ sich die dicken Früchte gut schmecken.
»Rot wie Blut«, sagte Karl. »Du, sie sagen, ihr Juden brauchtet Kinderblut.«
»Quatsch! Großer Quatsch! Wozu sollten wir es wohl brauchen?«
»Sie erzählen überall, dass ihr es für euren Passah-Wein nötig habt. Der kleine Jean soll einen Schächterschnitt gehabt haben. Was ist das überhaupt?«
»Wenn Vater schlachtet, dann sticht er das Tier so ab, dass es ganz ausblutet. Wir dürfen kein Blut verwenden. So sagen es unsere Gesetze. Keinen Tropfen Blut, verstehst du! Deshalb haben wir unsere eigene Art, Tiere zu schlachten. Und das nennt man schächten.«
»Metzger, das ist ein scheußlicher Beruf. Das wäre nichts für mich. Polizist ist gut, Sigi, was meinst du? Polizist möchte ich schon werden.«
»Ich nicht. Ich werde Steinmetz.«
»Auch gut. Vater will, dass ich irgendetwas studiere. Aber ich habe keine Lust, dauernd zu büffeln. Polizist, das ist schon besser. Mutter sagt auch, Beamter ist Beamter.« Sie pflückten und aßen.
»Hörst du nichts, Karl?«
»Was soll ich hören?«
»Ich glaube, es gibt ein Gewitter. Es brummelt schon in der Luft.«
»Das wird ein Wagen gewesen sein.«
»Nein, hör nur, da donnert es wieder.«
Karl kletterte ein wenig höher in die Baumkrone. Von dort oben aus konnte er weit in die Ebene sehen. Ein Kranz von sanften Hügeln schließt die Stadt von drei Seiten her ein. Dicht drängen sich die Häuser in einer Mulde, die sich zum Strom hin weit öffnet.
»Der Himmel ist hinter den Bäumen ganz schwarz, Sigi.«
Doch Sigi kümmerte sich nicht um das Gewitter und pflückte weiter. Die Steine spuckte er im Bogen in die Tiefe.
»Wir müssen nach Hause, Sigi.«
»Ja. Doch warte, ich will mir ein paar Kirschen mitnehmen.« Schnell zupfte Sigi reife Früchte und sammelte sie in ein Taschentuch.
Da zuckte ein Blitz auf, fern noch, aber Sigi fuhr zusammen.
»Los, Karl, wir rennen nach Hause.«
Wind rüttelte die Wipfel. Sie rauschten auf. Über der Straße wirbelte eine Staubwolke hoch. Eilig kletterten sie aus dem Baum und machten sich auf den Weg.
Doch die Wolken flogen schnell. Die Jungen waren noch inmitten der Kornfelder, weit vor der Stadt, als die ersten Tropfen schwer herniederschlugen.
»Wir schaffen es nicht mehr«, keuchte Sigi. »Komm, wir laufen dort auf unseren Friedhof. Da weiß ich einen trockenen Platz.«
Einen Augenblick zauderte Karl. Zum Judenfriedhof? Ihm fielen die grausigen Geschichten ein, die ihm sein Onkel Bartel von den Gespenstern dort und vom Ewigen Juden erzählt hatte. Aber Sigi schien keine Angst zu haben. Er war schon ein Stück weit weg. Wenn Sigi keine Angst hatte, dann konnte es nicht so schlimm sein.
Der Regen prasselte herab. Wie eine düstere Insel ragten die alten Bäume des Judenfriedhofes aus den Feldern auf. Eine hohe Hainbuchenhecke umschloss ihn wie eine Mauer. Sigi schaute sich um und wartete, bis Karl ihn erreicht hatte.
»Hier ist ein Durchschlupf.«
Er schob die Blätter auseinander. Ein Spalt tat sich auf. Karl erkannte, dass ein Weg innerhalb des Friedhofes rundum führte. Doch Sigi überquerte den Weg und auch einen zweiten Wegkreis, wich einigen Grabsteinen aus und strebte dem Baumriesen zu, der genau die Mitte des kreisrunden Totenackers bildete.
»Hier hinein«, sagte er.
Der Stamm war aufgerissen und hohl. Karl zwängte sich durch den Spalt. Der Innenraum war größer, als er vermutet hatte. Schon drängte Sigi nach. Es wurde eng. Aber als sie sich zurechtgesetzt hatten, reichte der Platz für zwei.
»Das ist eine sichere Höhle«, sagte Sigi.
Durch den Spalt gleißte das Blendlicht der Blitze. Die Donnerschläge überschlugen sich. Die Jungen rückten dicht zueinander.
»Ist es nicht gefährlich, beim Gewitter in einem Baum zu sitzen, Sigi?«
»Ich weiß es nicht. Aber diese Linde ist sicher dreihundert Jahre alt. Nie ist der Blitz hineingeschlagen. Warum also gerade heute?«
»Trocken ist es ja hier«, gab Karl sich zufrieden.
Sie schwiegen. Schwere Wolken hatten den Himmel ganz überzogen. Es war fast dunkel.
Jedes Mal, wenn ein Blitz aufzuckte, sah Karl durch den Spalt einen Grabstein. Er wollte nicht an das Gewitter denken und versuchte, die Schrift zu entziffern. Seltsame Zeichen zeigte der Stein. Ähnliche waren ihm auch in Waldhoffs Werkstatt aufgefallen. Eine gespreizte Hand erkannte er. Karl versuchte, seine Hand auch so zu halten: Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger beieinander und Ringfinger und kleiner Finger eng zusammen, aber weit abgespreizt von den andern. Er versuchte es vergeblich. Sigi sah es und machte es ihm vor. Für ihn schien es leicht zu sein. Karls Finger gehorchten nicht.
»Bei euch ist alles anders«, sagte er. »Ihr habt eine eigene Schrift, eure Toten beerdigt ihr abseits der Stadt, die Gräber sind düster, ohne Blumen, am Samstag haltet ihr euren Sonntag. Warum ist das eigentlich so?«
»Wir glauben eben anders«, antwortete Sigi. Nach einer Weile fuhr er fort: »Vater sagt, unser Volk kommt von weit, weit her und ist nun in der ganzen Welt zerstreut.«
»Ach, ihr wohnt doch schon immer hier.«
»Lange wohl. Aber immer?«
»Ist das etwa nicht so?«
»Nein. Die meisten jüdischen Familien, die in diesem Städtchen leben, sind im Mittelalter aus Köln hierher geflohen.«
»Geflohen?«
»Ja. Es ging damals auf Leben und Tod. Das Leben haben wir übrigens einem der Euren zu verdanken, dem Erzbischof von Köln.«
»Woher weißt du das alles?«
»Wir vergessen nicht schnell. Damals war in Köln eine Pest ausgebrochen. Die Juden lebten in einem Stadtteil eng beieinander. Sie sollten das Unheil herbeigezogen haben.«
»Wie kann jemand eine Krankheit herbeiziehen?«
»Die Leute dachten, die Pest sei als Gottes Strafe dafür gesandt worden, weil in der Stadt nicht nur Christen lebten. So fielen sie über die Juden her, steckten ihre Häuser in Brand und trieben unsere Vorfahren durch die Straßen. Einige kamen im Feuer um oder starben unter Steinwürfen und Stockschlägen. Da erfuhr der Erzbischof davon, eilte mit Soldaten in unser Wohnviertel und wollte die wilde Menge zur Ruhe mahnen. Doch viel fremdes Volk, das sich zu einem Kreuzzug rüstete, hielt sich damals in der Stadt auf. Es hätte nicht viel gefehlt, da hätte sich die Masse in ihrem blinden Zorn sogar gegen den eigenen Erzbischof gewandt. Der sah das Leid unseres Volkes und erinnerte sich wohl, wie häufig ihm Juden mit der Judensteuer, Geschenken und Darlehen in Geldnöten geholfen hatten, und er versprach uns eine neue Heimat. Die Kölner Juden entkamen mit seiner Hilfe in andere Städte des Bistums. Doch nur wenige konnte er retten. Aufgehetzte Menschen glaubten, es sei ein gutes Werk, einen Juden zu töten. So ist unsere Familie hier in diese Stadt gekommen.«
»Warum müssen die Menschen sich eigentlich so wehtun?« Weder Karl noch Sigi wussten darauf eine Antwort.
Dann tröstete sich Karl: »Aber das ist ja lange, lange her. So etwas kommt sicher nie wieder.«
»Wer weiß das?«, fragte Sigi. Er dachte an all das dumme und böse Geschwätz, das gerade an diesem Tag wieder über die Juden verbreitet wurde.
»Was hast du, Sigi? Sind wir nicht Freunde?«
»Ja, Karl. Ich bin dein Freund.«
»Und ich bin deiner, Sigi.«
Das Donnern und Blitzen hatte nachgelassen, aber der Regen legte immer noch einen dichten Vorhang vor den Baumspalt.
Da hörten sie das Geläut von der Großen Kirche her. »Es hat eingeschlagen. Es brennt!«
Dumpf und bang klang der tiefe Ton der Glocke bis hierher zum Berg. »Wir müssen nach Hause!«
Sie sprangen aus dem bergenden Stamm hinaus und eilten der Stadt zu.
3
Doch nicht Blitz und Feuersbrunst zeigte der Glockenton an, sondern Wasserflut. In viele Keller war sie geflossen. Sigi und Karl sahen die Feuerwehr mit ihrer Spritze zur Niederung fahren. Sie eilten dem Pferdegespann nach und holten es ein, als die Schläuche gerade angekoppelt wurden.
»He, Jungs«, rief Brandmeister Hoppe, »zeigt, was ihr in den Armen habt!« Er wies sie an den Pumpenbalken. An jeder Seite standen sechs Männer. Die Jungen zwängten sich zur Verstärkung zwischen sie. »Auf! Eins, zwei, drei, auf, eins, zwei, drei!«, schrie Hoppe und peitschte den Rhythmus ein. Schon saugte der Zubringerschlauch das Wasser aus dem Keller vom Oirmannshof an. Zischend und gleichmäßig schoss der Strahl aus dem Rohr. Dem Mann an der Spritze machte das Spaß, und er zielte auf die Kühe, die mit hochgeschwungenen Schwänzen davonsprangen.
»Vielleicht steht auch bei uns das Wasser im Keller«, stieß Karl hervor. Die Jungen schwitzten. Die Arme schmerzten von der ungewohnten Arbeit schon nach wenigen Pumpenzügen. Auch den Männern waren die lauten Worte vergangen. Sie keuchten und pumpten, Zug um Zug, auf und ab.
»Sollen wir nach Hause gehen?«, fragte Sigi.
Sie ließen den Pumpenarm los.
»Ihr da!«, schimpfte der Brandmeister. »Was gibt es? Wollt ihr schon schlappmachen?«
»Wir wollen nachsehen, ob es bei uns auch in den Keller gelaufen ist.«
»Nichts da. Das hier ist Notdienst. Da muss jeder zufassen.«
Die Jungen machten sich wieder an die Arbeit. Der Regen hatte aufgehört. Ganz plötzlich fiel kein Tropfen mehr aus den Wolken. Schon wagten sich die ersten Sonnenstrahlen wieder hervor. Die Erde dampfte. Endlich begann die Pumpe zu spucken.
»Wasser halt!«, befahl Hoppe. Aufseufzend ließen die Jungen die Arme sinken. Blitzschnell rollten die Feuerwehrleute die Schläuche ein.
»Jetzt geht es zu Weigling in die Stadt«, sagte der Brandmeister.
Die Feuerwehrmänner schwangen sich in den Wagen. Florian griff nach den Zügeln.
»Ihr könnt mitfahren«, bot er den Jungen an. Die ließen sich das nicht zweimal sagen und sprangen auf.
»Hier, greif zu!« Hoppe hielt Karl den Schellenriemen hin. Da spürte Karl nicht mehr den Schmerz in den Muskeln und schlug die Glocke, als ob es zu einem Großfeuer ginge.
An der Ecke sprang Sigi ab. In der Mühlenstraße floss das Wasser bereits ab.
Die Keller waren trocken geblieben.
Niemand befand sich im Laden. Sigi hielt die Ladenschelle fest, ehe er die Tür ganz öffnete. So machten es Waldhoffs alle, damit Mutter oder Ruth nicht unnötig aus der Küche ins Geschäft eilten. Man musste es allerdings verstehen. Gerade im richtigen Augenblick schoss Sigis Hand durch den Spalt und griff den Klöppel. Karl hatte das schon oft versucht, aber es schien so, als ob nur die Waldhoffs diesen Griff lernen konnten.
Sigi betrat das Wohnzimmer. Der Vater saß am Sekretär und hatte ein Blatt über und über mit Notizen bedeckt. Er schaute gar nicht auf, als Sigi hereinschlüpfte. »Sechs Uhr Synagoge«, murmelte er. »Zeugen: Pfingsten, Sammy Deichsel, Josefowitsch. Sieben Uhr Rückkehr. Vor dem Haus sah mich Märzenich. Acht Uhr dreißig zum ›Goldenen Apfel‹. Dort sprach ich mit Blümer wegen des Rindes. Rück und Scheldrup waren dabei. Mit Rück ging ich zurück in unser Haus. Das war so gegen Viertel vor zehn.«
»Warum hast du nicht mit Herrn Rück getrunken, Vater?«
Das war Sigi herausgerutscht, weil es ihm gestern aufgefallen war, dass Herr Rück ganz allein ein Gläschen getrunken hatte.
Waldhoff fuhr zusammen. »Ach, du bist es, Sigi. Scher dich hinaus. Ich habe zu tun.«
Schon wollte Sigi weggehen, da rief sein Vater ihn zurück.
»Komm doch her, Junge. Vielleicht fällt dir noch etwas ein. Ich muss über jede Minute des gestrigen Tages genau Rechenschaft geben können.«
»Warum denn, Vater?«
Da nahm Waldhoff seinen Sohn bei den Armen und zog ihn dicht zu sich heran.
»Sigi, es kann sein, dass für uns schwere Tage kommen. Ruth hat eben erfahren, dass Mehlbaum glaubt, wir hätten den kleinen Jean getötet.«
»Aber das ist doch Unsinn, Vater.«
»Das ist es. Aber wir müssen uns mühen, dass alle das einsehen.«
»Was sagt Herr Mehlbaum denn?«
»Er hat beim Bürgermeister ausgesagt, dass er gestern gegen drei Uhr aus dem Fenster geschaut habe. Er sei gerade von seiner Mittagsfahrt mit dem Wagen zurückgekommen. Ruth sei über den Hof zu Schyffers’ Scheune gelaufen und habe einen schweren Sack geschleppt.«
»Aber das geht doch gar nicht, Vater. Wir haben doch in der vorigen Woche unsere Tür zum Hof hin zugenagelt, weil Schloters nicht hereinkommen sollte.«
»Richtig.« Waldhoff sprang auf. Er schlug sich gegen die Stirn. »Daran habe ich in all der Aufregung gar nicht mehr gedacht.« Er machte sich eine Notiz. »Siehst du, es ist doch gut, wenn du dabei bist.«
Er las nun seinem Sohn vor, was er herausgefunden hatte: Dass er kurz vor Ende des Hochamtes noch einmal zum »Goldenen Apfel« gegangen war, um mit Blümer zu reden, dass Märzenich beinahe den ganzen Nachmittag bei ihnen gesessen habe, bis sie schließlich gegen halb fünf zur Pumpe gegangen waren.
Sigi fand noch genau die Uhrzeit heraus, wann Waldhoff vom »Goldenen Apfel« zurückgekommen war. Denn da ging gerade der Franziskanerbruder van de Löcht die Straße hinauf zur Großen Kirche. Jedermann wusste, dass es dann fünf Minuten vor zwölf gewesen sein muss. Um zwölf läutete der Bruder Tag für Tag die Glocke zum Engel des Herrn.
Der Stundennachweis für Mutter war leicht. Sie hatte bis zum Nachmittag im Bett gelegen, weil sie starke Kopfschmerzen hatte. Aber gab es dafür Zeugen? Kaum. Märzenich mochte ihre Stimme gehört haben, als sie nach Wasser rief und Ruth ihr ein Glas voll frisch von der Pumpe holte. Mehrmals war Ruth auf ein paar Minuten bei ihr gewesen, doch das machte es nur noch schwerer. Denn auch Ruth hatte für diese Minuten niemanden, der ihre Unschuld bezeugen konnte.
So kam es, dass es Sigi recht bange war, als Waldhoff endlich einen Strich unter all die Zeiten und Zeugen machte.
»Übrigens, ich habe mit Rück deshalb nicht getrunken, Sohn, weil gestern der Todestag meiner Mutter gewesen ist. Deshalb war ich ja auch schon so früh in der Synagoge, um ihr das Jahrzeitlicht anzustecken.«
Es dämmerte, als Sigi noch einmal auf die Straße trat. Bei der Pumpe standen Hein Schyffers und Norbert Schmals. Sigi schlenderte zu ihnen hinüber. Sie verstummten, als er näher kam.
»Was starrt ihr mich so an?«, fragte er.
»Wir?« Sie blickten weg.
»Komm, Hein, wir müssen nach Haus.«
Sie liefen davon. Sigi lachte hinter ihnen drein. Ob Norbert noch Angst hat, weil er vorige Woche in unserm Hof einen Stein umgestoßen hat?, dachte er.
Arglos übersah er die ersten Zeichen der Mauern, die rings um ihn emporwuchsen.
4
Der 1. Juli war heiß und schwül. Die kurze Abkühlung, die das Unwetter am Tage vorher gebracht hatte, war von der Sommersonne weggebrannt worden. Die Straßen lagen längst wieder trocken. Nur in den Gartenwegen erinnerte hier und da eine schmutzig braune Pfütze an den Regen des Vortages. Die Leute hatten die Kellerfenster und Luken weit aufgesperrt, damit die Feuchtigkeit aus den Mauern auftrocknen konnte. Obwohl es ein Werktag war wie jeder andere, schien die Stadt ausgestorben. Waldhoff und Sigi sahen auf ihrem Weg zum Markt keinen Menschen.
Waldhoff hatte seinen guten schwarzen Anzug angezogen, und Sigi war von Mutter in die Sonntagskleidung gesteckt worden.
Die Turmuhr schlug elf, als Waldhoff seinen Sohn in eine Haustür zog. Die Menschen strömten aus der Großen Kirche, die Kinder zuerst, in langen Reihen, von den Lehrerinnen und Lehrern geführt, die Messdiener, das Kreuz voran, die Frauen und Männer und schließlich der weiße Sarg, von sechs Jungen getragen. Der Leichenzug wollte und wollte kein Ende nehmen. Die ganze Stadt schien sich verabredet zu haben an der Beerdigung des kleinen Jean teilzunehmen. Was die Frauen anging, so mochten wohl keine dreißig fehlen. Die Männer waren weniger zahlreich vertreten. Doch aus den Bruderschaften hatten sich viele einen Tag freigenommen, und das Grün und Weiß ihrer Uniformen brachte ein wenig Farbe in den düsteren Zug.