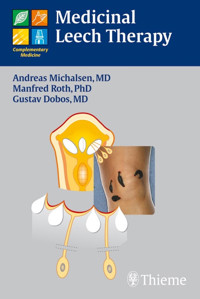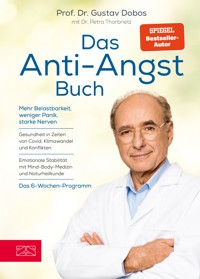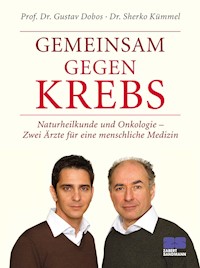20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ZS - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Essen macht glücklich, vertreibt Ängste und führt uns zu innerer Stabilität. Mit gezielter Ernährung können wir Depressionen eindämmen, die Nerven stärken und die Stimmung heben. Wenn das Gehirn die besten Nährstoffe bekommt, denken wir klarer, empfinden weniger Stress, haben seltener Schmerzen und steigern unser Wohlbefinden. Das ist kein Werbeslogan, sondern Wissenschaft! Viele Studien belegen inzwischen, welch großen Einfluss die Ernährung auf unsere Psyche hat. Deshalb plädiert der Internist und Ernährungsmediziner Prof. Dr. Gustav Dobos auch dafür, zu den richtigen Lebensmitteln statt zu Psychopillen zu greifen. Als Pionier der Naturheilkunde kennt Professor Dobos sich mit gesunder Ernährung bestens aus: In seinen ganzheitlichen Behandlungskonzepten ist sie seit jeher eine feste Säule der Therapie. Dieses Buch erklärt nicht nur die Hintergründe der neuesten Forschung, sondern stellt auch abwechslungsreiche Rezepte für jeden Tag vor: Genuss für die Seele.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
Bauchgefühle: Wieso Ernährung unsere Stimmung beeinflusst
GESUNDE NAHRUNG, GESUNDE PSYCHE
Höhen und Tiefen: Wie entstehen Gefühle überhaupt?
Die Darm-Hirn-Achse: zentrale „Datenbahn“ des Körpers
Schutzwall Darm: die Abwehrstrategien unseres Körpers
Schöne neue Welt? Wie der moderne Lebensstil unsere Psyche belastet
Depression und Ernährung: Wenn der Bauch das Gehirn steuert
„Mediterran plus“ als Basis: pflanzenbasierte Mischkost mit asiatischem Twist
12 Superfoods für die Seele: die Top-Lebensmittel für Hochstimmung im Gehirn
Alles im grünen Bereich: sieben Grundregeln des Essens für die Seele
Was der Seele sonst noch hilft: aktiv für mehr Wohlbefinden und Widerstandskraft
REZEPTE, DIE UNS GLÜCKLICH MACHEN
Frühstück
Sattmacher
Kleine Gerichte
Süßes und Snacks
Saisonkalender: Gemüse und Salate
Mein Ernährungstagebuch
Ausgewählte Literatur und Dank
Impressum
DIE SYMBOLE BEI DEN REZEPTEN
entzündungslindernd
ballaststoffreich
reich an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen
Superfood
blutzuckerstabilisierend
Omega-3-Bombe
glutenfrei
Gewürzbooster
BAUCHGEFÜHLE:
Wieso Ernährung unsere Stimmung beeinflusst
Sie kennen das bestimmt, das wohlige Gefühl, das zum Beispiel ein warmer Porridge am Morgen in Ihrem Inneren hinterlässt – als könnte man gefühlt noch mal unter die Bettdecke schlüpfen. Oder die Kraft, die eine scharf gewürzte asiatische Hühnersuppe voller frischer Kräuter durch Ihren Körper schickt – Energie bis in die letzte Pore! Allein schon der Duft nach Vanille oder Zimt beruhigt die Nerven. Und Nudeln lösen bei den meisten Menschen Glücksgefühle aus.
„Der Mensch ist, was er isst“ – viele Menschen haben diesen Satz schon einmal gehört. Aber die wenigsten wissen, dass er von dem Philosophen Ludwig Feuerbach (1804–1872) stammt. Feuerbach kritisierte die bis heute übliche Überhöhung von Geist und Vernunft. Ohne die Materie der Nahrung, betonte er, könne es auch kein Denken geben. Sinn und Sinnlichkeit gehörten bei ihm zusammen: „Die erste Bedingung, dass du etwas in dein Herz und deinen Kopf bringst, ist, dass du etwas in deinen Magen bringst.“
Das „Prinzip Bauch“ aber ist natürlich viel älter als das 19. Jahrhundert. In der asiatischen Philosophie ist der Mittelpunkt des Menschen das „hara“, Sitz des intuitiven Denkens und der Gefühle. Dieses Zentrum muss genährt werden, durch eine entsprechende Lebenspraxis, und dabei spielt das Essen eine wichtige Rolle. Die Nahrung nimmt daher in allen traditionellen Heilkunden, auch in der Naturheilkunde, einen weit höheren Stellenwert ein als in der modernen Medizin. Dort spielen zwar Inhaltsstoffe wie Vitamine oder Fettsäuren ebenfalls eine wichtige Rolle. Eigentlich aber geht es um die gesamte Haltung dem Essen gegenüber, seine soziale und ökologische Funktion – und immer wieder auch um die sinnliche Seite, die direkt an unsere Gefühle appelliert.
ERNÄHRUNG IST AUCH MEDIZIN
Krankheiten werden oft von Depressionen begleitet, vor allem chronische Leiden. Doch die psychische Seite rückt dabei oft in den Hintergrund vor den körperlichen Beschwerden. Nicht in der Naturheilkunde! Dort konnte ich in rund 25 Jahren immer wieder neu die Erfahrung machen, dass es den Patientinnen und Patienten als Erstes psychisch besser ging, nachdem sie stationär aufgenommen worden waren. Anfangs waren mein Team und ich verblüfft, schließlich behandelten wir sie internistisch-naturheilkundlich und nicht psychiatrisch. Doch dann wurde uns klar, dass unsere Ernährung diese kleinen Wunder bewirkte: Auf mein Betreiben hin war in der Klinik für Naturheilkunde in Essen, die ich viele Jahre leitete, eine eigene Vollwertküche eingerichtet worden, mit mediterraner Kost. Fleisch oder Fisch gab es einmal pro Woche. Seit einigen Jahren zeigen nun auch erste Metaanalysen, die einen Überblick über die Gesamtheit der Forschung geben, welche Rolle unsere Ernährung nicht nur für den Körper, sondern auch für unser Gehirn spielt. Dieser ganzheitliche Gesundheitsaspekt ruft nun auch die Universitätsmedizin auf den Plan: Inzwischen leite ich ein Zentrum für Naturheilkunde und Planetare Gesundheit, das sich zur Aufgabe gemacht hat, mediterrane Vollwertkost in die Uniklinik Essen einzuführen, als wichtige Basis der medizinischen Behandlung.
Dass die Ernährung auch unsere Psyche beeinflusst – für die moderne Medizin ist das eine neue Erkenntnis. Einer der Vorreiter ist die Harvard Medical School, die eine „nutritional psychiatry“ etabliert hat und nun interessante Impulse in die Wissenschaft schickt. Hinter dieser neuartigen Ernährungspsychiatrie steckt auch die Enttäuschung darüber, dass Arzneistoffe, von denen man sich viel versprochen hatte, bei vielen Menschen langfristig wenig geholfen haben. Dazu zählen etwa die berühmten Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRIs), die gegen Depressionen eingesetzt werden.
DIE MACHT DES PSYCHOBIOMS
Parallel zu dieser Erfahrung mehren sich die Erkenntnisse darüber, wie groß der Einfluss der Darmbakterien auf das Gehirn ist. Neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson, Demenz und Multiple Sklerose scheinen damit zusammenzuhängen. Auch unsere Gefühle? Lange Zeit hatte man angenommen, die Blut-Hirn-Schranke wehre Stoffe ab, die das Gehirn verändern könnten. Dass Schokolade glücklich mache, sagten deshalb Experten, sei ein Mythos. Inzwischen weiß man, dass das Gehirn längst nicht so abgeschottet ist, wie man dachte, und unsere Psyche komplizierter aufgebaut ist und von mehr Faktoren abhängt als nur von einzelnen Botenstoffen. Zum Beispiel von der Aktivität unseres Bauchhirns. Kann Joghurt also mutig machen? Helfen Kimchi oder Sauerkraut gegen Depression? Wirkt Chili gegen emotionale Erschöpfung? Hinweise dafür gibt es. Den Darmbakterien wird inzwischen so viel Einfluss zugeschrieben, dass man ihre Lebensgemeinschaft nicht mehr als Mikro-, sondern bereits als „Psychobiom“ bezeichnet.
Natürlich können wir einen Esslöffel gemahlene Kurkuma oder ein Brokkoliröschen nicht einnehmen wie eine Tablette und davon eine prompte Wirkung erwarten. Aber wir können unsere Psyche langfristig stabilisieren und uns damit unempfindlicher gegenüber Stimmungsschwankungen machen. Wir können mit der Zeit auch bestimmten Neigungen wie Ängstlichkeit oder depressiver Verstimmung gezielt entgegenwirken. Und für mehr gute Laune in unserem Alltag sorgen. Das „Essen für die Seele“ verhilft Ihnen nicht nur zur inneren Balance, sondern ist auch gesund – und ohne jede Nebenwirkung.
KOCHEN SIE SICH GLÜCKLICH
Ich bin immer wieder erstaunt, was Ernährung alles bewegen kann. So konnten wir zuletzt verblüffende Erfolge in einem Forschungsprojekt mit den emotional wie körperlich stark geschwächten Long-Covid-Patientinnen und -Patienten erzielen – beim Kochen! Um die Psyche zu stärken und positiv zu beeinflussen, sind vier Dimensionen besonders wichtig. Was wir essen, sollte
▶ballaststoffreich sein, um genug „Futter“ für das Psychobiom bereitzustellen,
▶entzündungslindernd wirken,
▶den Blutzucker stabil halten und
▶psychowirksame sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe enthalten.
Das ist die Basis des „Essens für die Seele“ und der Rezepte in diesem Buch – sie enthalten alle wichtigen Nährstoffe für Ihre Gesundheit, sind abwechslungsreich und lassen sich leicht umsetzen. Ihre Farben und Aromen werden schon beim Kochen alle Ihre Sinne anregen und Sie – hoffentlich – ein klein wenig glücklich machen.
In diesem Sinne wünscht Ihnen „Guten Appetit“
Ihr
GESUNDE NAHRUNG, GESUNDE PSYCHE
Nicht nur die Liebe geht durch den Magen, sondern auch die Gesundheit. Was wir essen, hat viel mehr damit zu tun, wie wir uns fühlen, als viele denken. Eine große Rolle spielt dabei unser Darm, der Sitz unseres „Bauchhirns“, das rund um die Uhr mit der Kommandozentrale im Kopf kommuniziert und so enormen Einfluss auf unser seelisches Befinden hat.
HÖHEN UND TIEFEN:
Wie entstehen Gefühle überhaupt?
Bevor wir zu denken anfangen, haben wir bereits Gefühle – ihre Basis sind Sinneswahrnehmungen. So hat sich das erste Leben entwickelt: Die noch ganz einfach gebauten Organismen, nicht mehr als Zellhaufen im Meer, entwickelten spezialisierte Organe, die auf die Umwelt reagierten: auf Licht oder Strömung, auf Temperatur oder einen bestimmten Säuregehalt. Sie nutzten diese Reize, um Nahrung zu suchen und zu finden. Das sinnliche „Spüren“ entsprang dem Instinkt, sich am Leben zu erhalten. Diese körperliche Reaktion wurde mit der Evolution immer komplexer – und schließlich zum „Gefühl“, zu etwas, das wir heute eher in unserer Psyche und damit im Gehirn verorten. Aber es hat immer noch sehr oft seinen Ursprung in äußeren Reizen.
ALLES FING MIT HUNGER AN
Nahrung prägt unsere Psyche von den Ursprüngen des Lebens an. Schon die Vorlieben der Mutter für bestimmte Lebensmittel hinterlassen ihre Spuren im Ungeborenen und prägen die Geschmacksvorlieben des Kindes. Die ersten Gefühle des Babys, Wut und Frust, aber auch Glück und Zufriedenheit, hängen mit dem Hunger nach Nahrung zusammen. Und Säuglinge zeigen sie völlig ungehemmt: Sie schreien lauthals, glucksen vor Lust an der Brust, strahlen oder zappeln vor Glück. Unsere Fähigkeit, Gefühle zu empfinden, also auch unsere Psyche, hat sich über unser Verhältnis zur Nahrung entwickelt. Das sollten wir nie vergessen.
Das portugiesische Forscherehepaar Antonio und Hannah Damasio, beide Neurowissenschaftler am Brain and Creativity Institute der University of Southern California, unterscheiden deshalb zwei Dimensionen von Gefühl: Die eine Dimension sind die körperlichen Sinneswahrnehmungen, wie etwa die Erfahrung von Schlägen oder auch von Zärtlichkeit, die im Körper als eine Art biografische Landkarte in einer Nervenmatrix abgespeichert werden. Die zweite Dimension ist die Verarbeitung dieser Reize – als Wut, Angst oder Sehnsucht – im Gehirn. Dort werden diese Gefühle entweder als Erinnerung abgelegt oder in verstecktere Areale verdrängt. Sie sind dann nicht mehr in unserem Bewusstsein, aber keinesfalls verschwunden. Sie dienen langfristig unserer Orientierung im Leben.
Diese psychische Ebene der Gefühle, die sich selten sauber von der körperlichen Ebene trennen lässt, hat großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Einer der Ersten, der sich mit der Funktion von Gefühlen beschäftigte, war übrigens Charles Darwin (1809–1882). Er stellte die These auf, dass es elementare und besonders wichtige Gefühle gebe, die man selbst bei manchen Tieren fände, zum Beispiel, wenn ein Hund zu seiner Verteidigung die Zähne fletscht. Neben diesen fundamentalen, angeborenen Gefühlen gebe es aber auch noch kulturell oder gesellschaftlich erworbene Empfindungen wie etwa Scham. Unter anderem untersuchte Darwin ein Phänomen seiner Zeit – das Erröten.
Was aber verknüpft die Wahrnehmung, plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, mit dem Gefühl der Scham und dem Erröten? Zu Darwins Zeiten waren Biologie und Medizin noch nicht so weit, dass man die chemischen Pfade solcher Gefühlsregungen hätte aufspüren und benennen können, auch wenn noch zu seinen Lebzeiten die ersten aufgedeckt wurden.
DIE ROLLE DER BOTENSTOFFE
Heute weiß man, dass Nervenleitungen kein zusammenhängender Strang sind wie ein Stromkabel, sondern dass sie aus hintereinandergereihten Nervenzellen (Neuronen) bestehen. Diese kommunizieren über Synapsen an ihren Enden, bauchige Wölbungen mit winzigen Bläschen, die Botenstoffe enthalten. Bei einer bestimmten elektrischen Ladung entlässt das Neuron diese Substanzen in seine Umgebung, den „synaptischen Spalt“. Von dort aus docken die Botenstoffe an die Rezeptoren benachbarter Zellen an, die darauf mit elek-trischen Signalen reagieren. Irgendwann werden die auch „Neurotransmitter“ genannten Substanzen von zugehörigen Nervenzellen wieder resorbiert und abgebaut.
Inzwischen kennt man auch die wichtigsten dieser Substanzen, zum Beispiel das Dopamin. Es zählt zu den Neurotransmittern und wird häufig euphemistisch als „Glückshormon“ bezeichnet. Wahr ist, dass er im Laufe seiner Entstehung ähnliche Zwischenstufen durchläuft wie Morphium und auch, dass Dopamin eine Rolle bei Motivation, Selbstvertrauen und Antrieb, aber auch bei der Motorik spielt. Es wird im Gehirn gebildet. Ein Mangel, genauso aber auch eine Überdosis führen zu Störungen in den Signalketten des Nervensystems. Damit erklärt man unter anderem Symptome des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms (ADS), aber auch die Bewegungsstörungen bei Parkinson. Denn wie die meisten anderen Botenstoffe hat Dopamin nicht nur eine einzige Aufgabe, sondern vielfältige Funktionen.
Serotonin ist ein zweiter wichtiger Botenstoff. In der Natur ist er weitverbreitet. Beim Menschen entsteht er über mehrere Zwischenstufen im zentralen Nervensystem und in den sogenannten chromaffinen Zellen, kleinen Drüsen in der Darmschleimhaut. Weil bei depressiven Menschen häufig ein Mangel an Serotonin im Gehirn gemessen wurde, führte man ihren gedämpften Gemütszustand lange auf dieses Defizit zurück. In den 1980er-Jahren wurde deshalb auch eine neue Wirkstoffklasse entwickelt, die Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRIs). Das vielleicht bekannteste Medikament, das damals euphorisch in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, war „Prozac“ (in Deutschland: „Fluoxetin“). Die SSRIs sollen dafür sorgen, dass das von den Nervenzellen ausgeschüttete Serotonin nicht rasch wieder absorbiert wird, sondern länger im Gehirn wirken kann. Das funktioniert auch – doch eine Auswertung von Langzeitstudien zeigte, dass die SSRIs bei etwa der Hälfte aller Patienten letztlich nicht mehr erreichen als ein Scheinmedikament (Placebo). Bei vielen treten außerdem mehr Nebenwirkungen auf. Nur Patienten mit schweren Depressionen profitierten etwas mehr. Die jüngste Forschung geht deshalb davon aus, dass der Serotoninmangel möglicherweise gar nicht die zentrale Rolle bei Depressionen spielt, zumindest nicht bei allen Menschen, sondern vielleicht nur ein Nebeneffekt ist. Das würde erklären, dass diese Wirkstoffklasse auch nur einem Teil der Betroffenen hilft.
Dopamin und Serotonin sind als zentrale Modulatoren des Nervensystems ständig präsent, sie spielen deshalb eine besonders wichtige Rolle für unsere Psyche. Die Effekte anderer Neurotransmitter sind schnelllebiger. Dazu gehört zum Beispiel Glutamat, vielen bekannt als konservierender Zusatzstoff bei vielen Fertigprodukten und als Geschmacksverstärker (etwa in einigen Chinarestaurants). Manche Menschen reagieren mit Kopfschmerzen oder anderen Symptomen empfindlich auf Glutamat im Essen. Die Ursachen sind nicht geklärt – die Blut-Hirn-Schranke sollte eigentlich verhindern, dass diese Substanz in das Gehirn gelangt. Dort produzieren unsere Nervenzellen unser eigenes Glutamat mithilfe von Enzymen, speichern es und schütten es bei Bedarf aus. Es unterstützt die Vermittlung und Verarbeitung von Sinnesreizen und ist wichtig für die Steuerung gezielter Bewegungen sowie Lernen und Erinnern. Ein Übermaß führt zu Stress, innerer Un- ruhe und Depression. GABA (Gamma-Aminobuttersäure) ist sein Gegenspieler und bremst die Aktivität von Glutamat. Und schließlich ist da noch das entspannende und schlaffördernde Glycin, das vor allem in Hirnstamm und Rückenmark zu finden ist.
Oxytocin ist eine Substanz, die besonders gut zeigt, wie inneres und äußeres Fühlen zusammenspielen. Das Hormon wird im Hypothalamus gebildet, dem Steuerungszentrum des vegetativen Nervensystems, und von der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) ausgeschüttet. Es festigt die Bindung zwischen Menschen, insbesondere zwischen Mutter und Kind. Das beginnt schon vor der Geburt, vor allem aber danach, unter anderem bei Augenkontakt. Oxytocin entsteht auch bei körperlicher Berührung wie Streicheln oder beim Sex und unterstützt das Gefühl der Liebe.
Alle diese Botenstoffe lassen in uns Gefühle entstehen. Viele sind auch in unserer Nahrung enthalten. Oder unser Essen liefert die Bausteine, aus denen der Organismus dann herstellen kann, was er gerade braucht. In jedem Fall erfüllt die Nahrung, wie Feuerbach schon sagte, „Herz und Kopf“ gleichermaßen. Dabei ist klar: Dass Serotonin in der Walnuss steckt, heißt nicht, dass es automatisch das Gehirn erreicht. Die Evolution hat viel Aufwand betrieben, unsere empfindliche Steuerungszentrale durch die Blut-Hirn-Schranke vor äußeren Einflüssen zu schützen. Und dennoch können wir nicht nur das Gehirn stärken, sondern auch unsere Psyche – durch unsere Ernährung.
VOM SINN DER BAUCHGEFÜHLE
Um das zu verstehen, müssen wir uns dem zweiten Gehirn zuwenden, dem dichten Nervennetz in unserer Mitte. Eigentlich ist dieses „Bauchhirn“, unser Ursprungsgehirn – jenes, das zu Urzeiten für die Nahrungssuche zuständig war. Dadurch, dass sich der Verdauungsapparat der Arten mit der Eroberung des Landes an unterschiedliche Lebensräume anpassen musste, entstanden immer mehr Spezies. Und irgendwann, vielleicht vor rund 1,8 Millionen Jahren, gelang es schließlich dem Menschen, durch die Beherrschung des Feuers seine Nahrungsaufnahme so zu optimieren, dass ausreichend Energie für eine weit komplexere Steuerzentrale zur Verfügung stand: das Kopfhirn. Es war zu Bewusstsein fähig und zum Umgang mit Gefühlen, die komplexer waren als die einfachen Sinneswahrnehmungen zum Zweck der Nahrungs- suche. Trotz alledem hat eigentlich immer noch das alte Bauchhirn, das enterische Nervensystem (ENS), das Sagen: Es laufen nämlich viel mehr Signale vom Bauch zum Kopf als umgekehrt. Es ist also nicht ganz unberechtigt, wenn wir nicht nur unseren Gedanken, sondern auch unserem „Bauchgefühl“ vertrauen. Immerhin enthält der Verdauungstrakt 400 bis 600 Millionen Nervenzellen, eingebettet in die Darmschleimhaut und die Darmwand.
Sie dienen nicht nur dazu, die Nahrung durch den Körper zu transportieren – indem sie dafür sorgen, dass sich der Darm rhythmisch zusammenzieht und wieder entspannt. Sie haben viel mehr Aufgaben als die pure Motorik: Sie entlassen Enzyme und Hormone, die für die Verdauung wichtig sind. Und sie registrieren alles, was im Darm passiert: Ob sich Nahrung ankündigt, wie viel davon und welche Zusammensetzung sie hat. Das alles tut das enterische Nervensystem ganz autonom, ohne jede Hilfe vom Kopfhirn – wir können diese Prozesse also auch nicht willentlich beeinflussen. Aber über die Darm-Hirn-Achse und den Vagusnerv stehen beide Gehirne – Bauch und Kopf – in ständigem Informationsaustausch.
DIE DARM-HIRN-ACHSE:
zentrale „ Datenbahn“ des Körpers
Das zentrale Nervensystem (ZNS), also Gehirn und Rückgrat, ist mit dem enterischen Nervensystem (ENS), dem Bauchhirn, in mehrfacher Weise vernetzt – über die Signale von Immunzellen, Hormonen und anderen Botenstoffen. Sie laufen über den großen Vagusnerv, der sich vom Gehirn bis zu den Organen und dem Verdauungstrakt zieht. Er ist unter anderem Teil des parasympathischen (auf Beruhigung ausgerichteten) unbewussten Nervensystems und transportiert Informationen über mechanische Belastungen genauso wie solche über Temperatur oder chemische Vorgänge im Körper. Der Vagusnerv steuert die Motorik des Darms und kontrolliert die Ausschüttung von Verdauungsenzymen, registriert aber auch entzündliche Prozesse im Körper und alarmiert Immunzellen.
SICH GLÜCKLICH ESSEN, GEHT DAS?
Wenn die Nahrung durch den Körper wandert, entlassen die Nervenzellen des Darms Botenstoffe wie das „Glückshormon“ Serotonin. Das ist ein Zeichen für andere Nervenzellen, die Darmbewegung zu verstärken oder zu signalisieren, dass der Bauch jetzt voll und der Mensch satt ist. Ein Teil des Serotonins gelangt auch in die Blutbahn. Zwar schirmt die Blut-Hirn-Schranke, eine weitgehend undurchlässige Struktur der Nervenzellenwände, das Gehirn vor äußeren Einflüssen ab. Trotzdem scheint ein hoher Serotoninspiegel im Darm Einfluss auf das Gehirn zu haben. Zudem können Nährstoffe und Vorläufersubstanzen für den Aufbau der wichtigen Neurotransmitter das Sicherungssystem passieren, um anschließend wieder zusammengesetzt zu werden.
Auch die Bakterien, die unseren Darm besiedeln, senden über den Vagusnerv, die Darm-Hirn-Achse, verschiedene Signale. Neben dem schon genannten Serotonin gehören dazu kurzkettige Fettsäuren, von denen man weiß, dass sie die Blut-Hirn-Schranke überwinden können und Nervenzellen stärken. Immunzellen produzieren Zytokine, die unter anderem helfen, Entzündungsreaktionen im Gehirn zu bekämpfen. Was wir essen, bestimmt damit also, wie wir uns fühlen. Denn die Zusammensetzung der Bakterien im Verdauungstrakt und damit automatisch auch die von ihnen ausgesandten Signale werden maßgeblich über die Ernährung beeinflusst.
Ein Indiz dafür, dass Botenstoffsignale aus dem Darm über den Vagusnerv das Gehirn erreichen, ist die Tatsache, dass massive Störungen im Gleichgewicht der Darmbakterien zu Veränderungen im Serotoninhaushalt des Gehirns und damit auch zu erheblichen Stimmungsschwankungen und Depres- sionen führen können. Wie das genau passiert, das ist in vielen Punkten noch nicht entschlüsselt. Fest steht aber immerhin, dass entzündliche Prozesse auf vielfache Weise negativen Einfluss nehmen: Sie verändern die Zusammensetzung des Mikrobioms, rufen vermehrt Immunzellen auf den Plan, können zu Verletzungen der Darmwand führen und sogar bis ins Gehirn reichen, wo sie die Blut-Hirn-Schranke schwächen. Zum Glück lässt sich dem entgegenwirken – indem wir Entzündungen vermeiden und das Darmmikrobiom möglichst lange gesund und vor allem auch seine Vielfalt erhalten. Am einfachsten gelingt das mithilfe einer darmgesunden Ernährung.
EIN AUSGEKLÜGELTES INFORMATIONSNETZWERK
Obwohl das Gehirn durch die Blut-Hirn-Schranke vor äußeren Einflüssen geschützt wird, kann der Darm auf verschiedene Weise Einfluss nehmen: über den Vagus-Nerv. So entsteht eine Darm-Hirn-Achse.
SCHUTZWALL DARM:
die Abwehrstrategien unseres Körpers
Kleine Kinder lernen beizeiten, dass sie nicht alles in den Mund stecken dürfen. Aber es gibt auch Dinge, die sie zum Leidwesen der Eltern nicht in den Mund stecken wollen: Spinat zum Beispiel. Dass viele Kinder gerade grünes Blattgemüse nicht besonders lieben, wird immer wieder darauf zurückgeführt, dass hinter der Skepsis noch ein evolutionär entwickelter Sicherheitsmechanismus stecke: Es gäbe in der Natur eben vieles Grüne, das nicht essbar oder sogar giftig sei. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Fest steht aber: Was wirklich essbar ist, musste der Verdauungsapparat des Menschen in vielen Versuch-und-Irrtum-Anläufen erst einmal herausfinden. Und einige unserer gemeinsamen Vorfahren mussten dabei ganz sicher auch ihr Leben lassen.
DIE ENTZÜNDETE SEELE
Inzwischen aber hat unser Verdauungssystem als Schnittstelle zwischen den Gefahren der Außenwelt und den Bedürfnissen der Innenwelt dazugelernt: Von Geburt an wird der Darm mit immer neuen Stoffen und Bakterien konfrontiert und lernt dadurch Schritt für Schritt, die Nahrung zu analysieren, sie weiter aufzuschließen und nützliche Bakterien zu tolerieren. In Zusammenarbeit mit dem Immunsystem beginnt er, feindliche Erreger zu erkennen, sie abzuwehren und giftige Substanzen vom Körper fernzuhalten, indem er sie schleunigst aus dem Körper leitet.
Im Darm leben 70 Prozent der im Körper vorhandenen Lymphozyten. Sie sind Wächterzellen: Wie eine kleine Festplatte tragen sie die chemisch verschlüsselten Informationen zu überstandenen Bedrohungen, etwa Krankheitserregern, in sich. Treten diese erneut auf, so alarmieren die Leukozyten sofort andere Soldaten des Immunsystems. Bei der Abwehr helfen zum Beispiel Plasmazellen