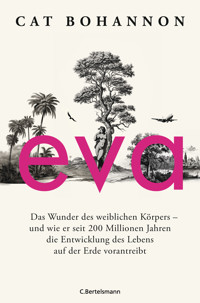
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
NEW YORK TIMES BESTSELLER UND
AUF DER SHORTLIST ZUM »WISSENSCHAFTSBUCH DES JAHRES« 2025:
Ein völlig neuer Blick auf den Ursprung der Menschheit, der unser Denken über den weiblichen Körper grundlegend verändern wird: »EVA überrascht, klärt auf und macht Mut.« – Bonnie Garmus, Bestsellerautorin von »Eine Frage der Chemie«
Warum menstruieren Frauen? Sind sie immer das schwächere Geschlecht? Ist Sexismus nützlich für die Evolution? Und wie haben Ammen die Zivilisation vorangetrieben? Viel zu lange hat sich die Wissenschaft fast ausschließlich auf den männlichen Körper konzentriert. Erst in den vergangenen 15 Jahren haben Forscher verschiedener Fachbereiche neue spannende Entdeckungen dazu gemacht, wie sich der weibliche Körper in den letzten 200 Millionen Jahren entwickelt hat, wie er funktioniert und was es wirklich bedeutet, biologisch eine Frau zu sein. Auf der Basis dieser Erkenntnisse unternimmt die Forscherin und Journalistin Cat Bohannon eine Neubeschreibung der Geschichte des Frauseins. Akribisch recherchiert und lebendig erzählt zeichnet sie den Entwicklungsverlauf des weiblichen Körpers nach und rückt dabei unser Wissen über die Evolution und darüber, warum der Homo sapiens eine so erfolgreiche und dominante Spezies geworden ist, in ein ganz neues Licht. »Eva« knüpft dort an, wo Hararis »Sapiens« aufgehört hat. Das Buch ist nicht nur eine tiefgreifende Revision der Menschheitsgeschichte, sondern auch ein dringend notwendiges Korrektiv für eine Welt, die bis vor kurzem vor allem den Mann im Blick hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1162
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ZUMBUCH
Warum menstruieren Frauen? Sind sie immer das schwächere Geschlecht? Ist Sexismus nützlich für die Evolution? Und wie haben Ammen die Zivilisation vorangetrieben? Viel zu lange hat sich die Wissenschaft fast ausschließlich auf den männlichen Körper konzentriert. Erst in den vergangenen 15 Jahren haben Forscher verschiedener Fachbereiche neue spannende Entdeckungen dazu gemacht, wie sich der weibliche Körper in den letzten 200 Millionen Jahren entwickelt hat, wie er funktioniert und was es wirklich bedeutet, biologisch eine Frau zu sein. Lebendig und auf beeindruckend breiter Recherchebasis erzählt Cat Bohannon die Geschichte des weiblichen Körpers vom Scheitel bis zur Scheide und findet dabei überraschende Antworten auf die Frage, warum der Homo sapiens eine so erfolgreiche und dominante Spezies geworden ist.
ZURAUTORIN
Cat Bohannon hat über die Evolution des Denkens und Geschichtenerzählens promoviert und arbeitet heute als Forscherin und Autorin. Ihre Essays und Gedichte erschienen unter anderem in Scientific American, Mind, Science Magazine sowie in literarischen Zeitschriften. »Eva« ist ihr erstes Buch, das sofort ein New-York-Times-Besteller wurde, auf zahlreichen Listen als bestes Sachbuch des Jahres 2023 stand und aktuell für den Women‘s Prize for Nonfiction 2024 nominiert ist. Bohannon lebt mit ihrer Familie in Seattle.
www.cbertelsmann.de
CAT BOHANNON
Das Wunder des weiblichen Körpers – und wie er seit 200 Millionen Jahren die Entwicklung des Lebens auf der Erde vorantreibt
Aus dem amerikanischen Englisch von Rita Gravert, Christina Hackenberg, Ursula Held und Sigrid Schmid
Die Originalausgabe erschien 2023
unter dem Titel Eve: How the Female Body Drove 200 Million Years of Human Evolution
bei Alfred A. Knopf/Hutchinson Heinemann in der Verlagsgruppe Penguin Random House, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2023 by Cat Bohannon
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
C. Bertelsmann in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Jorunn Wissmann
Illustrationen: Hazel Lee Santino
Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagabbildungen: Marcantonio Raimondi nach Raffael Santi, Adam und Eva, um 1509–1514, Albertina, Wien (Ausschnitt); Hafen Werbeagentur (5)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-23759-2V001
www.cbertelsmann.de
Für meine Kinder Leela und Pravin. Nichts hat mein Verständnis von Zeit mehr verändert als eure steten, wunderbaren Atemzüge.
Inhalt
Einleitung
1 Milch
2 Gebärmutter
3 Wahrnehmung
4 Beine
5 Werkzeuge
6 Gehirn
7 Stimme
8 Menopause
9 Liebe
Dank
Anmerkungen
Bibliografie
Register
Einleitung
So war es. Wir erkannten einander und empfingen einander in einer Dunkelheit, die ich in Erinnerung habe wie in Licht getaucht. Dies also will ich Leben nennen.[1]
Adrienne Rich, »Ursprünge und Geschichte des Bewusstseins«
Elizabeth Shaw hat ein Problem. Regisseur Ridley Scott hat ihr einen fiesen, krakenähnlichen Alien eingepflanzt. An Bord des Raumschiffs Prometheus setzt sie nun alles daran, den ungebetenen Gast wieder loszuwerden, ohne dabei zu verbluten. Sie schleppt sich zu einer futuristischen Operationseinheit und verlangt nach einem Kaiserschnitt. »Fehler«, meldet der Computer. »Dieser Medpod ist für männliche Patienten kalibriert.«
»Scheiße«, zischte eine Frau hinter mir. »Wer macht so was?«
Es folgt eine schauerliche Szene[2], in der Laser, Heftklammern und Tentakel vorkommen. Als ich 2012 in einem New Yorker Kinosaal saß und mir obiges Prequel zu Alien anschaute, dachte ich tatsächlich: Ja, wer macht so was? Wer schickt eine Abertrillionen teure Expedition ins All und vergisst, dass die Ausrüstung auch für Frauen funktionieren muss?
Leider macht die moderne Medizin oft genau das. Antidepressiva werden in Standarddosen an Männer wie Frauen verabreicht, obgleich es deutliche Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Geschlechter darauf unterschiedlich reagieren.[3] Auch Schmerzmittel werden ohne Blick auf das Geschlecht verschrieben, trotz übereinstimmender Belege, dass Frauen auf manche der Medikamente weniger gut ansprechen.[4] Frauen haben ein größeres Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben[5], obgleich sie ein geringeres Risiko haben, einen solchen zu erleiden – die Symptome sind bei den Geschlechtern unterschiedlich, und so werden sie von den betroffenen Frauen wie von den behandelnden Ärzten[6] oft nicht rechtzeitig erkannt. Narkosemittel[7], Alzheimermedikamente[8] und selbst die öffentliche Gesundheitsbildung[9] haben das große Manko, dass sie fälschlicherweise davon ausgehen, die Körper von Frauen seien vielleicht etwas molliger und weicher, aber abgesehen von ein paar entscheidenden Dingen untenherum würden sie sich nicht von Männerkörpern unterscheiden.[10]
Und natürlich berücksichtigen nahezu alle Studien, denen diese Einschätzung zugrunde liegt, ausschließlich Cis-Personen – in der Welt der Forschung gibt es kaum Aufmerksamkeit dafür, was in den Körpern von Menschen geschieht, denen bei Geburt das eine oder andere Geschlecht zugewiesen wird, die sich später aber anders identifizieren. Zum Teil liegt das an dem gewaltigen Unterschied zwischen dem biologischen Geschlecht – das tief mit unserer körperlichen Entwicklung verwoben ist, und zwar von den Zellorganellen bis hin zu den äußeren Körpermerkmalen, und sich über Milliarden Jahre der Evolution herausgebildet hat – und der fluiden, kognitiven Geschlechtsidentität, die höchstens einige Hunderttausend Jahre alt ist.*
Doch das ist nicht alles. Im Kern geht es darum, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem biologisch weiblichen Körper bis vor erschreckend kurzer Zeit weit hinter der Erforschung des männlichen Körpers zurückgeblieben ist. Dabei ist es nicht nur so, dass Ärzte und Wissenschaftler sich nicht die Mühe machen, nach geschlechtsspezifischen Daten zu suchen. Vielmehr gab es diese Daten bis vor Kurzem einfach nicht. Von den ab 1996 bis 2006 in der wissenschaftlichen Zeitschrift Pain veröffentlichten Tierstudien bezogen sich 79 Prozent ausschließlich auf männliche Versuchsobjekte.[11] Vor den 1990er-Jahren zeigten die Erhebungen sogar ein noch deutlicheres Ungleichgewicht. Und das ist keinesfalls die Ausnahme, denn Dutzende Zeitschriften berichten dasselbe. Der Grund für diesen blinden Fleck in Bezug auf den weiblichen Körper – ob wir nun von grundlegender Biologie oder von personalisierter Medizin sprechen – ist nicht allein Sexismus. Es handelt sich um ein intellektuelles Problem, das zu einem gesellschaftlichen Problem wurde: Lange Zeit haben wir den geschlechtlichen Körper und seine Erforschung vollkommen falsch aufgefasst.
In den Biowissenschaften gibt es immer noch so etwas wie die »männliche Norm«**. Von der Maus bis zum Menschen ist es der männliche Körper, der im Labor untersucht wird.[12] Wenn es nicht gerade um Eierstöcke, die Gebärmutter, Östrogene oder Brüste geht, kommen Mädchen und Frauen einfach nicht vor. Denken Sie einmal nach, wann Sie das letzte Mal von einer medizinischen Studie gehört haben, die neue Erkenntnisse zum Thema Fettleibigkeit, Schmerztoleranz, Gedächtnisleistung oder das Altern liefert: Es ist mehr als wahrscheinlich, dass diese Studie keine weiblichen Versuchsobjekte einbezogen hat. Und das gilt nicht nur für Mäuse, sondern auch für Hunde, Schweine, Affen und allzu oft auch für Menschen. Wird ein neues Medikament für klinische Studien, also die Testung am Menschen, freigegeben, wurde seine Wirkung davor womöglich überhaupt nicht an weiblichen Tieren erforscht. Wenn wir also sehen, wie Elizabeth Shaw den misogynen Sci-Fi-Medpod anschreit, sollten wir nicht nur Schrecken und Mitleid und Fassungslosigkeit empfinden. Wir können uns auch bestätigt fühlen.
Doch warum ist das bis heute so? Sollten Wissenschaft und Forschung nicht objektiv sein? Geschlechterneutral? Der empirischen Methode verpflichtet?
Als ich zum ersten Mal von der männlichen Norm erfuhr, fiel ich aus allen Wolken – nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich zu dieser Zeit als Doktorandin an der Columbia University arbeitete, wo ich mich mit der Entstehung von Narration und Kognition – einfach ausgedrückt: mit Gehirnen und Geschichten und ihrer 200 000 Jahre alten Vergangenheit – beschäftigte. Ich hatte an verschiedenen hochrangigen Instituten für Bildung und Wissenschaft gelehrt und geforscht. Daher nahm ich an, ich hätte einen ziemlich guten Überblick über die Situation von Frauen in der modernen Hochschulwelt. Ich hatte zwar ein paar grenzwertige Dinge beobachtet, persönlich aber hatte ich im Labor noch nie Sexismus erlebt. Die Vorstellung, dass sich ein Großteil der Biowissenschaften immer noch auf eine »männliche Norm« stützte, lag mir absolut fern. Ich bin Feministin, aber mein Feminismus war eher praktischer Natur: Allein, dass ich als Frau quantitative Forschung betrieb, genügte mir als revolutionärer Akt. Und ganz ehrlich, die Biologen, Neurowissenschaftler, Psychologen und Biophysiker, mit denen ich zu tun hatte – von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeitete, bis zu den Leuten, mit denen ich ausging –, gehören zu den weltoffensten, liberalsten, aufgeräumtesten und intelligentesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, dass diese gutherzigen Leute eine systemische Ungerechtigkeit am Leben hielten – noch dazu eine Ungerechtigkeit, die ihre eigene Wissenschaft und Forschung schädigt.
Aber es ist nicht allein ihre Schuld. Viele Forschende greifen aus rein praktischen Gründen auf männliche Versuchsobjekte zurück, denn die Auswirkungen der weiblichen Fruchtbarkeitszyklen sind insbesondere bei Säugetieren nur schwer zu kontrollieren. Der weibliche Körper wird in regelmäßigen Abständen von einem komplexen Hormongemisch überschwemmt, da erscheint der Einfluss der männlichen Sexualhormone nun mal stabiler. Ein gutes wissenschaftliches Experiment soll übersichtlich sein und so wenig Störfaktoren wie möglich aufweisen. Ein im Labor eines Nobelpreisträgers tätiger Postdoc sagte einmal zu mir, die Verwendung männlicher Probanden erleichtere es, »saubere Forschung« zu betreiben. Was heißen soll, dass man die Variablen leichter kontrollieren kann, wodurch die Daten mit weniger Aufwand interpretierbar sind und die Ergebnisse aussagekräftiger werden. Dies gilt insbesondere für die komplexen Systeme innerhalb der Verhaltensforschung, kann aber auch bei grundlegenden Dingen wie dem Stoffwechsel ein Problem darstellen. Die Einbeziehung des weiblichen Fortpflanzungszyklus gilt als kompliziert und teuer[13] – der Eierstock wird da zum »Störfaktor«. Wird also nicht ausdrücklich eine frauen- oder weibchenspezifische Frage erforscht, bleibt das weibliche Geschlecht außen vor. Denn dann laufen die Experimente schneller, die Arbeiten erscheinen früher, und es gibt mit größerer Wahrscheinlichkeit Fördergelder und eine Festanstellung.
Aber solche Entscheidungen zur »Vereinfachung« werden noch durch ein viel älteres Verständnis des geschlechtlichen Körpers veranlasst und verfestigt. Nun glauben zwar ernst zu nehmende Wissenschaftler nicht mehr, dass die Frau aus Adams Rippe entstanden ist, aber die Annahme, dass der geschlechtliche Körper allein über die Geschlechtsorgane definiert und das Frausein somit nur eine kleine Abwandlung einer platonischen Idee sei, erinnert doch ein bisschen an die alte Bibelgeschichte. Diese Geschichte ist eine Lüge. Wie wir zunehmend begriffen haben, sind weibliche Körper nicht einfach nur männliche Körper mit ein paar »Extras« wie Fett, Brüsten und Gebärmutter. Hoden und Eierstöcke sind keine austauschbaren Teile. Die Geschlechtlichkeit hat Einfluss auf alle wichtigen Merkmale unseres Säugetierkörpers und auf das Leben, das wir in ihm führen.[14] Das gilt für Mäuse wie für Menschen. Wenn Wissenschaftler ausschließlich die männliche Norm untersuchen, sehen wir nur knapp die Hälfte eines komplexen Bildes. Allzu oft wissen wir nicht einmal, was wir alles übersehen, wenn wir Geschlechtsunterschiede ignorieren, weil wir nicht nach ihnen fragen.
Nachdem ich also von der hartnäckigen Existenz der männlichen Norm überrascht wurde, tat ich, was Forscher gerne tun: Ich durchforstete Datensammlungen, um eine Vorstellung von der Tragweite des Problems zu bekommen. Und musste erkennen: Es ist tatsächlich ein riesiges Problem. Es ist so groß, dass viele Arbeiten nicht einmal erwähnen, dass nur männliche Versuchsobjekte herangezogen wurden. Oft musste ich die Autoren direkt anschreiben und nachfragen.
Na gut, vielleicht geht es nur um Mäuse, dachte ich. Vielleicht beschränkt sich die Problematik auf Tierversuche.
Leider ist das nicht der Fall. Gemäß in den 1970er-Jahren erlassenen Vorschriften wird für klinische Studien in den Vereinigten Staaten dringend davon abgeraten, weibliche Versuchspersonen im gebärfähigen Alter heranzuziehen. Studien an Schwangeren sind ein absolutes No-Go. Auf den ersten Blick mag das durchaus vernünftig erscheinen – niemand möchte werdendes Leben gefährden –, aber es bedeutet auch, dass wir weiter im Nebel stochern. Obgleich die National Institutes of Health (NIH) 1994 einige dieser Vorschriften aktualisieren konnten und die Berücksichtigung weiblicher Probanden einforderten, werden regelmäßig Schlupflöcher genutzt: Im Jahr 2000 bezog eine von fünf klinischen Arzneimittelstudien der NIH weiterhin keine weiblichen Versuchspersonen ein[15], während sich von den restlichen Studien fast zwei Drittel nicht die Mühe machten, ihre Daten mit Blick auf Geschlechtsunterschiede zu analysieren. Selbst wenn sich alle an die neuen Regeln gehalten hätten, wäre frühestens 2004 mit einem neu zugelassenen Medikament zu rechnen gewesen, das an einer signifikanten Anzahl von Frauen getestet wurde. Denn es dauert in der Regel mehr als zehn Jahre, bis ein Medikament die klinischen Studien durchlaufen hat und auf den Markt kommt.[16] Hersteller, deren Medikamente vor Inkrafttreten der neuen Vorschriften zugelassen wurden, sind in keiner Weise verpflichtet, ihre klinischen Studien zu wiederholen.***
Und so kommt es, dass ein Großteil der Probanden in klinischen Studien weiterhin Männer sind und die überwiegende Mehrheit der Tierstudien männliche Versuchsobjekte verwendet. Gleichzeitig werden Frauen mit höherer Wahrscheinlichkeit Schmerzmittel und psychoaktive Substanzen verschrieben[17] – Medikamente, die bei Weitem nicht ausreichend an weiblichen Organismen getestet wurden.
Da die Dosierung in der Regel nach Körpergewicht und Alter festgelegt wird, müssen Ärzte, wenn es keine spezifischen Empfehlungen für Frauen gibt, anhand von Erfahrungswerten**** herausfinden, ob eine Verschreibung für eine Patientin angepasst werden sollte.[18]
Besonders problematisch ist dies bei Schmerzmitteln. Jüngste Forschungsergebnisse haben zwar gezeigt, dass Frauen bei Schmerzmitteln höhere Dosen benötigen, um die gleiche Schmerzlinderung zu erfahren wie Männer, doch wird dieses Wissen derzeit nicht in die Dosierungsrichtlinien aufgenommen. Warum ist das so? Offizielle Leitlinien beruhen im Allgemeinen auf den Ergebnissen klinischer Medikamentenstudien. Viele heute erhältliche Schmerzmittel, etwa das Opioid OxyContin[19], das 1996 in den USA auf den Markt kam[20], wurden in solchen Studien nicht ausdrücklich auf geschlechtsspezifische Unterschiede geprüft, weil dies ganz einfach nicht vorgeschrieben war. In vielen Fällen waren die Verantwortlichen rechtlich sogar noch dazu angehalten, keine solche Überprüfung vorzunehmen, da die Studien vor der Änderung der NIH-Vorschriften durchgeführt wurden. OxyContin hat sich seitdem zu einem der am häufigsten missbräuchlich verwendeten Schmerzmittel der Welt entwickelt; es wird vor allem Frauen verschrieben, die an Endometriose und starken Unterleibsschmerzen leiden.[21] Schwangere Frauen, die von solchen Medikamenten abhängig sind, werden gewarnt, sie nicht zu abrupt abzusetzen, da die Stressreaktion auf den Entzug eine Fehlgeburt auslösen könnte. (Diese Frauen werden in der Regel auf Methadon gesetzt.[22]) Bei anderen beginnt die Sucht gar während der Schwangerschaft, unter anderem weil wohlmeinende Ärzte Schmerzmittel verschreiben, ohne zu ahnen, dass die Patientinnen schwanger sind (oder es bald sein werden). Eine 2012 veröffentlichte Studie zeigt, dass sich die Zahl der opiatabhängig geborenen Kinder in nur zehn Jahren verdreifacht hat[23] – was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Mütter eine Medikamentensucht nach Mitteln wie OxyContin entwickelt haben. Und die Zahlen steigen weiter.[24]
Laut einem aktuellen Bericht der American Academy of Pediatrics wussten viele Mütter nicht einmal, dass diese Medikamente ihren Neugeborenen schaden könnten.[25] Sie hatten Schmerzen, baten ihren Arzt um Hilfe, und dieser verschrieb ihnen ein Medikament. Aber im Gegensatz zu männlichen Patienten nahmen die Frauen das Medikament wahrscheinlich öfter und in höheren Dosen ein, weil sie nicht die erwartete Linderung verspürten oder die Linderung zu schnell nachließ: Das hat jetzt aber nur kurz geholfen … Was soll’s, am besten nehme ich mehr … Dieses Mal hat es nicht so gut gewirkt, ich nehme lieber etwas mehr … Die meisten klinischen Studien zeigen, dass Frauen verschiedenste Medikamente schneller verstoffwechseln als Männer.***** Diese Erkenntnis wird in medizinischen Richtlinien jedoch meist ignoriert. Und leider wird eine Abhängigkeit von Schmerzmitteln umso wahrscheinlicher, je höher und beständiger die Dosierung ist. Mit anderen Worten: Frauen, die OxyContin einnehmen, tun mit größerer Wahrscheinlichkeit genau das, was ihren Körper abhängig macht: Sie schlucken die Pillen, bis sich ihr Körper an den Einfluss der Substanz gewöhnt. Wären Medikamente wie OxyContin in klinischen Studienordnungsgemäß an Frauen getestet worden, dann hätten Ärzte bessere Richtlinien für den Umgang mit den Schmerzen ihrer Patientinnen, und weniger Neugeborene würden ihr Leben als Drogenabhängige beginnen.
Dabei ist zu beachten, dass es bei Medikamenten nicht nur um die Mittel geht, die wir in unserer Hausapotheke haben. Fragen wir uns doch einmal, ob es wirklich hinzunehmen ist, dass man erstmals 1999 eine Untersuchung zur geschlechtsspezifischen Wirkung von Narkosemitteln durchgeführt hat. Dabei hat sich gezeigt, dass Frauen früher aus der Narkose erwachen[26], und zwar unabhängig von Alter, Gewicht und Dosierung. (Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber die Vorstellung, mitten in einer OP aufzuwachen, gefällt mir nicht besonders.) Übrigens ging es bei besagter Studie anfänglich gar nicht darum, Geschlechtsunterschiede festzustellen. Die Forscher wollten lediglich einen neuen EEG-Monitor für die Vollnarkose testen. Für die Studie wurden Patienten rekrutiert, die bereits für eine Operation vorgesehen waren, außerdem waren vier verschiedene Universitätskliniken beteiligt, sodass es ungewöhnlich viele Probanden gab, zu denen Frauen wie Männer gehörten. Der EEG-Monitor erwies sich als nützlich, doch war dies am Ende weit weniger erstaunlich als die Ergebnisse, auf die man bei den teilnehmenden Patientinnen stieß. Offenbar kamen die Wissenschaftler erst dann darauf, ihre Daten mit Blick auf Geschlechtsunterschiede zu analysieren. Die Frage danach wurde also nicht von Anfang an formuliert. Erst im Nachhinein zeigte sich, dass man ihr hätte nachgehen sollen.
Es ist gefährlich, diese Frage nicht zu stellen. Ich habe wahrhaftig nichts gegen ein einfaches Studiendesign, aber welcher Mensch bei klarem Verstand würde so etwas als »saubere Forschung« bezeichnen?
Etwa zur gleichen Zeit, als ich erkannte, wie gravierend das Problem der männlichen Norm ist, entdeckte ich neue Forschungsergebnisse über den weiblichen Körper, denen nicht annähernd genug Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Wissenschaftler lesen eher keine Fachliteratur außerhalb ihrer eigenen Disziplin, aber in meinem Forschungsfeld musste ich mich regelmäßig in mindestens drei verschiedenen Bereichen (kognitive Psychologie, evolutionäre Kognitionstheorie und Computerlinguistik) auf dem Laufenden halten und mich zudem über neue literaturwissenschaftliche Themen informieren. Aber selbst für mich war es ziemlich ungewöhnlich, Fachzeitschriften für Anästhesie, Studien zum Stoffwechsel und Veröffentlichungen aus der Paläoanthropologie zu durchforsten. Angetrieben wurde ich durch die Frage nach den Frauen: Was gewinnen wir, wenn wir fragen, was anders ist am weiblichen Körper? Und was könnten wir sonst übersehen?
Warum zum Beispiel sind Frauen (um mal ganz offen zu sein) dicker als Männer? Als Amerikanerin des 21. Jahrhunderts habe ich übermäßig viel Zeit damit verbracht, über mein Körperfett nachzudenken, aber ich hatte nicht die leiseste Ahnung, dass mein Fettgewebe eigentlich ein Organ ist – geschweige denn, dass es sich aus demselben embryonalen Vorläufergewebe wie meine Leber und ein Großteil meines Immunsystems entwickelt hat.[27]
Nehmen wir ein Beispiel aus dem echten Leben: Im Jahr 2011 zitierte die New York Times in einem Artikel über Fettabsaugungen eine Studie, laut der Frauen, die sich an Hüften und Oberschenkeln Fett absaugen lassen, danach offenbar neues Fett ansetzen, aber an anderer Stelle:[28] Die Oberschenkel bleiben schlank, die Oberarme jedoch sind dicker als vorher. Der Artikel war nicht besonders gut recherchiert. Anders als die meisten plastischen Chirurgen, so würde ich mal vermuten, hatte ich kurz zuvor über neue Forschungen zur Evolution von Fettgewebe – insbesondere weiblichem – gelesen.
Das Körperfett von Frauen ist nämlich nicht das gleiche wie das von Männern. Auch die einzelnen Fettdepots an unserem Körper weisen kleine Unterschiede auf******, doch das Fett an Hüfte, Po und Oberschenkeln von Frauen, das sogenannte gluteofemorale Fett, steckt voller besonderer Lipide[29]: langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (die wir von Omega-3-Fettsäuren oder Fischöl kennen), kurz LCPUFA (long-chain polyunsaturated fatty acids). Unsere Leber kann diese Fette nicht ausreichend selbst herstellen, sodass wir sie größtenteils mit der Nahrung aufnehmen müssen.[30] Körper, die schwanger werden können, benötigen diese Lipide, damit sich das kindliche Gehirn und die kindliche Netzhaut bilden können.
Die meiste Zeit widersetzt sich das gluteofemorale Fett der Verstoffwechselung.[31] Wie viele Frauen wissen, sind Hüfte und Oberschenkel die ersten Stellen, an denen wir an Gewicht zunehmen, und die letzten, an denen wir abnehmen.******* Im letzten Schwangerschaftsdrittel aber – wenn der Fötus seine Gehirnentwicklung vorantreibt und seine Fettspeicher ausbildet – gibt der Körper der Mutter diese besonderen Lipide massenweise an das Baby ab. Dieses natürliche Absaugen der mütterlichen Fettreserven setzt sich während des Stillens fort, wobei ausgerechnet das erste Lebensjahr die wichtigste Zeit für die Entwicklung von Gehirn und Augen ist. Einige Evolutionsbiologen glauben daher, dass sich bei Frauen Hüftpolster entwickelt haben, weil diese darauf spezialisiert sind, die Bausteine für die großen Gehirne der Spezies Mensch zu liefern.[32] Da wir über die tägliche Ernährung nicht genug LCPUFA aufnehmen können, beginnen Frauen schon ab der Kindheit, sie zu speichern. Bei anderen Primaten ist dieses Muster offenbar nicht vorhanden.
Zusätzlich wurde erst vor ein paar Jahren herausgefunden – wiederum, weil jemand endlich die richtige Frage stellte –, dass das Hüftfett bei Mädchen ein besonders zuverlässiger Prädiktor für das Einsetzen der ersten Periode sein könnte.[33] Es zählt demnach nicht das Skelettwachstum, die Körpergröße oder die Ernährung, sondern der Anteil an gluteofemoralem Fett, das für die Fortpflanzung augenscheinlich sehr wichtig ist. Denn erst, wenn wir genug von diesem Fett gespeichert haben, werden unsere Eierstöcke aktiv. Und wenn wir zu viel Gewicht verlieren, bleibt unsere Periode aus. Man weiß inzwischen – auch dies aus einer neueren Forschungsarbeit –, dass die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln den Anteil an LCPUFA bei stillenden Frauen zwar erhöhen kann, der Großteil der an das Baby gelieferten Fette aber dennoch aus den mütterlichen Depots stammt, vornehmlich von denen am Gesäß.******** Der weibliche Körper bereitet sich schon früh auf eine Schwangerschaft vor – und das nicht etwa, weil Frauen zwangsweise Mütter werden, sondern weil eine menschliche Schwangerschaft unendlich strapaziös ist und unser Körper Wege entwickelt hat, sie zu überleben.
Jedes Jahr unterziehen sich allein in den Vereinigten Staaten fast 190 000 Frauen einer Fettabsaugung.[34] Wie seit 2013 in verschiedenen medizinischen Fachzeitschriften berichtet, bewirkt die gewaltsame Zerstörung des Gewebes[35] anscheinend, dass sich an der Operationsstelle kein neues Fett bildet.******** Das sich nach einer Liposuktion an den Oberarmen der Frauen ansammelnde Fett ist höchstwahrscheinlich anders geartet als das, was aus Oberschenkeln und Gesäß abgesaugt wurde. Und deshalb frage ich mich: Was passiert, wenn ein Körper schwanger wird, dessen LCPUFA-Speicher durcheinandergebracht wurden und daher womöglich nicht mehr leisten können, was sie vorher leisteten?
Ich sollte eigentlich nicht die erste Person sein, die diese Frage stellt. In den Jahrzehnten, seit denen wir das Körperfett von Frauen »kosmetisch« entfernen, als ginge es da um einen Haarschnitt, hätte längst jemand dieser Frage nachgehen und eine entsprechende Studie durchführen sollen. Doch das hat bisher niemand getan – obwohl ich versucht habe, etwas in dieser Richtung anzustoßen, nachdem ich den Artikel in der Times gelesen hatte.
Aber die Abteilung, in der ich damals Doktorandin war, hatte keine geeigneten Gefrierschränke für die Lagerung der Muttermilch, die ich analysieren wollte – Milch, die ich bei Frauen aus Manhattan sammeln wollte, welche sich einige Jahre zuvor einer Fettabsaugung unterzogen hatten und nun ihre Kinder stillten.******** Daher wandte ich mich an Wissenschaftler anderer Labore. Immerhin waren sich alle einig, dass jemand eine solche Untersuchung in Angriff nehmen sollte. Und irgendwann wird das auch jemand tun. Bis dahin lassen immer mehr Frauen eine Fettabsaugung vornehmen, und niemand hat die leiseste Ahnung, ob es eine Rolle spielt, welches evolutionäre Fettdepot diese Eingriffe zerstören. Wie in vielen Bereichen der modernen Medizin müssen die Patientinnen und ihre Ärzte letztlich auf das Beste hoffen.
Wird alles gut ausgehen? Vielleicht. Der mütterliche Körper ist erstaunlich widerstandsfähig: Er wird unendlich strapaziert und ist doch so entwickelt, dass er unendlich strapaziert werden kann und wundersamerweise am Leben bleibt. (Auch Muttermilch, so habe ich inzwischen gelernt, ist bemerkenswert anpassungsfähig. Das gilt für jede Säugetiermilch.) Das Kinderkriegen auf Menschenart ist eine gefährliche Angelegenheit. Aber das war es schon immer, also muss es eine gewisse Störungssicherheit geben.
Während ein Großteil der Wissenschaft den weiblichen Körper weiterhin erfolgreich ignoriert, braut sich in der Frauenforschung eine stille Revolution zusammen. In den vergangenen fünfzehn Jahren haben Forschende aller möglichen Fachbereiche spannende Entdeckungen dazu gemacht, was es bedeutet, eine Frau zu sein – ein weibliches Wesen mit all seinen evolutionär herausgebildeten Körpermerkmalen –, und wie dies unsere Auffassung von uns und der gesamten Spezies Mensch verändern könnte. Viele Wissenschaftler haben allerdings von dieser Revolution noch nichts mitbekommen. Und wenn sogar Wissenschaftler nichts davon wissen (weil sie keine fachfremde Literatur lesen und ihr Gebiet weiterhin von der männlichen Norm geprägt ist), wie soll dann überhaupt jemand in der Lage sein, das Bild zu komplettieren?
Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie merken, dass etwas getan werden muss, Sie sich jedoch nicht sicher sind, ob Sie die richtige Person dafür sind – es aber verdammt noch mal angepackt werden sollte? Genauso ging es mir in dem überfüllten Kinosaal, als ich zuschaute, wie Ridley Scott seinen Mutterkomplex mit einem sexistischen Medpod abarbeitete.******** Die Frau in der Reihe hinter mir spürte es. Ich spürte es. Und ich wette, jede andere Frau in diesem Raum spürte es auch. Es war wie ein Schwindelanfall. Das gleiche Gefühl hatte ich, als ich den Times-Artikel über Fettabsaugung las, in dem Frauen wegen ihrer Schwabbelarme verspottet wurden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass weder der Redakteur noch die Autoren der von ihm zitierten Forschungsarbeit noch die behandelten Frauen wussten, dass unser Fettgewebe, unsere Leber und unser Immunsystem aus derselben Organanlage hervorgegangen sind. Wahrscheinlich teilen die drei deshalb so viele Eigenschaften[36]: die Regenerationsfähigkeit des Gewebes, die hormonelle Signalübertragung und die starke Reaktion auf Veränderungen der nahen Umwelt. Dieser Ursprung ist der Grund dafür, dass man einem Patienten, der eine Leber benötigt, nicht gleich eine ganze Leber transplantieren muss: Es reicht ein kleiner Lappen, der Rest wächst an Ort und Stelle nach. Auch Fettgewebe regeneriert sich bekanntermaßen. Doch im Gegensatz zur Leber sind die einzelnen Fettdepots in unserem Körper offenbar für unterschiedliche Aufgaben vorgesehen, die jeweils eng mit dem Verdauungs-, dem Hormon- und dem Fortpflanzungssystem verknüpft sind. Aus diesem Grund betrachten Forscher das Fettgewebe inzwischen als Organsystem: Unter unserem Kinn sitzt also keine Speckfalte, sondern ein kleiner Teil unseres Fettorgans. Unser Unterhautfettgewebe erfüllt andere Aufgaben als die tiefen Fettdepots, die das Herz und andere lebenswichtige Organe umgeben. Und das Fett an der Hüfte einer Frau ist wahrscheinlich wichtiger für ihre möglichen Nachkommen als das Fett an ihren Oberarmen.
Wann genau diese Entwicklung begann, wissen wir nicht. Die meisten Säugetiere haben spezielle Fettdepots rund um die Eierstöcke und am Hinterteil. Es lässt sich jedoch grob schätzen, wann die Abstammungslinien unserer Vorfahren und die der Taufliegen (die immer noch das alte Vorläuferorgan, den »Fettkörper«, besitzen) verschiedene Wege nahmen: vor 600 Millionen Jahren. Denkt man zu lange über diese Zeitspanne nach, wird einem zwar auch schwindelig, aber zumindest ist dieses Staunen nützlich. Denn es liefert einen Grund dafür, warum es so schwierig ist, Körperfett »loszuwerden«. Wenn das Fettgewebe ein körperumfassendes Organ ist, dessen regenerative Eigenschaften 600 Millionen Jahre zurückreichen, löst die Entfernung von bestimmten Fettarealen vielleicht eine natürliche Selbstschutzreaktion aus, die es an anderer Stelle »nachwachsen« lässt. Und wie bei allem, das eine schrecklich lange Evolution durchlaufen hat, sind inzwischen mit aller Wahrscheinlichkeit noch weitere Merkmale hinzugekommen: spezialisierte, nicht nachwachsende Regionen etwa und damit Funktionen, die verloren gehen.
Körper sind im Grunde Zeiteinheiten. Was wir einen individuellen »Körper« nennen, ist eine Möglichkeit zur Eingrenzung von Ereignisketten, die selbst replizierenden Mustern folgen, bis irgendwann so viel schiefläuft, dass die uns zusammenhaltenden Kräfte nachlassen und Entropie einsetzt. Auch Arten sind in gewisser Weise Zeiteinheiten. Betrachtet man den Körper mit diesem Blick, so fällt auf, dass unser Verdauungssystem steinalt ist, unser Gehirn dagegen blutjung. Und unsere Harnblase ist eine Schwerstarbeiterin, die seit aberhundert Millionen Jahren im Grunde dieselbe Aufgabe erfüllt. Sie verhindert, dass die Abfallprodukte unseres in vielen Millionen Zellen ablaufenden Stoffwechsels uns vergiften. Unsere Blase kann nichts dafür, dass die Gebärmutter der Säugetiere inzwischen wie Quasimodo auf ihr hockt – dazu kam es erst vor etwa vierzig Millionen Jahren. Wobei sich das Problem der Schwerkraft erst vor vier Millionen Jahren hinzugesellte. Davor waren unsere Vorfahren schlau genug, nicht auf zwei Beinen zu gehen und damit sämtliche Organe im Rumpf zu stauchen (und die Wirbelsäule zu verbiegen).
Als ich an diesem Abend im Jahre 2012 aus dem Kino kam, wurde mir klar, dass wir so etwas benötigen wie eine Gebrauchsanweisung für das weibliche Säugetier. Einen geradlinigen, schonungslosen, sorgfältig recherchierten (aber lesbaren) Bericht darüber, was wir sind. Darüber, wie sich unsere Körper entwickelt haben, wie sie funktionieren und was es eigentlich bedeutet, eine biologische Frau zu sein. Einen Bericht, der das Interesse von Frauen und Wissenschaftlern gleichermaßen weckt. Der die männliche Norm zerschlägt und einer besseren Forschung zu ihrem Recht verhilft. Eine neue Geschichte der Weiblichkeit. Denn genau dieses Ziel verfolgen wir, wenn wir heute über Geschlechterunterschiede forschen. Wir arbeiten an einer neuen Geschichte. Einer besseren, wahreren Geschichte.
Das vorliegende Buch ist diese Geschichte.********Eva zeichnet die Evolution des weiblichen Körpers vom Scheitel bis zur Scheide nach und zeigt auf, wie diese Entwicklung unser heutiges Leben prägt. Indem ich diese Evolution nachverfolge und sie mit neueren Erkenntnissen verknüpfe, möchte ich aktuelle Antworten auf grundlegende Fragen geben, die Frauen zu ihren Körpern stellen. Es zeigt sich, dass diese grundlegenden Fragen spannende Forschungsarbeiten anregen: Warum menstruieren wir? Warum leben Frauen länger? Warum erkranken wir eher an Alzheimer? Warum schneiden Mädchen in allen wissenschaftlichen Fächern besser ab als Jungen – bis zur Pubertät, wenn die Leistungen plötzlich in den Keller rasseln? Gibt es wirklich so etwas wie das »weibliche Gehirn«? Und, jetzt mal ernsthaft: Warum müssen wir nachts unsere Laken nass schwitzen, wenn wir in die Wechseljahre kommen?
Zur Beantwortung dieser Fragen müssen wir zunächst eine simple Feststellung treffen: Wir sind diese Körper. Ob wir unter Schmerzen leiden oder Freude empfinden, ob wir mit Behinderungen leben oder nicht, ob wir krank oder gesund sind: Bis dass der Tod uns zersetzt, sind unsere Körper und die darin enthaltenen Gehirne ganz einfach das, was wir sind. Wir sind dieses Fleisch, diese Knochen, dieser kurze Zusammenschluss von Materie. Ob es darum geht, wie wir unsere Nägel wachsen lassen oder wie wir denken – alles, was wir als menschlich bezeichnen, ist grundlegend davon geprägt, wie sich unser Körper entwickelt hat. Und da wir eine Spezies mit biologischen Geschlechtern sind, gibt es entscheidende Dinge, über die es nachzudenken gilt, wenn wir unser Dasein als Homo sapiens beleuchten. Wir müssen den weiblichen Körper in die Betrachtung einbeziehen. Wenn wir das nicht tun, wird nicht nur der Feminismus infrage gestellt. Die moderne Medizin, die Neurobiologie, die Paläoanthropologie und auch die Evolutionsbiologie bleiben unvollständig, wenn wir die Tatsache ignorieren, dass die Hälfte von uns Brüste hat.
Wir müssen unbedingt über diese Brüste sprechen. Über Brüste, Blut und Fett, über Vaginen und Gebärmütter – das volle Programm. Wir müssen uns fragen, wie sie entstanden sind und wie wir heute mit ihnen leben, ganz gleich, wie merkwürdig oder auch lachhaft die Wahrheit sein mag. In diesem Buch möchte ich beschreiben, was wir bisher über die Evolution des weiblichen Körpers begriffen haben und wie diese Herkunft unser Leben prägt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt dafür: In Laboren und Kliniken auf der ganzen Welt entwickeln Wissenschaftler derzeit bessere Theorien, bessere Belege und bessere Fragen zur Evolution der Frau. In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Weiblichkeitsforschung revolutioniert. Endlich schreiben wir die Geschichte unseres Seins und unseres Entstehens Kapitel für Kapitel neu.
Nachdenken über 200 Millionen Jahre
Wie aber geht man vor, wenn man die Geschichte von jeder jetzt und jemals auf der Welt lebenden Frau schreiben möchte?
Solange man nichts dagegen hat, mit schwindelerregenden Zahlen zu jonglieren, ist die Sache recht einfach. Die Evolutionsgeschichte der Frauen lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Vor etwa 3,8 Milliarden Jahren gab es auf der dünnen Kruste unseres einsamen kleinen, um seinen gelben Stern kreisenden Planeten lediglich einzelne Mikroben. Vor ein bis zwei Milliarden Jahren tauchten die Eukaryoten auf – einzellige Organismen mit einem Zellkern (wie Amöben). Nach etlichen Verzweigungen in unserem Evolutionsbaum kam dann der Unterstamm der Wirbeltiere auf; früheste fossile Belege stammen aus der Zeit vor 500 Millionen Jahren. Wirbeltiere machen bis heute nur etwa ein Prozent aller lebenden Arten aus.******** Der für uns interessante Teil dessen, was wir als »Evolution« bezeichnen – ein Begriff, der in bestimmten Kreisen heftig umstritten ist und mancherorts gar aus Lehrbüchern verbannt werden soll –, hat also in einem relativ kleinen Teil der Zeit stattgefunden, in der es überhaupt Leben auf der Erde gab.
Wenn man in diesen immensen Zeitspannen denkt, wird einem schnell klar, warum der menschliche Körper ein so junges Phänomen ist. Denn das sind alle Körper. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir Daumen statt großen Zehen an den Füßen trugen. Die Erkenntnis, dass die Evolution des Frauenkörpers beeinflusst, wie wir unser heutiges Leben wahrnehmen, ist keinesfalls weit hergeholt, sondern liegt auf der Hand. Jedes unserer Körpermerkmale hat seine eigene Evolutionsgeschichte, und wir stecken noch mittendrin in der Entwicklung. Die Evolution schreitet voran, indem sie einfache Upgrades für bestehende Systeme vorschlägt. Sobald sich ein Körpermerkmal ausgebildet hat, interagiert der veränderte Körper mit seiner Umgebung, und diese Interaktion beeinflusst wiederum die Entstehung weiterer Merkmale. Diese führen zu weiteren Veränderungen, die oft einen Bogen zurückschlagen und das erste Merkmal verändern: Milch bringt Brustwarzen hervor, und die Fürsorgegewohnheiten der stillenden Mutter befördern die Entwicklung der Gebärmutter mit Plazenta. Die Plazenta hat wiederum Einfluss auf unseren Stoffwechsel und die Bedürfnisse unseres Nachwuchses, sodass sich auch die Muttermilch verändert. Im gleichen Zug wird der Geburtskanal zum Überträger von Bakterien, die dem Neugeborenen helfen, die zuckerhaltige Milch zu verdauen. So wird das Kind auf dem Weg nach draußen mit nützlichen Bakterien überzogen, die sich zusammen mit unserer Muttermilch entwickelt haben.
Die Evolution ist vergleichbar mit P. T. Andersons Film Magnolia, mit Paul Haggis’ L.A.Crash oder IñárritusBabel. Man kann ihr nur folgen, wenn man bereit ist, mehr als einer Hauptfigur Aufmerksamkeit zu schenken. Sie ist eine komplizierte Erzählung mit vielen Launen und Zufällen und zunächst unwichtig erscheinenden Dingen, die sich später aber als lebenswichtig herausstellen. Sie ist kein Bildungsroman. Aber im Gegensatz zu dem, was in anderen, grob vereinfachenden Geschichten über unsere Ursprünge geschrieben steht, ist sie eine Tatsache. Indem wir die Herkunft unserer einzelnen Merkmale enträtseln, können wir uns ein genaueres Bild davon machen, was Frauen sind: eine Hälfte einer sehr jungen, komplexen und faszinierenden Spezies.
Das eigentliche Problem an Schöpfungsgeschichten wie dem Buch Genesis lautet: Unsere Körper sind nicht aus einem Guss. Wir haben nicht alle die eine Mutter. Tatsächlich hat jedes System in unserem Körper ein anderes Alter – und das nicht nur, weil sich verschiedene Zelltypen in einem jeweils anderen Rhythmus erneuern (beispielsweise sind unsere Hautzellen viel jünger als die meisten unserer Gehirnzellen), sondern auch, weil sich die Dinge, die wir als charakteristisch für unsere Spezies ansehen, zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten entwickelt haben. Wir haben nicht nur eine Mutter, wir haben viele Mütter. Und jede Eva hat ihren eigenen Garten Eden: Unsere heutigen Brüste haben wir, weil sich Säugetiere dahin entwickelt haben, Milch zu geben. Und unsere Gebärmütter haben wir, weil wir uns dahin entwickelt haben, unsere Eier innerhalb des Körpers »auszubrüten«. Unsere Gesichter und den dazugehörigen Sinnesapparat haben wir, weil sich Primaten auf das Leben in Bäumen spezialisiert haben. Der aufrechte Gang, der Gebrauch von Werkzeug, unser fettreiches Gehirn und unser so viele Worte hervorbringender Mund, unsere menopausierenden Großmütter – all diese uns als »menschlich« kennzeichnenden Eigenschaften sind zu verschiedenen Zeitpunkten in unserer evolutionären Vergangenheit entstanden. Es gibt in Wahrheit Milliarden Gärten Eden, aber nur eine Handvoll Orte und Zeiten, die unsere Körper zu dem werden ließen, was sie heute sind. An diesen Orten haben wir oftmals eine neue Spezies ausgebildet, indem sich unsere Körper in eine Richtung entwickelten, die uns am Ende zu sehr von anderen unterschied und damit ausschloss, dass wir uns mit ihnen fortpflanzten. Wenn wir die Körper von Frauen begreifen wollen, müssen wir uns diesen Evas und diesen Eden widmen.
So wird jedes Kapitel in diesem Buch eines unserer bestimmenden Merkmale bis zu seinen Ursprüngen zurückverfolgen – bis hin zu seiner Eva oder auch seinen Evas und deren Gärten Eden, die von den feuchten Sümpfen der späten Trias bis zu den grasbewachsenen Hügeln des Pleistozäns reichen. Daneben betrachte ich die laufende Forschungs-diskussion dazu, wie die Entstehung dieser Merkmale das heutige Leben von Frauen prägt, und berücksichtige für jeden Strang der Geschichte den zugehörigen Stand der Wissenschaft.
Obwohl ich mich, wenn ich all das erfassen möchte, in der Zeit vor und zurück bewegen muss, werden die Merkmale in etwa in der Reihenfolge abgehandelt, in der sie in unserer Abstammungslinie auftauchen. So wie unser Körper neue Modelle von sich selbst aus älteren Formen entwickelt, so baut jedes Kapitel auf dem vorigen auf, und wir bewegen uns folgerichtig in der Zeit weiter. Ohne die Milchfelder im Pelz unserer Milch-Eva hätten wir wohl nie Stillbrüste entwickelt. Ohne die Verwendung von gynäkologischen Instrumenten hätten wir vielleicht nie Gesellschaften entwickelt, die eine Kindheit unterstützen können, aus der unsere massiven menschlichen Gehirne hervorgehen. Ohne große, komplexe soziale Gruppen, in der ältere Menschen (unter anderem mithilfe der Gynäkologie) versorgt werden können, hätten wir uns vielleicht nie dahin entwickelt, in die Menopause zu kommen. Jeder evolutionäre Zufall baut auf einem früheren Zufall auf; jedes neue Merkmal braucht Umstände, unter denen sein Nutzen schwerer wiegt als seine Nachteile.
Nachdem ich diesen Aufbau meiner »Gebrauchsanweisung« konzipiert hatte, war es relativ einfach, die einzelnen Merkmale für die Kapitel auszuwählen. Dazu habe ich mir unsere Taxonomie vorgenommen: Das in der Biologie verwendete Ordnungsprinzip setzt uns anhand der mit anderen Arten geteilten Merkmale in Beziehung zum übrigen Leben auf dem Planeten. Frauen gehören, wie alle Menschen, zur Spezies Homo sapiens. Weil wir Säugetiere sind, produzieren wir Milch. Weil wir Plazentatiere sind, haben wir einen Uterus, der lebende Junge hervorbringt. Weil wir Primaten sind, haben wir große, Farben unterscheidende Augen und Ohren, die ein breites Klangspektrum registrieren. Weil wir zum Tribus der Hominini gehören, haben wir zwei Beine und inzwischen riesige Gehirne. Und so weiter und so fort, den Evolutionsbaum hinaufkletternd. Bei jedem neu auftauchenden Merkmal frage ich, ob es eine spezielle Bedeutung für Frauen hat: Beeinflusst uns dieses Merkmal vielleicht besonders? Gibt es neue Forschungsergebnisse, die unsere Annahmen über dieses Merkmal – und damit über die gesamte Menschheit – anfechten könnten?
Für gewöhnlich untersuchen Evolutionsbiologen die Funktionsweise eines bestimmten Merkmals, indem sie sich den letzten gemeinsamen Vorfahren mit anderen Arten anschauen, die dasselbe Merkmal aufweisen. Auch ich habe für jedes Merkmal eine solche Eva gefunden – oder mich bemüht, sie zu finden. Für den aufrechten Gang etwa die erst 2009 bekannt gewordene Ardi aus der Gattung Ardipithecus und für die Milchproduktion ein seltsames kleines Wieseltier, das zu Füßen der Dinosaurier lebte!******** Auf der Suche nach einer Eva stieß ich oft auf überraschende neue Forschungsergebnisse aus der Paläontologie und Mikrobiologie, die noch mehr Annahmen über den weiblichen Körper infrage stellten.
Bei all dem möchte ich Sie – ob Sie sich nun als männlich, weiblich oder divers identifizieren – dazu ermuntern, über sich selbst nachzudenken: Gehen Sie mit mir der Frage nach, woher Ihr Körper stammt, wie die Evolution des biologischen Geschlechts ihn formt und wie diese Vergangenheit in den Alltag der Menschen eingebettet ist. In ihrem Essay zu Annie Leibovitz’ Buch Women schrieb Susan Sontag: »Jede umfassendere bildliche Darstellung von Frauen fügt sich in die fortdauernde Geschichte dessen, wie Frauen präsentiert werden und welche Selbstauffassung ihnen nahegelegt wird. Ein Buch mit Fotos von Frauen muss, ob es will oder nicht, die Frauenfrage aufwerfen – eine entsprechende ›Männerfrage‹ gibt es nicht. Anders als Frauen sind Männer kein ›work in progress‹.«[37] Aus wissenschaftlicher Sicht hat Sontag unrecht: Die Evolution kennt kein Innehalten. Alle Arten entwickeln sich weiter. Aber in dem Sinne, wie sie es gemeint hat – dass der Blick auf die Frau die »Frauenfrage« aufwirft –, hat sie absolut recht.
Welchen Grund gäbe es, über die Evolution der Frau zu sprechen, wenn das Thema nicht vernachlässigt worden wäre? Warum sollten wir unser Augenmerk auf die weibliche Anatomie richten, wenn dieser Fokus nicht immer noch erstaunlich ungewöhnlich wäre? Es gibt keine umfassendere »Darstellung« der Frau als die Aufforderung an die Leser, an alle Frauen zu denken, die es jemals auf unserem Planeten gab. Genau das ist meine Absicht. Ich rufe uns dazu auf, weibliche Körper anzuschauen und gründlich darüber nachzudenken, wie diese das Menschsein prägen.
Unsere Evas[38]
»Morgie« – Morganucodon. Lebte vor 205 Millionen Jahren. Ursprünglich in Wales entdeckt, wurde diese Eva der Muttermilch inzwischen auch in China gefunden – eine weitverbreitete, äußerst erfolgreiche Kreatur, so etwas wie eine Kreuzung aus Wiesel und Maus. Man geht davon aus, dass Morgie keine direkte Vorfahrin von uns ist, sondern als »exemplarische« Gattung zu sehen ist. Unsere wahre säugende Eva war ihr wahrscheinlich sehr ähnlich.
»Donna« – Protungulatum donnae. Lebte vor 67 bis 63 Millionen Jahren. Die Eva der Plazentatiere (keine Beuteltiere, keine Kloakentiere, sondern Säugetiere mit einer Gebärmutter, wie sie der Mensch hat). Aufgetaucht ist sie wahrscheinlich im Umfeld der Asteroiden-Apokalypse, die alle Nichtvogelsaurier auslöschte, wobei ihre Linie bis in die Kreidezeit zurückreichen könnte. Diese hochspezifische, als Art benannte Eva ähnelte im Grunde einem Wiesel-Eichhörnchen und wurde durch umfangreiche vergleichende Fossilien- und Genanalysen rekonstruiert.
»Purgi« – Purgatorius. Lebte vor 66 bis 63 Millionen Jahren, ist eine Vorfahrin der Primaten und damit unseres durch das Baumleben der Primaten geprägten Sensoriums. Sie ist die Eva unseres Sinnesapparats und der Grund, warum wir Frauen die Welt so wahrnehmen, wie wir es tun. Ihre Fossilien wurden in der Hell Creek-Formation in der Ödnis nordöstlich von Montana gefunden. Purgi, gewissermaßen ein Affen-Wiesel-Eichhörnchen, ist so nah an Donna, dass man sie eigentlich als deren Zeitgenossin betrachten kann.
»Ardi« – Ardipithecus ramidus. Lebte vor 4,4 Millionen Jahren. Älteste bekannte Art der aufrecht gehenden (bipeden) Hominini. Ihr erst kürzlich entdecktes Fossil ist gut erhalten. Im Vergleich zu den an Eichhörnchen erinnernden Evas vor ihr hat Ardi sowohl zeitlich als auch evolutionär einen großen Sprung gemacht.
»Habilis« – Homo habilis. Lebte vor 2,8 bis 1,5 Millionen Jahren. Die Eva des einfachen Werkzeuggebrauchs und der damit verbundenen intelligenten sozialen Interaktion. Die geschickte Werkzeugnutzerin lebte eine halbe Million Jahre lang neben Homo erectus in Afrika. Ihre Fossilien wurden in der Olduvai-Schlucht in Tansania gefunden.
»Erectus« – Homo erectus. Lebte vor 1,89 Millionen bis 110 000 Jahren. Die über ein großes Gehirn verfügende Nutzerin von ausgefeilterem Werkzeug begab sich zudem auf Wanderung. Sie ist die Eva der komplexen Werkzeuge und der komplexen intelligenten Interaktion. Bei ihr finden wir einen der Ursprünge unseres modernen menschlichen Gehirns (und zu einem Teil wohl auch die Kindheit, die es formt).
»Sapiens« – Homo sapiens. Lebt seit 300 000 Jahren bis heute******** und ist die Eva der menschlichen Sprache, der menschlichen Menopause, der modernen Liebe und des Sexismus.
Weitere Mitspielerinnen
»Lucy« – Australopithecus afarensis. Lebte vor 3,85 bis 2,95 Millionen Jahren. Viele Australopithecinen werden mit Werkzeugen in Verbindung gebracht, und man geht davon aus, dass die meisten, wenn nicht alle, frühe Werkzeugnutzer waren. Wenn man bedenkt, dass auch heutige Schimpansen Werkzeuge einsetzen, wäre es doch seltsam, wenn man Vorfahrinnen wie Lucy diese Fähigkeit absprechen würde. Australopithecus gehört sowohl zu den bekanntesten (bisher wurden mehr als dreihundert einzelne Fossilien gefunden) als auch zu den am längsten auf der Erde lebenden Hominini. Ihr Körperbau und ihre Lebensweise haben also über lange Zeit gut funktioniert. Die in Äthiopien und Tansania gefundene Eva lebte in Bäumen und auf dem Boden und war vollständig an den aufrechten Gang angepasst.
»Africanus« – Australopithecus africanus. Lebte vor 3,3 bis 2,1 Millionen Jahren. Ihre Fossilien wurden im südlichen Afrika entdeckt, und es ist nicht geklärt, ob Africanus ein Nachkomme von Lucys Art ist. Sie hatte ein größeres Gehirn und kleinere Zähne als Lucy, war ansonsten aber noch ziemlich affenähnlich, wenn auch aufrecht gehend.
»Heidelbergensis« – Homo heidelbergensis. Lebte vor 790 000 bis 200 000, möglicherweise sogar 1,3 Millionen Jahren. Aus der Heidelberger Eva gingen laut genetischer Forschung vor geschätzt 350 000 bis 400 000 Jahren der Neandertaler, der Denisova-Mensch und der moderne Homo sapiens hervor (bzw. gibt es zumindest eine gemeinsame Vorfahrin). Der europäische Zweig führte zum Neandertaler, der afrikanische Zweig (Homo rhodesiensis) zum modernen Homo sapiens. Der Homo heidelbergensis hielt sich jedoch parallel und starb erst aus, kurz bevor der Homo sapiens offiziell in Erscheinung trat. Wir haben hier die erste Spezies, die einfache Behausungen aus Holz und Stein baute, das Feuer beherrschte und Großwild mit Holzspeeren jagte (statt Kadaver zu suchen). Sie lebte in kälteren Gegenden, denen sie sich offenbar anpassen konnte. Wie der Name schon sagt, wurden ihre Fossilien zuerst in Deutschland und später auch in Israel und Frankreich gefunden.
»Neandertaler« – Homo neanderthalenis. Lebte vor 400 000 bis 40 000 Jahren. Der sich in Europa ausbreitende Neandertaler hat mit dem modernen Homo sapiens koexistiert und sich mit ihm fortgepflanzt.******** Anthropologen haben zahlreiche Fossilien und Siedlungen der Neandertaler gefunden. Frühere Annahmen über die Spezies wurden inzwischen widerlegt: Es ist bekannt, dass sie eine komplexe Kultur hatte, zu der Bestattungen, Kleidung, Feuer, Werkzeug- und Schmuckherstellung gehörten, und man nimmt an, dass sie womöglich sogar über eine Sprache verfügte. Ihr Hirnschädel war anders geformt, aber nicht kleiner als der von Homo sapiens – manchmal war er sogar größer (was mit ihrem größeren, robusten Körper zusammenhängen könnte). Neandertaler sind offenbar schneller erwachsen geworden als wir; die Kindheit von Neandertalern war bedeutend kürzer.
»Denisova-Mensch« – vermutlich Homo denisova oder Homo sapiens denisova, obwohl noch nicht formal beschrieben. Lebte vor 500 000 bis 15 000 Jahren. Diese Eva ist nur durch drei Zähne, einen Fingerknochen und einen Unterkiefer bekannt, die in einer Höhle in Sibirien gefunden wurden, sowie durch vergleichende DNA-Sequenzierung. Gesichert ist, dass die Denisova-Menschen vor mindestens 120 000 Jahren lebten, wobei Sedimentanalysen und DNA-Forschung auf eine längere Zeitspanne schließen lassen. Die vermutlich kleine Denisova-Population lebte in Sibirien und Ostasien, unter anderem in den Höhenlagen des heutigen Tibet – möglicherweise hat sie ein Gen weitergegeben, das auch die heutigen Bewohner zum Leben in großen Höhen befähigt. DNA-Untersuchungen haben ergeben, dass viele moderne Menschen – insbesondere Melanesier und australische Ureinwohner – bis zu fünf Prozent ihrer DNA mit dem Denisova-Menschen teilen, was darauf hindeutet, dass sie sich, wie schon die Neandertaler, mit Frühmenschen vermischt haben. Daher sind auch die Grenzen zwischen diesen späteren Hominini-Gattungen recht unscharf.
*Ich weiß, dass manchen Menschen diese Vorstellung immer noch fremd ist, aber innerhalb der Wissenschaft herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass das biologische Geschlecht grundsätzlich von der Geschlechtsidentität zu trennen ist. Die Annahme, dass die Geschlechtsmerkmale seines Körpers einem Menschen unweigerlich eine von zwei Geschlechtsidentitäten samt geschlechtstypischem Verhalten zuweisen, wird manchmal als Biologismus oder auch als »Gender Essentialism« (Witt, 1995) bezeichnet. Dabei handelt es sich im Grunde um eine Ausweitung des Sexismus: Gesellschaften, die feste kulturelle Überzeugungen dazu ausgebildet haben, wie das eine oder andere Geschlecht »zu sein hat«, glauben zudem, dass eine Person ab der Geburt – abhängig von ihren Körpermerkmalen – einem von zwei Geschlechtern zugehörig ist. Die Gesellschaften verfestigen sodann diese Überzeugungen durch bestimmte, an das jeweilige Geschlecht gebundene Regeln. Die damit verbundenen Sanktionen reichen von einer subtilen, kognitiv verankerten gesellschaftlichen Ausgrenzung bis hin zur gewaltsamen Bestrafung von »Regelbrüchen«.
**In der Fachliteratur spricht man auch vom »male bias«, also einer Verzerrung durch Männerzentriertheit.
***Ähnliche Probleme mit gesetzlichen Richtlinien bestehen in vielen Industrienationen, etwa in Kanada, dem Vereinigten Königreich und Frankreich. Die gute Absicht, Schwangere und deren potenzielle Kinder zu schützen, hat dazu geführt, dass das weibliche Geschlecht lange Zeit aus medizinischen Studien herausgefallen ist. Neuere, in mehreren Ländern getroffene Vorgaben haben den Anteil weiblicher Versuchspersonen zwar steigen lassen – beispielsweise müssen sich vom NIH finanzierte US-amerikanische Studien inzwischen rechtfertigen, wenn sie keine Frauen in ihre klinischen Tests einbeziehen –, doch bietet das System noch genug elefantengroße Schlupflöcher (Geller et al., 2018; Rechlin et al., 2023). Einige Fachzeitschriften, darunter Endocrinology, haben sich der Sache angenommen und verlangen, dass im Methodenteil von Studien das Geschlecht der Versuchstiere aufgeführt wird (Blaustein, 2012), ein Großteil der renommierten Peer-Review-Zeitschriften aber hat keinerlei Regeln in dieser Richtung aufgestellt.
****Manchmal ziehen die Regulierungsbehörden nach, aber das dauert eine Weile. So gab die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA 2013 endlich Leitlinien heraus, in denen sie Ärzte anweist, niedrigere (im Wesentlichen halbe) Dosen des Schlafmittels Zolpidem zu verschreiben, weil der Wirkstoff bei Frauen länger im Blutkreislauf verbleibt als bei Männern (FDA, 2013). Zu diesem Zeitpunkt war Zolpidem bereits seit einundzwanzig Jahren zugelassen. In der ursprünglichen Empfehlung hieß es, die Dosierung solle »individuell angepasst« werden, es wurde aber keine Angabe zu geschlechtsspezifischen Unterschieden bei der Dosierung gemacht, sondern lediglich erklärt: »Die empfohlene Dosis für Erwachsene beträgt 10 mg unmittelbar vor dem Schlafengehen.« (FDA, 1992) Dabei sollten »ältere, geschwächte Patienten und Patienten mit Leberinsuffizienz« eine Anfangsdosis von 5 mg erhalten (ebd.). Vielleicht sollte man Frauen also grundsätzlich ein Leberleiden andichten?
*****Hier wird der Tatsache, dass der Körper von Frauen tendenziell kleiner ist, viel Aufmerksamkeit geschenkt, doch könnte der Grund für den schnelleren Abbau tatsächlich viel mit der weiblichen Leber zu tun haben. Eine 2011 durchgeführte Studie, in der Biopsien von männlichem und weiblichem Lebergewebe verglichen wurden, förderte 1300 Gene zutage, deren mRNA-Expression (die Rückschlüsse auf die Verstoffwechselung von Wirkstoffen erlaubt) signifikant vom Geschlecht beeinflusst wird; von diesen zeigten 75 Prozent eine stärkere Expression bei Frauen (Renaud et al., 2011). Es geht also nicht nur darum, wie viel Wirkstoff auf wie viel Körpermasse verteilt wird, sondern welches Verhalten die Zellen in einer geschlechtstypischen Leber an den Tag legen. Tatsächlich spielt hier der »Tag« eine Rolle: Wie der gesamte Körper hat auch die Leber einen zirkadianen Rhythmus, und weibliche Säugetiere reagieren evolutionär bedingt besonders sensibel auf Sonneneinwirkung (Lu et al., 2013). Mehr über die Bedeutung von Tageslicht in Kapitel 3.
******Beispielsweise verhalten sich die Fettansammlungen rund um unser Herz anders als die unter dem Kinn, und auch ihre Struktur unterscheidet sich ein wenig.
*******Damit sind sie auch beliebte Stellen für eine Liposuktion. Bauchfettabsaugungen folgen knapp dahinter. Der sogenannte Brazilian Butt Lift verbindet beides, indem das am Bauch abgesaugte Fett in den Po gespritzt wird. Eine gefährliche OP, da sich am weiblichen Gesäß sehr viele Blutgefäße befinden und man gerade dort keine Massenansammlung von Lipiden haben möchte, denn es kann zu einer Fettembolie kommen, bei der Fetttröpfchen in die Blutbahn gelangen und dann in einem lebenswichtigen Organ wie Herz, Lunge oder Gehirn einen Verschluss hervorrufen.
********Entdeckt wurde dies, indem man stillenden Frauen ein speziell markiertes Nahrungsergänzungsmittel verabreichte, das über Isotope verfolgt werden konnte. Anhand von Muttermilchproben konnten die Forscher feststellen, welche der Fettsäuren in der Milch aus den Nahrungsergänzungsmitteln stammten und welche aus anderer Quelle kommen mussten. In weiteren Studien wurde festgestellt, dass Schwankungen in der Ernährung von Schwangeren einige, aber nicht alle LCPUFA im Blutkreislauf der Mutter und im Nabelschnurblut des Neugeborenen verändern können (Letzteres dient oftmals als Anhaltspunkt dafür, welche Stoffe in der Spätschwangerschaft über die Plazenta von der Mutter zum Kind gewandert sind). Außerdem scheint es eine Rolle zu spielen, welche Art von Fettsäuren eingenommen wird (Brenna et al., 2009).
********Vielleicht liegt dies am Verfahren: Bei der gängigsten Form der Fettabsaugung wird das betreffende Areal mit einer Lösung gespült, die das Fettgewebe lockert, und dann wiederholt mit einer Kanüle durchstochen, welche die eingebrachte Flüssigkeit samt Fettzellen und Stütz-gewebe absaugt. Es sei an dieser Stelle gesagt, dass die meisten Behandelten mit dem Ergebnis zufrieden sind. In einer Fachklinik ist eine Liposuktion grundsätzlich ein sicherer Eingriff. Hier geht es nicht darum, Fettabsaugungen zu verteufeln, sondern um die Frage, ob wir subkutanes Fettgewebe als grundsätzlich überflüssig und seine operative Entfernung, insbesondere bei Frauen im gebärfähigen Alter, als nebenwirkungslos betrachten sollten. Auf einer tieferen Ebene geht es darum, ob unser Nachdenken über den weiblichen Körper und über das, was ihm »schaden« könnte, die lange Geschichte der Säugetierevolution berücksichtigt – denn das, was wir sind, besteht aus dem, woher wir kommen.
********Zum Umgang mit menschlichen Zellen gibt es in der Forschung strenge Regeln. Dazu kam, dass das kleine Kühlfach in meiner Wohnung an der Upper West Side keine konstante Temperatur hielt. (Außerdem waren da noch meine Mitbewohner.)
********Ich betone: Ich bin ein großer Fan von Scotts Filmwerken.
********Zumindest in dem Maße, wie ich dazu in der Lage war – von einem kleinen Schreibtisch aus, mit Zugang zu einer riesigen Bibliothek und der Unterstützung von geduldigen Forschern und Wissenschaftlern, die dankenswerterweise bereit waren, mir zu erklären, was ich nicht auf Anhieb begriff.
********Zweiundzwanzig Prozent der auf der Erde lebenden Arten sind Käfer. Ohne Witz. In der Geschichte des irdischen Lebens schlagen sich Käfer richtig gut.
********Da die tiefe, dunkle Erde ihre Geheimnisse gerne gut verbirgt, gibt es nicht für jedes Merkmal eine bekannte oder augenfällige Eva: Entweder haben wir die Fossilien noch nicht entdeckt, das Merkmal eignet sich nicht für den Fossilnachweis, oder wir haben noch nicht herausgefunden, wie wir bereits vorhandene Fossilien deuten sollen. Aber in jedem Fall suche ich, wenn ich keinen Namen für ein Tier habe, das sich direkt in die Reihe fügt, nach einer exemplarischen Art oder Gattung: ein Lebewesen, über dessen Körper, Zeit und Umwelt wir einiges wissen und dessen Geschichte uns etwas darüber sagen kann, wer unsere tatsächlichen Evas gewesen sein könnten.
********Der genaue Beginn unserer Spezies ist nach wie vor höchst umstritten. Kaum jemand glaubt, dass die frühesten Hominini eine richtige menschliche Sprache, eine moderne Menopause oder auf das biologische und soziale Geschlecht bezogene gesellschaftliche Regeln kannten. Die meisten gehen davon aus, dass diese Merkmale nicht vor unserer Spezies aufgetreten sind. Wie so oft in der Welt der Paläoanthropologie wäre es unwahrscheinlich hilfreich, wenn wir über mehr Fossilien aus der Vergangenheit der Menschheit verfügten.
********Ich für meinen Teil habe massenhaft Neandertaler-Gene, so wie die meisten neuzeitlichen Europäer.
1 Milch
Sobald die Erinnerung an die Sintflut sich beruhigt hatte, blieb ein Hase im Klee und in den schwankenden Glockenblumen sitzen und sagte dem Regenbogen sein Gebet, durch das Netz der Spinne hindurch. (…) Das Blut floss, beim Blaubart, – im Schlachthof, in den Zirkussen, wo das Siegel Gottes die Fenster erbleichen ließ. Das Blut und die Milch flossen.[1]
Arthur Rimbaud, »Nach der Sintflut«
Got Milk?[2]
Werbekampagne für das California Milk Processor Board, 1993
Als der Abend hereinbrach, lag sie lauernd im weichen, feuchten Gras: ein von Regentropfen gekräuseltes, daumengroßes[3] Fellbündel.
Nennen wir sie Morgie.[4] Kleine Jägerin. Eine der ersten Evas.
Sie wartete am Eingang ihres Baus, weil der Himmel noch immer von hellen Streifen durchzogen war – von den Wolken gebrochene Photonenstrahlen vor einem langsam dunkler werdenden Blau. Sie wartete, weil es ihr ihre Zellen befahlen, all die kleinen Rädchen in ihrem Uhrwerk, ihre Augen, ihre zuckenden Tasthaare, ihre Pfoten auf dem noch warmen Boden.[5] Sie wartete, weil es Ungeheuer gab in dieser Welt, und diese Ungeheuer wiederum warteten auf sie.
Erst als es richtige, pechschwarze Nacht war, huschte Morgie nach draußen und begann mit der Suche nach Beute: Insekten, von denen manche fast so groß waren wie sie selbst. Sie hörte die Tierchen, bevor sie sie sah.[6] Das Sirren ihrer Flügel, das leise Scharren ihrer Füße. Blitzschnell fasste ihre schmale Schnauze zu. Sie genoss es, wenn der Chitinkörper knackte[7] und ihr das flüssige Innere übers Kinn rann. Sie leckte es ab und jagte weiter. Innehalten war gefährlich. Überall lauerten Mäuler, Klauen und Zähne. Was wie ein Baum aussah, konnte ein Bein sein, und dieser Luftzug im Farn war vielleicht ein heißer Atem. Also rannte sie, schnappte zu, hastete weiter, versteckte sich, kämpfte sich weiter durch die schwere feuchte Luft. Sie flitzte über die Füße von Dinosauriern wie ein Grashüpfer über einen Elefantenzeh. Das tiefe Grunzen nahm sie weniger als Geräusch denn als Erdbeben wahr.
So also sah das nächtliche Dasein von Morganucodon aus – dem kleinen Wesen, das unter Riesen lebte.
Wenn sie müde war, kehrte sie in ihren Unterschlupf zurück und floh vor der grauen Morgendämmerung. Wie eine Eidechse kroch sie durch ihren Tunnelbau[8], der Bauch schleifte über den Boden, die Pfoten zogen sie vorwärts ins dichte Dunkel ihres Zuhauses. Drinnen empfing sie die weiche Wärme ihrer übereinanderliegenden Jungen. Deren Atem stank nach vergorener Milch, und die Fetzen ihrer ledrigen Eihüllen schimmelten zwischen Urin und Kot und getrocknetem Speichel vor sich hin – in dem feuchten Loch, das Morgie für ihre Familie gegraben hatte, vermischten sich allerhand Gerüche. Hier war sie sicher vor den über ihr dahindonnernden Ungetümen.[9] Halbwegs zumindest.
Erschöpft legte sie sich hin. Ihre Jungen wachten auf. Die blinden, quiekenden Neugeborenen schoben sich über- und untereinander hin zu ihrem Bauch, an dem Milchtropfen aus ihrer Haut drangen. Sie wetteiferten um den besten Platz. Sie sogen an Morgies nassem Fell, und bald waren ihre Gesichter von Milch bedeckt. Morgie streckte sich auf der Seite aus, und ihre Tasthaare fanden das Kleine, das ihrem Kopf am nächsten war. Behutsam drehte sie es auf den Rücken, beschnüffelte die aufgerollten Ohren und die dünnen, noch geschlossenen Augenlider. Sie fuhr mit ihrer rauen Zunge über seinen Bauch, um ihm beim Kotabsetzen zu helfen, das es noch nicht allein bewältigen konnte.
Die Milch, der Schmutz und die Eihaut in dem dunklen, verdreckten Bau – sie markieren den Ursprung der weiblichen Brust. Morgie ist die wahre Urmutter, Lebewesen wie sie haben ihre Nachkommen nicht nur gesäugt, um sie zu ernähren, sondern auch, um sie vor einer gefährlichen Umgebung zu schützen.
Ganz einfach gesagt: Frauen haben Brüste, weil sie Milch bilden. Wie alle Säugetiere ernähren wir unsere Neugeborenen mit einem ziemlich süßen, wässrigen Sekret, das wir aus besonderen, am Rumpf sitzenden Drüsen absondern. Warum unsere Brüste so weit oben am Brustkorb und nicht in der Nähe des Beckens sitzen, warum wir nur zwei Brüste haben und nicht sechs oder acht und warum diese mehr oder weniger von Fettgewebe umgeben sind, das manche Menschen sexuell anziehend finden – all das sind Fragen, zu denen wir noch kommen werden. Tatsache bleibt: Weibliche Menschen haben Brüste, weil sie Milch produzieren.
Neueste Forschungen deuten zudem darauf hin, dass wir Milch produzieren, weil wir einst Eier gelegt haben – und kurioserweise auch, weil wir eine langjährige Liebesbeziehung zu Millionen von Bakterien unterhalten. Beides lässt sich auf Morgie zurückführen.
Was war zuerst da, Henne oder Ei?
Tag für Tag trampelten die Jura-Monster über Morgies Bau hinweg. Lastwagengroße Fleischfresser rannten umher wie Strauße auf Anabolika. Einige sahen auch tatsächlich aus wie aufgepumpte Strauße. In den Meeren lebten an das Ungeheuer von Loch Ness erinnernde Plesiosaurier. Da alle großen Nischen im Ökosystem besetzt waren, entwickelten sich die meisten unserer frühen Evas am Boden[10] – kein sehr angenehmer Ort damals, vor 200 Millionen Jahren. Denn auf dem Erdboden lebte es sich gefährlich, da sich der Superkontinent Pangäa in Auflösung befand: Tektonische Verschiebungen ließen Morgies Welt auseinanderbrechen. In die immer weiter aufklaffenden Spalten strömte Wasser ein, traf zischend auf heiße Lava und brachte neue Ozeane hervor.
Dennoch war Morgie eine unglaublich erfolgreiche Spezies. Ihre Fossilien finden sich überall von Südwales bis nach Südchina.[11] Wo es eine Morgie geben konnte, gab es sie offenbar auch. Sie war anpassungsfähig und einfallsreich. Und sie hatte eine Menge Nachkommen. Der britische Evolutionsbiologe J. B. S. Haldane soll gesagt haben, Gott hege offenbar eine übertriebene Vorliebe für Käfer, immerhin habe er so viele von ihnen geschaffen.[12] Insektenfresser wie Morgie profitierten jedenfalls von dieser Vorliebe. Mindestens so gern wie die Käfer mochte der Schöpfer offenbar die pelzigen, warmblütigen, flatterherzigen Evas, welche die kleinen Krabbler verspeisten.
Aber es war nicht nur das reiche Käferangebot, das Morgie so erfolgreich machte. Denn anders als die Evas vor ihr säugte sie ihre Nachkommen.[13]
Sobald sie das Licht der Welt erblicken, sind neugeborene Lebewesen vier Gefahren ausgesetzt: Sie können verdursten, Raubtieren zum Opfer fallen, verhungern oder, sollte all dies nicht geschehen, an Krankheiten sterben, wenn Bakterien oder Parasiten ihr Immunsystem überwältigen. Jede Mutter der Tierwelt hat bestimmte Strategien entwickelt, um ihre Nachkommen zu schützen – Morgie aber gelang es, allen vier Gefahren zu begegnen, indem sie ihre Kinder mit einer körpereigenen Substanz tränkte.
Sollten wir Muttermilch umschreiben, so würden wir sie spontan als die erste Nahrung eines Babys bezeichnen. Nun will man auf keinen Fall, dass ein Baby unterernährt ist – schließlich brauchen Neugeborene Brennstoffe, um Fett, Blut, Knochen und sonstige Gewebe zu bilden. Und so nehmen wir an, dass Babys schreiend nach Milch verlangen, weil sie hungrig sind. Aber das stimmt nur halb. Wer gerade auf die Welt gekommen ist, benötigt nämlich vor allem Wasser.
Alle Lebewesen, ob Säugetiere oder nicht, bestehen hauptsächlich aus Wasser. Der Körper eines erwachsenen Menschen besteht zu fünfundsechzig Prozent aus Wasser, bei Neugeborenen sind es fünfundsiebzig Prozent.[14] Die meisten Tiere sind im Grunde Windbeutel mit Meerfüllung. Wollte man das Leben auf der Erde in möglichst einfachen Worten beschreiben, so könnte man sagen, dass wir energetische Behälter mit streng geregeltem Wassergehalt sind.
Dieses Wasser





























