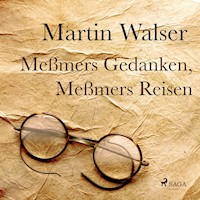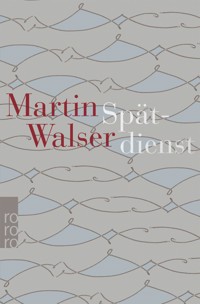14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein großer Schriftsteller und seine Zeit Vom Beginn seines schriftstellerischen Schaffens an hat Martin Walser das politische und gesellschaftliche Geschehen begleitet, er hat beobachtet, teilgenommen und sich eingemischt. «Ewig aktuell» versammelt Äußerungen, Aufsätze und Reden, die in mehr als einem halben Jahrhundert aus aktuellen Anlässen entstanden sind. In den sechziger Jahren protestierte er gegen die deutsche Haltung zum Vietnamkrieg der Amerikaner, ab den siebziger Jahren wollte er sich nicht mehr mit der Anerkennung der deutschen Teilung als Resultat einer Katastrophe zufriedengeben; dann die Wiedervereinigung, die Golfkriege und der Flüchtlingsstrom. Immer wieder stellte er sich der deutschen Schuld, beschäftigte sich mit der Ungeheuerlichkeit, dass Auschwitz menschenmöglich war. Er setzte sich mit Zeitgenossen – dem, was andere taten, dachten – rege auseinander, wurde zu einem scharfen Kritiker der Instrumentalisierung der Medien durch die Politik. «Ewig aktuell» ist eine Reise durch nahezu sechzig Jahre Zeitgeschichte aus dem Blickwinkel eines großen Schriftstellers und zugleich das persönliche Zeugnis eines Beobachters, der das Geschehen nicht von einem fernen Planeten aus beschreibt, sondern sich selbst immer auch als Teil des Geschehens verstanden hat. Die politische Entwicklung der Bundesrepublik von den Anfängen bis in die Gegenwart, sie wird in diesem Band lebendig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 735
Ähnliche
Martin Walser
Ewig aktuell
Aus gegebenem Anlass
Über dieses Buch
Ein großer Schriftsteller und seine Zeit
Vom Beginn seines schriftstellerischen Schaffens an hat Martin Walser das politische und gesellschaftliche Geschehen begleitet, er hat beobachtet, teilgenommen und sich eingemischt. «Ewig aktuell» versammelt Äußerungen, Aufsätze und Reden, die in mehr als einem halben Jahrhundert aus aktuellen Anlässen entstanden sind. In den sechziger Jahren protestierte er gegen die deutsche Haltung zum Vietnamkrieg der Amerikaner, ab den siebziger Jahren wollte er sich nicht mehr mit der Anerkennung der deutschen Teilung als Resultat einer Katastrophe zufriedengeben; dann die Wiedervereinigung, die Golfkriege und der Flüchtlingsstrom. Immer wieder stellte er sich der deutschen Schuld, beschäftigte sich mit der Ungeheuerlichkeit, dass Auschwitz menschenmöglich war. Er setzte sich mit Zeitgenossen – dem, was andere taten, dachten – rege auseinander, wurde zu einem scharfen Kritiker der Instrumentalisierung der Medien durch die Politik.
«Ewig aktuell» ist eine Reise durch nahezu sechzig Jahre Zeitgeschichte aus dem Blickwinkel eines großen Schriftstellers und zugleich das persönliche Zeugnis eines Beobachters, der das Geschehen nicht von einem fernen Planeten aus beschreibt, sondern sich selbst immer auch als Teil des Geschehens verstanden hat. Die politische Entwicklung der Bundesrepublik von den Anfängen bis in die Gegenwart, sie wird in diesem Band lebendig.
Vita
Martin Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, war einer der bedeutendsten Schrifststeller der deutschen Nachkriegsliteratur. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Martin Walser starb am 26. Juli 2023 in Überlingen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Umschlagabbildung: Naoyuki Noda/Getty Images
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-00103-9
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Für Leonid
26. September 1959
Prophet mit Marx- und Engelszungen
Anlass: Das Prinzip Hoffnung, Ernst Blochs Hauptwerk, erscheint in Westdeutschland.
Geboren ist Bloch ja in Ludwigshafen, aber er lebt in Leipzig, allerdings, so hört man, liest er nicht mehr. Man hat den geprüften Emigranten anscheinend verbannt in die innere Emigration. Hat es sich also gelohnt, Neuengland wieder zu verlassen, wo doch immerhin der Hummer billig und das Wort frei ist? Freilich, irgendwann in den letzten zehn Jahren war er Nationalpreisträger drüben, der Aufbau-Verlag druckte Band I und Band II von Prinzip Hoffnung, Bloch hatte alle Chancen, der Philosoph des jungen Staates zu werden (und das ist für Philosophen allemal eine Verlockung); auch im Westen wurde er ein attraktives Gerücht, und vielleicht hat der zutiefst gelehrte Marxist selbst ein paar Augenblicke gehofft, dass sich nun zu erfüllen beginne, was er ein Leben lang ersehnt, erforscht, gefördert und gepredigt hatte, die klassenlose Gesellschaft, angesiedelt im politischen Summum Bonum, im «Reich der Freiheit». (Vielleicht hat er auch angesichts des neuen Staates ein Auge zugedrückt, wie es nach seiner Beschreibung die Stoiker Rom gegenüber taten, vielleicht war auch er bewegt «von der Dankbarkeit, wovon Propheten bewegt sind, wenn ihre Prophezeiung halbwegs erfüllt scheint».) Zweiundzwanzig sei er gewesen, als ihm, unter numinosen Umständen, das Noch-nicht-Bewusste aufging und das, was an noch Ungewordenem dem in der Welt entspricht, die Offenheit der Materie. Zehn Jahre später, 1917, hat er den Geist der Utopie beendet, es folgen Thomas Münzer als Theologe der Revolution, Spuren, und dann beginnt schon, in den dreißiger Jahren, die Arbeit an der «Enzyklopädie der utopischen Gehalte in Bewusstsein, Gesellschaft, Kultur, Welt», die Arbeit am jetzt abgeschlossenen, bisherigen Hauptwerk: Das Prinzip Hoffnung.
Als ich vor ein paar Jahren, infiziert vom Gerücht Bloch, in Ostberlin den ersten Band des Prinzips kaufen wollte, musste ich mir zuerst einen Studenten chartern, der das Buch für mich erwerben und ausführen konnte. Nun, da Bloch, nicht mehr auf das Gerücht angewiesen, bei uns vorliegt, müssen, wenn sie über das Gerücht vom vollendeten Werk hinausdringen wollen, DDR-Bürger bei uns eindringen, um den III. Band heimzutragen, weil dem offensichtlich drüben kein Papier bewilligt wird. Dieser Tatbestand ist eher ein Grund zur Schwermut als zum selbstgerechten Jubel. Denn heimisch ist das Werk bei uns so wenig wie drüben. Bloch ist noch Marxist wie eh und je, der spätkapitalistische Westen ist ihm genauso zuwider wie die «mehreren und doch allesamt verrotteten Berlin-W» der zwanziger und dreißiger Jahre, deren vieles Licht nach seiner Meinung nur dazu diente, «die Dunkelheit zu vermehren». Aber die Art von Marxismus, die die seine von Anfang an war, eine chiliastische Art, der zur Hochreligion nur noch Gott fehlt, diese Art muss denen drüben ein Gräuel und uns ein Ärgernis sein.
Man kann Bloch nicht lesen, ohne auf taktische Erwägungen zu kommen, man sorgt sich um ihn, denn es sprudelt aus dem Riesenwerk ein so vehementer Katalog von Versündigungen gegen die Ideologie des Ostens und gegen die Ideologie des Westens: Man könnte das Werk ruhiger lesen, wenn man seinen Schöpfer in irgendeiner gleichgültigen Schweiz wüsste, vom SSD ebenso weit wie von Hearings. Der Einwand, das sei kein Kriterium bei einer sozusagen öffentlichen Beurteilung, zieht nicht, denn dass das Prinzip Hoffnung, beziehungsweise sein Apostel, dass beide, wie die nächstverwandten Gracchen, keinen Platz haben, worauf sie unangefochten und unbedroht sich niederlegen könnten, das charakterisiert Blochs Werk ebenso wie die beiden Demimondes. Zur Verteidigung der unseren muss allerdings jetzt doch gesagt werden, dass sie keinen Spezialfall an Ruchlosigkeit darstellt, sondern eben den üblichen irdischen Befund repräsentiert, während die drüben ja ganz andere Ansprüche stellen.
Es sei uns nur allzu gut gelungen, das Fürchten zu lernen, jetzt komme es darauf an, das Hoffen zu lernen. Bloch intoniert das wie einen Orgelton, und er lässt ihn in zwanzigjähriger Arbeit immer mächtiger werden, schickt ihn quer durch alle Zeiten, dass er alles aufstöbere, was je an Hoffnung, an Träumen nach vorwärts, an Entwürfen einer besseren Welt in der Menschheit dämmerte, aufleuchtete und wieder versank. In den Tagträumen sucht er die Spur des Noch-nicht-Bewussten, des Noch-nicht-Gewordenen, meint aber nicht den «kränklichen Feinsinn» der Hellseher und «Zwerchfellpropheten», auch nicht den kleinbürgerlichen Träumer, der sich bloß selbst besser stellen möchte; den, der es beim Träumen nicht bewenden lässt, meint er. Und es ist schon ein ungewohnt ungeheurer Ton in diesem Aufbruch, in dieser beleidigend schroffen Abwendung von uns allen, und Freude in der Behauptung, das Unbewusste sei nicht bloß die «Mondscheinlandschaft des zerebralen Verlusts», es gebe auch eine «Dämmerung nach Vorwärts». In ihr entspringt die Hoffnung, die dann vorschweift ins «utopische Feld»; «cum ira et studio» wird nun untersucht, was war und «was der Fall zu sein hat», daran arbeitet «das Kombinat Docta Spes» mit «Parteilichkeit für die begriffene Phantasie nach vorwärts, für das objektiv Mögliche».
Unter den Philosophen findet er nicht viel Gesellschaft. Der Kategorialbegriff Möglichkeit «ist der Benjamin unter den großen Begriffen». Bloch hätte besser gesagt, der David, dem er die Steinschleuder bastelt, dass er gegen den Riesen Gewordenheit angehe. Alle haben sie vor ihm nur das Vergangene bedacht. Und nicht bloß die, die der Welt überhaupt keine Veränderungsmöglichkeit zubilligten, auch die Prozess-Denker. Sogar der sehr verehrte Hegel hat ja in der Zukunft bloß Gestaltlosigkeit gesehen, auch bei Bergson ist das «Neue» bloß eine Art schöpferischer Wiederholung, Platon gar hat das ganze mögliche Wissen zu einer beschworenen Erinnerung gestempelt; da sieht sich der auf die Zukunft versessene, von Jugend an der Utopie von der besseren Welt ergebene Bloch ziemlich allein, sieht sich einem riesigen «Antiquarium des unverrückbar Gewordenen» gegenüber und will nicht daran glauben, dass es zur Philosophie gehöre, immer zu spät kommen zu müssen; er will die Eule endlich einmal ins Morgenrot fliegen lassen, und da begegnet er Marx: Der hat wenigstens eine Wirtschaftslehre geliefert, die nicht nur nach hinten liebäugelt und nach vorne beißt oder schweigt. Mit Marx kann man die Hoffnung lehren, klug zu sein, Tatsachensinn, Sinn für das Mögliche zu erwerben.
In einer Zeit, in der es weniger wissenschaftlich hergegangen wäre, in der man keine Philosophie zur Ausbreitung und Entwicklung einer so unbändigen Hoffnungsnatur gebraucht hätte, wäre Bloch vielleicht Religionsstifter oder Prophet oder Apostel oder Revolutionär geworden, so aber, um seiner eschatologischen Hoffnung irdisches Schrittmaß und heute notwendige Wissenschaftlichkeit beizubringen, ist er Marxist geworden, ist aber doch ein Prophet geblieben, wenn auch einer mit Marx- und Engelszungen; zornig singend gegen den «riesengroßen Schlaf der Dummheit oder Disparatheit in dem so schweren Fahrwasser unserer Prozesswelt».
Die Hoffnung wird also marxistisch auf Kiel gelegt, erhält rote Segel, die Instrumente sind östlich geeicht, Bloch erfindet noch ein paar neue, schöne dazu: Die Fahrt kann beginnen. Zuerst die Fahrt in die Vergangenheit, um Gefährten zu suchen; nicht bloß in der Philosophie, sondern in Heilkunst, Architektur, Geographie, in den geträumten besseren Welten der Sozialutopien. Bloch lässt nichts aus. Er hat ein methodisches Organ für «unabgegoltene Zukunft» in allem Vergangenen entwickelt, eine sensible Wünschelrute, die zu singen beginnt, wenn irgendwo Utopisches verschüttet liegt. Aber diese Ausfahrt ist nicht Sightseeing, sie ist «Konstruktion», sie ist Umfunktionierung des Alten in Noch-Brauchbares, Heraussprengung zukunftsträchtiger Kerne. Und da erweist es sich einige Male, dass Bloch ein seltsamer, ein so noch nicht dagewesener Marx ist. Wenn er zum Beispiel die Technik in Vergangenheit und Gegenwart betrachtet und sich nicht helfen kann, die nicht euklidische Technik immer wieder zu kritisieren wegen ihrer Unanschaulichkeit, wegen ihres «immer weiteren Überhangs in vermathematisiertes Niemandsland». Er trauert den verschwundenen qualitativen Naturbegriffen nach, er will materielle Gesetze, den Glauben, dass es wirklich so ist; verhasst sind ihm Gesetze, die, relativitätsbewusst, nur von Zusammenhängen, von statistischen Wahrscheinlichkeiten handeln, die sich selbst als Konvention, als Benennung, verstehen. Er will, und das ist noch durchaus gängig marxistisch, den subjektiven Faktor nicht übertrieben sehen; wo käme man hin, wendete man das aufs Ökonomische an!
Aber was ihn über den Marxismus hinausträgt, das ist seine Sehnsucht nach dem Subjekt der Natur, das er mit dem Menschen vermittelt sehen will, der bürgerliche Dompteursstandpunkt (Schillers Glocke!) soll überwunden, eine natura naturans gefunden, die schöpferische Materie aus der Abstraktheit relativierter Gesetze erlöst und zur Mitproduktivität befreit werden. Natürlich ist sein «Subjekt der Natur» in ein ebenso großes Inkognito gehüllt wie der eigentlich erwünschte Kern des Menschen, der mit diesem Natursubjekt vermittelt werden soll. Selbst ein universelles Feldgesetz würde Bloch nicht genügen, um dieses Inkognito zu lüften. Bloch denkt paracelsischer, wehrt sich zwar gegen Animismus und Mythologie, will aber eine Naturwissenschaft, die so fundamentale Qualitäten wie Sturm, Gewitter nicht bloß mit Ionisierung der höheren Luftschichten erklärt; er will eine Naturwissenschaft, die das Physische nicht zum «Leichnam des abstrakten Verstandes» macht. Heisenberg und Hölderlin in einer Person, das wäre wahrscheinlich der Mann, der jenes Inkognito in Bloch gemäßer Weise formulieren und die Vermittlung leisten könnte.
Musik und Tod und Religion und höchstes Gut sind die Themen des letzten Bandes, die Hochplateaus dieses Gedankengebirges; und wenn man diese hochgelegenen Gegenden erreicht hat, dann nehmen sich die marxistischen Grundlegungen des ersten Bandes als dumpfere, enge Nebeltäler aus. Die Beschimpfungen des Westens werden seltener, und jetzt erst wird es ganz klar, wer Bloch eigentlich ist: nicht nur der zornige Moralist, der, vom Gegenwärtigen entsetzt, eine bessere Zukunft fordert und der den Marxismus wählt, weil dort eine «Theorie-Praxis» des Zukunftmachens im Schwange ist, jetzt erst wird Bloch erkennbar als der Verfasser einer Utopie, die sich nicht mit dem Erfinden besserer Abwasseranlagen, klügerer Verfassungen und milderer Klimata beschäftigt, sondern der eine Utopie des menschlichen Heils entwirft und dabei ohne Gott auszukommen versucht. Eine Utopie, die, trotz marxistischer Grundlegung, den Ökonomismus des Marxismus weit hinter sich lässt. «Nichts mag im Überbau sein, was nicht im wirtschaftlichen Unterbau war – mit Ausnahme des Überbaus selber», formuliert er jetzt, Leibniz paraphrasierend. Es genügt nicht, die «miserable Gesellschaft» endlich zu verändern, der Babbit würde, wenn jeder seinen Eisschrank hätte, allenfalls ein «kommunistischer Spießbürger» sein. Noch einmal erzählt Bloch die Menschengeschichte, diesmal als Geschichte der Religionen, der Musik und der Todesvorstellungen. Wo Religion ist, da ist in der Tat Hoffnung, heißt es jetzt, und im Christentum sei das Wesen der Religion am reinsten hervorgetreten. Und der Satz Jahwes an Moses: «Ich werde sein, der ich sein werde», ist der vollkommenste Ausdruck, den sich Bloch für seine ins Bessere zielende Prozesslehre wünschen kann. Gott gibt es zwar nicht, aber die Stelle, die Gott einnahm, wird von Deus Spes eingenommen, denn das höchste Gut, das die Hoffnung meint, das «Reich der Freiheit», wäre «allerletzt nicht intentionierbar, wenn das Feld der religiösen Hypostasen nicht dauerhafter wäre als die religiösen Hypostasen selbst». Und mit dem Mut zur «Ungarantiertheit» gesteht er, dass er sich hier im absolut Unbekannten bewegt: Er lässt sich über das endgültige, schon im Christentum anvisierte und vielleicht in der Gestalt Buddhas vorübergehend Figur gewordene Menschenbild nichts sagen, als dass sowohl der Kern des Menschen, sein mögliches Wesen, eben noch so ungeworden, so exterritorial sind wie das Reich der Freiheit, die endgültige Heimat.
Der einzige Bezug zu diesem «messianischen Omega» ist Hoffnung. So marxistisch Bloch am Anfang die Hoffnung als den wichtigsten Erwartungsaffekt aus dem kleinen Abc der gängigen Psychologie hervorinterpretierte, so sehr zeigt es sich jetzt, dass er auch über den Tendenz-Sinn des Marxismus hinausgetrieben ist: Die jetzt verlangte Hoffnung hat nichts mehr mit dem Möglichen zu tun, das man als das partiell Bedingte mit geschultem Theorie-Praxis-Verstand erkennen und zur Realisierung treiben kann: Was Bloch jetzt nach dem Durchgang durch die Religion verlangt, ist unbedingte Hoffnung. Als er noch sagte: «Ubi Lenin ibi Jerusalem», da bewegte er sich noch im Reiche Hegel’scher und marxistischer Vermittlungsprozesse, seine letzte Reichsfigur Heimat aber, die die Genesis weit hinaus ins Ende verlegt und ein Reich verlangt, in dem die Erfüllung nicht geringer ist als die Sehnsucht (während er im ersten Band noch konzedierte, dass kein irdisches Paradies beim Eintritt ohne den Schatten bleibe, den der Eintretende noch wirft), seine jetzige «Endfigur» ist eigentlich nicht mehr auf dem Wege der Vermittlung zu erhoffen, sondern nur noch durch den Sprung (den wir, wie Bloch anderswo sagt, vom christlichen Wunder gelernt haben). Manchmal erscheint es bloß noch als eine besonders stolze Hartnäckigkeit, dass Bloch, der das «schlechthin paradoxe Dur im Trauermarsch» so deutlich hört, dass er seine Hoffnung nicht auch noch Gott nennt. Das Ziel seines «inhaltlichen Atheismus» sei «genau das gleiche» wie das «aller höheren Religionen», bloß «ohne Gott, aber mit aufgedecktem Angesicht unseres Absconditum und der Heils-Latenz in der schwierigen Erde».
Er ist ein Ketzer durch und durch, von uns aus gesehen, von Rom aus, von Washington und Moskau aus, von Ost- und West-Berlin aus, von wo aus auch immer, Bloch ist ein Ketzer. Es sei denn, man könnte sich erheben, noch über das Empire State Building hinaus, so hoch auf jeden Fall, dass die Farben blasser werden, dann müsste man ihn einen Propheten nennen. Aber hier unten, rundum dicke Luft, da ist es riskant, ihn einen Propheten zu nennen. Es tut einem keiner was, aber das Wort wirkt komisch. Prophet! Auch wenn man keinen hohlwangigen Hellseher meint damit, sondern einen Mann, der vielleicht aus Liebe zornig und rabiat geworden ist und nun mehr fordert, als ein bloß vernünftiger Mensch zu fordern wagte. Kein Heuschreckenesser, aber immerhin ein Mann mit einer Orgelstimme und einer Orgelsprache. Bloß schade, dass er nicht bei uns lebt. Gegen alle Prophetenregel, er würde viel mehr gelten. So gerät seine Stimme, obwohl sie eine Orgelstimme ist, in den Chor der Beschimpfungen aus dem Osten, das hängt ihr Verdacht an und nimmt ihr viel Frische. Ich muss mir auf dem Untersuchungsweg umständlich klarmachen, dass Bloch uns die gleichen Grobheiten ins Gesicht sagen würde, auch wenn er in München lebte und kein Marxist geworden wäre.
Die messianische Infektion grassierte in seinem Blut schon lang, lang vor seiner Geburt. Überhaupt ist er Amos, Jessias, Thomas Münzer und Weitling viel verwandter als den Säulenheiligen des Marxismus, die zitiert er – vielleicht – bloß anstandshalber. Vielleicht. Gott sei Dank habe ich nicht aufgehört, bevor ich auch seinen dritten Band durchhatte. Zuerst ist er bloß klug und heftig, teils ärgerlich, teils amüsant, dann wird er vertrauenswürdig, und schließlich holt man das altmodische Wort «weise» hervor und wendet es zaghaft an. Aber dass er so unversöhnlich ist, das widerstrebt. Und da soll man sich Mühe geben, jemanden, der uns Westlern nur das Schlimmste wünscht, als einen lauteren Mann zu verstehen. Malt ein irdisches Paradies, zündet Hoffnungsbrände an, aber uns schließt er aus. Bloß gut, dass SED-Mitglieder in diesem Paradies, im «Reich der Freiheit», in der Endlandschaft Heimat, auch nicht gerade am Platz wären. Schließlich soll dort «keine aufrechte Haltung mehr unterdrückt» werden, «keine Gemeinheit sich mehr rentieren». Und wenn er auch alle bösen Beispiele bei uns herausfischt, so muss er doch, um seiner besseren Zukunft einigen wirklichkeitsverwandten Umriss zu geben, auch alle guten Baumaterialien bei uns, das heißt, im Christentum, in der Antike, bei Buddha oder Bach ausleihen. Nur mit Hoffnung geht es ja nicht. Er braucht Vor-Schein, er sammelt Züge der Zukunft, und er findet sie in der christlichsten aller Künste, in der Musik, findet sie in Jesus selbst am meisten, findet sie aber nicht im gegenwärtigen Osten. Allerdings auch nicht in unserer Gegenwart. Das wäre auch zu viel verlangt.
Eine Herausforderung bleibt natürlich, dass er im Osten lebt, dass er dort doch mehr für möglich hält als bei uns. Über Hoffnung wird bei uns ja auch wenig geschrieben. Bei uns reibt sich ein feines Hirn an der feuchten Mauer, Schicht für Schicht, auf, ehrlich. Eine elegant-apathische Skepsis trägt sich auch gut. Im Auslegen der Angst und Unwendbarkeit wird Großes geleistet. Kunst, in motorischem Selbstvertrauen, bleibt vor dem Spiegel und entdeckt, immer wieder schwermütig-entzückt, sich selbst. Als Steuerzahler hast du widerwillig, und zu sanftem Betrug geneigt, Anteil am Allgemeinen. Plötzlich muss auch wieder gewählt werden. Dann darfst du weitere vier Jahre zuschauen. Politik ist ein Beruf geworden wie Zahnarzt und Karosserieschlosser. Das Interesse ist weit fortdelegiert. «So sucht der Nachtschmetterling, wenn die allgemeine Sonne untergegangen ist, das Lampenlicht des Privaten.» (Karl Marx) Bloch macht Musik fürs Allgemeine. Bläst alle Instrumente der Hoffnung. Östliche Tonart auf durchaus westlichen Instrumenten. Man wird nicht gleich danach tanzen können. Es wäre für das Ohr, diesen weitreichenden Sinn, tief angenehm, wenn wir auch so einen Musikanten hätten wie Bloch. Wo wir doch die Instrumente schon haben.
Süddeutsche Zeitung, 26. September 1959
Sommer 1961
Das Fremdwort der Saison
Anlass: Bei einem informellen Treffen einiger Schriftsteller der Gruppe 47 mit Willy Brandt wird entschieden, ihn bei seinem Wahlkampf zur Bundestagswahl 1961 zu unterstützen.
Ich bin Abonnent bei mehreren Lieferanten, die sich auf schonungsvolle Zubereitung zeitgeschichtlicher Ereignisse verstehen. Meine Lieferanten in Bild, Ton und Prosa sind seriös, also wissen sie: Das Wichtigste bei der Meinungsfreiheit ist, dass man sie nicht missbraucht. (Manche Kühe – das beobachtet der Landwirt mit Sorge – bleiben viel weiter vom geladenen Zaun, als sie eigentlich müssten. Das kommt vom Respekt. Dadurch entgeht ihnen natürlich Gras. Und uns Milch.)
Man gewöhnt sich an Diät. Und wenn es den Abonnenten einmal überkommt, kauft er sich was Scharfes für eine Mark oder hört Auslandssender.
Um nicht im Bilde zu bleiben: Immer im Wahljahr zeigen sich bei mir die Folgen. Ich soll wählen, nachdem ich drei, vier Jahre eingelullt worden bin. Ich soll sagen, ich sei so zufrieden, wie sie mir sagen, dass ich sein soll. Ich soll nachsagen: Es-geht-allen-so-wie-noch-nie-ist-es-allen-so-wie-esjetzt-allen-geht. Da und dort noch ein Stäubchen. Man würde sich genieren, auf so was auch noch hinzuweisen. Das wissen die doch selber. Soo wichtig ist Globke auch wieder nicht.
Es gibt natürlich in jeder Zeit Magenkranke, Querulanten, Unverbesserliche, Leute ohne Epochengefühl, Bequemlinge, die es nicht hören wollen, dass wir in einer «Auseinandersetzung stehen», man kennt diese Sorte. Für solche hält sich die Regierung eine Opposition. Machte sich bisher ganz gut. Plötzlich hat sich die Regierung anders entschlossen. Meine Lieferanten haben das gleich begriffen. Inzwischen weiß es jeder: Es gibt keine Opposition mehr. Anno 57, Erich Ollenhauer und seine SPD, das war beste Opposition. Es war wie in einer Demokratie damals. Gute alte Zeit.
Es ist ja so: Viel mehr als einen Satz kann man einem Volk pro Jahr nicht zumuten. Und in diesem Jahr hat man sich für den Satz entschieden: Die SPD ist keine Alternative. Man weiß dann schon, dass der Zeitgenosse mit schöner Logik daraus schließt: Also … noch drei Buchstaben, und er hat es. Früher pflegten die Regierenden und Mitregierenden an Außenstehende die Frage zu richten: Wo bleibt da das Positive? Jetzt heißt die Frage: Wo bleibt da die Alternative? Das schöne zweischneidige Fremdwort. Jeder brave Vater bringt es abends heim und sagt es einmal – zur Übung – seiner Familie vor. Ich weiß, ich weiß, sagt die Frau und zeigt es ihm in der Zeitung.
Weil ich mir in Wahljahren besondere Wachsamkeit anbefehle, hielt ich das mit dem Fremdwort für einen Einfall meiner Diätköche. Sie sind zu besorgt um mich, dachte ich. Sie wollen es diesmal ganz schmerzlos machen. Ein großer Betäubungsversuch im Mai, dass die Wahl schon im Juni sozusagen entschieden ist. Es muss sich dann keiner im Urlaub Gedanken machen.
Es ist nicht so, dass ich vorsätzlich nach Alternativen Ausschau halte. Bloß, ich wähle so gern. Auch anno 57 hat keiner befürchten müssen, dass die Wahl in ein schreckliches Morgenrot führe. Aber wir hatten unsere demokratische Spielfreude. Verstehe ich aber das Fremdwort der Saison so, wie es jetzt im Schwange ist, dann wäre es doch besser, am 17. September den HSV noch einmal gegen Barcelona spielen zu lassen, da stünde wenigstens etwas auf dem Spiel. Ist aber die SPD keine Alternative mehr, dann ist die Wahl am 17. September eine ungerechtfertigte Sonntagsbelästigung.
Eingelullt von dreijähriger Schonkost und nun auch noch lokal anästhetisiert für den 17. September durch den Gassenhauer von der fehlenden Alternative, ziehe ich aus, um die Alternative zu suchen.
Der Mensch lebt in Furcht und Hoffnung, sage ich mir, wo weniger zu fürchten wäre, ist mehr zu hoffen.
Was die Furcht angeht, so verlasse ich mich da ganz auf die Gänsehaut. Die meisten Gänsehäute der letzten Jahre verdanke ich jenem Albdruck aus Bayern, der uns verteidigen kann gegen alles, nur nicht gegen sich selbst. Wenn er den Unterschied zwischen taktisch und strategisch «herausarbeitet», schon sitz’ ich in jener Haut, bloß ohne Daunen. Jetzt strampeln aber die Experten aller Parteien im Gestrüpp der Zitate, jeder hat schon einmal das Gegenteil behauptet, der Jargon ist ziemlich zum Kotzen. Weichselbrücken lassen sie hochgehn, nebenbei Warschau, zum Ausgleich wird auch mal Hamburg ausradiert.
Ich habe die Wahl zwischen dem Gefühl, dass es zum Kotzen ist, und der Gänsehaut. Ich entscheide mich für das Erstere! Ich weiß doch: Wenn ich dagegen bin, schmeißt keiner eine Atombombe. Das nimmt keiner auf seine Kappe. Bloß, dem Albdruck trau’ ich eher zu, dass ihm eine heilige Mission den Verstand mit Wetterleuchten hell macht, und dann redet er es uns und sich ein, dann glaubt er, er hat es uns eingeredet, und dann muss es eben sein, dann ist es zumindest möglich. Schau’ ich dagegen den nüchtern-düsteren Erler an, der aussieht, als hätte er jeden Morgen schon vor dem Frühstück auf Granit gebissen: Das ist ein Mann, sage ich mir, der seine Rechtfertigungen auf der Erde suchen muss, der ist eine Hoffnung wert.
Ich höre das nicht ungern, wenn sich eine Partei bloß auf die Erde beruft und sagt: Seht, ich will ja gar nicht alles neu machen. Aber zwischen Aktien und Aktien ist ein Unterschied. Jetzt werden sie angeboten wie ein Geschenk. Vorzugsaktien zum Beispiel. Kein schlechter Name für eine Aktie, mit der oft genug nicht einmal ein Stimmrecht verbunden ist. Vom kapitalistischen Mantel soll wenigstens jeder noch einen Zipfel erwischen. Die endlose Vermehrung dieser Zipfel-Kapitalisten als Inbegriff sozialer Versöhnung. In milder Börsenfurcht wird man dann seine Tage hinbringen und von der Regierung nur noch verlangen, dass sie ihre Hand schützend über die Kurse hält. Nicht durch ein Recht nimmt man am Sozialprodukt teil, sondern durch ein Risiko, das politisch verpflichtet. Ein Volk von machtlosen Kleinstaktionären als soziale Utopie. Jeder träumend vom großen Jongleur Flick: stoße ab Harpener Majorität, breche ein in die Verarbeitung, sagen wir: Daimler. Solche Aktionäre müssen Opportunisten sein. Schließlich hat ein Flick den «Freundeskreis des SS-Führers Himmler» unterstützt. Nicht aus Überzeugung, sondern aus vorsorgendem Opportunismus. Ein Volk von Opportunisten, keine angenehme Utopie! Auch wenn kein Hitler vor der Tür steht, sondern ein … ich bin abergläubisch und male nicht gern alles an die Wand.
Jetzt schaffen Geschenke das Klima. Eine Sozialpolitik, die jederzeit zurückgepfiffen werden kann. Ich erhoffe die Überwindung dieses Geber- und Nehmer-Klimas. Frag einen Geber, und er sagt dir: Die Arbeitsmoral ist gesunken, die Nehmer neigen zum Missbrauch der Vergünstigungen. Die Geber aber tragen die Aura heroischer Herzinfarkte andauernd mit sich herum. Das gehört längst verfilmt.
Noch das oberste Ziel aller bundesrepublikanischen Politik (nach Bundespräsident Lübke): Wiedervereinigung. Ich habe keine Güter in Mecklenburg, von Großdeutschland träume ich nur, wenn ich schlafe, also höchst unfreiwillig und gar nicht selig, aber ich bemerke, dass das Wort «Ostkontakte» immer mehr in die Nähe von Wörtern wie «Sittlichkeitsverbrechen» und «Landesverrat» rutscht. Das kommt vom Antikommunismus. (Lexikalischer Hinweis: Antikommunismus: eine Lehre, die entdeckt hat: Wer kein Antikommunist ist, der ist ein Kommunist.) Dank dieser Entdeckung ist vieles einfacher geworden. Nicht gerade die Wiedervereinigung. Die ist nach wie vor das Ziel, dem sich, sagt der Bundespräsident, alle andere Politik unterordnen müsse. Fast möchte man empfehlen, einen Orden zu stiften für Verdienste um die Wiedervereinigung (lexikalischer Hinweis: Orden, kunstgewerblich geformte Metallstückchen, mit denen man schwache Stellen markiert).
Franz Josef Strauß hat zu den Seinen gesagt, es müsse pragmatisch zugehen in der Politik. Ob die Seinen ihn hören? Ich höre jetzt schon wieder die Wahljahrs-Predigten (lexikalischer Hinweis: Predigt im Wahljahr, Verkündigung und Auslegung dessen, was Gott im Hinblick auf den 17. September geoffenbart hat). Sie basteln sich einen Feind. Sie basteln sich eine Art Teufel. So wie Ulbricht und die Seinen sich die «nazistische Bundesrepublik» als nützlichen Wunschfeind zurechtbiegen. Pragmatische Politik? Wer fängt an damit?
Als Angehöriger des katholischen Fußvolks meine ich, das Christentum braucht die CDU weniger als die CDU das Christentum. Das Christentum könnte sich auch auf Jesus Christus stützen. Zurzeit aber ist der Himmel ein Gelände, in das man nur kommen kann, wenn man den richtigen Feind hat.
Leider hat auch die SPD dem vulgärsten Antikommunismus geopfert. Aber wenn sie schon am Feind mitbastelt, wird sie Bindfaden und Leim doch wenigstens nicht aus dem Jenseits holen. Gegen alles gefährlich Missionarische müsste sie doch um ein Gran weniger anfällig sein. Eine winzige, recht winzige Hoffnung. Aber eine Hoffnung schon deshalb, weil es viel schlimmer zwischen uns Deutschen gar nicht mehr werden kann.
Jetzt habe ich mich genugsam als verführbarer Intellektueller ausgewiesen und überlasse das Podest wieder den Profis, den Verwischern der Alternative. Dem Volk darf man aufs Maul schauen, nicht aber den Parteien. Nicht weil sie keins hätten, sondern weil sie keine Sprache mehr haben. Sie benutzen das Vokabular, auf das sie sich im Lauf der Zeit – uns zuliebe! – hinabgeschraubt haben. Ein Politiker gebraucht nun einmal gern geräumige Worte, in denen mehr Platz als Inhalt ist. Was in uns zurückbleibt, wirkt wie eine Nachtaufnahme von Gebirgsmassiven. Selbst Gott, der doch alles selbst gemacht hat, könnte darauf den «Mönch» nicht mehr von der «Jungfrau» unterscheiden. Die Alternative dagegen ist ihm natürlich sonnenklar.
Die Alternative oder Brauchen wir eine neue Regierung? Reinbek bei Hamburg 1961
August 1961
Zwei Berichte an Bertolt Brecht
Anlass: Der Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961.
Was Deutlichkeit angeht, B.B., lebtest Du
in märchenhafter Zeit. Die Mörder wollten
nichts als Mörder sein. Das Böse war
auf dem Marktplatz zu besichtigen. Meistens
genügte die Waage. Der mehr Kilo hatte,
war der Schlechtere. Den Armen ließest Du
straucheln nur zur Brandmarkung der Verhältnisse.
Dir dankt das Jahrhundert sein einziges Märchen.
Die Fahnen, die Du sticktest, flattern abends
noch lange zum Entzücken des Parketts.
Jetzt gibt das Lebendgewicht keine Auskunft mehr
über die Klasse. Sozialismus ist hierorts
ein Programm fürs Elektronengehirn.
Rundum grassiert das Lächeln der Partner, da helfen nicht
Lyrik und Messer. Im gut gelenkten Bus
geht’s zur Besichtigung der Pause. Kauend
sitzen Praktiker, trinken Verschiedenes zu
verschiedenen Vespern. Fahnen sind Hemden
mit Reißverschluss. Pistolen treuherzige Flaschenöffner.
Die Pause sei reichlich, sagen die Gähnenden
und grüßen flott den nach Süden rasenden Sohn
des Besitzers, den zu verachten ihnen tariflich
erlaubt ist. Wir besichtigen auch die Frauen,
die es elektrisch haben und in den Augen
ein Weh, für das man nicht kämpfen kann. Lassen
wir uns also von der Statistik verhöhnen
und spielen mit der Nabelschnur der Ungeborenen.
Es darf heute einer fast alles, B.B.
Der ruchlos sein will wie Du und böse
und mit Gelächter einbrechen in
ein Heiligtum, wird mit Lorbeer empfangen
von Ruchloseren, denen liefert er nur noch
Dekoration. Der lieber Satans
Grimasse wäre, wird Vorsitzender
einer Gemeinde für satanische Samstage.
Der dem Pfarrer die Fenster einwirft,
den lädt die Köchin in Hochwürdens Namen
zum Tee. Berstend vor Anmut verrichtet
einer die Notdurft vor dem Hochaltar
und wartet vergebens auf den Prozess,
auf die Ernennung zum Lästerer,
also beschreibt er die Gräuel der Liebe,
macht sein Männchen vor Zeugen, weil er
anders seinen Spaß nicht mehr findet,
auch lassen sich über die Liebe und die
durch sie veranlassten Bewegungen ganz schöne
Gemeinheiten formulieren, aber
da kanonisieren ihn schon die Pärchen
und tun’s von jetzt an in seinem Namen.
Von Müttern wird er ins Haus gebeten,
seine Kenntnis um eine Tochter
zu erweitern. Die Dir nachfolgen, B.B.,
haben es schwer. Die Klasse ist ihnen
entlaufen, Spaß macht ihnen nur noch,
denen in Düsseldorf den Spaß zu verderben,
und am Ende sind sie’s zufrieden, deren
Spaßmacher zu sein.
Zukunft ist hier nicht mehr gefragt,
auf Barrikaden geht man noch für den Geschmack.
Deine List lebt noch, Schule hat Deine Schläue gemacht,
es stickt mit Deiner List und Schläue jetzt jeder
höchst persönliche Muster in sein Taschentuch
und schwenkt’s von seinem Standpunkt in die Welt.
Die Liebe hast Du auch nicht gelehrt,
es sei denn, das kennerische Betasten
verschiedener Haut. Den Hass hast Du
gegen die Mörder gebraucht, jetzt lackiert
damit jeder seine Karosserie,
weil Hass, wenn er so ins Freie glänzt
und Ungefähre, ein dunkler Spiegel ist
für jedermanns Wunsch, ein bisschen böser zu sein
als es der Klüngel erlaubt.
Dächten wir aber an Afrika wie an uns selbst,
hätte einer noch einen arglosen Zeigefinger frei,
die Tage endeten unbequem. Deshalb sagt keiner:
Beißt ihr in das gleiche Brot, so doch mit anderen Zähnen.
So dahin geht Getrenntes wie nicht getrennt.
Wir reißen dem, der es hat, das Hähnchen nicht
aus den Zähnen, weil unsere Hände beschäftigt sind
mit der Anrichtung einer Languste.
Auch an Deinen Händen, heißt es, klebte
Langustenblut, nicht das des Klassenfeinds.
Hier ist der hübsche Hass zu Haus
die Phantasie der Entschuldigung
Regen fällt hier zurzeit als Schnee
wer ein Glas hebt, zerbricht es.
Dann streicht einem ein Freund über die Haare
und zählt sie dabei.
Deine Feinde hatten viel Spaß an Dir,
lachend verdauten sie Hähnchen und Weißwein in Deinem
Theater, lobten Dich, weil Du das Streichholz zuerst
an Deine Zigarre und dann erst ins Dunkel der Zeit
gehalten hast. Ein großer Esser, hieß es,
sorgtest Du Dich ums Essen aller, hättest
auch für Deinen Appetit fürchten müssen, wär Dir
beim Fisch eingefallen: Du hast an diesem Tag
noch nichts getan für die Speisekarte der Armen.
Weil Dir Dein Appetit herrlicher Namen wert war,
vertrauten unter den Essern Dir auch die Feinen,
eisige Dichter etwa. Die wären sonst ratlos
vor Dir. So aber ist die Idee nicht blamiert.
Und die Partei? Ach ja, diese Partei,
Dein elfenbeinerner Pferdefuß, wenn Du
gestattest. Sie kann sich allemal auf Dich
berufen, dafür hast Du in Deiner Güte
listig gesorgt, weil die Geschichte Kredit
bei Dir hatte. Die Esser, Deine Brüder, sagten:
wie der aufgeklärte Sohn die fromme
Mutter, hättest Du behandelt die Partei,
setzt man voraus, er ist kein Rohling, pfeift
ihr nicht ins Gesicht, wenn sie gerade betet
oder Schwierigkeiten hat im Juni. Du merkst,
wir kriegten Dich hin, dass Du ein Genuss bliebst
großen Gemeinden: Du, ein Dichter, zu Hause
auf dem Lilienblatt, das auf der Pfütze schwimmt.
Dem Blatt bekommt es, der Pfütze auch, und Dich
machte es unwiderstehlich.
Aufgenommen unter die Großen Deutschen,
schien es, wir hätten Dich in Leinen und Glanz
als einen Wert. Gab es noch Stunk in Passau,
lächelten wir wie über eine Bestätigung.
Aber
der schwarze Sonntag, genannt der 13. August,
der scheuchte die Courage von den Brettern,
Grusche singt nicht mehr, Puntila verkommt
in der Garderobe. Als wäre die Mauer in Deinem
Namen erbaut, so stürzte Dein Kurs, Du warst
erkannt als rotes Papier, ein Wert nur wie eine
Aktie: Tendenzumschwung, Glattstellung herrschte vor,
die Börse pfiff aus allen Löchern, B.B.
ein Farbenwert, im Angstverkauf zu Boden
prasselnd. Kein Großer Deutscher mehr.
(Beethoven spielten die Engländer mitten im Krieg.)
Dein Maurer und mein Maurer sind fleißige Maurer.
Dein Maurer führte Hammer und Zirkel ins Feld
und rief herüber: Sprecht ihr nicht mit mir,
lass ich den Mörtel mischen, ich habe
Angst um mich. Mein Maurer rief in die sinkende
Sonne, den geduldigen Rhein: Mit dem
sprech ich nicht, den gibt es nicht. In meines
Maurers Schweigen wuchs die Mauer. Jedes
Wort, das nicht gesprochen wurde, war
ein Stein. Dein Maurer lieferte Mörtel und Hände
und war recht froh, dass er die Blöße jetzt
mit Mauerwerk bedecken durfte. Mein Maurer
gab sich erschüttert, als hätte er nie
einen Stein geliefert. Dein Maurer, jetzt ein Burgherr,
verteilte Gewehre, ließ schießen, so wurde Dein Maurer
der Täter und meiner ein Mann, der das schon immer
gesagt hat. Jetzt warten wir aufs Ausland. In fremden
Sprachen soll es Worte geben zur Verständigung
der Deutschen. In unserer Sprache, in Deiner Sprache,
B.B., gab es sie nicht. Dein Maurer lässt schießen,
mein Maurer bereitet sich vor, dem Volk die Botschaft
des Auslands zu übersetzen. Wird es ein Diplom sein
für zwei Maurer, ein Meisterbrief, Anerkennung
für beide? Wird Anerkennung das Ende sein
des Maurerspiels? Hoch genug ist die Mauer jetzt.
Was Du damit zu schaffen hast, Du, ein höflicher Feind
Deines Maurers, ein Dichter, nie ein Mörtelmischer,
warum Du zum Maurergesellen ernannt worden bist,
das, Bertolt Brecht, lass Dir erklären: Das Volk
(um dessen Speisekarte Dir’s zu tun war)
liebt Dich jetzt gerade nicht, verkünden
einige Theater. Kaputte Stühle, laute
Rufe seien zu befürchten und ein großes Pfui
der Presse. Später heißt es, darf Grusche wieder,
später zeigt man auch wieder Courage, später
ruft die Presse wieder: Hoch, Bert Brecht,
der Große Deutsche. Du siehst, die Mauer ist noch nicht
hoch genug. Gedulde Dich, sie wächst in jedem Haus.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23. Dezember 1997
13. April 1962
Brief an einen ganz jungen Autor
Anlass: Die Treffen der Gruppe 47.
Lieber Kollege,
wenn Du bemerkst, dass Dir der Jahrmarkt, der im Herbst und im Frühjahr mit Buden und Lärm in Deine Stadt kommt, keinen Spaß mehr macht, wenn Du schon Kettenkarussell fahren kannst, ohne in lauten Gesang zu verfallen, gar wenn Du mit den tauben Stoffballen nach Blechbüchsen wirfst und Deine Unterlippe nicht zerbeißt, obwohl Du nicht getroffen hast, dann ist es Zeit für Dich, Frühjahr und Herbst mit anderen Abenteuern zu besetzen. Als einschlägiger Jahrmarkt für Dich empfehlen sich die Frühjahrs-und Herbsttagungen der Gruppe 47.
Schreib also an Hans Werner Richter, Walter Jens oder Walter Höllerer. Es schadet Deinem Brief und Deinen Chancen durchaus nicht, wenn Du, ohne es direkt auszusprechen, merken lässt, dass Du alles gelesen hast, was der Adressat geschrieben und herausgegeben hat. Bei dem, was er herausgegeben hat, genügt die Kenntnis der Vor- und Nachworte. Er sieht dann schon, dass Du es ernst meinst.
Schlimm werden für Dich die ersten Stunden sein. Keiner kümmert sich um Dich. Du musst zusehen, wie sie einander begrüßen. Manche gehen mit ausgebreiteten Armen auf einander zu. Lass Dich nicht täuschen.
Bitte, weigere Dich, schon am ersten Vormittag vorzulesen. Gib Dich so scheu, wie Du bist.
Wenn Du den Lesenden und den Kritikern ein paar Stunden zugehört hast, verzichtest Du vielleicht darauf, jene Gedichte vorzulesen, die ein lautes Schließen der Tür nicht überleben könnten. Du wirst spüren, dass Du im Saal etwa mit der Aufmerksamkeit rechnen kannst, die in der Bahn, im Raucherabteil zweiter Klasse, einem Mitreisenden gezollt wird, der vom Hund seiner Schwägerin erzählt.
Du kannst Dich aber darauf verlassen, dass Dir die Kritiker der Gruppe mit jener trainierten Konzentration zuhören, mit der etwa ein Detektiv, der im Urlaub ist, gegen seinen Willen im Bahnabteil zuhört.
Vieles lässt sich nicht voraussagen (etwa: ob Hans Werner Richter Dich im Auftrag des Unmuts der Gruppe unterbrechen wird oder ob er sich lediglich beauftragt fühlen wird, Dich während Deiner Lesung zwei-, dreimal erstaunt von der Seite zu mustern), eines aber ist fast sicher: Nach Deiner Lesung werden Höllerer, Jens, Kaiser und Reich-Ranicki sich mit Dir beschäftigen. Solltest Du diese großen Vier je zitieren, tu’s bitte immer alphabetisch und sage das dazu. Wenn er und wir Glück haben, wird, ein Alphabet für sich eröffnend und ausfüllend, Hans Mayer aus Leipzig auftreten.
Nehmen wir an (um des Alphabetes willen), Höllerer hebt zuerst die energische kleine Hand. Er verbindet das gern mit einer ersten Drehung des Oberkörpers, so als wollte er die Unabhängigkeit einzelner Körperpartien von einander erproben. Wenn er und eine seiner waagerechten Schultern zu Dir hinschauen, ist er in Ausgangsstellung. Er wird Dein Vorgelesenes flink tranchieren, in Schnitte, wie fürs Mikroskop, zerlegen, wird einzelne Sätze vom Gros abtrennen, wird sagen, das seien für Dich typische Sätze, Du hörst zum ersten Mal, dass es für Dich typische Sätze gibt, dankst es Höllerer mit einer Gänsehaut, während er schon dabei ist, diese typischen Sätze weiter zu zerkleinern, bis die Teilchen seinen mikroskopischen Blick befriedigen.
Nachdem er Dich so in Deiner wahren Zusammensetzung nur noch für sich selber anschaubar gemacht hat, ist er bereit, Dich zu benennen. Weil Du ein ganz junger Autor bist, er aber ein ganz großer Kulturenzüchter, spricht er vorsichtig über Dich. Du hast das Gefühl, er spricht über Dich wie über eine neue Krankheit. Dabei spricht er über Dich wie über eine neue Bakterienart, die er, wenn Du nur wolltest, aus Deinen Anlagen züchten könnte. Du musst darauf gefasst sein, dass er murrt. Sein Murren wird Dich verletzen, obwohl es gar nicht gegen Dich gerichtet ist. Es ist ein dauernder Hinweis auf die Sprache, in der er sich eigentlich ausdrücken möchte. Keiner von uns kennt sie. Wir kennen nur das Murren (das nichts Mürrisches an sich hat), welches ihn und uns daran erinnert, dass es jene Sprache gibt. Zu ebenjener in Höllerer umgehenden Sprache gehört auch sein plötzliches Lachen. Bitte, erschrick nicht. Es klingt, als springe Rübezahl über die Steinhalde und reiße bös aufgelegtes Geröll mit sich. Ertönt dieses Lachen, wird der Raum sehr groß, und in diesem mit dem Lachen immer riesiger werdenden Raum sitzt jeder ganz allein.
Nicht umsonst tut Höllerer vorerst noch so, als spräche er zu sich selbst, als sei er fast sicher, dass ihn niemand so gut versteht wie er sich selbst. Zum Schluss wird er noch kurz praktisch und spickt die für Dich typischen Sätze mit ein paar Fähnchen und versieht die Fähnchen mit einigen subtilen Gutachterformeln.
Dann aber wirft er Dein Vorgelesenes samt seinen Fähnchen wieder in die Luft, aber keine Angst: Jens fängt es auf und nimmt Dein Vorgelesenes und Höllerers Fähnchen in seine Scheren. Du darfst ruhig an so was wie Languste denken. Jens hält sich mit seinen Scheren Dein Vorgelesenes und die Zugaben Höllerers vom Leib. Du kannst Dich nicht darauf verlassen, dass er das pure Gegenteil von dem behauptet, was Höllerer gesagt hat. Zweifellos wird er dieses oder jenes Fähnchen Höllerers an eine andere Stelle stecken, vor allem aber wird er Dein Vorgelesenes immer wieder in die Luft werfen und wird das Vorgelesene in der Luft verfolgen lassen von einem Geschwader heftig dröhnender Substantive, die im Verbandsflug geschult sind. Ein Luftkampf beginnt. Wird sich Dein Vorgelesenes gegen diese hoch und massiv anfliegenden Substantive behaupten können? Erstaunt wirst Du zusehen, wie er sich bei diesem Spiel ins Zeug legt, mit welcher Leidenschaft er seine Substantive in den Kampf führt, um Deinen Rang zu ermitteln – denn ihm geht es um Deinen zukünftigen Platz in der Walhalla der zeitgenössischen Literatur. Und wie auch immer er entscheiden wird, er hat als Platzanweiser nicht seinesgleichen, wo er Dich hinsetzt, da sitzt Du (vorerst). Erstaunt also und ergriffen wirst Du zusehen, das weiß ich jetzt schon, wenn er in stürmischer Genauigkeit mit Dir umgeht; an Kinski oder Demosthenes wirst Du denken, wirst Dich versinnen, bis zur synchronisierenden Fehlleistung: Sturm über Attica, und wirst ganz vergessen, dass es dabei um Dich geht, um Dein Vorgelesenes. Und Du wirst nicht der Einzige sein, der das vergessen hat. Das mag Dich, falls Jens Dich gar zu schlimm platziert, zwischen Stockholm und Athen – denn er misst immer gern am Nobel-Griechen – ein wenig trösten.
Nehmen wir an, Jens habe seine Substantiv-Geschwader wieder eingezogen, die Stille, die nach Jens eintritt, sei eingetreten, was nun? Eigentlich wäre Joachim Kaiser dran. Das Alphabet weiß es, der Saal weiß es, er selbst weiß es.
Hans Werner Richter sagt es. Kaiser, ein Kenner von Jens-Finalen, hat den Kopf rechtzeitig in Schrägstellung gebracht: Jeder, der jetzt hinschaut, sieht, dass er Dein Vorgelesenes treuherzig anschaut. Er findet es hübsch, das sagt er auch, weil er weiß, dass alle wissen, was er sagt, wenn er ein Wort sagt, das er eigentlich nicht sagt. Den treuherzigen Blick auf Dein Vorgelesenes hält er noch eine ganze Zeit lang aufrecht, auch wenn er sich sichtbar dazu durchringt, sein «hübsch» zu erläutern. Wenn er noch das kritische Werkzeug seiner Vorredner in Erinnerung bringt, dann mit jenem Schauder, mit dem Erstkommunikantinnen von Vergewaltigung sprechen. Du wirst gleich hören und sehen, Kaiser hat es nicht mit dem Werkzeug. Elegisch schleppend spricht er aus Deinem Text einen Satz nach, das genügt unter Umständen. Ich bin überzeugt, Du wirst nachher zu Kaiser hingehen und Dich für diesen Satz entschuldigen. Kaiser kann leiden. Auch unter sich selbst. Legst Du Wert auf seine Anerkennung, dann lies nichts vor, was er, seiner Meinung nach, auch selbst hätte geschrieben haben können. Und wenn ihm zu Deinem Text Sätze einfallen, die so geistreich sind, dass sie sich vom Anlass lösen, darfst Du nicht überrascht sein. Er ist es auch nicht.
Er ist es so wenig, dass er das zu früh einsetzende beifällige Kichern des Saales mit glaubhaften Händen abwehrt, während sein Satz sich noch auf den Punkt zubewegt, auf den hin er gedacht ist. Er wehrt diesen allzu frühen Beifall nicht nur ab, weil er fürchtet, der Punkt, auf den es ankommt, könne schon im Beifall untergehen, nein, er wehrt sich glaubhaft, wehrt sich wieder einmal gegen sein Schicksal. Eine Art Midas-Schicksal. Er will über Dich sprechen, über Dein Vorgelesenes, und er tut es auch, aber kaum beginnt er einen Satz, will der schon wieder aus dem Dienst entlaufen, will selber was werden und wird auch was, wird ein Kaiser-Satz. Und das hat Kaiser natürlich als Erster kommen sehen. Versteh ihn also nicht falsch. Eigentlich möchte er Dir Sätze sagen im Weisungston Bertolt Brechts; wenn er dazu Hugo-Wolf-Melodien benützt, dann stellt er dadurch einfach gewisse Anforderungen an Deine Musikalität und Gebrochenheit.
Sozusagen widerwillig hat er sich seiner Aufgabe entledigt, Dein Vorgelesenes landet, mit Höllerers Fähnchen gespickt, von Jens groß etikettiert und gewogen, von Kaiser ein- und ausgeatmet und intim entlarvt bei Reich-Ranicki, der sofort aufsteht, wenn er sich mit Dir abzugeben beginnt. Weil er schneller sprechen kann als seine Vorredner, kann er, bei nur geringer Überschreitung der erträglichen Rededauer, alle Verfahren seiner Vorgänger an Dir exekutieren und noch ein eigenes dazu. Sein eigenes Verfahren ist ein rechtschaffenes, es hat auch mit seiner eigenen Rechtschaffenheit zu tun. Höllerers Sprach-Bakteriologie, Jensens Maßnahme und Platzanweisung und Kaisers Versuch, Dein Bild in seinem Spiegelkabinett zu versehren, haben Reich-Ranicki außer Wiederholungen und Korrekturen nur noch übrig gelassen, die weltliche Nützlichkeit und Anständigkeit Deines Vorgelesenen zu beurteilen. Und schon der bloße Gedanke, dass ohne sein Da- und Dabeisein dieser weiß Gott nicht nebensächliche Aspekt ganz unerwähnt geblieben wäre, versetzt Reich-Ranicki in große Eile.
Wenn Du, ihm zuhörend, glaubst, er hätte das, was er Dir sagt, schon gewusst, bevor er Deiner Lesung zuhörte, so beweist Du dadurch nur, dass Dir solche Fertigkeit fremd ist. Bedenke bitte immer, der Kritiker ist in jedem Augenblick einer. Der Autor hat Pausen. Und selbst wenn Reich-Ranicki etwas sagt, was er schon vor Deiner Lesung wusste, so ist es doch Deine Schuld, dass ihm das jetzt wieder einfällt. Lass Dich nie dazu hinreißen, einem Kritiker einen Vorwurf zu machen. Wisse (vielmehr): Der Autor ist verantwortlich für das, was dem Kritiker zu ihm einfällt. Ja, ich weiß, das ist eine schreckliche Verantwortung. Aber noch steht ja Reich-Ranicki vor Dir, und das ist gut so, denn wie auch immer seine Vorgänger mit Dir verfahren sein mögen, er wird Dich nicht ganz verlorengehen lassen.
Natürlich will auch er zeigen, dass streunende Adjektive und Vergleiche, die nur noch von verheirateten Entomologen gewürdigt werden können, seine kritischen Sinne beleidigt haben, natürlich reitet auch er gern laut und prächtig über den Markt wie König Drosselbart (der Ahnherr aller Kritiker) und zerdeppert Dir Deine Keramik, aber ohne den Oberton einer spröden, fast preußischen Güte kann er einfach nicht schimpfen. Eine nordöstliche Mutter ist er; in den Westen gekommen, um mit glänzenden Augen seinen Tadel so lange vorzutragen, bis sich eine Familie von solchen, die nur von ihm getadelt werden wollen, um ihn versammelt. Sollte die Gruppe 47 je eine Abordnung zu irgendwelchen Literatur-Olympiaden schicken, so wird der Mannschaftstrainer, der für zeitiges Schlafengehen, Beseitigung von internen Intrigen und Ausräumung von Wettbewerbsneurosen sorgt, zweifellos Reich-Ranicki sein. Unnachsichtig ist er nur gegen die geistigen Gegenden, aus denen er selber stammt. Möglich, dass er so Heimweh bekämpft.
Nun hoffe ich, um Deinetwillen, um unseretwillen, Hans Mayer sei uns erlaubt worden. Bedenke ich, wann Du geboren bist, rechne ich ein, wo Du jetzt wohnst, dann fürchte ich fast, Du hast noch keinen lebenden Marxisten gesehen. Und jetzt spräche einer zu Dir über Dich. Reich-Ranicki hat eigentlich doch recht langsam gesprochen, findest Du. Und noch eine Revision: Wenn Reich-Ranicki bei Deiner Lesung etwas eingefallen sein sollte, was er vorher schon wusste, so hast Du bei Mayer den Eindruck, Du hättest ihm einen Gefallen getan, weil Du ihm alles bestätigt hast, was er schon wusste. Hat es Dich beunruhigt, als Du fühltest, Höllerer spräche über Dich wie über eine neue Krankheit, so beunruhigt es Dich jetzt, dass Hans Mayer Dich wie eine allzu gut bekannte alte Krankheit bespricht.
Trotzdem, Du hast, während Mayer spricht, vielleicht auch zum ersten Mal das Gefühl, dass Du einen Sinn hast in dieser Welt; Du hast nicht umsonst gelebt, denn Hans Mayer bestätigt Dir, dass es schon eines Lebens Sinn sein kann, Symptome vor Hans Mayer zu tragen, Anlass zu einer Mayer-Diagnose zu sein, die Dich – das spürst Du gleich – überleben wird. Du siehst ihn so reden, schräg nach oben Sätze versendend, als denke Mayer ballistisch und wolle noch nebenbei Leipzig erreichen; Du hörst, dass doch alle Krankheiten zur Gesundheit wollen, und Du betrachtest diese Gesundheit namens Mayer; Du bist angerührt; denkst an Fahrkarten und alles Mögliche; bist bewegt von dieser wohl schönsten Fremdsprache des Vaterlandes; und wer hätte gedacht, dass auch in Mayers Haus, wenn nicht viele, so doch sicher mehrere Zimmer sind! Wenn Mayer aufgehört hat zu sprechen, kommst Du Dir vor wie nach dem Kino. Du blinzelst. Musst Dich zurückfinden. Routiniertere Mayer-Hörer im Saal gehen Dir voran, bahnen auch Dir einen Weg.
Nehmen wir an, Du säßest wieder auf Deinem Stuhl. Hans Werner Richter ist von Dir zurückgekommen. Sein Gesicht zeigt noch jene zwiespältige Versonnenheit des Musikkritikers, der zwar ein Buch gegen Wagner geschrieben hat, der aber gerade aus einer Tristan-Aufführung kommt. Da sitzt Du also, vor Dir Höllerer, der exakt gemurrt hat, Jens, der nobel-attisch gebrodelt hat, Kaiser, der so gekonnt geseufzt hat, Reich-Ranicki, der spröd-gütig geschimpft hat, und als hätte er nur eben das Fenster aufgemacht und wieder geschlossen, sitzt da aufrecht zwischen Stühlen der ballistische Redner Hans Mayer.
Im Saal erhebt sich ein durch vier oder fünf teilbares Echo, individuell phrasiert. Ist den fünfen ein Satz, der geahndet werden muss, entgangen, so wird das jetzt selbstverständlich nachgetragen. Hast Du Dir einen Freund erworben durch Deinen Text, so wird der jetzt aufstehen und Dich schüchtern oder grimmig verteidigen. Dadurch gibt er den Kritikern die Möglichkeit, alles noch einmal zu sagen.
Das tun sie zwar gereizt, aber bereitwillig. Das Gute kann ja gar nicht oft genug wiederholt werden.
Da ich Deine eher schüchterne Art kenne, fürchte ich, Du könntest Dich abschrecken lassen. Bitte lass Dich durch nichts abschrecken. Wenn Du Deinen Text zum Vorlesen auswählst, denke daran, hier handelt es sich um Literatur fürs Zuhören. Heimliche Libretti eignen sich gut. Die Texte müssen zwar die Musik, nach der sie schreien, schon enthalten, müssen aber dem Zuhörer suggerieren, er habe Rhythmus und Melodie beim Zuhören sozusagen dazugemacht. Natürlich sind auch feinere Arten schon gut über die Runden gekommen, aber wenn Du furchtsam bist und sichergehen willst, dann denke daran, dass man Proust vielleicht weniger lange zuhören kann als den wild und rhythmisch flutenden Bildern des Olympischen Frühlings von Spitteler. Literatur fürs Zuhören! Das muss nicht gleich schlechte Literatur sein.
In der Hoffnung, bald Dein Zuhörer zu sein, grüßt Dich
Dein Martin Walser
DIE ZEIT, 13. April 1962
November 1962
Ja, und Aber
Anlass: Die Spiegel-Affäre und die Verhaftung von Rudolf Augstein, dem Gründer des Nachrichtenmagazins, am 27. Oktober 1962 unter anderem wegen Landesverrats.
Motto: Nicht nötig, auf den Spiegel zu schelten, wenn die Fratze schief ist.
(LEIDER EIN RUSSISCHES SPRICHWORT.Aber schon von Gogol vor seinen Revisor gesetzt.)
Ja, vor einem schwebenden Verfahren sollst du respektvoll den Hut ziehen, aber vor diesem kannst du ihn ruhig aufbehalten.
Ja, der Goebbels hätte sich den Augstein nicht so lange gefallen lassen, aber verhaftet hätte er ihn auch.
Ja, er hat uns die Opposition ersetzt, aber unsere Opposition wird uns nie den Spiegel ersetzen.
Ja, der Augstein war auch der Ansicht, mit der Wiedervereinigung wird es nichts mehr, aber leider hat er das ausgesprochen.
Ja, dem Ausbund aus Bayern hat er glatt jeden Montag versaut, aber wer versüßt uns jetzt jeden Montag?
Ja, wie viel Flick ausgibt, um keine Public Relations zu haben, ist immer noch unbekannt, aber ohne den Spiegel wird es unbekannt bleiben.
Ja, das kann schon mal vorkommen, dass was zum Himmel schreit, aber warum sitzen dort immer bloß Spiegel-Redakteure?
Ja, ein Staat, der sich diesen Spiegel leisten kann, kann sich schon sehenlassen, aber vielleicht will er das nicht mehr.
Ja, der Augstein muss was gegen den Strauß haben, aber der Strauß hat nichts … mit dem schwebenden Verfahren zu tun.
Ja, der Augstein muss, nach dem, was er schreibt, ein westdeutscher Patriot sein, aber er kann halt nicht singen.
Pardon, November 1962
13./14. März 1965
Unser Auschwitz
Anlass: Beobachtung der Auschwitz-Prozesse im Gerichtssaal.
Willst du dir ein hübsch Leben zimmern,
Mußt dich ums Vergangne nicht bekümmern.
GOETHE, LEBENSREGEL
Der Prozess gegen die Chargen von Auschwitz hat eine Bedeutung erhalten, die mit dem Rechtsgeschäft nichts mehr zu tun hat. Geschichtsforschung läuft mit, Enthüllung, moralische und politische Aufklärung einer Bevölkerung, die offenbar auf keinem anderen Wege zur Anerkennung des Geschehenen zu bringen war.
Über ein Jahr lang haben wir in der Zeitung gelesen, wie es zuging in Auschwitz. Wir waren vielleicht sogar im Gerichtssaal in Frankfurt. Wir kennen die Gesichter der Angeschuldigten, wir erinnern uns an einzelne Zeugen, und am meisten erinnern wir uns an fürchterliche Einzelheiten. Das Unglaubliche hat sich am tiefsten eingeprägt. Das Unvorstellbare hat den nachhaltigsten Eindruck gemacht. Jeder kennt momentan die schrecklichen Instrumente, kann einzelne Wörter zitieren aus dem Jargon der Täter, aus der Sprache der Opfer, weiß gewisse Gebäude und Plätze in Auschwitz und die dort geübten Mordpraktiken; man macht sich eine Vorstellung von der Beseitigung der Leichen, von den so und so und so misshandelten und gemarterten Körpern. Über ein Jahr lang lasen wir Überschriften dieser Art: «Frauen lebend ins Feuer getrieben», «Suppe und Straßenkot in den Mund gestopft», «Todkranke von Ratten angenagt», «Hähnchen und Vanilleeis für die Henker», «Der Gnadenschuss in der Frühstückspause», «In den Gaskammern schrien die Opfer fast 15 Minuten lang», «In Auschwitz floss der Alkohol», «Genickschüsse an der Schwarzen Wand», «Die Folterschaukel von Auschwitz», «Der Teufel sitzt auf der Anklagebank», «Wie die Raubtiere» …
Kaduk und Boger werden am liebsten in den Zeitungen abgebildet. Sie sind Stars geworden. Reduziert auf die Dimension des Zitats. An ihnen hat man sofort den Inbegriff. Je scheußlicher die Einzelheit, desto genauer wurde sie uns mitgeteilt. Je unfassbarer das Detail, desto deutlicher wurde es uns beschrieben.
So ist unser Gedächtnis jetzt angefüllt mit Furchtbarem. Und je furchtbarer die Auschwitz-Zitate sind, desto deutlicher wird ganz von selbst unsere Distanz zu Auschwitz. Mit diesen Geschehnissen, das wissen wir gewiss, mit diesen Scheußlichkeiten haben wir nichts zu tun. Diese Gemeinheiten sind nicht teilbar. In diesem Prozess ist nicht von uns die Rede. Nicht umsonst werden die Angeschuldigten in den Berichten «Teufel» und «Henker» und «Raubtiere» genannt. Wer von uns ist schon ein Teufel, ein Henker, ein Raubtier. Tatsächlich, auf diese Distanz gebracht, lässt sich Auschwitz betrachten. Ja, Auschwitz bringt es sogar zu einer traurigen Art von Attraktion. Die Berichte über die Verbrechen in Auschwitz geraten ganz von selbst in die Nachbarschaft der Berichte über andere Verbrechen: «Siebzehn Bisswunden und Kopfverletzungen», «Singend in den Tod», «Der Hungertod dauert 15 Tage».
Die Faszination, die das Grauenhafte auf uns ausübt, ist bekannt. Und Auschwitz scheint, wenn überhaupt, auf diesem Weg bei uns zur geschichtlichen Berühmtheit zu gelangen. Als Gräuelzitat. Wir sind offenbar so. Kein Mensch, glaube ich, könnte des Öfteren in Frankfurt im Gerichtssaal zuschauen, ohne von diesen schrecklichen Zitaten ebenso abgestoßen wie angezogen zu werden: Es ist die Frage, ob man sich der Natur dieser Faszination bewusst wird. Immer wieder taucht in den Zeitungsberichten das Wort «Inferno» auf. Dante wird beschworen. Schon einer der Herausgeber der Dokumente aus den Prozessen gegen die SS-Chargen von Buchenwald und Sachsenhausen schrieb: «Vielleicht hat die Phantasie eines Dante, der die Qualen der Hölle schilderte, die Realität der KZ-Verbrechen erahnt.» Oft genug taucht Dante jetzt wieder am Rande des Auschwitz-Prozesses auf. Man spricht von «dantesken Szenen».
Die Berichterstatter wollen vielleicht der bloßen Brutalität der Schlagzeile entkommen und geraten in einen Zusammenhang, der dem Sachverhalt Auschwitz noch fremder ist als der tägliche Raub- oder Sexualmord. Auschwitz mit Dantes Inferno zu vergleichen ist fast eine Frechheit, falls nicht Unwissenheit mildernd ins Feld geführt werden kann. Im Inferno werden schließlich die «Sünden» von «Schuldigen» gesühnt. Dem Inferno folgen immerhin noch Purgatorio und Paradiso. Die Menschen in Auschwitz wären grauenhaft überfragt gewesen, wenn sie einem durchwandelnden Dante hätten die Sünden aufsagen sollen, um derentwillen sie da gequält wurden. Und ihrer Qual folgte lediglich die Vernichtung.
Woher kommt aber die Neigung, die SS-Chargen für «Teufel» und «Bestien» zu halten und die Qualen der Menschen mit Dante zu umschreiben, also aus Auschwitz eine «Hölle» zu machen? Sicher auch daher, dass für den Berichterstatter Auschwitz einfach keine Realität ist. Wer dem Prozess zusieht, kann ohne weiteres feststellen, dass Auschwitz nur noch für die «Häftlinge», die überlebten, etwas Wirkliches ist. Die SS-Chargen beschreiben ihre damalige Tätigkeit, wie es die Taktik ihrer Verteidigung fordert. Das ist ihr gutes Recht. Trotzdem gesteht man ihnen nicht gern zu, dass es ihnen so leichtfällt, in ihrem Dienstplan-Jargon zu verbleiben. Und man weiß noch nicht einmal sicher, ob sie diesen Jargon benutzen, weil in ihm die Verantwortlichkeit des Einzelnen so gut wie unauffindbar ist, oder ob sie wirklich keine eigene Sprache haben für ihre Erinnerung an Auschwitz.
Was Auschwitz war, wissen nur die «Häftlinge». Niemand sonst. Wenn ein ehemaliger «Häftling» im Gerichtssaal nicht weitersprechen kann, wenn er Mühe hat, die ehemaligen Quäler überhaupt anzuschauen, um einen zu erkennen, wenn er wie unter Zwang Redewendungen seiner Folterer wiederholt, Sätze, zwanzig Jahre alt, auch Sätze von Gefolterten, wenn ein paar Minuten lang das Gedächtnis seinen schlimmen Stoff einfach und unverarbeitet hergibt, dann wird ein wenig von Auschwitz real. Der Zeuge Johann Wrobel sagte im Prozess gegen die Chargen von Sachsenhausen: «Als ich im Fernsehen Sorge und Schubert wiedersah, musste ich weinen.» Es ist nicht Schuld der SS-Chargen, sondern die Art unseres menschlichen Gedächtnisses, dass die SS-Chargen nicht weinen müssen, wenn sie die ehemaligen «Häftlinge» jetzt wiedersehen. Unser Gedächtnis arbeitet zwar schwer durchschaubar weiter an unseren Erfahrungen, die es aufnimmt, aber wenn wir uns an eine Situation erinnern, so liefert uns das Gedächtnis zuerst einmal ein Abbild unserer damaligen Rolle in der Situation. Dann können wir, nach neueren Einsichten, unsere Rolle manipulieren, wir können sie bedauern, verleugnen, widerrufen. Aber eine wirkliche Macht über uns können diese Kommentare, die wir dem Gedächtnisstoff jetzt beigeben, nicht erringen. Deshalb sollte man sich nicht zu sehr darüber wundern, dass die Angeschuldigten oft lächeln oder fast ironisch wirkende Antworten geben. Das ist nicht Zynismus. Sie können auch heute die Auschwitz-Realität der «Häftlinge» nicht begreifen, weil ihnen ihr Gedächtnis ein ganz anderes Auschwitz aufbewahrt hat; ihr Auschwitz nämlich, das der SS-Chargen.
Auschwitz ist aber seiner «Häftlinge» wegen wichtig geworden, das an den «Häftlingen» Begangene ist der Prozessstoff und unsere nationale Schwierigkeit. Und eben von dieser Realität des Lagers wissen wir noch weniger als von der der SS-Leute. Die Situation dieser absoluten Rechtlosigkeit ist uns einfach nicht vorstellbar. Weil wir uns also nicht hineindenken können in die Lage der «Häftlinge», weil das Maß ihres Leidens über jeden bisherigen Begriff geht und weil wir uns deshalb auch von den unmittelbaren Tätern kein menschliches Bild machen können, deshalb heißt Auschwitz eine Hölle, und die Täter sind Teufel. So könnte man sich erklären, warum immer, wenn von Auschwitz die Rede ist, solche aus unserer Welt hinausweisenden Wörter gebraucht werden.
Nun war aber Auschwitz nicht die Hölle, sondern ein deutsches Konzentrationslager. Und die «Häftlinge» waren keine Verdammten oder Halbverdammten eines christlichen Kosmos, sondern unschuldige Juden, Kommunisten und so weiter. Und die Folterer waren keine phantastischen Teufel, sondern Menschen wie du und ich. Deutsche oder solche, die es werden wollten.
Unsere mangelnde Erfahrung und das Übermaß des Begangenen sind sicher ein Grund dafür, dass wir uns Auschwitz mit solchen Wörtern vom Halse halten. Man kapituliert einfach vor so viel «Unmenschlichkeit». Dann sammelt man Zitate nach Maßgabe der darin spürbaren Brutalität. Die Bedingungen, die diese Brutalität ermöglichten, sind viel zu farblos, viel zu sehr im Historischen, im Politischen, im Sozialen zu Hause, also entschwinden sie uns vor dem saftigen Inbegriff eines SS-Mannes, den wir zur Bestie stilisieren. Ebenso wenig kommt es uns ja bei Dante auf die Bedingungen an. Wir lösen die puren Scheußlichkeiten aus ihrem Zusammenhang, machen Dante zu einem Meister des Brutalen, dadurch wird er brauchbar zur Beschreibung der Scheußlichkeiten von Auschwitz, die uns auch erscheinen als Scheußlichkeiten an sich, als pure Brutalität. Aber wenn wir schon Dante und die christliche Hölle bloß der Effekte wegen plündern und fälschen, so sollten wir doch ein bisschen genauer sein, wenn es um Auschwitz geht. Da spielen die Bedingungen eine zu große Rolle, da sind es überhaupt die Bedingungen, die Auschwitz unter uns ermöglichten. Wie Auschwitz für die «Häftlinge» war, werden wir nie verstehen. Aber was geschah, dass es für diese «Häftlinge» ein Auschwitz gab, das sollte nicht in einer Flucht zu phantastischen Umschreibungen – halb Bild-Zeitung, halb Dante – verlorengehen.
Auschwitz ist überhaupt nichts Phantastisches, sondern eine Anstalt, die der deutsche Staat mit großer Folgerichtigkeit entwickelte zur Ausbeutung und Vernichtung von Menschen. Wenn man mit wehleidiger Lust (die sich auch als nationaler Protest äußern kann) in der Zeitung die brutalen Fakten zur Kenntnis nimmt, vergisst man leicht, dass all diese mittelalterlich bunten Quälereien eher gegen das System veranstaltet wurden. Unsere Nationalsozialisten waren ja erst am Anfang. Persönliche Grausamkeit hätte über kurz oder lang kaum mehr eine Rolle spielen dürfen. «Fleißaufgaben» nannte der ehemalige «Häftling» Dr. Wolken die grausamen Praktiken der SS-Chargen. Man vergisst angesichts der einprägsamen Folterer, dass das schlechtere Idealisten waren als die besseren Idealisten, die das System entworfen hatten. Es sollte wirklich, wie Ossietzky sah, die «Zeit des desinfizierten Marterpfahls» werden.