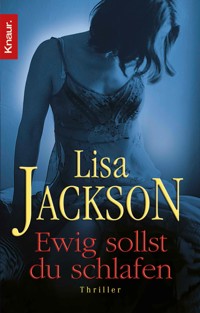
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Um sie herum herrscht tiefe Dunkelheit. Ein süßlicher, unangenehmer Geruch nimmt ihr fast den Atem, als die junge Frau aus tiefer Bewusstlosigkeit erwacht. Gedämpft hört sie das Prasseln von Erde und ein grausames Lachen – und erkennt in plötzlicher Panik, dass sie lebendig begraben wird. Sie wird nicht das letzte Opfer des sadistischen Killers bleiben. Dessen verstörende Taten sind für die Journalistin Nikki Gillette zunächst nichts weiter als neuer Stoff für die Titelseiten. Sie ahnt noch nicht, dass der Mörder einen kranken Plan verfolgt, in dem sie eine Schlüsselrolle spielt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Lisa Jackson
Ewig sollst du schlafen
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Hartmann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Um sie herum herrscht tiefe Dunkelheit. Ein süßlicher, unangenehmer Geruch nimmt ihr fast den Atem, als die junge Frau aus tiefer Bewusstlosigkeit erwacht. Gedämpft hört sie das Prasseln von Erde und ein grausames Lachen – und erkennt in plötzlicher Panik, dass sie lebendig begraben wird. Sie wird nicht das letzte Opfer des sadistischen Killers bleiben.
Dessen verstörende Taten sind für die Journalistin Nikki Gillette zunächst nichts weiter als neuer Stoff für die Titelseiten. Sie ahnt noch nicht, dass der Mörder einen kranken Plan verfolgt, in dem sie eine Schlüsselrolle spielt …
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
Epilog
Danksagung
Prolog
Himmel, es war kalt … so kalt …
Bobbi fröstelte. Sie war benommen, konnte sich kaum rühren, ihr Bewusstsein träge und wie betäubt. Sie wollte schlafen, wollte das verschwommene, nagende Gefühl des Unbehagens ignorieren. Ihre Lider waren schwer. Als hätte sie zu viele Schlaftabletten geschluckt. Ein stechender Geruch drang ihr in die Nase, ein Geruch nach Fäulnis. Sie verzog angewidert das Gesicht. Sie bemerkte, dass es still in ihrem Zimmer war. Absolut still. Auf gespenstische Weise. Kein Geräusch von der Uhr im Flur drang herein, die sonst stetig tickte, oder von der Heizungslüftung … Die Stille war ohrenbetäubend.
Du bist nicht in deinem Zimmer.
Der Gedanke traf sie wie ein Schlag vor den Kopf.
Du bist nicht in deinem Bett.
Sie zwang sich, die Lider zu heben. Wo war sie?
Der modrige Gestank ließ sie würgen. Ganz allmählich kam sie zu sich. Wo zum Teufel befand sie sich, und warum konnte sie sich nicht bewegen? Sie spürte einen Druck auf den Lungen, die Luft war dünn, die Dunkelheit undurchdringlich. Als ihr klar wurde, dass sie auf dem Rücken lag, eingequetscht von etwas Hartem, erfasste sie Panik. Glatter Stoff wurde gegen ihre Nase gepresst.
Es war dunkel. Sie bekam keine Luft, konnte kaum atmen. Und dieser entsetzliche Gestank … Sie musste sich beinahe übergeben.
Hier stimmte etwas nicht, absolut nicht.
Sie versuchte, sich zum Sitzen aufzurichten.
Sie stieß mit dem Kopf an und konnte die Arme nicht zu Hilfe nehmen. Sie ließen sich weder nach oben noch zur Seite ausstrecken. Sie war in einen engen Raum gepfercht, lag auf einem unbequemen Bett … nein, das war kein Bett, es fühlte sich weicher an, schwammig und rutschig, mit harten Stellen, die ihr in den Rücken stachen. Und dieser grauenhafte Modergeruch. Angst, wie Bobbi sie noch nie empfunden hatte, fuhr in ihr noch immer benebeltes Gehirn. Sie steckte in einer Art enger Kiste.
Und dann wusste sie es.
Sie lag in einem Sarg!
Gott, nein, das war unmöglich! Undenkbar. Sie war nur noch benommen. Und die klaustrophobische Panik war Teil eines merkwürdigen, makabren Traums. Das war alles. Das musste alles sein. Dennoch raste ihr Puls. Der Schrecken hatte sie fest im Griff.
Nein, o nein … bitte nicht … das muss doch ein Traum sein. Wach auf, Bobbi. Um Himmels willen, wach doch endlich auf!
Sie schrie, und der markerschütternde Ton hallte ihr in den Ohren, konnte nicht heraus, eingeschlossen in den engen, luftlosen Raum.
Einen klaren Kopf behalten. Nicht in Panik geraten! O Gott, o Gott!
Verzweifelt versuchte sie, nach oben zu treten, doch ihr bloßer Fuß stieß gegen die harte Oberfläche, ein Zehennagel verhakte sich in der Auskleidung. Das Bein prallte zurück. Unbändiger Schmerz schoss durch ihren Fuß, und sie spürte, dass der Zehennagel nur noch an einem Fetzen Fleisch hing.
Das konnte unmöglich Wirklichkeit sein. Es war ein Albtraum. Und doch … mit aller Macht versuchte sie, sich hochzustemmen, aus dieser furchtbaren Enge mit der seidenen Auskleidung zu steigen und … und … Herrgott, sie lag auf etwas, das stellenweise weich war und dann wieder hart … ein … eine …
Eine Leiche! Du liegst auf einer Leiche!
»Neeeiiin! Lasst mich raus, bitte!« Sie zerfetzte die Auskleidung mit den bloßen Fingern, kratzte und hämmerte, spürte Knochen und faulendes Fleisch und trockenes Haar an ihrer nackten Haut … an ihrer nackten Haut! Lieber Himmel, war sie etwa nackt? Unbekleidet in diese grauenhafte Kiste gesperrt? Wer hatte ihr das angetan? Und warum? »Hilfe! Bitte helft mir!« Ihre Schreie wurden von den engen Wänden zurückgeworfen. »O Gott … bitte, jemand muss mir helfen.« Lag sie wirklich auf einem Toten? Ihr ganzer Körper überzog sich mit einer Gänsehaut bei dem Gedanken an das vermodernde Fleisch unter ihr, an den lippenlosen Mund, der sich in ihren Nacken presste, an die knochigen Rippen und Hände, die …
Vielleicht lebt derjenige noch – ist nur betäubt, wie du es warst.
Doch sie wusste es besser. Der Mensch unter ihr war eiskalt und stank, er verweste offenbar bereits und … o bitte, lass das nur ein entsetzlicher, monströser Albtraum sein! Bitte mach, dass ich aufwache. Sie hörte ein Schluchzen und begriff, dass es aus ihrer Kehle kam. Nicht in Panik geraten. Versuch, einen Ausweg zu finden … solange du noch Luft zum Atmen hast. Dass du noch atmest, muss doch bedeuten, dass du erst seit kurzem hier bist. Die Tatsache, dass du in einem Sarg liegst, heißt nicht zwangsläufig, dass du unter der Erde bist … Doch sie konnte die feuchte Erde riechen, wusste, dass diese Kiste bereits in ein Grab gesenkt worden war. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie –
Hör auf damit und überleg dir lieber, wie du hier rauskommst! Du bist eine intelligente Frau, also denk nach! DENK NACH! Falls man dich nicht begraben, sondern nur in diese Kiste gesperrt hat, hast du vielleicht noch eine Chance … Doch sie ahnte, dass die Zeit ablief, dass jede Sekunde, die verging, sie einem makabren, unvorstellbaren Tod näher brachte. Bitte, Gott, lass mich nicht sterben. Nicht so … nicht … nicht so!
»Hilfe! Hilfe! HILFE!«, schrie sie gellend und schluchzte wie von Sinnen. Sie kratzte wild am Deckel des Sargs. Sie zerrte abermals an der glatten seidenen Auskleidung, ihre langen, manikürten Fingernägel brachen ab, die Haut riss auf, stechender Schmerz durchzuckte ihre Handrücken. Der Gestank war unerträglich, die Luft so kalt und dünn … Das konnte doch nur ein Traum sein. Aber die Schmerzen in ihren Fingern, das Blut, das fühlbar unter ihren Nägeln hervorquoll, überzeugten sie davon, dass sie diesen grauenhaften Albtraum wirklich erlebte.
Entsetzen schnürte ihr die Kehle zu, und sie glaubte, ohnmächtig zu werden. Sie schrie aus Leibeskräften, sie trat um sich, stieß mit Knien und Füßen an, ihre Muskeln verkrampften sich. Ihre bloße Haut war abgeschürft und blutig, Tränen strömten aus ihren Augen. »Lasst mich nicht so sterben, bitte, o bitte, lasst mich nicht so sterben …«
Doch die Dunkelheit wollte nicht weichen. Der glitschige Leib unter ihr regte sich nicht, sie spürte erneut das modrige Fleisch und die spitzen Rippen, die sich in ihren Rücken bohrten. Sie schauderte, war kurz davor, sich zu erbrechen, und kreischte wie nie zuvor in ihrem Leben.
Über ihre eigenen Schreie hinweg hörte sie ein dumpfes Poltern von Erde und Steinen, die auf den Sarg herabstürzten. Das Blut gefror ihr in den Adern.
»Nein! Nein!«
Sie hämmerte gegen den Deckel, bis ihre Fäuste bluteten und brannten, und flehte und weinte unentwegt. »Lasst mich raus! Bitte! Bitte!«
Wer tat ihr das an?
Warum … o Gott, warum nur … Wem hatte sie etwas derart Schreckliches zugefügt, dass er diese Rache an ihr nahm? Es gab viele, die sie belogen hatte, ihre Gesichter tanzten vor ihrem inneren Auge. Aber wer hasste sie so sehr, dass er sie auf diese Weise quälte? Wer hatte einen Grund dazu? Wer konnte so grausam sein?
Sie keuchte, es war kaum noch Atemluft vorhanden. Sie war im Begriff, die Besinnung zu verlieren. Ihre Gedanken drehten sich verzweifelt um die Männer in ihrem Leben und insbesondere um einen, der sich vermutlich nicht einmal an ihren Namen erinnerte und dem sie übel mitgespielt hatte.
Pierce Reed.
Detective bei der Polizei von Savannah.
Ein Ehrenmann, der dennoch dunkle Geheimnisse hütete.
Nein … Reed würde ihr so etwas nicht antun; er wusste ja gar nicht, wie eng ihrer beider Leben miteinander verknüpft waren, und es war ihm gewiss auch egal.
Es musste ein anderer Mann sein, ein Ungeheuer, das sie hier in seiner Gewalt hatte.
Sie begann zu zittern.
»Lass mich raus! Lass mich raus!«, schrie sie und schluchzte mit schmerzender Kehle, geschüttelt von unsäglichem Grauen bei dem Gedanken an den verwesenden Menschen, der ihr als Bett diente. »Bitte, bitte, lass mich hier raus … Ich tu alles … alles, o bitte, tu mir das nicht an …«
Aber sie wusste nicht einmal, wen sie da anflehte, und unentwegt regnete es schaufelweise Erde und Kies in ihr Grab.
Sie rang nach Luft, nach dem bisschen Luft, das noch vorhanden war. Der Mangel an Sauerstoff machte sich bemerkbar, und ihre Lungen brannten. Plötzlich fühlte sie sich schwach.
Hilflos.
Zum Sterben verdammt.
Sie unternahm einen letzten vergeblichen Versuch, sich mit bloßen Händen aus ihrem Gefängnis zu befreien, doch es war sinnlos. Die Dunkelheit umfing sie erbarmungslos, presste den Kampfgeist, das Leben aus ihr heraus, und sie ließ die Hände sinken. Das sollte also ihr Grab sein. Bis in alle Ewigkeit.
Durch die gespenstische Stille hörte sie Gelächter. Es klang, als käme es aus weiter Ferne, doch sie wusste, dass es ihr galt. Er wollte, dass sie es wusste. Sie sollte ihn hören, bevor sie ihren letzten Atemzug tat.
Wer auch immer ihr dies zugefügt hatte, genoss seine Tat.
1. Kapitel
Dieser Scheißkerl will mich noch einmal vor Gericht zerren!« Morrisette stürmte in Reeds Büro und knallte ein paar Gerichtsunterlagen auf die Ecke seines Schreibtisches. »Kannst du dir das vorstellen?«, wollte sie wissen, und die gedehnte Aussprache der Westtexanerin trat nun, da sie wütend war, noch deutlicher zutage. »Bart will seine Unterhaltszahlungen um dreißig Prozent kürzen!«
Bart Yelkis war Sylvie Morrisettes vierter Exmann und Vater ihrer zwei Kinder. Solange Reed bei der Polizei von Savannah arbeitete, lagen Sylvie und Bart im Clinch bezüglich der Erziehung ihrer Kinder Priscilla und Toby. Sylvie war zäh wie altes Leder und hielt kaum jemals ihre spitze Zunge im Zaum. Sie rauchte, trank und fuhr Auto, als wollte sie sich fürs Indy 500 qualifizieren, fluchte wie ein Seemann und kleidete sich, als ginge sie auf die zwanzig zu und nicht auf fünfunddreißig. Doch in allererster Linie war sie Mutter. Nichts brachte sie mehr in Rage als Kritik an ihren Kindern.
»Ich dachte, er zahlt regelmäßig.«
»Hat er auch, aber nur für kurze Zeit. Ich hätte es wissen müssen. Es war einfach zu schön, um wahr zu sein, verdammt noch mal. Warum zum Teufel kann der Kerl kein anständiger Vater sein, he?« Sie ließ ihre große Handtasche zu Boden fallen und warf Reed einen Blick zu, der in ihm auf der Stelle die Überzeugung weckte, dass alle Männer in Morrisettes Leben als absolute Loser zu betrachten waren. Morrisette stand in dem Ruf, eine hartgesottene Frau zu sein, fest entschlossen, in einem Männerberuf zu bestehen, eine aufbrausende, äußerst schlagfertige Frau mit wenig salonfähigen Ansichten, ohne eine Spur von Toleranz für ihre Kollegen. Ihre Sprache war mindestens so unflätig wie die jedes beliebigen Detectives im Dezernat. Sie trug Stiefel aus Schlangenleder, und zwar keineswegs von der Stange, und eine platinblonde Igelfrisur, die aussah, als hätte Billy Idol sie fabriziert. Und ihr Auftreten ließ jeden Punker zweimal überlegen, ob er sich mit ihr anlegen wollte. Reed hatte schon so manchen mitleidigen Blick von anderen Bullen einstecken müssen, die ihn wegen seines Pechs bedauerten, eine solche Partnerin abbekommen zu haben. Nicht, dass es ihn störte. Während der kurzen Zeit seit seiner Rückkehr nach Savannah hatte er gelernt, Sylvie Morrisette zu respektieren, selbst wenn er bei mancher Gelegenheit das Gefühl hatte, auf dünnem Eis zu gehen. An diesem Morgen war ihr Gesicht von einer tiefen Röte überzogen, und sie sah aus, als könnte sie Feuer speien.
»Darf er das einfach so – die Zahlungen kürzen?« Reed war mit dem Öffnen seiner Post beschäftigt, legte den Brieföffner jetzt jedoch auf den von Papierkram übersäten Schreibtisch.
»Wenn er ein Weichei von Richter findet, der ihm seine erbärmliche Mitleidstour abkauft. Bart hat seinen Job verloren, na und? Da muss er eben den Arsch hochkriegen und sich eine andere Art von einträglicher Beschäftigung suchen – verstehst du, wie normale Menschen es nun mal tun. Stattdessen meint er, dass ich und die Kinder zurückstecken sollen.« Sie verdrehte die Augen und straffte ihre zierliche Gestalt, von den abgelatschten Absätzen ihrer Stiefel bis hin zu ihrem blonden Igel. Sie war ganz schön in Fahrt. »Scheißkerl. Was anderes ist er nun mal nicht. Ein waschechter verdammter Scheißkerl mit Visitenkarte.« Sie stapfte zum Fenster und blickte finster hinaus in den grauen Winter über Savannah. »Himmel, es ist ja nicht so, dass er Millionen für uns abdrücken müsste. Und sie sind seine Kinder. Seine Kinder. Er beklagt sich ständig, dass er sie nicht oft genug sieht, will aber am liebsten keinen müden Cent für sie zahlen!« Sie stampfte mit dem Stiefel auf und fluchte leise. »Ich brauch was zu trinken.«
»Es ist neun Uhr morgens.«
»Wen stört’s?«
Reed störte es nicht sonderlich. Morrisette war bekannt für ihre bühnenreifen Auftritte, besonders, wenn es um ihre Kinder oder um einen ihrer vier Exmänner ging. Ihr traumatisches Privatleben bestärkte ihn in seinem Vorsatz, ledig zu bleiben. Ehegatten bedeuteten Probleme, und Bullen brauchten nicht noch mehr Probleme, als sie ohnehin schon hatten. »Kannst du dich nicht wehren?« Reed leerte seinen lauwarmen Kaffee, zerdrückte den Pappbecher und warf ihn in den übervollen Mülleimer.
»Doch, aber das kostet. Dann brauche ich einen verdammten Anwalt.«
»In der Stadt wimmelt es von Anwälten.«
»Das ist ja das Problem. Bart hat eine Freundin, die ihm noch einen Gefallen schuldet – und die ist Anwältin. Die hat er angeheuert, und sie hat eine Eingabe gemacht oder wie immer das heißt. Eine Frau. Ist das zu fassen? Wo bleibt da die Solidarität, he? Das würde ich gern mal wissen. Besteht zwischen Frauen denn nicht angeblich eine Art generelle Übereinstimmung, die verbietet, dass man einer anderen Frau einfach den Unterhalt in Grund und Boden stampft?«
Von diesem Thema ließ Reed wohlweislich die Finger. Soweit er wusste, verhielt sich auch Morrisette oft nicht gerade solidarisch. Sie trampelte mit der immer gleichen Rücksichtslosigkeit über Männlein wie Weiblein hinweg. Er nahm wieder den Brieföffner zur Hand und schlitzte einen schlichten weißen Umschlag auf, adressiert an die Polizeibehörde von Savannah, zu seinen Händen. Sein Name war in Blockbuchstaben geschrieben: DETECTIVE PIERCE REED. Die Absenderadresse kam ihm bekannt vor, doch er konnte sie im Moment nicht einordnen.
»Das war’s dann also«, schimpfte Morrisette. »Die Zukunft meiner Kinder geht den Bach runter, weil Bart diesem Weibsstück vor ein paar Jahren einen Zaun für ihre Hunde gebaut hat. Rums – und sie kürzt mir den sowieso schon lächerlich knappen Unterhalt.« Morrisette kniff die Augen zu Schlitzen zusammen. »Weißt du, es müsste ein Gesetz geben. Haben die Typen in juristischen Berufen – und ich benutze diesen Begriff im weitesten Sinne – nichts Besseres zu tun, als blödsinnige Klagen durchzuboxen, die kleine Kinder um den Unterhalt ihres Vaters bringen?« Sie fuhr sich wild mit den Fingern durch das ohnehin schon zerzauste Haar, dann rauschte sie zurück zu ihrem Schreibtisch und griff nach ihren Akten. Während sie sich auf den Drehstuhl fallen ließ, fügte sie hinzu: »Schätze, ich werde in Zukunft Überstunden schieben, und zwar jede Menge.«
»Du schaffst das schon.«
»Fick dich«, fauchte sie. »Das Letzte, was ich von dir erwartet habe, sind solche Plattheiten, Reed. Also halt’s Maul.«
Er unterdrückte ein Lächeln. »Wie du willst.«
»Genau das will ich.« Aber sie schien sich ein wenig zu beruhigen.
»Klag doch einfach mehr Unterhalt ein. Dreh den Spieß um.«
»Glaubst du, das wäre mir nicht auch schon in den Sinn gekommen? Aber hier trifft die alte Redensart zu, dass man einem nackten Mann nicht in die Tasche greifen kann.«
Reed blickte zu ihr hinüber und grinste. »Vielleicht kommt wirklich nichts dabei heraus, aber es könnte doch Spaß machen.«
»Reden wir nicht mehr darüber.«
»Du hast angefangen«, erinnerte er sie und zog ein einzelnes weißes Blatt Papier aus dem Umschlag.
»Erinnere mich nicht daran. Ich habe eben Pech mit Männern.« Sie schnaubte durch die Nase. »Wenn ich schlau wäre, würde ich ins Kloster gehen.«
»O ja, das würde es bringen«, spottete Reed. Er faltete das Blatt auseinander. Es enthielt nichts weiter als ein paar Zeilen in den gleichen säuberlichen Blockbuchstaben wie die Adresse auf dem Umschlag:
EINS, ZWEI,DIE ERSTEN PAAR.HÖR SIE SCHREIEN,HORCH, WIE SIE STERBEN.
»Was zum Teufel soll das?«, murmelte Reed.
Morrisette war unverzüglich auf den Füßen. Sie umrundete den Schreibtisch und studierte den schlichten Schrieb. »Ein Scherz?«
»Vielleicht«, brummte er.
»Oder eine Warnung?«
»Wovor?«
»Ich weiß es nicht. Was meinst du? Ist das hier ein harmloser Irrer oder ein ausgewachsener Psychopath?« Sie runzelte die Stirn, schien ihre Sorgen wegen gerichtlich angeordneter Kürzung der Unterhaltszahlungen für ihre Kinder vergessen zu haben. »›Horch, wie sie sterben‹, das gefällt mir nicht. Himmel, es gibt schon ein paar echt Perverse auf der Welt.« Sie betrachtete zuerst den Bogen, dann den Umschlag. »Direkt an dich adressiert.« Mit schmalen Augen spähte sie auf den Poststempel. »Hier aus Savannah. Und der Absender … das ist eine Adresse unten an der Abercorn … Mann, gleich hier um die Ecke.«
»Colonial Cemetery«, sagte Reed, dem es in diesem Moment wieder einfiel.
»Der Friedhof. Wer schickt denn einen Brief vom Friedhof aus?«
»Irgendein Spinner. Dieser Brief ist ein blöder Witz«, sagte er stirnrunzelnd. »Irgendwer hat was über den Montgomery-Fall gelesen und will mich verarschen.« Im vergangenen Sommer war er einem Mörder auf der Spur gewesen, der einen Rachefeldzug gegen die Familie Montgomery unternahm. Seitdem hatte Reed sehr viel Beachtung von der Presse bekommen. Zu viel von der Art von Publicity, die er verabscheute. Ihm war die Lösung des Falls zu verdanken, und deswegen betrachtete man Pierce Reed plötzlich als Helden und Experten, dem andere Dezernate und Reporter, die den Fall immer wieder aufwärmen wollten, und selbst der Oberstaatsanwalt von Atlanta nachstellten. Seit er Atropos überführt hatte, eine Frau, die entschlossen gewesen war, eine der vermögendsten und berüchtigtsten Familien von Savannah auszulöschen, nahm sein Ruf übertriebene Dimensionen an, und sein Privatleben wurde unentwegt auseinander genommen und kommentiert.
Während der vergangenen sechs Monate war er entschieden häufiger, als ihm lieb war, zitiert, fotografiert und interviewt worden. Er hatte nie gern im Rampenlicht gestanden und immer bewusst zurückgezogen gelebt. Er hatte selbst ein paar Leichen im Keller, Geheimnisse, die er lieber für sich behielt, aber die hatte schließlich jeder. Reed wäre seinem Beruf lieber weiterhin ohne die Belastungen des Ruhms nachgegangen. Er verabscheute all das Interesse, besonders vonseiten der Reporter, die seine Vergangenheit zu faszinieren schien und die sich offenbar zum Ziel gesetzt hatten, jede kleinste Information über ihn zu sammeln und die Welt wissen zu lassen, was für ein Typ Pierce Reed war. Als ob sie auch nur die geringste Ahnung hätten … Er hob den Brief und den Umschlag mit einem Taschentuch auf und kramte einen Plastikbeutel aus seiner Schreibtischschublade. Behutsam schob er Brief und Umschlag hinein.
»Ich glaube nicht, dass was dahintersteckt, aber man kann ja nie wissen. Ich bewahre das lieber auf, falls es vielleicht doch noch als Beweismaterial gebraucht wird.«
»Beweismaterial wofür? Dass da draußen ein weiterer Verrückter frei herumläuft?«
»Irgendein Verrückter läuft immer frei herum. Ich behalte es nur für alle Fälle und schicke ein Rundschreiben übers lokale System und über NCIC, um abzuchecken, ob irgendeine andere Behörde im Land etwas Ähnliches gekriegt hat.« Er fuhr seinen Computer hoch und loggte sich in das vom FBI betriebene National Crime Information Center ein. »Vielleicht landen wir ja einen Glückstreffer«, sagte er zu Morrisette. »In der Zwischenzeit mache ich Pause und geh rüber zum Friedhof.«
»Meinst du, du findest da was?«
»Nein, eigentlich nicht. Aber man kann nie wissen.« Er schob die Hände durch seine Jackenärmel. »Wie ich schon sagte, wahrscheinlich ist es nur ein Spinner. Einer, den es anmacht, eine verschwommene Drohung gegen die Polizei loszulassen.«
»Nicht gegen die Polizei. Dieser Spinner hat es genau auf dich abgesehen.« Sylvie rückte ihr Schulterhalfter zurecht. »Ich komme mit.«
Er widersprach nicht, es wäre sinnlos gewesen. Sylvie gehörte zu der Art Bullen, die ihren Instinkten folgten und Regeln außer Acht ließen – zu der Art starrsinniger Frauen, denen kein Mensch eine einmal getroffene Entscheidung ausreden konnte. Er ließ den Plastikbeutel in eine Aktenschublade gleiten.
Sie verließen das Gebäude durch eine Seitentür, und der kalte Winterwind schlug Reed hart ins Gesicht. Das Wetter, im Dezember gewöhnlich mild, war momentan grässlich, Folge eines Kälteeinbruchs an der Ostküste, der bis in den Süden die Ernte gefährdete. Während sie die paar Häuserblocks am Columbia Square vorbeischritten, gelang es Morrisette, sich im Kampf gegen die steife Brise eine Zigarette anzuzünden. Der Colonial Cemetery, der älteste Friedhof in Savannah, war die letzte Ruhestätte von über siebenhundert Opfern der Gelbfieber-Epidemie im neunzehnten Jahrhundert und Schauplatz zahlreicher Duelle in vergangenen Zeiten. General Sherman hatte das Landstück während des Bürgerkriegs beziehungsweise des Aggressionskriegs der Nordstaaten, wie viele Einheimische ihn nannten, als Lagerplatz genutzt. Schatten spendende Bäume, im Augenblick allerdings unbelaubt, schienen im Wind zu zittern, und trockene Blätter fegten über die Wege zwischen den alten Grabsteinen und historischen Gedächtnistafeln, wo nach Auffassung vieler Menschen noch immer Gespenster hausten.
Nach Reeds Meinung war das alles Quatsch. Und obwohl dunkle, dicke Wolken über diese Begräbnisstätte hinwegzogen, wirkte sie an diesem Morgen eher wie ein Park denn wie ein Friedhof.
Nur wenige Fußgänger schlenderten zwischen den Grabsteinen umher, und nichts an ihnen war verdächtig. Ein älteres Paar ging Hand in behandschuhter Hand und studierte die Inschriften, drei Teenager, die wahrscheinlich in der Schule hätten sein müssen, rauchten und drängten sich flüsternd zusammen, und eine Frau mittleren Alters, eingemummelt in Skimütze, Parka und Wollhandschuhe, führte einen Hund von der Größe einer Ratte in einem affigen kleinen Pullover spazieren und zerrte an der Leine, da er immer wieder versuchte, an jedem einzelnen alten Grabstein zu schnuppern. Niemand lauerte hinter einem Busch, kein einziges Grab wies Spuren von Vandalismus auf, kein Auto mit getönten Scheibe fuhr auffällig langsam vorüber.
»Haben wir eigentlich nichts Besseres zu tun?«, fragte Sylvie, bemüht, ihre Zigarette nicht ausgehen zu lassen. Sie sog heftig am Filter.
»Nein, könnte man meinen.« Dennoch ließ Reed den Blick über trockenes Gras und verwitterte Grabsteine schweifen. Er dachte an die Fälle, die er im Moment bearbeitete. In einem ging es schlicht und ergreifend um häusliche Gewalt. Eine zwanzigjährige Ehefrau war endlich zu dem Schluss gekommen, dass das Maß voll war, und bevor sie noch ein Veilchen oder eine angeknackste Rippe riskierte, hatte sie ihren Mann im Schlaf kurzerhand erschossen. Ihr Anwalt plädierte auf Notwehr, und Reeds Aufgabe bestand darin, das Gegenteil zu beweisen – was nicht sonderlich schwierig war, ihm aber kein gutes Gefühl vermittelte. Ein anderer Fall betraf den Mord-plus-Selbstmord-Pakt eines Pärchens, in diesem Fall zweier schwuler Jungen, der eine siebzehn, der andere fast zwanzig Jahre alt. Der mit dem Finger am Abzug, der Jüngere der beiden, rang im Krankenhaus noch immer mit dem Tod. Falls er durchkam, drohte ihm eine Mordanklage. Der dritte dieser jüngsten Mordfälle war nicht so klar. Vor zwei Tagen war eine Leiche aus dem Savannah River gezogen worden. Nicht zu identifizieren; von der Frau war nicht viel übrig. Ein Lieschen Müller unter vielen. Niemandem schien sie zu fehlen, kein Hinweis in den Vermisstenakten auf eine Schwarze von, wie der Gerichtsmediziner sagte, etwa dreißig Jahren, Blutgruppe 0 positiv, zahlreiche Zahnbehandlungen, eine Geburt.
Ja, er hatte weiß Gott Besseres zu tun. Doch als sein Blick über den Friedhof schweifte, der die letzte Ruhestätte von vor zweihundertfünfzig Jahren gestorbenen Einwohnern Savannahs war, da überkam ihn das beunruhigende Gefühl, dass der merkwürdige Brief nicht das Letzte war, was er von seinem Verfasser hörte.
Eins, zwei, die ersten paar. Hör sie schreien, horch, wie sie sterben.
Was zum Teufel sollte das heißen?
Er würde es zweifellos bald erfahren.
»Ich hab ihn gesehen«, versicherte Billy Dean Delacroix aufgeregt. Im kalten Wind traten die Pickel in seinem Gesicht in noch kräftigerem Rot hervor. Er war fünfzehn und ein Draufgänger. »Der olle Bock ist da den Hügel rauf. Aber der kommt nicht weit. Ich hab ihn getroffen, ganz bestimmt. Er muss jeden Moment umfallen. Ich hab seinen weißen Schwanz gesehen, nu komm schon, Pres!« Billy Dean schoss davon wie eine Rakete, galoppierte so leichtfüßig wie ein erfahrener Spurenleser durchs dichte Unterholz, begleitet von dem schlappohrigen Hund seines Vaters.
Prescott Jones, Billys Cousin zweiten Grades, sechs Monate älter und fünfundzwanzig oder dreißig Kilo schwerer, hatte Mühe, Schritt zu halten. Während er dem alten Wildwechselpfad folgte, der sich am Ufer des Bear Creek entlangwand, zerrten Brombeerranken an seiner alten Jeans und zerfetzten den Stoff, zerkratzten sein Gesicht und rissen ihm beinahe die Brille von der Nase. Ein Waschbär spähte durch seine schwarze Augenmaske, suchte schleunigst das Weite und versteckte sich tief im Dorngestrüpp. Am Himmel zog ein Falke gemächlich seine Kreise.
Als Prescott die Hügelkuppe erreicht hatte, war er völlig außer Atem, er schwitzte unter seiner Jägerjoppe und dem alten Thermohemd seines Pas. Billy Dean, von Kopf bis Fuß in Tarnklamotten gekleidet, war nirgends zu sehen. Der hässliche rötliche Hund auch nicht.
»Verdammte Scheiße«, brummte Prescott und rang keuchend nach Luft. Manchmal konnte Billy Dean so ein Arschloch sein, zum Beispiel wenn er ihm einfach davonrannte. Er hätte gern gewusst, ob Billy den Bock wirklich getroffen hatte. Wahrscheinlich war es doch nur ein Streifschuss, und sie konnten dem Mistvieh noch meilenweit hinterherrennen.
Prescott entdeckte ein paar rote Flecken im dürren Gras am Weg, und das reichte aus für einen Sinneswandel. Also war das Reh doch schwer verwundet. Gut. Sehr lange hielt er dieses ziellose Gerase durchs Gestrüpp nämlich nicht mehr aus. Um die Wahrheit zu sagen: Prescott liebte alles an der Jagd, bis auf das eigentliche Stellen der Beute. O ja, es machte ihm genauso viel Spaß wie jedem anderen Jungen, ein Eichhörnchen, einen Bock oder einen Fuchs abzuschießen. Er hatte sogar schon davon geträumt, mal eigenhändig einen Bären oder einen Alligator zu erlegen und ausstopfen zu lassen, doch alles in allem war die Jagd harte Arbeit, und er zog doch bei weitem das Bier, ein bisschen Gras und hin und wieder Crack vor, was zur eigentlichen Jagd nun mal dazugehörte. Er mochte Lagerfeuer und Jägerlatein über Huren und Großwild und das Kiffen dabei. Die Jagd selbst, das Verfolgen der Beute, das Verwunden, das Ausnehmen und das Wegschleppen waren ihm eher unangenehm.
»Hey! Hier drüben! Pres! Komm schon! Hinter der Kuppe … Was zum Teufel …?« Billys Stimme kam aus einer Mulde, die tief im Schatten lag. Prescott folgte der Stimme und sah auf seinem Weg hinunter über einen überwucherten Trampelpfad ein paar mehr Blutstropfen im geknickten Gras und auf verschrumpelten Blättern. Zwischen hohen Tannen und buschigen Eichen hindurch schlitterte er hinab. Der Weg war steil, in einen Felsen gegraben, und so abschüssig, dass er in seinen Stiefeln gelegentlich ins Rutschen geriet. Prescotts Herz hämmerte wild. Mit einer schweißnassen Hand umklammerte er das Jagdgewehr seines Pas, voller Angst, dass er über den Felsen in die Tiefe stürzen könnte. Doch während des gesamten Wegs nach unten erblickte er immer wieder Blutstropfen. Vielleicht hatte Billy letztendlich doch nicht gelogen. Dass der Junge berüchtigt war für sein unverschämtes Jägerlatein, hieß ja noch lange nicht, dass er den Bock nicht waidwund geschossen haben könnte.
Prescott drängte seine Körpermassen durch ein Dickicht von Schösslingen, hinaus auf eine kleine Fläche verdorrten Grases, eine schattige Lichtung in dieser dunklen Schlucht. Die Lichtung war umgeben von struppigem Wald, daher drang kaum Sonnenlicht hinein.
Billy Dean stand neben einem Baumstumpf, dessen verkohlte Rinde auf einen Blitzeinschlag hinwies. Davor lag etwas Dunkles. Zuerst glaubte Prescott, es sei der erlegte Bock, doch als er näher kam, stellte er fest, dass er sich geirrt hatte. Und wie. Billy Dean kratzte nervös an seiner Wange, den Blick auf einen Haufen Erde und Kiesel gerichtet, der etwa zwei Meter fünfzig lang und etwas mehr als einen halben Meter breit war. Der alte Köter von Billys Dad jaulte und wieselte um den säuberlichen, unnatürlichen Hügel herum.
»Was ist das? Was hast du da gefunden?«, fragte Prescott und sah, dass der rötliche Köter die Nase in den Wind gehoben hatte.
»Das ist ein Grab.«
»Was?«
»Ein Grab, Mann, guck doch. Und groß genug für einen Menschen.«
»Nie im Leben …« Schwer atmend ging Prescott ein Stück näher heran und erkannte, dass Billy Dean Recht hatte.
Der Hund winselte, sein Fell sträubte sich zitternd.
Prescott gefiel das alles nicht. Ein Grab hier draußen in der Nähe vom Blood Mountain. Nein, das gefiel ihm ganz und gar nicht. »Was machen wir jetzt?«
»Weiß nicht.«
»Solln wir’s ausgraben?«
»Vielleicht.« Billy Dean stieß mit dem Gewehrlauf in einen weichen Erdklumpen, wofür ihm sein Daddy das Fell über die Ohren ziehen würde, wenn er ihn dabei erwischte.
Der Hund verhielt sich immer noch merkwürdig. Nervös. Jaulte und starrte über die Lichtung hinweg. »O Scheiße.«
»Was?«
Billy Dean bückte sich. »Da liegt was. Ein Ring … ein Ehering.« Er hob einen schmalen Goldreif mit mehreren Steinen auf. Billy wischte ihn an seiner Hose ab, und ein Diamant, ein ziemlich großer, blinkte im trüben Licht. Kleinere rote Edelsteine glitzerten rings um den Diamanten. Der Hund winselte erneut. »Himmel. Guck mal, wie riesig der ist. Ist bestimmt was wert.« Mit zusammengekniffenen Augen inspizierte er die Innenseite des Rings. »Da ist was eingraviert. Hör dir das an: Für Barbara. In ewiger Liebe. Und dann kommt ein Datum.«
»Wem gehört der?«
»Einer Frau, die Barbara heißt.«
»Ph! Das weiß ich auch.« Manchmal war Billy Dean so verdammt blöd. Wenn er auch rennen konnte wie eine Gazelle, nach Prescotts Meinung war er doch nicht schlauer als einer von den Mischlingshunden seines Vaters. »Aber was für eine Barbara? Und warum liegt der Ring hier rum?«
»Wen interessiert’s? Schade, wegen der Gravierung ist er vielleicht doch nicht ganz so viel wert.«
»Na und? Du hast doch wohl nicht vor, ihn zu stehlen.« Aber Prescott wusste es besser. Billy Dean hatte eine diebische Ader – nicht, dass er ein schlechter Kerl war, nur eben arm, und er hatte die Schnauze voll davon, dass er nie irgendwas besaß. Der Hund stieß ein leises Knurren aus. Senkte den Kopf. Prescott sah, wie sich das rötliche Nackenfell sträubte.
»Von Stehlen kann gar keine Rede sein. Ich habe ihn gefunden, das ist alles.« Billy ließ den Ring in seine Hosentasche gleiten, und bevor Prescott irgendetwas dazu sagen konnte, entfuhr ihm ein Jubelschrei. »Nun sieh dir das an. Und jetzt behaupte noch einer, heute wäre nicht mein Glückstag. Da ist der Bock! Scheiße aber auch! Sieh ihn dir an. Es ist ein verdammter Vierender!«
Wahrhaftig, der Bock war ein kleines Stück weiter hinter zwei knorrigen Eichen zusammengebrochen und hatte seinen letzten Atemzug getan. Billy Dean war hinübergelaufen und hatte ihn angestoßen, um sicher zu gehen, dass er wirklich tot war. Zufrieden zückte er bereits sein Jagdmesser, doch Prescott eilte ihm nicht zu Hilfe. Eine Gänsehaut überkam ihn, kalt wie Teufelspisse. Sie lief ihm vom Hinterkopf aus über den Rücken bis hinunter ans Steißbein, und sie hatte nichts mit dem Wind zu tun, der heulend durch die Talsenke peitschte.
Nein, da steckte mehr dahinter.
Ihn beschlich so ein Gefühl, und es warnte ihn vor einer Gefahr.
Dem ollen Red, dem Hund, ging’s genauso.
Prescott warf einen Blick über die Schulter und kniff hinter den verschmierten Brillengläsern die Augen zusammen.
Wurden sie beobachtet?
Spähte ein Dämon durch das Gebüsch bei der verlassenen alten Holzfällerstraße?
Warum hielt der verflixte Hund Wache und starrte in den Wald, dorthin, wo er am dunkelsten war?
Prescotts Gaumen wurde trocken. Plötzlich spürte er den Drang zu pinkeln. Dringend. »Ich finde, wir sollten abhauen.«
»Warum?« Billy Dean hatte sich bereits auf ein Knie niedergelassen und schlitzte dem Rehbock den Bauch auf, vom Brustbein bis zu den Geschlechtsteilen.
Wieder knurrte der Hund.
Tief und leise.
Eine Warnung.
»Ich muss den Bock noch ausnehmen«, sagte Billy, »und ich finde, dann sollten wir das Grab ausheben.«
»Was? Kommt nicht infrage!«
»Hey, vielleicht ist da noch mehr zu holen als nur der Ring.«
»Vielleicht sollten wir die Polizei verständigen.«
»Wieso?«
»Weil hier irgendwas absolut nicht stimmt«, flüsterte Prescott und tastete mit nervösen Blicken die andere Seite der Lichtung ab, wo das Gestrüpp dicht und finster war. Der Hund fletschte die Zähne und begann, im Kreis zu laufen, ohne jemals den Blick von den dunklen Schatten unter den Bäumen zu lösen. »Hier ist irgendwas, dem wir besser nicht in die Quere kommen sollten.«
»Du vielleicht nicht. Ich gehe erst, wenn ich mit diesem Mistvieh hier fertig bin, das Grab ausgehoben habe und weiß, was los ist. Vielleicht ist da noch mehr Schmuck drin – eine Art Schatz womöglich.«
»Wie kommst du darauf?«
»Wer weiß?« Billy Dean verlagerte sein Gewicht auf die abgetragenen Absätze seiner Stiefel und blinzelte mit einem Auge zum Himmel hinauf, als käme von dort eine Art Erleuchtung.
Düstere Wolken zogen vorbei. Ein böses Omen, eindeutig.
Billy schien anderer Meinung zu sein. »Schätze, hiermit will Gott mich dafür entschädigen, dass er mich so oft in der Scheiße stecken gelassen hat.« Billy wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Er hatte die Decke des Vierenders bereits aufgeschlitzt, gerade so weit, dass keine Innereien verletzt wurden. In einem schillernden Haufen ergossen sich die Eingeweide auf den Boden. »Ich weiß, ich weiß. Ich sollte nicht so über Gott reden, aber er hat wirklich noch nicht viel für mich getan. Bis heute. Schätze, er will das endlich wieder gutmachen.« Mit vorgeneigten Schultern schnitt Billy die Eingeweide des Bocks los und band sie ab.
»Das glaube ich nicht«, widersprach Prescott, und die Angst prickelte unter seiner Haut. Währenddessen arbeitete Billy starrsinnig weiter. »Komm jetzt, Billy Dean. Wir müssen weg hier. Auf der Stelle.«
»Ich denk nicht dran, meine Beute hier liegen zu lassen. Und ich will das verdammte Grab ausheben. Was ist denn in dich gefahren?« Billy richtete sich auf und drehte sich um, das Jagdmesser noch immer in der linken Hand. Von der Klinge tropfte Blut und lief über seine Finger. Als er seinen Cousin wütend ansah, wirkte seine Gesichtshaut pickliger denn je. »Du hast wohl Schiss, wie? O Mann.« Seine Stimme troff vor Verachtung. Billys Blick wanderte zum dunklen Waldrand. »Was ist denn? Was hast du da gesehen?«
»Nichts. Ich hab nichts gesehen, aber das heißt noch lange nicht, dass da nichts ist.« Prescott bemerkte eine Bewegung, Schatten unter Schatten, ein bisschen Blattwerk, das sich unnatürlich im Wind bewegte. Das Knurren des Hundes war so tief und leise, dass es aus einer anderen Welt zu kommen schien. »Los jetzt«, befahl Prescott und machte sich im Laufschritt auf den Rückweg. »Wir müssen weg hier«, schrie er über die Schulter zurück. »Sofort!« Er blieb nicht stehen, um zu sehen, ob Billy Dean ihm folgte, rannte einfach los, so schnell er konnte, immer weiter den Pfad hinauf. Der Hund schoss, den Schwanz zwischen die Hinterbeine geklemmt, an ihm vorbei.
Verdammt noch mal, Billy Dean sollte lieber mitkommen. Kein Rehbock und kein verdammter Ring waren es wert, sich auf das unfassbar Böse einzulassen, das Prescotts Instinkt in diesem verlassenen Teil des Waldes gespürt hatte. Der Weg war steil, seine Schritte unsicher, und während er so heftig nach Luft rang, dass seine Brillengläser beschlugen, drohten seine Lungen zu bersten. Schweiß rann ihm übers Gesicht, in die Augen, unter den Kragen. Gott, bitte lass mich heil hier rauskommen, und gib mir nicht die Schuld an Billy Deans dämlichen Aktionen. Er ist ein Blödmann, Gott, bitte … Als er an einer Weggabelung vorüberstolperte und im Zickzack steil aufwärts hastete, brannten seine Lungen wie Feuer, sein Herz hämmerte wie wild. Das war doch der richtige Weg, oder nicht? War er an dieser gespaltenen Eiche vorbeigekommen –
Etwas bewegte sich … schob sich durch das Dämmerlicht, das durch die Baumkronen sickerte. Himmel! Was es auch war, es kroch durchs Unterholz. Ein Mensch? Eine dunkle Gestalt. Ein Mann? Oder die Verkörperung des Teufels selbst? Prescotts Herz schien stehen zu bleiben. Er wirbelte zu hastig herum und verdrehte sich das Fußgelenk.
Schmerz schoss in seinem Bein hoch.
Ach, Scheiße! Prescott stieß einen Schrei aus, biss sich dann auf die Zunge. Der Satan durfte ihn nicht finden.
Lauf! Jetzt!
Er musste sich verstecken. Er rannte wieder los. Aufwärts. Hügelab. Wohin immer der Weg führte. Währenddessen wurde der Schmerz in seinem Bein immer schlimmer.
Nicht daran denken. Nicht an Billy Dean denken. Nur weg hier. Schnell!
Der Wald, Dornenranken, struppige Bäume, Unterholz, alles verschwamm vor seinen Augen und flog an ihm vorüber.
Ein Stück weiter vorn auf dem Weg stieß der Hund ein verängstigtes, qualvolles Jaulen aus. Es hallte in der Schlucht wider.
Und dann herrschte Stille.
Tödliche Stille.
O Gott! Prescott hatte Angst wie noch nie in seinem Leben.
Er bremste ab, sein Knöchel schmerzte unerträglich. Er spähte angestrengt durch die beschlagenen, verschmierten Brillengläser. Wo war der Hund? Wo zum Teufel war der verdammte Hund? Und die dunkle Gestalt? Heilige Scheiße, wohin war dieser Satan verschwunden? Vielleicht hatte er sich alles nur eingebildet. Ja, so musste es sein. Eine Sinnestäuschung, hervorgerufen durch das Zwielicht im Wald. Und wo war sie gewesen – diese schwarze Gestalt? Weiter oben auf der Hügelkuppe, oder hatte er aufgrund des Zickzackwegs und der vielen Gabelungen völlig die Orientierung verloren? Er konnte nicht mehr klar denken, konnte kaum atmen.
O Gott, o Gott, o Gott!
Er musste weiter!
Der Knöchel pochte in seinem Stiefel. Prescott war am ganzen Körper schweißnass. Er war halb blind. Die Hügelkuppe schien Hunderte von Metern über ihm zu schweben, die an den Weg grenzende Schlucht wirkte wie ein tiefer, schwarzer Abgrund. Wie sollte er jemals hier rauskommen? Warum hatte er nicht versucht, dieser verdammten Holzfällerstraße zu folgen? Wenn doch bloß Billy Dean endlich auftauchen und ihm helfen würde …
Knack!
Ganz in der Nähe brach ein Zweig.
Prescott stand da wie angewurzelt.
Das Blut rauschte ihm in den Ohren.
Gott steh mir bei!
Blanke Panik befiel ihn.
Hatte er hinter sich was gehört? Schritte auf dem Laubteppich?
Prescott fuhr herum.
Wieder zu hastig.
Ein wahnsinniger Schmerz jagte durch seinen Knöchel, der unter ihm nachgab.
Der Kies auf dem Weg bot seinen Füßen keinen Halt, und er rutschte auf den Rand der Schlucht zu. Wild fuchtelte er mit den Armen, doch es war zu spät. Er verlor jeglichen Halt unter den Füßen. Schreiend warf er die Arme hoch und erhaschte aus den Augenwinkeln gerade noch einen flüchtigen Blick auf den dunklen, großen Mann unter den Bäumen. Dann taumelte er rückwärts und stürzte kopfüber in die Schlucht.
2. Kapitel
Komm schon, Nikki, gib’s auf. Gehen wir einen trinken.« Trina Boudine stoppte ihren Schreibtischstuhl am Rand von Nikki Gillettes Büronische, erhob sich und reckte ihre schlanke Modelgestalt, um über die Trennwand zwischen ihren Schreibtischen zu spähen. »Du weißt doch, was man sagt, wenn jemand nur arbeitet und kein Vergnügen hat.«
»Ich habe davon gehört. Aber ich weiß nicht, wer ›man‹ ist, und ›man‹ macht sich offenbar keine Gedanken darüber, wie ich die Miete bezahlen soll.« Sie blickte zu Trina auf. »Und nur für den Fall, dass es dir entgangen sein sollte: Ich bin kein Junge, auf mich trifft das nicht zu.«
»Haarspalterei.« Trinas dunkle Augen blitzten. Sie lächelte und zeigte dabei ihre weißen Zähne, gerade unregelmäßig genug, dass sie interessant wirkten. Mit einem wohlgeformten Handgelenk, an dem mindestens ein Dutzend Kupferarmbänder klimperte, winkte sie ab. »Ist das, woran du gerade arbeitest, denn so verdammt spannend? Ich hab doch gehört, dass du eine Serie über die Kürzungen des Schulbudgets schreibst.« Sie schnalzte mit der Zunge. »Total faszinierend.«
»Okay, okay, ich habe verstanden.« Nikki rollte auf ihrem Stuhl vom Computer weg und hoffte, dass Trina den Text, den sie gerade eingegeben hatte, nicht lesen konnte, denn ihre Story hatte nicht das Geringste mit Budgetkürzungen oder der öffentlichen Empörung über mangelhafte Schulfinanzierung zu tun. Stattdessen schrieb sie mal wieder einen Artikel über ein Verbrechen, über eine Frau, die vor zwei Tagen aus dem Fluss gezogen worden war. Das war eigentlich nicht ihre Story. Norm Metzger hatte den Auftrag bekommen, aber Nikki konnte nicht anders. Verbrechen übten eine sonderbare Faszination auf sie aus. Das war schon immer so gewesen und hatte nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass ihr Vater der Richter Ronald ›Big Ron‹ Gillette war. Bei dem Gedanken an ihren Vater verdüsterte sich ihre Miene, dann sah sie erneut zu Trina auf. »Gut, wir treffen uns. Wann und wo?«
»Gegen sieben, zu Horsd’œuvres und Drinks bei Bridges. Aimee und Dana kommen auch. Es gibt was zu feiern. Aimees Scheidung und Danas Verlobung. Die beiden Endpunkte auf der Romantikskala, sozusagen.«
»Könnte lustig werden«, bemerkte Nikki spöttisch.
»Tja, dann verstehst du vielleicht, dass wir in dieser Runde Verstärkung brauchen. Ich hoffe, dass vielleicht noch Ned, Carla und Joanna zu uns stoßen – du verstehst schon, um eine Art Party daraus zu machen. Aimee fällt es weiß Gott nicht leicht, Begeisterung für Danas Verlobung aufzubringen, aber Dana will natürlich feiern.«
»Obwohl sie schon zwei Mal verheiratet war?«
»Du weißt doch, was man so sagt …«
»Aller guten Dinge sind drei, ja, ja. Die Perlen der Weisheit springen dir heute nur so von den Lippen, was?«
»Wie immer.« Trinas Telefon klingelte, und sie verdrehte die Augen. Nikkis Computerbildschirm begann wie wild zu flackern.
»Dieses verdammte Ding«, murrte Nikki. »Ich dachte, Kevin wollte es reparieren.« Kevin Deeter war der Neffe des Redakteurs, ein Teilzeitstudent und Vollzeit-Elektronikfachmann, dessen einzige Aufgabe beim Sentinel darin bestand, die elektronischen Geräte in Schuss zu halten. Ein Sonderling, der merkwürdige Witze erzählte und sich weitgehend abkapselte. Was ein Segen war. Nikki drückte verzweifelt auf die Escape-Taste, fuhr den Computer wieder hoch, und der Bildschirm erwachte zu neuem Leben.
»Kevin war eben noch da.«
»Hat er irgendwas mit dem Computer angestellt?«
»Ich hatte zu tun. Hab nichts mitgekriegt, tut mir Leid.«
»Na prima«, grummelte Nikki gereizt. Sie mochte Kevin nicht sonderlich, duldete ihn jedoch wegen seiner Computerkenntnisse, wegen seines schrägen Humors bestimmt nicht. »Also ehrlich, er macht mehr kaputt, als er repariert. Verdammt noch mal.«
Trina schüttelte hastig den Kopf, und Nikki verstand die Warnung. Aus den Augenwinkeln sah Nikki Kevin in der Nähe der Garderobe herumlungern, mit einem Kopfhörer auf seinen Ohren. Er hatte vermutlich nicht gehört, was sie gesagt hatte, und selbst wenn – sollte er ruhig wissen, dass er hier war, um zu reparieren, und nicht, um die Pannen noch zu verschlimmern. Und was sollte dieser Kopfhörer? Wenn Tom Fink jemand anderen während der Arbeit damit erwischte, flog der Betreffende hochkant raus.
»Ich werde ihm sagen, dass er meine Geräte in Ruhe lassen soll, wenn ich nicht da bin«, nahm sich Nikki vor.
»Tu das.« Trinas Telefon klingelte noch immer. »Die Pflicht ruft.« Sie glitt mit ihrem Schreibtischstuhl in ihre Nische und meldete sich: »Savannah Sentinel, Menschliches allzu Menschliches. Trina am Apparat.«
Nikki rollte ihren Stuhl näher an den Monitor ihres Computers. Sie hatte im Internet gesurft und dabei so viele Informationen wie eben möglich über die Unbekannte eingeholt, die an schwere Hanteln gebunden auf dem Grund des Flusses gefunden worden war. Taucher hatten ihre Überreste entdeckt und die Polizei benachrichtigt. Detective Pierce Reed leitete die Ermittlungen. Wie üblich gab er ›keinen Kommentar‹ zu dem Fall ab, und ganz gleich, wie oft sie auch anrief, sie war bisher nicht einmal mit dem eigenbrötlerischen Ermittler verbunden worden.
Sie klickte ein Bild von Reed an. Er sah aus, als hätte er längere Zeit als Marlboro-Mann gearbeitet. Groß und langgliedrig, mit einem kantigen, aber schönen Gesicht und Augen, denen nicht viel entging. Nikki hatte herausgefunden, dass er ledig war, und redete sich ein, dass sie so viel wie nur möglich über ihn in Erfahrung bringen musste.
Außerdem hatte sie herausgekriegt, dass er früher schon einmal bei der Polizeibehörde von Savannah gearbeitet hatte, vor mehr als zwölf Jahren und nur für kurze Zeit, dann zog er an die Westküste und trat bei der Polizei von San Francisco seinen Dienst an, wo er schließlich irgendwann zum Ermittler avancierte.
Von da an war seine Vergangenheit ein bisschen undurchsichtig, doch dem, was sich Nikki zusammenreimen konnte, entnahm sie, dass Reed irgendwie in Schwierigkeiten geraten war. Er hatte großen Ärger bekommen. Eine Frau war umgebracht worden, während er ihre Wohnung überwachen ließ. Soweit Nikki es verstand, hatte Reed den Mord beobachtet, das Leben der Frau aber nicht retten können und auch den Mörder nie gefasst. Reed war zwar abgemahnt worden, doch seine Dienstmarke durfte er behalten. Trotzdem hatte er gekündigt und war kurz darauf nach Savannah zurückgekehrt.
Der Rest war, wie man so sagt, Schnee von gestern. Und dessen Krönung waren die Montgomery-Morde.
Hoch oben unter der Decke dieses zum Bürogebäude umfunktionierten Lagerhauses waren Lautsprecher angebracht, aus denen Entspannungsmusik rieselte. Zu diesen Klängen klopfte Nikki mit einem Bleistift auf die Schreibtischplatte und musterte finster Pierce Reeds Konterfei, ein vor dreizehn Jahren aufgenommenes Foto, als er noch als junger Polizist von Ende zwanzig in Savannah tätig war. Sehr ernst und nahezu zornig blickte er in die Kamera. Nikki hätte gern gewusst, was den Mann umtrieb. Warum verließ er seine Heimatstadt, zog nach Kalifornien und kam mehr als ein Jahrzehnt später zurück? Warum hatte er nicht geheiratet? Keine Kinder in die Welt gesetzt?
Liebend gern hätte sie eine Story über Reed gebracht; sie versuchte bereits, einen Aspekt herauszuarbeiten, unter dem sie dem Chefredakteur ihre Idee schmackhaft machen konnte. Etwas in der Art von dem Mann, der hinter dem Mythos steckte, eine persönliche Studie eines von Savannahs Besten …
Ihr Telefon klingelte, und sie unterbrach ihre Überlegungen über den schwer zu packenden Detective.
»Savannah Sentinel«, meldete sie sich automatisch. »Nikki Gillette am Apparat.«
»Hallo, Nikki, hier ist Dr. Francis von der Schulbehörde in Savannah. Sie haben mich angerufen?«
»Hallo. Ja«, antwortete Nikki rasch und sah die Frau vor ihrem inneren Auge – groß, imposant, jedes Härchen an seinem Platz, eine Afroamerikanerin, die es geschafft hatte und mit zweiundvierzig Jahren einen leitenden Posten in einer Behörde ihrer Heimatstadt innehatte. »Nett, dass Sie sich melden, danke. Ich möchte Sie zu den jüngsten Budgetkürzungen interviewen«, sagte Nikki und rief ihre diesbezüglichen Notizen im Computer auf, den Hörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt. »Man munkelt, dass einige von den kleineren Grundschulen geschlossen werden sollen.«
»Vorübergehend. Wir ziehen es vor, von Zusammenlegung zu sprechen. Zwei oder drei Schulen sollen jeweils zum Nutzen aller Betroffenen zu einer einzigen zusammengefasst werden. Auf diese Weise können wir die vorhandenen Begabungen der Kinder maximieren, die Schüler profitieren von vielen verschiedenen Lehrern mit innovativen Ideen und können ihren Bildungshorizont erweitern.«
»Selbst wenn sie per Bus aus ihrer Wohngegend – und da handelt es sich ja vorwiegend um ärmere Viertel – quer durch die Stadt fahren müssen?«
»Letztendlich geschieht es zu ihrem eigenen Vorteil«, warf Dr. Francis mit glatter, freundlicher Stimme ein. Sie war in Savannah geboren, ihr Akzent war verhalten und vornehm. Als Kind armer Eltern hatte sie sich durch das lokale Schulsystem gearbeitet, Stipendien und Zuschüsse erkämpft und sich als Werkstudentin durchs College und die Promotion geboxt. In der Zeit hatte ihre ledige Mutter mit zwei schlecht bezahlten Jobs insgesamt sechs Kinder durchgebracht. Dr. Francis war der Inbegriff des amerikanischen Traums, eine Philanthropin, nie verheiratet gewesen, ohne Kinder, eine Frau mit Weitblick, der offenbar tatsächlich alle Kinder Savannahs am Herzen lagen. Aber warum wurde Nikki dann das Gefühl nicht los, dass sie resigniert hatte? Dr. Francis rasselte ihre Sprüche über die Erfüllung der Bedürfnisse von Schülern und Gemeinde herunter, und Nikki machte sich Notizen und ermahnte sich, nicht so zynisch zu sein. Vielleicht glaubte die Frau wirklich an den Quatsch, den sie da absonderte. Und vielleicht ist es gar kein Quatsch. Dass eine Schule geschlossen wird, die man selbst vor Jahren besucht hat, bedeutet doch nicht zwangsläufig, dass das schlecht ist.
Nikki spielte mit ihrem Kuli, hörte zu und vereinbarte noch für diese Woche ein Treffen mit Dr. Francis. Mit dem Gedanken, dass die zu erwartende Story nicht eben Pulitzerpreis-verdächtig war, ja, ihr selbst nicht einmal sonderlich wichtig war, legte Nikki auf. Aber das Thema hatte vielleicht Potenzial und war in gewisser Weise bestimmt nachrichtentauglich. Na ja, eine größere Zeitung befand es sicherlich nicht einmal eines Zweizeilers für würdig, es würde Nikki keine Beförderung zur New York Times oder zur Chicago Tribune oder zum San Francisco Herald einbringen, aber es würde ihr helfen, die offenen Rechnungen für den laufenden Monat zu bezahlen, und womöglich lernte sie noch etwas dabei.
Vielleicht.
In der Zwischenzeit wollte sie die Unbekannte aus dem Fluss nicht aus den Augen verlieren, und auch ihre Story über Detective Reed durfte sie nicht auf die lange Bank schieben. Das hatte Potenzial, das war nachrichtentauglich. Sie spürte es. Sie musste nur noch herausfinden, was genau dahinter steckte. Und um das zu erfahren, musste sie Reed interviewen, ihn irgendwie zu fassen kriegen.
Was ungefähr so einfach war wie mit einem Stachelschwein zu schmusen. Der Mann war halsstarrig, mürrisch und manchmal verdammt grob. Was wahrscheinlich auch der Grund dafür war, dass sie ihre Idee von einer Story über ihn nicht einfach fallen lassen konnte. Er stellte eine Herausforderung dar. Und Nikki Gillette hatte sich einer Herausforderung noch nie entzogen. Niemals. Doch nicht die Tochter des ehrenwerten Ron Gillette!
Irgendwie würde Nikki alles aufspüren, was es über Detective Reed herauszubekommen gab. Vielleicht brachten ihre Recherchen kein Ergebnis, vielleicht fand sie nichts Interessantes. Vielleicht war Reed nicht spannender als eine schmutzige Tennissocke. Sie lächelte. Ausgeschlossen. Sie wusste instinktiv, dass sich um den unzugänglichen Bullen eine Geschichte rankte. Sie brauchte sie nur noch aufzudecken, ganz gleich, unter wie vielen Mäntelchen des Schweigens Reed sie verbarg.
Unter dem Getöse der Rotoren erhob sich der Rettungshubschrauber vom Grund der Schlucht. Einen Wirbel winterlich kalter Luft zurücklassend strich er knapp über die bewaldeten Felsen und verschwand hinter einem Höhenzug. Auf halbem Weg zum Felsabsturz hinauf richtete Detective Davis McFee den Blick auf den Jungen, der zitternd vor ihm stand. Der Bengel hatte eine Heidenangst, so viel stand fest, aber McFee wusste so gut wie nichts, außer dass der andere Junge in Lebensgefahr schwebte.
McFees Partner, Bud Ellis, übernahm das Verhör. »Gehen wir das Geschehen noch einmal von vorn durch, Billy Dean. Ihr wart auf der Jagd, und irgendetwas hat deinem Freund einen Schrecken eingejagt.«
»Meinem Cousin – äh, Cousin zweiten Grades.«
»Prescott Jones?«
»Ja. Wir beide machen viel zusammen.«
»Es ist Schonzeit.«
»Ja.« Der picklige Bengel hatte Anstand genug, um den Blick zu senken und mit der Stiefelspitze in der weichen Erde zu bohren.
Delacroix’ Geschichte zufolge hatten er und sein Cousin ein Reh verfolgt, waren dem verwundeten Bock in die Schlucht nachgelaufen, wo sie auf einen Erdhaufen stießen, der aussah wie ein Grab, und irgendwas hatte dem kleinen Jones Angst eingejagt. In panischem Schrecken war er zusammen mit Billy Deans Hund den Hügel hinaufgerannt, und als Billy Dean selbst endlich diesen Wegabschnitt erreicht hatte, konnte er nur noch feststellen, dass sein Cousin von den Serpentinen aus einen steilen Abhang hinuntergestürzt war.
Bei seinem Sturz hatte Jones einen Schädelbruch, drei Rippenbrüche und einen Splitterbruch des rechten Unterarms erlitten. Außerdem war sein Gesicht schlimm zerkratzt und seine Brille zerbrochen. Der Sanitäter im Hubschrauber war nicht sicher, meinte aber, der Junge könnte sich auch einen Milzriss oder irgendeine andere innere Verletzung zugezogen haben, auf jeden Fall aber eine Gehirnerschütterung. McFee schloss nicht aus, dass der ältere Junge in den Abgrund gestoßen worden war. Vielleicht hatten die beiden Jungen Streit gehabt, vielleicht hatten sie auch nur ein bisschen gerangelt, aber auf irgendeine Weise war Prescott Jones völlig zerschunden fünfzehn Meter tief gefallen.
Ellis bohrte nach: »Und du hast ihn nicht den Hügel hinaufgejagt?«
»Nein, Sir. Ich bin ihm und Red gefolgt. Wüsste gern, wo dieser Köter jetzt steckt. Jedenfalls, als ich hier oben ankam, hab ich ihn da unten liegen gesehen.« Er deutete den steilen Abhang hinab in die Wälder. »Ich konnte nicht zu ihm runter, deshalb bin ich weiter zum Wagen gerannt. Das Handy von seinem Pa war da drin, aber ich musste eine Meile fahren, bis ich endlich Empfang hatte, und dann hab ich Sie gleich angerufen. So war’s, ich schwöre!« Dem Jungen klapperten vor Kälte oder Angst oder beidem die Zähne.
»Und da unten in der Talmulde habt ihr ein Grab entdeckt?«, fragte Ellis.
»Ja, Sir.« Billy Dean nickte so wild, dass eine schmutzig blonde Haarlocke zwischen seinen Brauen auf und nieder hüpfte.
»Das wollen wir uns doch mal anschauen.« Ellis warf McFee einen Blick zu, und beide folgten dem Jungen bis zum Ende des Pfads, wo auf einer Seite der Lichtung der ausgenommene Bock und die auf dem Boden verstreuten Eingeweide lagen. Und ganz in der Nähe, wie der Junge beschworen hatte, befand sich ein frischer Erdhügel, der tatsächlich wie ein Grab aussah. McFee gefiel das gar nicht. Er zückte seine Kautabaksdose und stopfte sich einen Klumpen in den Mund. Was zum Teufel mochte sich unter der Erde verbergen? Vielleicht noch ein totes Reh. Vielleicht gar nichts. Vielleicht Müll … aber Müll wurde gewöhnlich einfach nachlässig weggeworfen. Hier jedoch war eine Grube ausgehoben und wieder zugeschaufelt worden, und niemand hatte sich die Mühe gemacht, die Erde mit Laub oder Zweigen oder Blattwerk zu tarnen. Abgesehen davon, dass das Grab, wenn es sich denn wirklich um eins handelte, tief in dieser Schlucht angelegt worden war, hatte der Urheber den Erdhügel für jeglichen Vorüberkommenden gut sichtbar hinterlassen.
Es war merkwürdig. Verdammt merkwürdig. »Sehen wir nach, was da drin ist«, sagte McFee zu Ellis.
»Sollten wir nicht lieber den Sheriff rufen? Vielleicht benötigen wir die Spurensicherung.«
»Für welches Verbrechen?«, fragte McFee. »Wer weiß, was sich da drin befindet. Wenn wir es ausgraben und nichts finden, was dann? Dann haben wir die Leute für nichts und wieder nichts hier herausgelotst.«
»Hör zu. Ich geh rauf und hol eine Schaufel und ruf gleich auf der Wache an.«
»Tu das. Billy Dean hier kann mir so lange Gesellschaft leisten, nicht wahr, Junge?«
Der Junge wollte offenbar widersprechen, überlegte es sich jedoch anders. »Ja, Sir.«
»Gut. Mann, ist das kalt hier unten!« McFee rieb sich die Arme und blickte zum Himmel auf. Graue Wolken kündigten Regen an. Während Ellis eilig dem Weg hügelauf folgte, zog McFee sein Messer und schob behutsam etwas von der Erde zur Seite. Der Junge trat nervös von einem Fuß auf den anderen, und McFee vermutete, dass er mehr wusste, als er zugegeben hatte. »Warst du früher schon mal hier?«
»Ja.«
»Du warst tatsächlich schon mal hier?«
»Na ja, nicht genau hier, aber in dieser Gegend.«
»In dieser Talmulde?«
»Ja, einmal. Vor einem Monat oder so.«
»Hast du dieses Grab da schon gesehen?«
»Nein, Sir, es war noch nicht da.«
So weit glaubte McFee ihm. Die Erde war zu frisch, wie gepflügte Schollen auf einem neu angelegten Acker. Nicht ganz von der gleichen Farbe wie die Erde in der Umgebung, nicht von Tieren heruntergetreten oder von Regen durchweicht. Vor zwei Tagen hatte es einen Wolkenbruch gegeben. Es hatte geschüttet wie aus Eimern. Ausreichend, um den Hügel platt zu machen. Aber das war nicht geschehen. Weil das, was unter der Erde lag, noch nicht da gewesen war. Abermals kratzte McFee mit seinem Messer. Er schob die Klinge in der Mitte des Hügels in die Erde, um das, was sich darunter befand, auf keinen Fall zu verfehlen. Während er grub und ein kleines Loch aushob, fuhr die Klinge tief in die Erde, bis über das Heft hinaus, so tief, dass sich McFee vorbeugen und mit einem Knie auf dem Erdhaufen abstützen musste. Während der Junge weiter von einem Fuß auf den anderen trat, sich mit dem Handrücken die laufende Nase abwischte und mit den Schlüsseln in seiner Tasche klimperte, bohrte er das Messer immer tiefer in die Erde.
»Läuft dein Hund öfter weg?«
»Was? Nein, Sir. Der olle Red läuft nie weit weg.«
»Was meinst du, wo er steckt?«
»Keine Ahnung.« Er zog finster die Augenbrauen zusammen und sog die Lippen ein, als machte er sich Sorgen. Er biss sich auf die Unterlippe und schniefte. »Pa zieht mir das Fell über die Ohren, wenn ihm was passiert sein sollte.«
»Mal nicht den Teufel an die Wand«, sagte McFee. Er war sicher, dass sie ohnehin schon genug Probleme hatten.
Reeds Magen rumorte. Es stieg ihm sauer in die Speiseröhre. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Seit er und Morrisette am Vormittag vom Friedhof zurückgekommen waren, kümmerte er sich um den Papierkram, nahm Anrufe entgegen, beantwortete E-Mails und erledigte alles Liegengebliebene. Das Frühstück hatte aus Kaffee bestanden, das Mittagessen war ausgefallen, und er war seit sechs Uhr morgens auf den Beinen. Zeit für eine Pause. Er bewegte den Kopf und ließ die Schultern kreisen, um die verspannten Muskeln zu lockern. Wie lange war er schon nicht mehr im Fitnesscenter gewesen? Seit einer Woche? Seit zehn Tagen? Himmel, vielleicht sogar noch länger. Aber heute Abend, egal, was kommen mochte, würde er in seinen Trainingsanzug schlüpfen und rüber zum alten Sportclub laufen, wo die Boxer trainierten, Gewichte schepperten und der Geruch von Moschus und Schweiß zur alten Tribüne hinaufstieg. Es war kein typischer Club der modernen Sorte mit schicken computergesteuerten Laufbändern und Treppenmaschinen, die den Pulsschlag, den Kalorienverbrauch und die zurückgelegte Strecke berechneten. Nein, dieser Club war alte Schule. Gewichte, Gewichte und nochmals Gewichte. Wenn man laufen wollte, ging man joggen. Wenn man den Oberkörper trainieren wollte, tat man das an der Boxbirne, bearbeitete sie mit den Fäusten, um Aggressionen abzubauen, und für schnellere, flinkere Bewegungen nahm man den Punchingball.
Die echten Macho-Typen konnten Boxhandschuhe und Mundschutz anlegen und sich im Ring versuchen. Währenddessen sahen die anderen Clubmitglieder zu und schlossen hier und da auch mal Wetten ab, wer gewinnen würde. Nicht ganz legal, aber was war schon legal? Wenn gewettet wurde, schauten Reed und ein paar von seinen Kollegen weg. Er vermutete, dass hinter einer Reihe zerbeulter Spinde auch mit Drogen gehandelt wurde, doch er hatte nie beobachtet, dass Geld für Methadon, Koks oder Steroide den Besitzer wechselte. Bis jetzt nicht. Er hoffte, dass es nie dazu kam.
Er reckte sich auf seinem Stuhl und dachte an den Brief, den er am Morgen erhalten hatte. Wahrscheinlich hatte wirklich irgendein Spinner ihn abgeschickt, den es aufgeilte, wenn er die Polizeibehörde in Aufruhr versetzen konnte und womöglich dadurch fragwürdigen Ruhm erlangte. Der Brief war an ihn adressiert, weil er eine gute Zielscheibe war, dank des Montgomery-Falls vor ein paar Monaten der berühmteste Detective in der gesamten Dienststelle.
Was ihn ziemlich ärgerte.
Er griff in seine oberste Schreibtischschublade, entnahm ihr ein Fläschchen mit Magentabletten, schob zwei in den Mund und schluckte sie mit dem Rest Kaffee. Da klingelte das Telefon wohl zum hundertsten Mal an diesem Tag. Er hob den Hörer ans Ohr. »Detective Reed.«
»Sheriff Baldwin, Lumpkin County.«
Reed straffte sich. Kein gewöhnlicher Anruf. Lumpkin County lag über dreihundert Meilen entfernt weiter nördlich. Aber die Gegend war ihm vertraut. Zu vertraut. »Was kann ich für Sie tun, Sheriff?«
»Sie sollten auf dem schnellsten Weg hierher kommen.«
»Ich?«, fragte Reed, und sein Magen krampfte sich zusammen, wie immer, wenn er das Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte.
»Ich denke, das wäre das Beste.«
»Und wieso?«
»Zwei Jungen waren mit ihrem Hund in der Nähe von Blood Mountain auf der Jagd. Einer der Jungen, Billy Dean Delacroix, hat Glück gehabt und einen Bock angeschossen. Die Jungs haben ihn bis in eine Schlucht verfolgt. Der Bock lag verendet am Rand einer Lichtung. Aber das war nicht alles. Sie entdeckten einen frischen Erdhügel und hielten ihn für ein Grab, denn der Hund spielte verrückt. Einer von den Jungs, Prescott Jones, kriegte es mit der Angst zu tun und rannte weg, meinte, der Teufel oder so würde im Gebüsch lauern und flüchtete auf demselben Weg, den die beiden gekommen waren. Billy Dean war sauer, glaubte, sein Cousin hätte Gespenster gesehen, aber ein paar Minuten später wird er auch nervös und rennt Prescott hinterher. Als Billy Dean dann die Hügelkuppe erreicht, hört er einen markerschütternden Schrei. Er biegt um eine Ecke und sieht den kleinen Jones kopfüber vom Felsen stürzen. Da geht’s fünfzehn Meter steil abwärts, und er kann seinen Cousin nicht bergen, also rennt er zum Pick-up seines Vaters und ruft mit dem Handy um Hilfe – was oben in den Bergen nicht so einfach ist. Er muss erst ein Stück fahren, bis er Empfang kriegt.«
»Du liebe Zeit.« Reed malte Kringel aufs Papier, notierte die Namen der Jungen und hoffte, dass der Sheriff bald zur Sache kam.





























