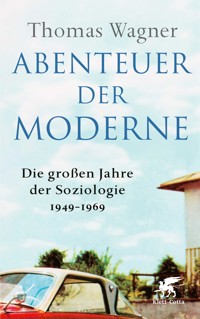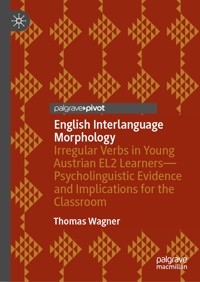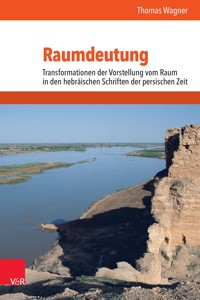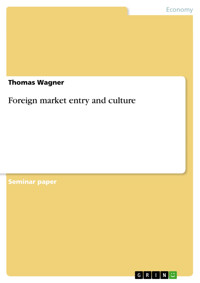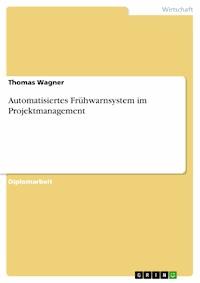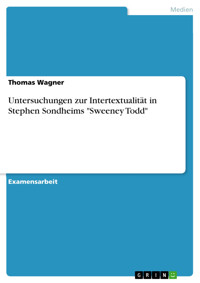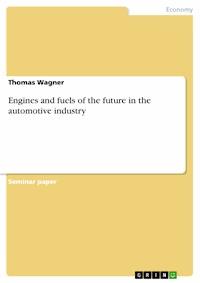Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Immanuel Kant bestimmte die Anarchie 1798 als »Gesetz und Freiheit, ohne Gewalt«. Das ist zunächst nur eine Denkmöglichkeit, die mit der Welt, in der wir leben, wenig zu tun zu haben scheint. Aber sie wird unterstützt durch eine Abstimmung mit den Füßen, die in der Geschichte der Menschheit auffallend häufig gegen das Leben in Herrschaft ausfiel. Thomas Wagners radikale Revision der Demokratiegeschichte folgt diesen Füßen auf ihren vielfältigen Wegen. Bis weit in die Neuzeit hinein lebte ein großer Teil der Menschheit auch deshalb in Gesellschaften ohne Staat, weil er sich dem Zugriff der Herrschenden entziehen wollte. Erzählungen über das ungebundene Leben »edler Wilder« und »Amazonen«, Freibeuter oder Beduinen regten überall auf der Welt aber auch die politische Fantasie derjenigen an, die weiter in Unfreiheit leben mussten. Die Idee der politischen Freiheit hat ihren Ursprung keineswegs allein in Europa. Fahnenflucht in die Freiheit macht diese Erkenntnis zum Ausgangspunkt der dringenden Dekolonisierung des politischen Denkens. Es ist eine Einladung, die faszinierenden Fährten aufzunehmen und weiterzuverfolgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Wagner
Fahnenflucht in die Freiheit
Wie der Staat sich seine Feinde schuf: Skizzen zur Globalgeschichte der Demokratie
»Die Zivilisation wurde mit Peitschenhieben errichtet.
Wir erben die Last.«1
Bruce Chatwin
»Das Gros der Menschheit hat, bis in unsere Zeit hinein,
niemals in Städten gelebt, noch war sie bereit,
die Art von Leben, wie es dort geboten wurde,
als höchstes Gut zu akzeptieren.«2
Lewis Mumford
»Wir brauchen die Möglichkeit des Entkommens so nötig,
wie wir Hoffnung brauchen.«3
Edward Abbey
Inhalt
1. Einleitung: Der Staat und seine Feinde
Das Erbe des Leviathan
Die Zähmung des Raubtiers
Revolutionäre Selbstbefreiung
2. Ganz weit draußen. Zu Besuch in Sointula
Lenin im Gemeindesaal
Aussteiger der Frühgeschichte
Institutionen gegen den Staat
3. Getrennte Wege gehen. Die Verhinderung von Herrschaft
Primärer Sinn für Fairness
Das Weite suchen
Hierarchien unerwünscht
4. Ungleiche Geschwister. Die Geburt von Staat und Staatsfeinden
Die Herrschaft des Korns
Im Joch der Zivilisation
Barbarische Freiheit
5. Zu nah an der Sonne. Ikarus in Südostasien
Zuflucht in Zomia
Widerständige Knollengewächse
Die linke Seite der Feuerstelle
6. Aufbruch ins gelobte Land. Exodus und Befreiung
Zeit der starken Frauen
Das Reich Gottes
Biblische Herrschaftskritik
7. Lob des einfachen Lebens. Daoistische Staatsferne
Rebellen in der Wildnis
Die dunkle Seite der Technik
Füße binden verboten
8. Platon und die Amazonen
Sie ritten zusammen
Die Quellen des Mythos
Emanzipation zu Pferde
9. »Das goldene Zeitalter der Barbaren«
Staat im Wartezustand
Die Steppe als Alternative
Das Filzzelt im Hof
10. Die Verheißung indianischer Freiheit
Kulturelle Überläufer
Der Edle Wilde im republikanischen Denken
Der deutsche Indianer – oder: Pribers Utopie
11. Marronage – oder: Sklaven erkämpfen das Menschenrecht
Widerstand und Revolution auf Haiti
Die Widersprüche der Aufklärung
Ausweitung der Fluchtzone
12. Die Brüder der Küste
Demokratie unter Seeräubern
Kaperbriefe und internationale Politik
Auf eigene Faust
13. »Zum Teufel mit dem König!«
Piraten mit Sozialversicherung
Marronage auf See
Hakim Bey und die Kommune der Faschisten
14. Banditen gegen die Obrigkeit
Wiederherstellung der Ordnung
Unsichere Kantonisten
Der edle Räuber
15. Europas letzte Mohikaner. Utopische »Zigeuner«-Bilder
Widersprüchliche Projektionen
Freie Liebe
Eine Stadt für Nichtsesshafte
16. Durch Absonderung zum Sozialismus: Die Vagabunden
Die Gemeinschaft der Ausgestoßenen
Revolutionäre Umsturzpläne
Die Bruderschaft
17. In den Fußstapfen Dschingis Khans
Die Theorie der Kriegsmaschine
Flucht aus der Lohnarbeit
Klassenkampf im »Empire«
18. Die Armee aus den Bergen. Aufstand der Zapatisten
Der Mann mit der Pfeife erzählt
Von unten nach oben
Eine andere Welt ist möglich
19. Zivilisierung des Staates
Kulturelle Aneignung
Achse der Freiheit
Die gemeinsame Aufgabe
Danksagung
Anmerkungen
Literatur
1.
Einleitung: Der Staat und seine Feinde
Sobald der Staat die Bühne der Weltgeschichte betritt, geht er mit seiner Widersacherin schwanger: der Anarchie, der Idee einer von Herrschaft befreiten Gesellschaft. Unter »Staat« verstehe ich dabei ein gesellschaftliches Verhältnis, in dem »Individuen oder kollektive Institutionen regelmäßig damit rechnen können, in der öffentlichen Sphäre für einen Befehl Gehorsam zu erlangen«.1 Damit ist außerhäusliche Herrschaft auf Dauer gestellt.2
Während die Verfechter staatlicher Autorität den herrschaftslosen Zustand als eine Zeit des Chaos und des Schreckens fürchten, halten es die Anhänger der Idee der Anarchie für wünschenswert und zumindest prinzipiell auch für möglich, im größeren Rahmen eine friedliche Ordnung zu etablieren, die ganz oder zumindest weitgehend ohne die Erzwingung von Gehorsam, sprich: Unterdrückung, auszukommen vermag. Immanuel Kant bestimmte die Anarchie 1798 als »Gesetz und Freiheit ohne Gewalt«.3 Das ist zunächst einmal nur eine Denkmöglichkeit, die mehr mit der spekulativen Fantasie von Stubengelehrten oder realitätsfernen politischen Romantikern in Verbindung zu stehen scheint als mit der Realität der Welt, in der wir – ob wir wollen oder nicht – nun einmal leben müssen. Aber sie wird unterstützt durch eine Abstimmung mit den Füßen, die auffallend häufig gegen den Staat ausfiel.
Bis weit in die Neuzeit hinein lebte ein großer Teil der Menschheit auch deshalb in Gesellschaften ohne Staat, weil sich deren Angehörige oder ihre Vorfahren dem Zugriff zentralisierter Herrschaft entzogen hatten. Schon vor Jahrtausenden begannen die Menschen in Scharen, vor dem Zugriff der ersten Steuereintreiber, Soldaten und Sklavenjäger der mesopotamischen Stadtstaaten, des Reichs der Pharaonen und der von den Flusstälern Südostasiens oder den Gebirgszügen Zentral- und Südamerikas aus expandierenden frühen Staaten in unzugängliche Regionen auszuweichen. Ob in undurchdringlichen Wäldern, schwer zu erklimmenden Gebirgen, auf abgelegenen Inseln, in kaum überschaubaren Steppen sowie lebensfeindlichen Sand- und Eiswüsten: Die Deserteure des Staates flüchteten in die Freiheit, um an ihren Zufluchtsorten neue Gemeinwesen zu gründen. Sie praktizierten auf diese Weise gleich alle drei von dem Ethnologen David Graeber und dem Archäologen David Wengrow jüngst herausgestellten Grundformen der Freiheit: »die Freiheit, sich zu bewegen, die Freiheit, Befehle zu missachten, und die Freiheit, soziale Beziehungen neu zu organisieren.«4
Sie demonstrierten auf diese Weise, dass es zu dem Gewaltregime, vor dem sie geflohen waren, eine Alternative gab, die breiteren gesellschaftlichen Schichten ein freieres und komfortables Leben versprach. In den Annalen der frühen Staaten und Imperien, die in der Regel von den mit viel Blut erkauften Triumphen der Könige und Heerführer über ihre Feinde berichteten, ist von den Angehörigen staatsloser Gemeinwesen häufig als »Barbaren« oder »Wilden« die Rede, die auf skandalöse Weise gegen die geltenden Sitten verstießen. Sie folgten keinen Befehlen, schienen den Unterschied zwischen oben und unten nicht zu kennen, trugen merkwürdige Kleider, ungewöhnliche Haartrachten und scherten sich zudem häufig überhaupt nicht darum, welchen Platz anständige Männer und Frauen in der Gesellschaft einzunehmen hatten. Für die Herrenschicht des Staates war das Grund genug, um sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen – jedenfalls dann, wenn man sie nicht als Bündnispartner gegen konkurrierende Mächte brauchte oder von ihrem Zugang zu sonst schwer erreichbaren Naturprodukten (Hölzer, Arzneien, Nahrungsmittel) zu profitieren hoffte und Handelsbeziehungen mit ihnen aufnahm. Beides kam häufig vor. Zunächst aber versuchte man, die abtrünnig gewordenen Bauern oder Soldaten wieder einzufangen und aus ihnen ordentliche Untertanen zu machen, die ihre Knie zu beugen wussten, Abgaben leisteten und sich zur Zwangsarbeit oder zum Militärdienst heranziehen ließen. Meist wurden die abweichenden Sitten und Gebräuche der Angehörigen von staatsflüchtigen Gemeinschaften in den düstersten Farben geschildert. Trotzdem übten sie auf nicht wenige Bewohner der vom Staat kontrollierten Gebiete eine Faszination aus, die nie ganz verschwand. Daher kommen die populären Mythen, die sich um edle Räuber, lustige »Zigeuner«, unabhängige Beduinen, Piraten oder Vagabunden ranken und die sich in den verschiedensten Weltregionen und kulturellen Überlieferungen bis heute – oft in trivialisierter Form, beispielsweise in Gestalt von Romanen, Comics, Hollywoodfilmen, Fernsehserien oder Karnevalskostümen – erhalten haben. Sie inspirierten nicht wenige Menschen, die ihres Status als Untertanen überdrüssig waren, dazu, selbst dem Lockruf der Wildnis zu folgen, wenn der Herrschaftsdruck zu groß wurde und sich eine Fluchtmöglichkeit ergab. Auch die Angehörigen der ärmeren Schichten wussten, dass die Gewürze, mit denen die Reichen ihre Speisen schmackhaft machten, die teuren Hölzer, aus denen sie ihr feines Mobiliar zimmern ließen und viele der übrigen Luxusgüter, mit denen sie ihr privilegiertes Leben verschönerten, aus fernen Ländern herangeschafft wurden. Soldaten, die von Strafexpeditionen heimkamen und die Teilnehmer von Fernreisen, die von Händlern in Gebiete unternommen wurden, in denen die »Wilden« das Sagen hatten, erzählten Geschichten über Gemeinschaften, in denen jeder und jede vollständig über seinen eigenen Körper verfügte und unvorstellbare sexuelle Freiheiten genoss. Die tägliche Arbeit sollte dort viel weniger Mühe kosten und zugleich mehr Früchte bringen, als ihre Felder zu tragen in der Lage waren. Das Land, in dem Milch und Honig floss, lag irgendwo hinter dem Horizont – aber nicht so weit entfernt, dass man es nicht vielleicht doch unter größter Anstrengung und mit ein wenig Glück hätte erreichen können. Es gibt zahlreiche Indizien dafür, dass es solche zunächst vor allem mündlich überlieferten Erzählungen über ein besseres, freieres Leben jenseits des Staates überall dort auf der Welt gab, wo der Staat seine repressive Seite zeigte.
Die biblische Erzählung vom Auszug der Israeliten aus der Knechtschaft des Pharao ist die vielleicht bekannteste, ideengeschichtlich wirksamste und auch politisch folgenreichste Erzählung einer Fahnenflucht in die Freiheit, wie sie als wiederkehrender historischer Vorgang, als demokratischer Gründungsmythos sowie als Versatzstück einer politischen Theorie im Zentrum dieses Essays steht. Sie ist aber keineswegs die einzige. Die mit Gewalt verbundene Herrschaft von Menschen über Menschen wurde immer wieder infrage gestellt und war hochgradig begründungsbedürftig. Je mächtiger ein Staat war, desto größer war zuweilen der Aufwand, den die Beamten und Berater der Herrschenden betrieben, um seine Existenz zu rechtfertigen, konkurrierende Erzählungen eines guten Lebens unsichtbar zu machen oder – insofern sich das nicht bewerkstelligen ließ – so in den offiziellen Kanon zu integrieren, dass sie entschärft wurden. Schaut man genauer hin, dann begleitet die in ihrer Grundlinie positiv auf den Staat bezogene Geschichte der politischen Philosophie ein mal mehr, mal weniger deutlich hervortretender, zumeist viel zu wenig beachteter Strang radikaler Herrschaftskritik, der zumindest eine seiner historischen Wurzeln in der eingangs beschriebenen Flucht vor dem Staat hat. Die Sehnsucht nach einem Abschütteln des Jochs staatlicher Unterdrückung beschränkt sich dabei nicht auf jenen Teil der Welt, der unter Begriffe wie »Abendland« oder »westliche Zivilisation« rubriziert wird. Tatsächlich sind weder der repressive Staat noch seine Kritiker und Feinde unter jene Phänomene zu zählen, die sich auf Europa und seine Kolonien beschränken ließen. Es macht das den Nachgeborenen nur schwer fassliche Leid, das Millionen von afrikanischen Menschen durch die Hand europäischer Sklavenhändler und kolonialer Plantagenbetreiber im 17., 18. und auch im vermeintlich längst aufgeklärten 19. Jahrhundert erfuhren, keinen Deut geringer, wenn darauf hingewiesen wird, dass auch indigene Gesellschaften in den beiden Amerikas lange vor dem Einzug der Konquistadoren zum Teil in großem Umfang Menschen versklavten und der Handel mit christlichen Sklaven aus den europäischen Anrainerstaaten des Mittelmeers lange Zeit zum Geschäftsmodell muslimischer Menschenhändler an der nordafrikanischen Küste gehörte.
Für die Anführer der Fon im westafrikanischen Dahomey war der lukrative Sklavenhandel ein Mittel, um ihre Vorherrschaft in der Region auszubauen. Sie brachen Kriege gegen benachbarte Völker vom Zaum, um die begehrte menschliche Ware zu erbeuten. König Gezo unterhielt für seine Raubzüge ein stehendes Heer von ungefähr 12 000 Bewaffneten. 5000 von ihnen waren Frauen, die sich im Kampf zu ähnlich grausamen Taten hinreißen ließen wie ihre männlichen Kameraden. Einige Gefangene wurden stets im Rahmen der jährlichen Feste geopfert, den meisten war das Los der Sklaverei bestimmt. Nachdem sie sich zum Ende der 1920er-Jahre von einem der letzten von der westafrikanischen Küste in die Sklaverei nach Nordamerika verschleppten Afrikaner seine Lebensgeschichte hatte erzählen lassen, zog die schwarze US-amerikanische Ethnologin und Schriftstellerin Zora Neale Hurston ein bitteres Resümee: »Die Weißen hatten meine Leute in Amerika in Sklaverei gehalten. Sie hatten uns gekauft, das ist wahr, und uns ausgebeutet. Woran ich aber schwer zu schlucken hatte, war die unabweisliche Tatsache: Meine eigenen Leute hatten mich verkauft […]«.5
Bestrebungen, Macht an einem Ort zu zentralisieren und Menschen als unfreie Arbeitskräfte auszubeuten, lassen sich lange Zeit vor dem europäischen Kolonialismus, der schließlich die Welt dominieren sollte, fast überall auf dem Globus nachweisen. Ebenso universell zeigt sich aber auch das Bemühen der Unterdrückten oder von Unterdrückung Bedrohten vor der immer weiter expandierenden Herrschaft zu fliehen und an einem dafür geeigneten Ort eine Gesellschaft der Freien und Gleichen zu gründen. Nichts könnte daher falscher sein, als den Ursprung der Demokratie einzig und allein auf eine griechische Urstiftung zurückzuführen, wie es in den im Gestus eigener Überlegenheit vorgenommenen Selbstbeschreibungen europäischer Kolonialregime und ihrer Siedlerkolonien bis heute Usus ist. Sie hat weit mehr, als das bis heute wahrgenommen wird, auch Wurzeln, die weit von Europa entfernt liegen. Ein wichtiges Anliegen dieses Essays ist daher der Versuch, den westlichen Alleinvertretungsanspruch in Sachen politischer Partizipation zu bestreiten. Nur so lässt sich der zivilisatorische Prozess als ein Projekt begreifen, dessen Gelingen vom selbstbestimmten und gleichberechtigten Einsatz vieler unterschiedlicher Stimmen abhängt. Gefragt ist ein globalgeschichtlicher Zugang, also »eine Form der historischen Analyse, bei der Phänomene, Ereignisse oder Prozesse in globale Kontexte eingeordnet werden«.6 Dieses Herangehen »eröffnet einen Blick auf Zusammenhänge, die innerhalb bestehender Ansätze lange Zeit unsichtbar waren oder zumindest als irrelevant angesehen wurden«,7 erläutert Sebastian Conrad die Vorzüge einer Disziplin, die sich erst in jüngerer Zeit zu einem der wichtigsten Felder der Geschichtswissenschaft entwickelt hat. Das in ihr angelegte Potenzial der Erleichterung einer »grenzüberschreitenden Kommunikation und Interaktion« erstreckt sich auch auf die politische Ideengeschichte, die – was die Genese und den transkulturellen Transfer demokratischer Vorstellungen, Praktiken und Konzepte betrifft – ein bislang noch wenig beackertes Feld darstellt, insbesondere wenn es um Vorgänge geht, die sich vor dem Siegeszug des europäischen Kolonialismus abspielen und das Verhältnis von Staaten und herrschaftslosen Gemeinwesen betreffen.
Das Erbe des Leviathan
Dem Alltagsverstand ist der hierarchisch geordnete Staat zunächst problemlos gegeben. Er gehört zu den Dingen, die wir in der Regel vorfinden, wenn wir auf die Welt kommen, und seine Existenzberechtigung wird daher zunächst meist nicht infrage gestellt. Wer seines Lebens sicher sein und dauerhaft in geordneten und einigermaßen komfortablen Verhältnissen leben will, so lässt sich immer wieder vernehmen, ist auf jemanden angewiesen, der die Fäden zusammenhält, der in letzter Instanz entscheidet und buchstäblich »weiß, wohin die Reise geht«. Die in der Regel kaum hinterfragte Vorstellung von der Notwendigkeit einer sich im Zweifel mit harter Hand durchsetzenden Regierung entspricht nicht zuletzt dem, was in den Klassikern der politischen Philosophie zu lesen ist. Seit der Antike wird die Politik in der Regel als ein Verhältnis betrachtet, in dem ein Souverän als höchste Gewalt entscheidet, dem alle anderen Bewohner eines Gemeinwesens als seine Untertanen zum Gehorsam verpflichtet sind. So vertrat Aristoteles (384–322) die Ansicht, dass in der Gesellschaft, ganz genau wie zwischen den menschlichen Organen oder zwischen Mann und Frau, natürlicherweise ein Teil »das Herrschende« (archon) und ein anderer »das Beherrschte« (archomenon) sein müsse.8 Thomas von Aquin (1225–1274) bewegte sich in den Spuren des griechischen Philosophen, als er argumentierte, der gesellschaftliche Friede »muss erst durch die Bemühung des Führers bewirkt werden«.9 In den Texten, mit denen die ersten Staatsgebilde im Vorderen Orient, in Ägypten und in Indien ihre Existenz rechtfertigten, findet sich ebenfalls die Vorstellung, dass ein mächtiger Herrscher vonnöten sei, um die Schwachen vor der Unterdrückung und Ausbeutung durch die Starken zu schützen. Hammurabi, König von Babylon (1792–1750), sagt im Prolog zu dem ihm zugeschriebenen Gesetzeswerk, seine Aufgabe sei es, »Gerechtigkeit im Lande herrschen zu lassen, damit der Starke den Armen nicht unterdrücke«.10 Die altindische Überlieferung kennt das dem Philosophen und Herrscherberater Chanakya (375–283) zugeschriebene »Gesetz der Fische«, in dem es heißt: »Gäbe es auf Erden keinen König, der den züchtigenden Stock trägt, dann würden die Starken die Schwachen aufspießen und braten wie Fische.«11 Nach Auffassung des konfuzianischen Philosophen Xunzi (ca. 298–238) waren die Menschen von Natur aus böse und das Geheimnis eines gelingenden Gemeinwesens in China bestand in der Einhaltung klar gezogener sozialer Grenzen zwischen ihnen. »Die heiligen Könige«, schreibt er, »hassten die Unordnung und stellten deshalb die Regeln auf von Ritual und Gerechtigkeit, um das Volk dadurch einzuteilen und ihm die Klassen der Reichen und der Armen, der Adeligen und der Gemeinen zu geben, so dass es einander kontrollierte. Dies ist der Leitsatz für die Befruchtung der Welt«.12
Der altägyptischen Herrschaftslehre zufolge ist die Abwesenheit des Staates verbunden mit einem Zustand von Unrecht und Gewalt, die in dem Begriff isfet zum Ausdruck kommt. Die Aufgabe des Herrschers besteht dieser Auffassung nach darin, die Gerechtigkeit zwischen Armen und Reichen, Schwachen und Starken herzustellen, die einen wichtigen Aspekt des weiter ausgreifenden Begriffs der ma’at darstellt, der Recht, Moral, Staat, Kult und religiöses Weltbild auf eine gemeinsame Grundlage stellt.13 Während dieser Vorstellung zufolge das Königtum und die Gerechtigkeit vom Himmel in die Menschenwelt herabsteigen, um die hier normalerweise herrschende isfet niederzuhalten, ist die staatliche Ordnung, um die es Thomas Hobbes (1588–1679) in seiner unter dem Eindruck des Englischen Bürgerkriegs und der kolonialen Expansion des britischen Empire verfassten Schrift Leviathan etliche Jahrhunderte später zu tun ist, eine menschengemachte.
Niemand, so stark er auch sein möge, schreibt der Begründer eines aufgeklärten Absolutismus, könne sich in einer Welt ohne ordnende staatliche Gewalt hinreichend davor schützen, der Raubgier oder dem Schwert seiner im Zweifel missgünstigen Mitmenschen zum Opfer zu fallen. Da der Mensch dem Menschen ein Wolf sei, aber im Unterschied zu diesem über so etwas wie Verstand verfüge, lege ihm die Vernunft nahe, den herrschaftslosen Naturzustand zu überwinden und sich mit den anderen Menschen auf einen Vertrag zugunsten eines übergeordneten Dritten zu verständigen: den Staat. »Der alleinige Weg zur Errichtung einer solchen allgemeinen Gewalt, die in der Lage ist, die Menschen vor dem Angriff Fremder und vor gegenseitigen Übergriffen zu schützen und ihnen dadurch eine solche Sicherheit zu verschaffen, dass sie sich durch eigenen Fleiß und von den Früchten der Erde ernähren und zufrieden leben können, liegt in der Übertragung ihrer gesamten Macht und Stärke auf einen Menschen oder eine Versammlung von Menschen, die ihre Einzelwillen durch Stimmenmehrheit auf einen Willen reduzieren können«,14 so Hobbes in dem vielleicht einflussreichsten staatsphilosophischen Text der Neuzeit. Fehlt besagter Souverän, so droht sich die Gesellschaft in einen Zustand aufzulösen, in dem ein unkontrollierter Gewaltausbruch jederzeit und allerorten möglich ist. Das Vorhandensein eines starken Staates, der die legitime Ausübung von Gewalt in einer Hand monopolisiert, ist daher in dieser bis heute auch in sich selbst als liberal und demokratisch verstehenden Gemeinwesen weitverbreiteten Sichtweise die Bedingung der Möglichkeit jedweder kulturellen Entwicklung.
Die Zähmung des Raubtiers
In der Tradition dieses modernen Staatsdenkens steht auch Norbert Elias’ (1897–1990) rund 300 Jahre später verfasste Theorie vom »Prozess der Zivilisation«. Am Beispiel der Entwicklung von Politik und Gesellschaft vom europäischen Mittelalter zum Absolutismus will der Soziologe einen Zusammenhang zwischen Herrschaftszentralisierung und der Innenlegung gesellschaftlicher Zwänge aufzeigen, die eine Verfeinerung der Sitten, eine stärkere soziale Arbeitsteilung und die Abnahme direkter körperlicher Gewalt zwischen den Menschen zur Folge hat. Der Zivilisationsprozess, wie ihn Elias auf der Grundlage eigener historischer Untersuchungen modellhaft beschreibt, geht von den herrschaftlichen Höfen des europäischen Mittelalters aus und verbreitet sich von dort, also von oben, in die untergeordneten Schichten. »Die Art der Stilkonventionen, der Umgangsformen, der Affektmodellierung, die Wertschätzung der Höflichkeit, die Wichtigkeit des Gutsprechens und der Konversation, die Artikuliertheit der Sprache und anderes mehr«, so Elias, »alles das bildet sich in Frankreich zunächst innerhalb der höfischen Gesellschaft und wird in einer kontinuierlichen Ausbreitungsbewegung langsam aus einem Sozial- zum Nationalcharakter«.15 Die geschilderte Herausbildung einer gleichsam automatisch arbeitenden »psychischen Selbstzwang-Apparatur« stehe »mit Monopolinstituten der körperlichen Gewalttat«,16 welche die Individuen zur sozialverträglichen Unterdrückung und Mäßigung ihrer Affekte zu zwingen in der Lage sind, in engem Zusammenhang.
Die Allgemeingültigkeit dieser Aussage kann heute anhand vieler Einzelbeispiele aus dem reichen Fundus ethnologischer Forschung als widerlegt gelten. So wurde gezeigt, »dass die Triebmodellierung in Gesellschaften nicht nur ohne Staat, sogar ohne Stammesverband zumindest genauso weit fortgeschritten war und ist wie bei uns«.17 Zwar hat sich Elias von einem alten, imperial geprägten Begriff der Zivilisation lösen wollen, doch teilt seine »Beschreibung ›früherer‹ und anderer, besonders nichtstaatlicher Gesellschaften«18 jenen herablassend kolonialistischen Blick auf indigene Bevölkerungsgruppen, der auch für ansonsten in vielerlei Hinsicht emanzipatorisch gesinnte Intellektuelle seiner Zeit typisch war. So fabulierten Horkheimer und Adorno in ihrer Dialektik der Aufklärung ganz unbefangen vom »Schlagen und Beißen beim Geschlechtsakt der australischen Wilden«,19 welches »noch« in der sublimiertesten Zärtlichkeit durchscheine, und Hannah Arendt übernahm den kolonialen Herrenmenschenblick, als sie in ihrer ebenso berühmten wie einflussreichen Studie Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft über afrikanische Gesellschaften schrieb, dass »deren politische Organisation Formen, die wir auch aus dem tierischen Gemeinschaftsleben kennen, kaum überschritten«.20 Die Buren hätten daher mit »viel berechtigter Verachtung und mit einem noch viel berechtigteren Grauen«21 auf die Eingeborenenvölker in der Wildnis herabsehen müssen, was sie – in Arendts Augen – »zu den furchtbar mörderischen Vernichtungen und zu der völligen Gesetzlosigkeit in Afrika verführt«22 und sie zudem eine Blaupause für die von faschistischen Mobführern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verübte Gewaltpraxis habe abgeben lassen. Diese, spekuliert Arendt, hätten ganz einfach realisiert, dass die Buren »für die unbestrittene Herrschaft über den schwarzen Erdteil« den Preis der kulturellen Degeneration hätten bezahlen müssen, und waren »bereit, es den Buren gleichzutun, wenn sie durch die Verwandlung ihrer eigenen Nationen in Rassehorden die Herrschaft über andere ›Rassen‹ gewinnen konnten«.23
Wo Arendt die kolonialen Täter zu verführten Opfern macht und die extreme Gewalt kolonialer Herrschaft auf diese Weise nicht nur zu erklären versuchte, sondern zu einem gewissen Grad auch entschuldigte,24 enthält die Theorie von Norbert Elias eine zumindest »implizite […] moralische Absolution Europas. Denn wenn der Prozess der Zivilisation allgemeines Schicksal und Europas Führerschaft ausgemacht ist, spricht nichts gegen die aktive kulturelle Missionierung der außereuropäischen Welt. Sie wäre ohnehin unvermeidlich«.25 Tatsächlich aber handelt es sich bei der Annahme, erst der Staat mache aus vermeintlichen »Wilden« ordentliche, zur demokratischen Beteiligung befähigte Bürger, um eine irrige Meinung. Stattdessen ist in globalgeschichtlicher Perspektive das Beispiel herrschaftsloser Gesellschaften am Rande und außerhalb des Wirkungsbereichs von Staaten als einer jener Faktoren zu betrachten, die zur Zivilisierung und demokratischen Zähmung des Staates beitragen. Es sind die in Reiseberichten, Mythen, Legenden, Volksliedern, aber auch in Geschichtsnarrativen, ethnologischen Studien oder philosophischen Erörterungen aufgehobenen Berichte über Gesellschaften, in denen es freier und gleicher zuging, als in der jeweils eigenen, die immer wieder die rebellische Fantasie all jener beflügelte, die mit dem jeweiligen Regime unzufrieden waren. Die Botschaft lautete: Ein Leben ohne Könige, Feudalherren, mächtige Priester und Generäle ist möglich und wurde – je nach Interessenlage und Perspektive – entweder rigoros abgelehnt oder als Ziel erachtet, das es anzustreben galt. Nun handelt es sich nicht bei allen dieser Gesellschaften um solche, deren Ursprung in einer Flucht vor dem Staat nachgewiesen werden kann. Manche mögen eine Jahrhunderte oder gar Jahrtausende alte Geschichte aufweisen, in denen dauerhafte Formen von Herrschaft keine wesentliche Rolle spielten. Doch viel spricht dafür, dass eine ganze Reihe von indigenen Gemeinschaften, die in der Regel als »ursprünglich«, als Überbleibsel eines früheren, weniger entwickelten Stadiums der Menschheitsgeschichte betrachtet werden, mit ihrer besonderen politischen Struktur auf die Erfahrung mit zentralisierten Herrschaftsformen reagiert haben. Beispielsweise gibt es bei den Haudenosaunee (Irokesenkonföderation), deren egalitäre Konsensdemokratie das Denken der Amerikanischen Revolution,26 der frühen US-Frauenbewegung27 und nicht zuletzt das von Karl Marx28 und Friedrich Engels29 beeinflusste, die Überlieferung, sie stammten letztlich von einem Volk entflohener Leibeigener ab, »die von einem zahlenmäßig überlegenen Feind namens Adirondack (›Baum-Esser‹) unterjocht worden seien. Unterwerfung und Revolte«, schlussfolgern Graeber und Wengrow, »waren also keineswegs unbekannte Phänomene«.30
Viele dieser Gesellschaften ohne Staat hatten zwar Häuptlinge, diese verfügten aber – sehr zur Verwunderung europäischer Beobachter – häufig über keinerlei Mittel, ihre Anweisungen auch durchzusetzen, d. h. ihre vermeintlich Untergebenen zu irgendetwas zu zwingen. Die Hauptfunktion dieser Institution, stellte der Ethnologe Pierre Clastres auf der Grundlage eigener Feldforschungen bei den Guayaki und Guarani in Paraguay und Brasilien heraus, bestand in nichts anderem, als in ritualisierten Reden die Einhaltung der egalitären gesellschaftlichen Normen einzufordern. »Fast immer wendet sich der Anführer täglich bei Morgengrauen oder in der Abenddämmerung an die Gruppe. In seiner Hängematte liegend oder neben seinem Feuer sitzend, spricht er laut die erwartete Rede. Und gewiss muss seine Stimme kräftig sein, um sich vernehmbar zu machen. Denn es herrscht keinerlei Andacht, wenn der Häuptling spricht, keine Stille, jeder fährt in aller Ruhe fort, seinen Beschäftigungen nachzugehen, als ob nichts geschähe«, so der 1977 im Alter von nur 43 Jahren tödlich verunglückte Schüler von Claude Lévi-Strauss. Genau jenen Platz, an dem sich in herrschaftlich verfassten Gesellschaften ein Befehlshaber oder Souverän befindet, nimmt in einer großen Gesamtheit von Gesellschaften in Süd-, Mittel- und Nordamerika eine Instanz ein, dem die Befugnis, Befehle zu erteilen, demonstrativ verwehrt wird. Die hervorgehobene, mit besonderen Pflichten verbundene Rolle des Häuptlings besetzt den zentralen symbolischen Ort, von dem Herrschaft ausgeht, gerade deswegen, um ihren Einzug in die Gemeinschaft zu verhindern – so lässt sich die von Clastres formulierte Theorie des Häuptlingstums interpretieren.31
Da jedoch bei Weitem nicht alle egalitären Gesellschaften überhaupt über solche Häuptlinge verfügen, liegt die Vermutung nahe, dass die symbolisch hervorgehobene Position eine Art Gegenentwurf darstellte zu einer Herrschaftsinstitution, die man bereits kannte. Vielleicht hatte ein unglücklich verlaufender Kontakt mit einem Staat in den davon schockierten Angehörigen einer Gesellschaft, in der eine auf die Gemeinschaft bezogene Individualität viel bedeutete, der fraglose Gehorsam gegenüber Autoritäten jedoch verpönt war, den Reflex ausgelöst, sich auch symbolisch gegen das Aufkommen von hierarchischen Zwangsstrukturen in den eigenen Reihen zu wappnen. »Die Menschen kamen herum. Deshalb ist es unwahrscheinlich, sie hätten schlicht gar keine Ahnung von der Entwicklung in den benachbarten Teilen des Kontinents gehabt.«32 Auch in Amazonien, so interpretieren Graeber und Wengrow jüngere Forschungsergebnisse, hätten in früher Zeit große Staaten existiert. »Vielleicht«, vermuten sie, »waren die staatenlosen Amazonas-Bewohner Kinder von Rebellen, die aus diesen alten Königreichen geflohen waren oder sogar ihre Könige gestürzt hatten«.33 Sie machen zudem den Gedanken stark, die Menschen könnten schon in der Frühzeit angefangen haben, mit unterschiedlichen politischen Organisationsformen geradezu zu experimentieren. Darauf deutete der saisonale Wechsel zwischen egalitären und hierarchischen Formen bei Indianern der nordamerikanischen Plains – heute sprechen viele Mitglieder dieser indigenen Gruppen bevorzugt von Nationen, um ihren fortwährenden Anspruch auf Selbstregierung zu betonen. Während sie die meiste Zeit des Jahres über in kleinen Gruppen von Familien umherzogen, versammelten sie sich zur Zeit der großen Bisonjagd im Sommer und führten zu dieser Zeit jeweils eine Schar junger Männer zu einer hierarchisch organisierten Ordner- oder Polizeieinheit zusammen, der es erlaubt war, die für diese Aktivitäten notwendige Disziplin notfalls auch mit Gewalt durchzusetzen. Ein ähnlicher Wechsel zwischen unterschiedlichen Modi der Konzentration von Macht und Autorität, so Graeber und Wengrow, ist für Gesellschaften in Zentralbrasilien dokumentiert. Hier verhielt es sich jedoch umgekehrt. Denn während des Zusammenlebens im Dorf schwand die politische Autorität, die einzelne Anführer genossen, wenn sie sich zum Jagen und Sammeln in kleine Gruppen aufteilten. Wieder anders gestaltete sich die Aufteilung in der Polarregion Nordamerikas. »Bei den Inuit herrschten im Sommer die Väter; aber bei ihren winterlichen Zusammenkünften wurden die patriarchalische Autorität und sogar die Normen sexuellen Anstands in Frage gestellt, untergraben oder einfach aufgelöst.«34 Durch das kollektiv erfahrene »Muster saisonaler Sammlung und Zerstreuung«,35 das die Archäologie schon für »Phasen monumentaler Bauarbeiten und allgemeiner Zerstreuung auf das weite Land« in der britischen Jungsteinzeit entdeckte,36 so Graeber und Wengrow, entwickelten die Menschen ein Verständnis der Risiken und der Vorteile autoritärer Macht, ohne dass sie dafür mit einem dauerhaften staatlichen Gebilde hätten in Berührung kommen müssen. Außerdem begriffen sie dadurch, dass politische Ordnungen nicht einfach gegeben und unveränderlich waren, sondern durch menschliches Eingreifen verändert werden konnten.
Zudem sollte auf gar keinen Fall unterschätzt werden, wie viel Wissen in vielen der von der Ethnologie untersuchten Gesellschaften über die Psychodynamik unbewussten Begehrens vorhanden war, »was auch den Wunsch zu dominieren, diesen zu verwirklichen und zu kontrollieren, einschloss«.37 Zu therapeutischen Zwecken hatten die Haudenosaunee Praktiken der Traumdeutung entwickelt, Jahrhunderte bevor Sigmund Freud in Wien seine Praxis eröffnete. Im Unterschied zu psychoanalytischen Verfahren blieb es allerdings nicht bei der individuellen Assoziation zum Trauminhalt, sondern es wurde versucht, die mithilfe von Spezialisten diagnostizierten Triebwünsche der erkrankten Mitglieder der Gemeinschaft realiter oder durch symbolische Handlungen auch zu erfüllen.38 Daher ist es auch nicht zufällig, dass im Gründungsmythos der Haudenosaunee ausgerechnet jene Gestalt als symbolisches Zentrum der Konföderation bestimmt wird, die zuvor als über alle Maßen machtgierig geschildert worden war. Als sich die fünf im Kriegszustand befindlichen irokesischen Nationen in einem langwierigen Verhandlungsprozess darauf verständigen, sich zu einem Bund zusammenzuschließen, verweigert sich Tadodaho, ein mächtiger Zauberer und Kannibale, der die Nation der Onondaga anführt, zunächst hartnäckig der gemeinsamen Friedensordnung. Am Ende gelingt jedoch seine Zähmung. Man bietet ihm an, der Sprecher der zu einer Konföderation vereinten Nationen zu werden. Das kommt seinem enormen Geltungsbedürfnis entgegen und so willigt er ein. Zwar hat er in seinem neuen Amt keinerlei Befehlsgewalt, aber er weiß die in einem Bund vereinten Nationen, die Haudenosaunee, hinter sich. Als ihr Sprecher kann er sich als bedeutender und mächtiger empfinden denn als noch so furchteinflößender Häuptling der Onondaga. Er verköpert eine Bundesmacht, die allerdings nur dann zur Geltung kommt, wenn sich alle einig sind.39 Die Aufgabe des Tadodaho besteht nun darin, die Sitzungen des Häuptlingsrates zu moderieren, die der Herstellung eines solchen Konsenses dienen.40 Auf sehr ähnliche Weise schildert der Gründungsmythos der Osage, ein Volk aus der Sioux-Sprachfamilie, die Einbindung eines mächtigen Häuptlings in den neu entstehenden politischen Bund. Auch hier wird ein todbringende Macht missbrauchender Zauberer gebändigt, »indem man ihm eine zentrale Stellung in einem neuen Bündnissystem zuweist«.41
Das psychologische Wissen um das individuelle Begehren nach Macht, die Kenntnis von repressiven Regierungsformen, die ihnen bei anderen Gruppen begegneten oder aber die Flucht aus oder vor den repressiven Strukturen eines herrschaftsförmigen politischen Gebildes – alle diese Aspekte können die Ursache dafür sein, dass die Mitglieder indianischer Gemeinwesen die Herausbildung dauerhafter autoritärer und hierarchischer Institutionen aktiv verhinderten.
Was die oben bereits erwähnte Gründungserzählung der Osage betrifft, so bezeichnen Graeber und Wengrow die erwähnte Zähmung des Zauberers als »eine übliche Geschichte unter den Nachkommen von Gruppen, die früher unter dem Einfluss der Mississippi-Zivilisation gestanden hatten«.42 Letztere zeichnete sich, darauf deuten die archäologischen Daten hin, durch eine Häufung zentralisierter städtischer Strukturen aus. »Welche Faktoren auch immer zusammenspielten und die Kulturen zerfallen ließen, jedenfalls kam es um 1350 oder 1400 n. Chr. zu einer Massenflucht. War die Metropole Cahokia durch die Fähigkeit ihrer Herrscher entstanden, verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen, die oft aus großen Entfernungen stammten, so ging sie nun unter, weil die Nachkommen jener Menschen einfach weggingen. […] Wie kam es dazu? Bei den Nachfahren der cahokianischen Untertanen ist Migration oft damit verbunden, eine ganze Gesellschaftsordnung umzustrukturieren, die unsere drei Grundfreiheiten zu einem einzigen Emanzipationsprojekt zusammenfasst: wegziehen, ungehorsam sein und neue soziale Welten aufbauen.«43 Für die Osage, die Graeber und Wengrow zu diesen Nachfahren zählen, und die im südlichen Ohio lebten, bevor sie in die Great Plains zogen, sei der »Ausdruck ›in ein neues Land ziehen‹ gleichbedeutend mit einer Verfassungsänderung«.44
Revolutionäre Selbstbefreiung
Die Flucht vor repressiver Herrschaft ist ein Phänomen, das im Zusammenhang mit der Geschichte politischer Ideen bislang wenig diskutiert wurde. Als Widerstandsform wird sie im Vergleich zu Protestbewegungen, Revolten und Revolutionen nicht selten unterschätzt. In der Regel wird angenommen, dass Menschen, die Reißaus nehmen, statt sich zusammenzutun, um den Kampf gegen ein Regime aufzunehmen, im Hinblick auf die Durchsetzung besserer, demokratischerer Verhältnisse nicht viel bewirken können. Als politisches Phänomen scheint die Flucht auf den ersten Blick kaum »weiterführende Aspekte«45 aufzuweisen und wird entsprechend unterschätzt. In der kolonialen Nomenklatur der politischen Theorie der Neuzeit bleibt Flucht als riskante Selbstbefreiungstat ausgespart: »Wer flieht«, fasst Iris Därmann die entsprechende Auffassung zusammen, »der tritt den Rückzug vor einer übermächtig erscheinenden Realität an, anstatt auf Augenhöhe und mit offenem Visier für die eigene Sache einzustehen. Flucht bedeutet, so scheint es zumindest, sich der Verantwortung zu entziehen, eingegangenen Verpflichtungen genauso wie schuldigem Gehorsam«.46
Die Kulturwissenschaftlerin hat verschiedene historische Fluchtbewegungen als »eminent politische Praktiken revolutionärer Selbstbefreiung« herausgestellt.47 Ihr Hauptaugenmerk liegt auf den Gewalträumen der Sklaverei, die mit der sich auf verschiedene Kontinente erstreckenden Landnahme durch die europäischen Kolonien im 17., 18. und 19. Jahrhundert verknüpft ist. Sie stellt heraus, dass die Absetzungsbewegung aus diesen Extremzonen repressiver Herrschaft »neue, emergente, und eigenständige Lebensformen hervor[brachte], die weder reduzierbar waren auf gemeinsame Herkunft noch auf das Fighting back«.48 An diese Feststellung knüpfe ich darüber hinaus eine ideen- und eine strukturgeschichtliche These. Zum einen hinterließen die in den Metropolen verbreiteten Bilder von der vermeintlich unzivilisierten Lebensweise der in die Wildnis Geflüchteten Spuren in der Geschichte der politischen Ideen, die in den herkömmlichen Darstellungen zu wenig gewürdigt werden. Zum anderen hatten sie einen bislang deutlich unterschätzten Anteil an der demokratischen Zivilisierung des Staates. Die Absicht hinter den nun folgenden Skizzen ist nicht mehr und nicht weniger, als diesen Gedanken eines Einflusses historischer Fluchtbewegungen auf die Entfaltung demokratischer Ideen plausibel zu machen.
2.
Ganz weit draußen. Zu Besuch in Sointula
Das Erste, was der Besucher zu Gesicht bekommt, wenn er die kleine Fähre verlässt und den Boden der Insel betritt, ist der 1909 gegründete und durch die Lettern über seinem Eingang schon von Weitem zu erkennende Cooperative Store. Hier kaufen die Bewohner der den winzigen Hafen umschließenden Ortschaft seit eh und je ein, was sie nicht jagen, fischen oder im eigenen Garten ernten können. Der Name des Städtchens ist Glück verheißend: Sointula. Der Ausdruck stammt aus dem Finnischen und bedeutet so viel wie »harmonischer Ort«. Er lässt den Idealismus erahnen, der die finnischen Siedler, Frauen und Männer, unter Führung des Journalisten Matti Kurrikka im Jahr 1901 hierhergeführt hatte.
Fernab von der Zivilisation wollten sie auf Malcolm Island – so der offizielle Name des abgeschiedenen Fleckchens Erde an der kanadischen Pazifikküste – ihre Vorstellung von einem selbstbestimmten Leben ohne Ausbeutung und staatliche Gängelung verwirklichen. Die an der Erschließung der labyrinthischen Inselwelt British Columbias interessierten Behörden hatten ihnen das Land überlassen. Das war ein akzeptabler Deal für die Zivilisationsflüchtlinge. Zwar wurde den Siedlern abverlangt, die britischen Gesetze anzuerkennen, doch häufige behördliche Kontrollen waren in der abgelegenen Gegend kaum zu erwarten. Schriftsteller waren unter den Pionieren, Bergleute, aber auch Bauern und Handwerker. Idealismus war im Übermaß vorhanden. Gebraucht hätte es hingegen mehr Menschen, die darüber hinaus gewusst hätten, wie man mit Fischernetzen umgeht und Land- oder Forstwirtschaft betreibt. Zudem mangelte es den enthusiastischen Siedlern an dem notwendigen Eigenkapital für die Grundfinanzierung ihres Projekts. Als das gerade errichtete Versammlungshaus im Jahr 1903 niederbrannte, brach die Gemeinschaft auseinander.
Zur Zeit meines kurzen Aufenthalts im Sommer 1996 waren Spuren der ursprünglichen Siedler noch deutlich zu erkennen. Beidseits der kaum von Autos befahrenen Hauptstraße standen kleine Holzhäuser. Auf manchen Grundstücken, die von hüfthohen Zäunen begrenzt waren, grasten Pferde. Und hier und da verriet noch eine kleine Saunahütte die Herkunft der Nutzerfamilien. In einem alten Schulgebäude befand sich das Museum der Ortschaft. In einem einzigen winzigen Raum waren die Überbleibsel von fast 100 Jahren Siedlungsgeschichte zu besichtigen: Werkzeuge, Fotos, Haushaltsgegenstände, Plakate, Musikinstrumente und Zeitungsartikel, die von weit zurückliegenden Ereignissen in der kleinen Gemeinde berichten.
Lenin im Gemeindesaal
Nicht alle Inselbewohner gaben ihre sozialistischen Überzeugungen nach dem Scheitern des utopischen Projekts auf. »Im Gemeindesaal«, erzählte Frank, »hängen noch heute Hammer und Sichel sowie ein Lenin-Porträt.« Erst vor ein paar Tagen war der studierte Sinologe, der bis zu seiner Pensionierung als Verwaltungsangestellter einer Universität in Kalifornien gearbeitet hatte, mit seinem Kajak wie aus dem Nichts am Strand vor dem kleinen Hostel der Nachbarinsel aufgetaucht, das in einer ehemaligen Kirche untergebracht ist. Ich und mein zeitweiliger Reisebegleiter Fritz hielten mal wieder vergeblich nach den Rückenflossen einer Familie von nomadisierenden Schwertwalen Ausschau, die nach Auskunft der Ortskundigen jedes Jahr um diese Zeit hier Zwischenstation auf ihrer Wanderung machten und sich dem Ufer von Alert Bay auf Steinwurfentfernung näherten. Nun statteten wir Frank also einen Gegenbesuch ab.
Wir zelteten im Garten des Hauses, das er für sich und seine chinesische Frau auf einem Waldgrundstück in Sointula gebaut hatte. Frank wusste viel zu erzählen, von dem manches noch nachhallte, als mich die unvertraut lauten Geräusche der Nacht lange Zeit nicht einschlafen ließen – von der Jagd auf Hirsche mit Pfeil und Bogen, von den bemitleidenswerten jungen Adlern, die sich mit ihren scharfen Krallen immer wieder in allzu große Fische verhakten, von diesen nicht mehr loskamen und schließlich ans Ufer der Insel gespült wurden, von den in der Region verbreiteten Schwarzbären und von den Buckelwalen, die keineswegs ungefährlich waren, wenn man ihrer mächtigen Schwanzflosse mit dem Kajak zu nahe kam. Einer seiner Freunde habe das schmerzlich erfahren müssen, als er beim Paddeln mitten in eine Gruppe der majestätischen Tiere hineingeriet. Ein einziger Hieb genügte, um dem unvorsichtigen Ausflügler die Rippen zu brechen. Unser Gastgeber warnte uns auch vor den Pumas, die hin und wieder Kinder angriffen und erst neulich einen Mountainbiker mit Jagdbeute verwechselt hatten: eine Begegnung, die für den Radfahrer tödlich endete. Frank erzählte von den Einsiedlern, die unbehelligt von den Behörden vom Fischen und Wildern lebten und nur selten hergepaddelt kamen, um sich auf dem letzten Vorposten der Zivilisation mit Vorräten einzudecken. Und nicht zuletzt berichtete er von den Hippies, die sich in den 1960er- und 1970er-Jahren auf einem abgelegenen Teil der Insel niedergelassen hatten, kaum Kontakt zur übrigen Bevölkerung pflegten und dort noch immer ungestört Marihuana anbauten.
Für Aussteiger war die zwischen Vancouver Island und den Gletschern des Festlands gelegene Inselwelt ein ideales Terrain. Hier hatten die durch die Studien des Ethnologen Franz Boas bekannt gewordenen Kwakwaka’wakw (früher: Kwakiutl) ihre 1884 verbotenen Potlatschfeiern fast 70 Jahre lang im Untergrund praktiziert. Stein des Anstoßes war vor allem das in die Festivitäten eingebundene rituelle Schenken. Man wollte ordentliche Staatsbürger aus den »Wilden« machen, die Steuern zahlten, Betriebe gründeten oder sich als Arbeiter in der Holz- oder Fischkonservenindustrie verdingten. Letzteres taten sie auch, aber nur um ihren Clanhäuptlingen die Ausrichtung verschwenderischer Feiern zu ermöglichen, bei denen die in einer Saison angehäuften Reichtümer mit einem Mal komplett konsumiert oder vernichtet wurden. Während diese Potlatsch-Zeremonien für Generationen von Sozialwissenschaftlern – von Marcel Mauss bis Georges Batailles – ein Faszinosum darstellten, vertrat der kanadische Staat – wahrscheinlich zu Recht – die Ansicht, dass sie sich nicht gut mit den Erwerbsnormen einer kapitalistischen Gesellschaft vertrugen. Kirchenvertreter, denen es zudem um die Missionierung der Heiden ging, war der im Rahmen der Zeremonien praktizierte rituelle Kannibalismus ein Dorn im Auge, auch wenn er – vergleichbar der Wandlung im christlichen Gottesdienst – nur in symbolischer Form auftrat. Jedenfalls setzte sich die