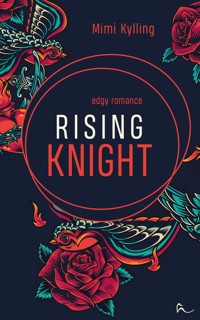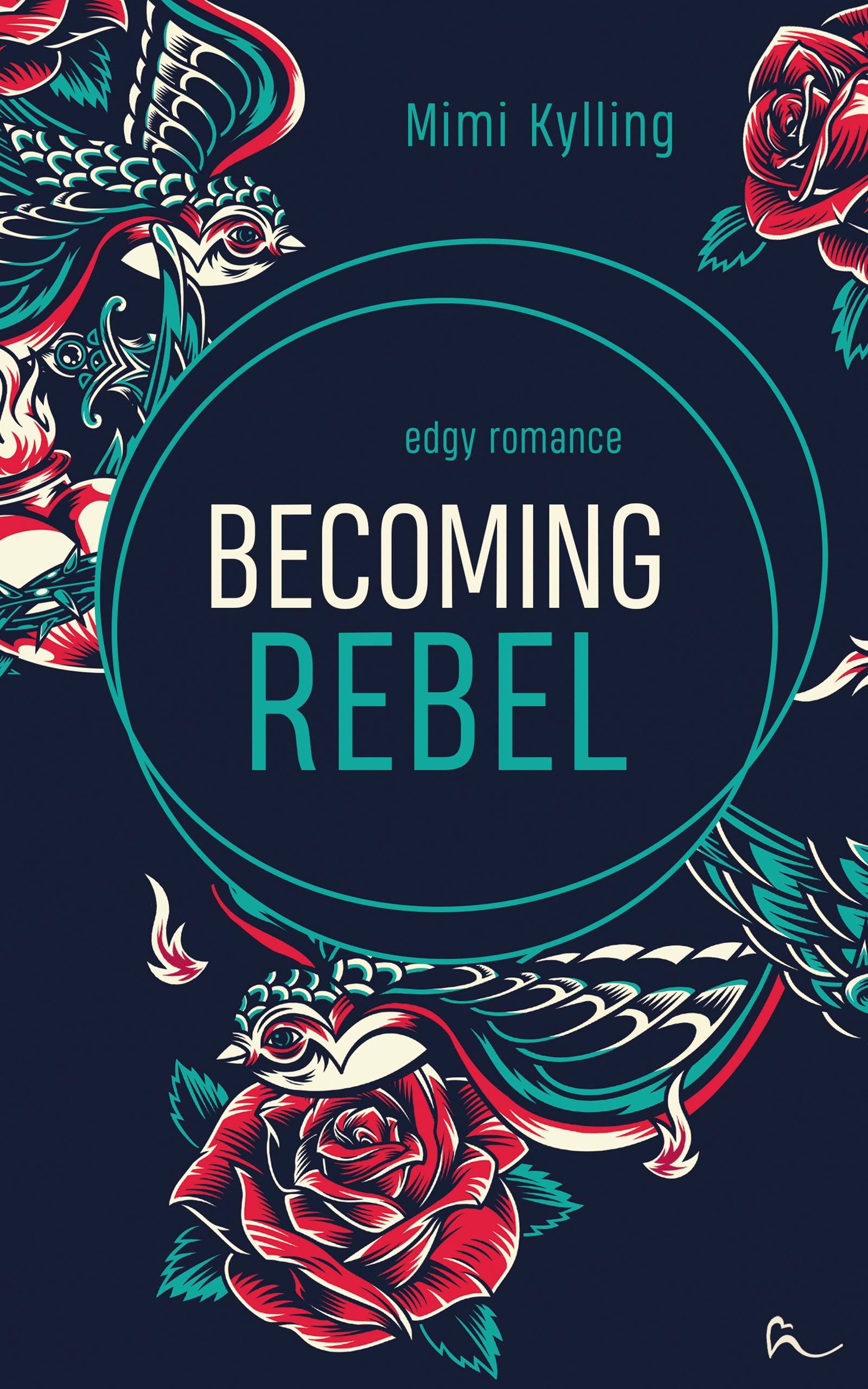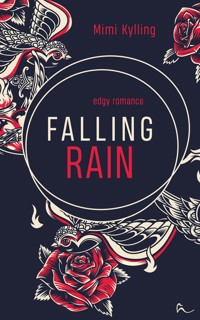
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rinoa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich bin Rain, June. Für dich bin ich Rain. Rain ist die beste Version von mir.«
June ist sicher, dass sie niemals wieder lieben wird. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an den Tod ihres Mannes. Als sie nach Half Moon Bay zieht, sucht sie deshalb nur eins: Ruhe, um mit der Vergangenheit abzuschließen.
Bis sie auf Rain trifft.
Rain, der seinen echten Namen nicht verrät. Der sie mit seinen vorlauten Sprüchen zur Weißglut bringt und mit seiner offensiven Art um den Verstand. Mit dem sie absolut nichts zu tun haben will. Wären da nicht diese grauen Augen, die so mühelos hinter ihre Fassade schauen können. Und diese Berührungen, die sich so sehr nach Leben anfühlen.
In ihrer Einsamkeit lässt sich June schließlich auf ein Spiel mit ihm ein. Die einzige Regel: Keine Fragen, keine Hintergründe, keine Vergangenheit. Eine Woche im Hier und Jetzt.
Niemand von beiden ahnt, welche Abgründe sich zwischen ihnen auftun werden und wie verwoben ihre Leben miteinander sind.
Als alle Masken fallen, müssen Rain und June sich entscheiden:
Vergangenheit oder Zukunft? Schuld oder Vergebung?
Serienauftakt, Edgy / Dark Romance Light
In sich abgeschlossen, kein Cliffhanger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Inhalt
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
EPILOG
Ein paar Worte zum Schluss …
Impressum
© 2023 Rinoa Verlag
c/o Emilia Cole
Pater-Delp-Straße 20, 47608 Geldern
ISBN 978-3-910653-50-4
© Covergestaltung: Coverstube
Korrektur: Lektorat Zeilenschmuck
rinoaverlag.de
mimikylling.de
Alle Personen und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden. Jedwede Ähnlichkeit zu lebenden Personen ist rein zufällig.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für alle, die Fehler gemacht haben.
Kapitel 1
Manchmal entstehen aus den merkwürdigsten Ideen die besten Momente im Leben.
Das hat mein Mann Sam immer gesagt.
Früher hat er mich mit seiner obsessiven Liebe zu Kalendersprüchen wahnsinnig gemacht. Heute würde ich alles dafür geben, nur noch ein einziges Mal seine Stimme zu hören.
Immer wenn ich ihn gefragt habe, warum er so viel auf diese dahingesagten Weisheiten gibt, hat er darauf mit einem unergründlichen Lächeln geantwortet und gesagt: Weil sie eben wahr sind, June. Irgendwann wirst du das auch verstehen.
Ich wünschte wirklich, er würde heute neben mir in diesem Auto sitzen, mir zulächeln und Mut machen. So, wie er es immer getan hat.
Doch der Sitz neben mir ist leer.
Mit schwerem Herzen biege ich in die Auffahrt von meinem neuen Haus ein und drehe die Musik leiser. Im Stillen bete ich dafür, dass ich es nicht bereue, den Mietvertrag so blindlings unterschrieben zu haben – ohne vorher eine Besichtigung zu vereinbaren.
Aber ich konnte nicht.
Ich habe mich davor gedrückt, herzukommen.
Ich war schon immer die, die sich bei Problemen lieber die Decke über den Kopf gezogen hat. Sam war der, der alles angegangen ist, der für alles eine Lösung hatte. Jetzt muss ich meine Lösungen selbst finden.
Als ich den Motor ausschalte und die Klimaanlage aufhört zu surren, wird die Luft im Auto sofort stickig.
Mein eigenes Seufzen klingt in der Stille übertrieben laut und ich öffne die Fahrertür, bevor ich es mir anders überlege und mit wehenden Fahnen nach San Francisco zurückfahre.
Hier in Half Moon Bay soll mein neues Leben beginnen. Genau dort, wo mein altes geendet hat. Es ist eine ziemliche Ironie des Schicksals, aber vielleicht der einzige Weg, damit fertig zu werden. Ich muss mich endlich den Dämonen stellen, bevor sie mich irgendwann in die Knie zwingen.
Komm schon, Junebug. Du schaffst das. Augen zu und durch.
Das Echo von Sams Stimme ist auch heute noch so präsent, dass es mir die Luft abschnürt.
Ein paar Minuten später stehe ich inmitten von Kisten im offenen Wohnbereich des Bungalows und stelle wieder einmal fest, wie weit Vorstellung und Realität manchmal voneinander entfernt sind. Was auf den Maklerfotos minimalistisch und modern wirkte, sieht jetzt einfach nur kalt und unpersönlich aus. Das meiste der Einrichtung ist in klinischem Weiß gehalten. Akzentuiert durch Möbel in Grau. Vielleicht ist es gut so. Das hier ist nur eine Zwischenstation. Eine weitere Etappe, keine Dauerlösung.
Für einen Moment sehe ich eine andere Vision meines Lebens. Ein größeres Haus, voller Leben und Liebe. Bunte Wände und unzählige Fotos. Sam und mich. Kinderlachen. Ich vertreibe das Bild, bevor es sich richtig festsetzen kann.
Sam hat sich das immer gewünscht. Er wollte unbedingt ein Haus am Meer, ein ruhiges Leben und eine große Familie.
Nichts davon wird er bekommen.
An Tagen wie heute vermisse ich ihn besonders. Ich wäre gern Arm in Arm mit ihm durch diese Räume gegangen und hätte sein strahlendes Gesicht gesehen, wenn er das Meer entdeckt hätte. Ich stelle mir vor, wie er mich hochgehoben hätte. Wie er gesagt hätte: Schau nur, Junebug. Da hinten. Siehst du den Strand? Schließ mal die Augen, hörst du das Meer? Wir werden das hier zu unserem Zuhause machen. Mit Liebe ist alles möglich.
Ich schließe die Augen, aber ich höre das Meer nicht. Ich höre nur das Klopfen meines Herzens und das Blut in meinen Ohren rauschen.
Warum musste er auch an diesem Tag zu genau dieser Zeit auf genau diesem Highway sein? Warum ist er ausgestiegen? Warum ist er nicht zehn Minuten später losgefahren?
Dann wäre er heute noch bei mir.
Wie macht man weiter, wenn an einem ganz normalen Samstag das komplette Leben aus den Fugen gehoben wird? Wenn dieser eine Mensch stirbt, den man mehr als alles andere auf der Welt geliebt hat? Unwiederbringlich und endgültig?
Vermutlich kann man niemals ganz weitermachen. Vermutlich wird ein Teil von mir für alle Zeit auf seiner Beerdigung stehen und auf seinen Sarg starren. Aber der andere Teil von mir muss weitermachen.
Für ihn und für uns.
Wir hatten Pläne.
Das hier ist einer davon.
Wir wollten schon länger aus San Francisco rausziehen. Zurück in die Nähe von Sams Eltern. Wir wollten sesshaft werden und eine Familie gründen.
Zwei Jahre später ist kaum etwas davon übrig geblieben. Ich habe Alice und Burt seit Sams Beerdigung nicht mehr gesehen und ich schäme mich dafür, dass ich all ihre Einladungen abgesagt habe. Aber wie hätte ich mit seinen Eltern am Tisch sitzen und Kaffee trinken sollen, wenn sein Platz für immer leer bleiben wird?
Heute ist der Tag, an dem ich es herausfinden werde, denn ich bin bei ihnen zum Abendessen eingeladen. Mein erster Reflex war, auch dieses Mal abzusagen, aber dann … konnte ich es nicht.
Ich bleibe am Fenster stehen und schaue zum Horizont, genau auf die Stelle, an der Himmel und Ozean sich treffen. Dann wird meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes gelenkt.
Sitzt da jemand in meinem Garten?
Tatsächlich, da sitzt ein Junge. Er hat die Füße auf dem Gartentisch abgelegt und hört über Kopfhörer Musik. Sein dürrer Körper steckt in einem schwarzen Bandshirt mit Wikingerprint auf der Vorderseite.
Im Ernst?
Nach einem kurzen Moment der Verwirrung öffne ich die Tür zur Terrasse. Der Typ wippt mit dem Oberkörper und singt schief.
»Hey, du!« Er hört es nicht. »Hallo! Du da!«
Wieder nichts. Erst als ich so nah vor ihm stehe, dass mein Schatten auf ihn fällt, schaut er sehr erschrocken hoch. Er zupft seinen Ohrstöpsel aus dem Ohr, bleibt aber sitzen.
»Das ist mein Haus«, sage ich überflüssigerweise.
Er nickt nur starr und betrachtet mich wie eine Außerirdische.
»Das bedeutet, dass du gehen solltest, denn dieser Garten ist mein Garten.«
Und als wäre ihm diese Information in der Zwischenzeit ebenfalls klar geworden, schießt er wie ein Irrwisch vom Sitz hoch und huscht davon, nur um Sekunden später mit einem gewaltigen Satz über die Hecke zum Nachbargrundstück zu verschwinden.
Na toll, das geht ja gut los.
Den Rest des Tages habe ich damit verbracht, einen Teil meiner Kleidung auszupacken, mich einzurichten und ein paar Einkäufe zu erledigen.
Jetzt ist es Punkt neunzehn Uhr. Ich stehe vor dem Haus meiner Schwiegereltern und versuche penibel, das cremefarbene Leinenkleid glatt zu streichen. Doch Leinen verzeiht nichts.
Alles hinterlässt Spuren.
Noch so eine Weisheit, von der Sam überzeugt war. Damals wusste ich noch nicht, wie tief seine Spuren auf meiner Seele sein würden. Und dass seine Spuren irgendwann alles sein würden, was von ihm bleibt.
Ehe meine Gedanken noch weiter abdriften können, wird die Tür aufgerissen. Mit einem solchen Schwung, dass ich den Luftzug auf der Haut spüre.
»Meine Güte, June. Wie schön, dass du da bist.« Alice schlägt eine Hand vor die Brust und zieht mich ohne Umschweife in den Arm. »Wir haben uns so auf dich gefreut, Liebes. Es ist eine halbe Ewigkeit her.«
Da ist nicht der Hauch eines Vorwurfes aus ihrer Stimme zu hören. Mein schlechtes Gewissen schießt durch die Decke.
Kraftlos lasse ich den Kopf gegen ihre Schulter sacken und atme ihr vertrautes Parfüm ein. Der Duft katapultiert mich mit Wucht in die Vergangenheit zurück.
Früher waren wir oft hier. Ich erinnere mich an gemeinsame Nachmittage, an Kuchen und gute Gespräche.
An Sams Lachen.
Im nächsten Moment kommt mein Schwiegervater Burt dazu und auch er begrüßt mich wie eine heimgekehrte Tochter. So lange, bis Alice mich aus seinen Armen löst.
»Lass sie doch los, Burt. Sie bekommt ja keine Luft.« Ihre Hand liegt so vorsichtig auf meiner Schulter, als hätte sie Angst, dass ich mich wieder in Luft auflöse, wenn sie zu forsch ist. »Komm, Liebes. Die Würstchen sind schon auf dem Grill.«
Alice und Burt führen mich Seite an Seite durch den Wohnbereich auf die Terrasse und bieten mir einen Platz in den Korbmöbeln an, die hier mitsamt einem Esstisch im Schatten eines großen Sonnensegels stehen. Sam hat es hier geliebt. Die Aussicht, die gemütliche Atmosphäre.
Ich lasse mich fallen, die beiden setzen sich mir gegenüber. Die letzten zwei Jahre stehen wie eine Mauer zwischen uns.
»Wie gehts euch denn so?« Eine Frage, so belanglos wie die Antwort, die man darauf erwartet. Aber ich habe heute keine Kraft für mehr. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, das Zittern meiner Hände im Zaum zu halten und nicht in Tränen auszubrechen.
»Ach, es geht schon. Burt ist ja seit einem Jahr in Rente, nicht, Burt? Wir genießen das Leben hier und sind viel im Golfclub. Seit Sam …« Alice hält kurz inne. »Also in den letzten Jahren haben wir einige neue Hobbys dazugewonnen. Ich belege jetzt Kochkurse. Ist doch so Burt, oder?«
Burt brummt eine kurze Zustimmung und verschwindet wieder an den Grill.
»Und bei dir, June? Wie geht es dir?« Alice senkt ihre Stimme und legt die Hand quer über den Tisch auf meine. Ich schaffe es kaum, sie anzusehen.
»Ach, weißt du, es ist in Ordnung. Ich freue mich, dass ich jetzt hier bin, und ich bin auch aufgeregt wegen meiner neuen Stelle. Es geht schon irgendwie.« Ich zwinge mich zu einem Lächeln, dabei ist die ganze Situation völlig abstrus.
Nichts geht. Ich vermisse meinen Mann mehr als alles andere. Aber was soll ich sonst sagen? Als würde es den beiden anders gehen.
Es ist schrecklich, wie steif und gezwungen es sich anfühlt, heute hier an diesem Tisch zu sitzen. Früher war das anders. Früher war hier Lachen und Fröhlichkeit.
Und heute?
Was verbindet mich heute noch mit diesen Menschen?
Nur eine Erinnerung.
Burt kommt mit dem Grillteller zurück und legt mir ein Würstchen hin. Er setzt sich zu uns und wir beginnen nach einem kurzen Gebet zu essen. Denn das ist eine Sache, die der Familie Reed schon immer wichtig gewesen ist. Ihr unerschütterlicher Glaube.
Burt war bis vor ein paar Jahren Pastor in der Gemeinde in San Francisco, in der meine Mom nach dem Tod meines Vaters die Gottesdienste besucht hat. Irgendwann nahm sie mich mit, denn wir waren beide an einem Punkt im Leben, an dem wir alles und jeden infrage stellten. Wie sollte es auch anders sein, wenn man zusehen muss, wie ein geliebter Mensch so sehr leidet, dass er den Tod als Erlösung sieht?
Es war eine düstere Zeit.
Ich saß neben Mom in dieser Kirche und mein Kopf war derart leergefegt von all der Trauer, von all dem Zweifeln, dass ich zum ersten Mal wirklich zuhörte, was da gepredigt wurde.
Über Vergebung und Freude.
Liebe und Nähe.
Über die Toten und die Lebenden.
Erstaunlicherweise zog ich viel Kraft und Zuversicht aus diesen Worten. Ich ging immer öfter mit Mom mit. Wenig später lernte ich Reverend Reeds Sohn Sam kennen und lieben.
Sam war genau das, wonach ich mein Leben lang gesucht hatte. Sicherheit und Ordnung. Er war viel reifer und aufgeräumter als ich. So perfekt darin, alles im Griff zu haben. Er wusste immer eine Antwort und konnte mir bei allem helfen, was sich mir in den Weg stellte. Sam war meine sichere Bank und hat mir all das abgenommen, worum man sich nicht selbst kümmern will, wenn man noch ein halber Teenager ist. Er hat mein Auto gewartet, alle Versicherungen im Blick behalten und unsere Steuererklärung gemacht. Er war einer dieser Menschen, die einem Tee an die Badewanne bringen und den Rücken streicheln, wenn man einen schlechten Tag gehabt hat.
Ich habe mich jahrelang in seiner Wärme und seinem Mitgefühl gesonnt und ich habe es so sehr geliebt. Ich habe ihn so sehr geliebt.
»Und, June, wie gefällt dir dein Haus?«, fragt Burt in meine Gedanken hinein.
Ich antworte ihm, ohne mich wirklich auf die Worte zu konzentrieren. Dass ich es schön finde und ordentlich, dass ich nahe am Meer wohne und den Garten mag. Es klingt schrecklich emotionslos. Weil die Leere in meinem Inneren sich bleischwer anfühlt. Ich müsste jetzt etwas fragen. Etwas, das interessant ist. Etwas, das sie zum Erzählen ermutigt.
Worüber redet man mit Menschen, wenn jedes Wort unbedeutend klingt?
Wir unterhalten uns tatsächlich noch eine geschlagene Stunde oberflächlich über dies und das, bevor sie mich zur Haustür begleiten. Alice und Burt verabschieden sich beide ähnlich überschwänglich, drücken mich fest und lassen sich das Versprechen abnehmen, dass wir mindestens einmal in der Woche zusammen essen. Aber wenn mich nicht alles täuscht, sind sie genauso froh wie ich, als die Haustür endlich zufällt.
Zu Hause trete ich mir die unbequemen Sandaletten von den Füßen, gehe durch den dunklen Eingangsbereich und knipse in der Küche das Licht über dem Herd an. Moderne Spots tauchen den gesamten Wohnbereich in einen sanften goldenen Schein.
Aus einem Impuls heraus öffne ich eine der Flaschen, die ich in einer Pappkiste auf der Arbeitsplatte zwischengeparkt habe, und fülle mein Wasserglas vom Mittag großzügig mit Weißwein. Während ich im Gehen den ersten Schluck nehme, ziehe ich das Haargummi aus den Haaren und genieße das Nachlassen des Druckgefühls auf meiner Kopfhaut. Diesen Tag kann ich abhaken. Den ersten Tag aus einer langen Reihe an Tagen in diesem neuen Leben.
Ich nehme einen weiteren Schluck und lausche der Stille. Bis … da keine Stille mehr ist. Da ist Musik. Und Lachen.
Nicht im Ernst?
Wenn das jetzt wieder dieser merkwürdige Junge von vorhin ist, dann kann der sich auf was gefasst machen. Das Licht aus der Küche spiegelt sich in der Fensterfront, sodass ich nicht wirklich etwas erkennen kann. Da sind bloß die Geräusche und ein kleiner Lichtpunkt auf Höhe des Pools.
Na warte!
Beherzt stelle ich mein Glas auf den Couchtisch und schiebe die Terrassentür auf. Die hereinströmende Luft ist trotz der späten Uhrzeit viel drückender als die im Haus.
Während ich barfuß auf die Terrasse trete, scheppert mir der Song einer Metalband aus Handylautsprechern entgegen. Unfassbar. Diesmal lasse ich mir den Namen von seinen Eltern geben. Also wirklich. Ich glaube, es geht los.
Wutentbrannt stapfe ich in die Nacht hinaus. Direkt auf die Quelle der Musik zu. Je näher ich komme, desto besser sehe ich, was der helle Punkt ist. Eine Zigarette glimmt in der Dunkelheit auf. Im gleichen Atemzug realisiere ich, dass da nicht nur eine Person sitzt, es sind diesmal drei. In ihren dunklen Klamotten verschwimmen sie beinahe mit der Umgebung. Das ist definitiv nicht der kleine Wicht von vorhin. Die sind älter.
Sie unterhalten sich so laut, dass sie mich gar nicht bemerken. Ihr dunkles Lachen rieselt mir eiskalt den Rücken hinab.
Und allem Ärger zum Trotz, das ist der Moment, in dem meine Vernunft beschließt, dass Flucht noch immer die beste Option war. Man muss es ja nicht darauf anlegen. Ich rufe einfach von drinnen die Polizei.
Gerade will ich mich umdrehen und die Füße in die Hand nehmen, als Bewegung in die Gruppe kommt.
»Na, wen haben wir denn da?«
Laufen oder stehen bleiben?
»Stehen bleiben.« Es ist die gleiche Stimme wie eben. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich schneller laufen kann als diese Typen?
»Umdrehen.«
»Sieh mal einer an, wir bekommen Besuch.« Das ist eine zweite Stimme. Nicht weniger durchdringend als die erste. Langsam drehe ich mich in ihre Richtung, verschränke die Arme vor der Brust und versuche, Sicherheit auszustrahlen. Innerlich bin ich schon in Ohnmacht gefallen. Kinder in Bandshirts sind das eine, ausgewachsene Männer in der Dunkelheit das andere.
»Na, Baby? Lust auf eine Privatparty?« Sie lachen. Alle drei. So abartig amüsiert, dass ich davon eine Gänsehaut bekomme.
»Das ist mein Haus.«
»Und?«
»Ich möchte euch bitten zu gehen.« Meine Stimme ist erstaunlich laut. Trotzdem habe ich keine Kontrolle darüber, wie sehr sie schwankt. Meine kribbelnden Finger graben sich immer tiefer in meine eigenen Oberarme. Die Musik verstummt und die darauffolgende Stille wirkt noch bedrohlicher als die brüllenden Stimmen aus dem Song.
»Du möchtest uns bitten? Sie möchte uns bitten, habt ihr das gehört?« Das ist wieder die Stimme des ersten Typen, die noch immer bis aufs Äußerste belustigt klingt. Seine zwei Schatten stehen auf. Und sie kommen näher.
Beide überragen mich um mindestens einen Kopf und bauen sich wie eine Mauer vor mir auf. Mist, Mist, Mist. Egal, wie schnell ich laufe, ich bin niemals schneller am Haus als die.
»Na, was ist, hm? Wie wäre es mit uns? Wir hätten hier noch einen Platz in unserer Mitte frei.« Wieder lachen sie. Dieses Mal noch ungehaltener und rauer.
»Ich habe euch gebeten zu gehen. Und ich möchte das nicht noch einmal wiederholen.«
»Netter Versuch. Was passiert denn, wenn wir böse Jungs sind und nicht auf kleine Mädchen hören? Holst du dann Daddy raus?«
»Dann rufe ich die Polizei.«
»Oh, da haben wir jetzt aber Angst.« Der Typ links von mir tritt noch einen Schritt näher, sodass ich im fahlen Lichtschein des Hauses die blonden Haarspitzen unter seiner Kapuze erahnen kann. Und seinen finsteren Blick. Verdammt. Das ist absolut gar nicht gut. Er bleibt erst stehen, als ich den ersten Schritt rückwärts mache.
»Hast du Angst, Prinzessin?«, fragt er leise. Seinen Mund umspielt ein leichtes Lächeln.
»Ich rufe sofort die Polizei, wenn ihr nicht verschwindet.«
»Wirklich? Dann sollten wir dich zur Sicherheit wohl lieber hierbehalten, was?« Er kommt noch einen Schritt auf mich zu.
»Nein! Weil … drinnen ist … mein Mann. Der wartet auf mich. Wenn ich nicht gleich wieder da bin, kommt er raus und sucht mich. Und dann werdet ihr das bereuen.« Etwas Besseres fällt mir spontan nicht ein, aber ich habe mal im Trash-TV gesehen, dass man bei Entführungen immer die Illusion schaffen soll, nicht allein zu sein.
Anscheinend bin ich nicht sehr überzeugend, denn das Grinsen auf dem Gesicht dieses Typen vor mir wird mit jeder Sekunde breiter.
»Ach, echt?«, sagt er. »Na, dann lass ihn doch rauskommen. Ist bestimmt ein netter Typ.«
»Ja, ein richtiger Ehrenmann, wenn er seine Frau vorgehen lässt«, brüllt der dritte Typ, der immer noch auf meinem Gartensessel sitzt. Das Poolwasser plätschert im Hintergrund. Diese ganze Szene ist völlig surreal.
»Es reicht jetzt.«
»Du hast ja keine Ahnung.« Der Blonde macht einen weiteren Schritt auf mich zu. Und dann noch einen, während ich immer weiter zurückweiche. Als er nach meinem Arm greifen will, hebe ich die Hände und stoße ihn vor die Brust. Wie aus einem unkontrollierbaren Reflex heraus. Er scheint damit nicht gerechnet zu haben, denn er verliert das Gleichgewicht und taumelt zurück. Während sein völlig ungläubiger Blick auf meinen trifft, rauscht ein eiskalter Adrenalinschauer durch meinen Körper. Das ist der Moment, in dem ich mich umdrehe und renne. Weit schaffe ich es allerdings nicht, denn diesmal bekommt er meinen Arm zu fassen. Mit einer fließenden Bewegung dreht er mich um und packt mein Kinn.
»Sag nicht, du willst schon gehen? Jetzt, wo es gerade spannend wird.«
Als Antwort darauf hallt mein Wimmern durch die Nacht. Alle noch vorhandenen Gedanken setzen einer nach dem anderen aus, während sein Gesicht meinem immer näher kommt. Die Faszination in seinem Blick dreht mir den Magen um.
Herzschläge lang betrachtet er mich, dann bricht der Bann, als der andere Typ von meinem Loungesessel aufsteht.
»Hey, Rain, lass gut sein. Die Schlampe ist den Stress nicht wert.«
»Warum Stress? Ist doch nett hier, findest du nicht?« Sein psychopathisches Grinsen wird immer breiter, während sich seine Fingernägel tiefer in meine Haut graben.
»Rain. Es reicht.« Der Typ, der gerade aufgestanden ist, legt eine Hand auf die Schulter seines blonden Freundes. Der starrt weiterhin in meine Richtung, als hätte er die deutliche Aufforderung nicht gehört.
»Glaub ja nicht, dass wir schon fertig sind«, flüstert er, lässt mit einem Ruck mein Kinn los und schließt in aller Seelenruhe zu den anderen auf, die sich langsam in Richtung der dichten Hecken am Rand des Grundstücks bewegen.
Die angestaute Luft entweicht aus meiner Lunge, während ich den drei Gestalten hinterhersehe. Mein Herz rast und mein Gesicht prickelt taub von der groben Berührung. Selbst dann noch, als die drei schon längst über alle Berge sind. Ist das gerade wirklich passiert? Verdammt, das war knapp.Richtig, richtig knapp.
Erst als das Telefon im Haus klingelt, setzen meine normalen Denkprozesse wieder ein. Überdeutlich.
Ich muss hier weg. Schnell.
Mit eiligen Schritten laufe ich über den Rasen bis zur Terrassentür, trete ins Haus und schiebe das Glaselement zu. Mein Handy liegt klingelnd auf dem Wohnzimmertisch. Es ist meine Freundin Olive, der ich versprochen hatte, mich heute Abend zu melden. Und ich hätte es sicherlich auch längst getan, wenn ich nicht damit beschäftigt gewesen wäre, in meinem eigenen Garten um mein Leben zu fürchten.
»Meine Güte, June, ich habe den ganzen Tag an dich gedacht. Wie gehts dir? Wie lief dein Essen mit Alice und Burt?«
»Alles gut, mir gehts gut.« Mehr bekomme ich nicht heraus, weil meine Stimme furchtbar zittert.
Was, wenn die wiederkommen?
Glaub ja nicht, dass wir schon fertig sind.
»War es so schlimm?«
»Was? Nein, das … Olive? Was macht man, wenn man einen Übergriff bei der Polizei melden muss?«
»Einen Übergriff?«, schreit sie mir entgegen. So laut, dass ich das Handy ein Stück von meinem Ohr weghalte.
»Da war jemand in meinem Garten. Mehrere.«
»Jetzt? Eben grade? Ach du … Bist du in Sicherheit? Soll ich eine Polizeistreife zu dir schicken? Soll ich … kannst du …«
»Sie sind jetzt weg.« Trotzdem fühlt sich die Erinnerung an die Begegnung erschreckend real an.
»Ja, aber … du musst das auf jeden Fall melden. Warum in Gottes Namen bist du da rausgegangen?«
»Weil da nachmittags schon mal einer saß. So ein Junge. Ich dachte, das wäre wieder derselbe. Aber das waren seine erwachsenen Doppelgänger. In dreifacher Ausführung.«
»June! Da hätte sonst was passieren können!«
»Vielleicht ist das ein Zeichen. Vielleicht hätte ich lieber in San Francisco bleiben sollen.«
Sie atmet so tief ein, dass ich es durch den Hörer am ganzen Körper spüre. »Unsinn. Himmlische Zeichen gibt’s nicht. Und wenn, dann sicher nicht in Form von tätlichen Übergriffen. Soll ich das bei der Polizei melden oder machst du es selbst? Soll ich zu dir kommen, June?«
»Nein, brauchst du nicht. Ich rufe selbst bei der Polizei an.«
Nachher. Oder morgen. Oder irgendwann, wenn ich wieder klar denken kann.
»June, wirklich. Ich finde nicht, dass-«
»Bitte, lass uns über was anderes reden. Es war einfach ein verdammt langer Tag.«
»Wegen der Sache eben oder wegen deinem Besuch bei Alice und Burt?« Die Frage steht lange zwischen uns. Weil ich die Antwort selbst nicht so genau kenne.
»Weißt du, es hat sich einfach nur merkwürdig angefühlt. Als wollte man in die Zukunft schauen, aber der Geist der Vergangenheit schwirrt immer noch um einen herum«, sage ich, nachdem ich einen Schluck Wein aus dem Glas von vorhin getrunken habe. »Es war, als würde alles wieder hochkommen, während ich da bei ihnen im Garten saß. Wie soll ich denn einen klaren Gedanken fassen, wenn alles dort so … er ist?«
Olive seufzt. »June, ich will dir nicht zu nahetreten, aber es ist jetzt so lange her. Egal, wie oft du dich fragst, was Sam gesagt oder getan hätte, er wird nicht wiederkommen und es dir verraten. Es tut mir wirklich leid, aber das ist die Wahrheit.«
Und während sie das sagt, fährt mir ein solcher Stich durchs Herz, dass es sich anfühlt, als wäre meine Brust in einen Schraubstock gespannt. Tränen schießen in meine Augen.
Ich will die Wahrheit nicht.
Die Wahrheit bedeutet, dass ich weiterleben muss, obwohl die Liebe meines Lebens tot ist.
»June? Ich habe dich furchtbar lieb, das weißt du. Ich will nur, dass es dir irgendwann wieder besser geht. Es tut weh, dich so leiden zu sehen.«
»Ich weiß schon, Olive. Du hast ja recht. Aber wie? Wie soll das jemals gehen?«
Man hört, dass sie auf der anderen Seite des Hörers auch an einem Glas nippt. Ich wünschte, sie würde jetzt hier sitzen. Die Einsamkeit in diesem Haus ist kein bisschen so wohltuend, wie ich sie mir vorgestellt habe. Sie ist einfach bloß erdrückend.
»Süße, schau mal, was du in der letzten Zeit alles geschafft hast. Du hast diesen Umzug gemeistert, du hast sogar einen neuen Job gefunden. Du bist so weit gekommen, die nächsten Schritte schaffst du auch.«
»In einer Woche gehts los.« Die Beklemmung darüber, dass ich in wenigen Tagen wieder komplett an einem normalen Arbeitsleben teilnehmen muss, ist schwer in nachvollziehbare Worte zu fassen.
»Versprichst du mir was, June?«
»Ungern.«
Sie lacht bloß. »Trauer hin oder her. Die Zeit, die du jetzt hast, die gibt dir später niemand zurück. Du bist noch so jung. Leb ein bisschen, gönn dir Spaß. Versprich mir, dass du es wenigstens diese eine Urlaubswoche lang versuchst. Glaubst du, Sam hätte gewollt, dass du jahrelang in deiner Trauer untergehst?«
»Olive, das-«
»Nein, Sam hätte dir denselben Tipp gegeben. Also nimm ihn dir zu Herzen.«
Kapitel 2
Am nächsten Morgen wecken mich seltsame Geräusche im Haus. Ich habe kaum ein Auge zugetan und bin total hinüber. Mir ist so heiß, dass meine Haare und mein Nachthemd ekelhaft feucht an meiner Haut kleben.
Von wegen erste Träume im neuen Haus. Wenn die Träume aus dieser Nacht wahr werden, dann habe ich ein ernstes Problem. Ich habe von hünenhaften Männern und stechenden Blicken geträumt. Meine Nerven sind völlig überspannt.
Da! Da war das Geräusch schon wieder. Zischend. Wie eine Kaffeemaschine. Oder eine Pfanne. Was in aller Welt?
Ein Schauer läuft mir über den Rücken, weil ich mir plötzlich ganz sicher bin, dass jemand im Haus ist.
Okay, durchatmen.
Es kann niemand im Haus sein. Solche Zufälle gibt es nicht.
Erst die Sache gestern und jetzt ein Einbrecher? Das ist statistisch gesehen unmöglich.
Ich werfe mir ein dünnes Kleid über, trete in den Flur und dann um die Ecke zum offenen Wohnbereich.
Gleich werde ich feststellen, dass ich mir das Geräusch eingebildet habe. Dass es der Wind war. Oder ein offenes Fenster. Oder was auch immer. Einbildung. Nichts weiter. Ganz klar.
Mein Puls rast trotzdem. Sicherheitshalber entsperre ich das Handy und tippe die Notrufnummer ein. Statistik hin oder her. Diesmal bin ich schlauer.
Dann komme ich um die letzte Ecke und bleibe ruckartig stehen. Es fühlt sich an, als wäre ich gegen eine imaginäre Mauer gelaufen.
Denn mich erwartet weder ein klapperndes Fenster noch sonst eine andere logische Erklärung für die Geräusche.
Nein.
Da steht jemand in meiner Küche am Herd.
Ein Mann. Da steht ein Mann und brät etwas. Er summt leise und ist gerade dabei, den Pfanneninhalt zu wenden. Einfach so, mit Schwung aus dem Handgelenk. Das Geräusch der Pfanne, wie sie auf dem Ceranfeld aufkommt, löst mich aus meiner Starre.
Mit panisch klopfendem Herzen will ich rückwärts flüchten, pralle aber beim nächsten Schritt mit dem Rücken gegen die Türzarge. Mein unterdrückter Schmerzlaut sorgt dafür, dass der Mann sich umdreht.
»Morgen, Prinzessin. Gut geschlafen?«
Moment. Was? Das ist der blonde Typ von gestern. Der mit dem festen Griff. Nicht im Ernst.
»Verschwinde von hier. Sofort. Ich werde sonst die Polizei rufen.« Ich hebe das Handy vor mein Gesicht, muss aber leider feststellen, dass der Bildschirm gesperrt ist. Ich tippe eine Zahlenfolge, dann noch eine. Meine Finger zittern so sehr, dass ich nicht die richtigen Tasten treffe.
»Willst du damit vielleicht bis nach dem Frühstück warten?« Er betrachtet meine Bestrebungen, endlich dieses Handy zu entsperren. Das ist doch alles ein einziger Albtraum.
»Sicher nicht. Ich werde genau jetzt den Notruf wählen«, sage ich abwesend und gebe den Code ein drittes Mal ein. Drei gescheiterte Eingabeversuche. Bitte geben sie die PUK ein.
»Mit deinem gesperrten Telefon? Willst du meins?«
Ich lasse das Teil sinken. »Das ist doch nicht zu fassen.«
»Wir könnten auch einfach diese Polizeigeschichte sein lassen und gleich zu meiner Entschuldigung übergehen.« Er zwinkert, als wäre die Situation nicht völlig wahnwitzig, und wendet in aller Ruhe ein weiteres Mal den Pfanneninhalt. »Essen wir allein oder kommt gleich dein Daddy und schmeißt mich raus?«
Ich schaue zurück auf mein Handy. Keine Ahnung, in welchem Ordner sich diese PUK befindet.
»Ich denke, du gehst jetzt besser.«
Er macht eine abwägende Kopfbewegung. »Ich denke nicht. Wir haben gestern ein bisschen übertrieben, das gebe ich zu. Deshalb bin ich jetzt hier. Ich wollte es wiedergutmachen. Ich hoffe, du magst Spiegeleier?«
»Bietest du mir jetzt echt als Entschädigung dafür, dass du mich bedroht hast, Spiegeleier an? Spiegeleier, die du in meiner Küche mit meinen Eiern gemacht hast? Im Ernst?«
Er lacht. Ein offenes, fast schon fröhliches Lachen. Ich werde wahnsinnig. Das wird es sein.
»Ach, solange es nicht meine Eier sind.«
Er gibt die Spiegeleier mit stoischer Ruhe auf zwei Teller und deutet mit seinem Kinn in Richtung des Esstisches.
Vielleicht ist es schlauer, zu tun, was er sagt. Nachher dreht er gleich wieder durch, weil er sich provoziert fühlt.
Also gehe ich tatsächlich zu diesem Esstisch mit diesem Typen und setze mich hin. Wer weiß, was passiert, wenn ich ihm widersprechen würde? Ich habe absolut keine Lust, das herauszufinden. Nicht nach gestern Abend.
»Kaffee habe ich auch gemacht.« Er geht in die Küche zurück, um zwei Tassen zu holen.
Ich muss mir unbedingt sein Gesicht einprägen, für den Fall, dass ich nachher ein Fahndungsbild bei der Polizei erstellen lassen muss. Womöglich sind die drei irgendwo entlaufen.
Aufmerksam studiere ich sein Profil und finde es erschreckend, dass er auch heute Morgen völlig abgerissen aussieht. Die schwarze Kleidung, kombiniert mit seinen tätowierten Armen und dem Gesicht, in dem bedeutend zu viel Metall steckt, macht ihn nicht gerade zum Prototyp von vertrauenswürdig.
Bevor ich mit der Bestandsaufnahme weitermachen kann, kommt er zurück an den Tisch und setzt sich mir gegenüber.
Auf meinen Stuhl.
In meinem Haus.
»Ist was?«, fragt er ungerührt und beginnt zu essen. Sein blondes Haar fällt ihm in die Stirn, als er den Kopf neigt. Es sieht so zerstört aus wie der Rest von ihm. Zerzaust und von der Sonne ausgeblichen.
»Willst du eine Aufzählung oder eine fortlaufende Liste?«
»Mach doch kein Drama. Ich will mich echt nur entschuldigen. Das war gestern ein bisschen uncool von uns, gebe ich zu.«
Und weil mir absolut nichts einfällt, was ich darauf sagen könnte, betrachte ich ihn einfach weiter. Die feinen Konturen seines Gesichts, die glatte Haut und die makellos gepflegten Nägel, die einen extremen Kontrast zu seiner restlichen Erscheinung bilden. So, als würde das alles gar nicht zu ihm gehören. Keine Ahnung, wie alt der Typ ist. Vielleicht Mitte zwanzig. Der tätowierte Schriftzug auf seinen Händen bewegt sich mit seinen Fingern, was es unmöglich macht, ihn zu entziffern.
»Was habt ihr gestern eigentlich in meinem Garten zu suchen gehabt?«, frage ich nach einer halben Ewigkeit. Ich hoffe, dass es eine einfache Erklärung gibt und ich diesen Typen nach heute Morgen niemals wiedersehen muss.
»Wir sitzen da ab und an und hängen rum. Nichts Großes. Bisher war das Haus nicht vermietet. Wir waren gestern einfach ein bisschen gut drauf. Es tut mir leid.«
Und wieder lässt mich seine Antwort sprachlos zurück. Wenn das sein Gut-Drauf-Sein ist, dann möchte ich nicht erleben, wenn er schlechte Laune hat. Ohne weiter darüber nachzudenken, schiebe ich einen Bissen von dem Rührei in meinen Mund, spucke es allerdings gleich darauf wieder auf meinen Teller zurück.
»Was hast du mit den Eiern gemacht? Das ist widerlich.«
»So oft wie du von Eiern redest, könnte man meinen, dass du es nötig hast.« Er legt den Kopf schief und grinst. Seine grauen Augen funkeln vergnügt.
»Was ich nötig habe oder nicht, das geht dich gar nichts an.«
»Du hast es so was von nötig, Prinzessin.« Er leckt über seine Unterlippe, das Metall klackert leise an seinen Zähnen. Zwei dünne Ringe. Links und rechts. Die an seiner Nase sind lediglich an einer Seite. Schade um die Symmetrie.
Warum tut man so etwas mit seinem hübschen Gesicht?
Mit seinem Gesicht und seinen Ohren. Himmelherrgott.
»Du hast es nötig und ich glaube, du weißt es. Du hast diesen Blick«, führt er weiter aus. Völlig ungerührt. Er hat auch diesen Blick. Diesen Ich-bin-ein-Arschloch-Blick.
»Sag mal, spinnst du?« Ich versuche aufzustehen, aber sein Arm schießt vor und er packt mich am Handgelenk.
»Was tust du, wenn die Antwort Ja ist?«, fragt er, während er sich über den Tisch beugt. »Verrätst du mir deinen Namen?«
»Sicher nicht.«
»Willst du meinen wissen?«
»Nein. Ich will, dass du gehst, aber das scheint für dich ja keine Option zu sein.«
»Ich bin Rain.«
Sein Blick findet meinen und irgendetwas passiert hier, was mir auf gar keinen Fall gefällt. Ich sollte weglaufen, ihn rausschmeißen, endlich die verdammten Cops rufen … und was mache ich? Ich bleibe sitzen und diskutiere über Frühstückseier und Vornamen.
»Und du?«, fragt er ein weiteres Mal.
»June.«
»June, wie April oder August?«
»Sagt der Typ, der Rain heißt.«
»Wer sagt denn, dass das mein echter Name ist?«
»Wer sagt denn, dass das mein echter Name ist?«
Er lächelt ein echtes Lächeln und lässt mein Handgelenk los, um sich in dem Stuhl zurückzulehnen.
»Irgendetwas sagt mir, dass du eine bist, die nicht lügt. Du hast so ehrliche Augen.«
»Und irgendetwas sagt mir, dass du jetzt gehen solltest. Danke für die Entschuldigung, aber ich würde gern diesen Tag ohne dich verbringen und alle kommenden auch.«
»Also lebst du tatsächlich allein?«
»Warum? Ohne dich heißt nicht allein. Nur eben ohne … dich.«
»Dann frag ich mich nur, wo er ist?« Rain deutet in Richtung meiner linken Hand, an der ein goldener Ehering steckt.
»Das geht niemanden was an.«
»Und wenn ich es gern trotzdem wüsste?«
»Dann musst du leider weiterhin mit dieser Unwissenheit leben, denn dieses Gespräch ist jetzt beendet. Findest du die Tür?«
Er steht allerdings nicht auf, sondern schaut nur herausfordernd.
»Bitte«, sage ich noch einmal lauter und deute zum Flur. Er seufzt, aber erhebt sich endlich.
»Soll ich wirklich schon gehen, Prinzessin? Egal, was es ist, ich kann es sicher besser machen.«
Ich trete auf ihn zu und schiebe ihn Richtung Ausgang. Bei der Tür angekommen, reiße ich an der Türklinke. Rain steht neben mir und beobachtet mich ungerührt.
»Vielleicht zur Abwechslung abgeschlossen?« Er greift auf das Sideboard hinter sich und wedelt mit meinem Schlüsselbund.
»Ich bin übrigens durch die Terrassentür rein. Da solltest du heute Abend drauf achten.«
Mit einem wütenden Schnauben reiße ich ihm den Schlüssel aus der Hand. »Vielen Dank für diesen großartigen Tipp. Ich gebe dir jetzt auch mal einen: Halt dich in Zukunft von diesem Haus fern.«
Er salutiert locker, während er sich an mir vorbeiquetscht.
»Was auch immer du willst, June. Und wenn du mal-«
»Raus hier!«
Er geht lachend ein paar Schritte rückwärts.
»Bin schon weg. Aber für den Fall, dass du es mal besorgt-«
»Verschwinde einfach!«
Sein höhnisches Lachen verfolgt mich noch, als er schon die Auffahrt in Richtung Straße entlangschlendert. Er fährt durch seine Haare, zündet eine Zigarette an und zieht im Gehen das Handy aus der Tasche. So entspannt, als wäre die letzte halbe Stunde gar nicht passiert.
Na, schönen Tag noch, komischer Unbekannter.
Rain. Dass ich nicht lache.
Kapitel 3
»Hey, Mann, was machst du?«, brüllt Knight ins Telefon und klingt dabei, als wäre er seit gestern gar nicht ausgenüchtert.
»War bei der Kleinen vom Pool und hab Frühstück gemacht.« Ich ziehe ein letztes Mal an der Zigarette, bevor ich sie im Gehen auf die Straße schnippe. Eine alte Frau bleibt stehen und regt sich übertrieben darüber auf, bevor sie meinen Mittelfinger von hinten sieht.
»Du? Du machst Frühstück? Was willst du von der Alten? Lass mal gut sein mit der«, gibt Knight zurück. Die Verbindung ist schlecht, es klingt furchtbar blechern.
»Ich habe doch gesagt, ich bin noch nicht fertig mit ihr. Seit wann machst du einen auf Moralapostel?«
»Bleib mal cool, Mann. Bleib mal cool.« Knight macht eine kurze Pause. Neben ihm raschelt etwas am anderen Ende der Leitung. Womöglich ist es schlauer, nicht weiter nach der Geräuschquelle zu fragen.
»Steht heute Abend?«, frage ich stattdessen.
»Sicher. Gibt’s sonst noch was? Ich habe zu tun.«
»Findest du, es ist ein Einbruch, wenn die Tür nicht abgeschlossen ist?«
»Alter, Rain.«
»Was denn?«
»Wir klären das später.«
»Du klingst schon wie Rebel.«
Darauf klickt es in der Leitung. Hat der mich einfach ohne Verabschiedung weggedrückt? Kopfschüttelnd biege ich in die Zufahrt zur Villa meines Onkels und schaue kurze Zeit später am blank polierten Eisentor hoch. Home Sweet Home. Ich betätige den Schalter am automatischen Tor und werde eingelassen. Es ist heute Morgen so still, dass man im Hintergrund das Meer hören kann. Mit jedem weiteren Schritt werden meine Füße schwerer. Als würde sich mein Körper weigern, nach Hause zu kommen. Im Grunde ist Zuhause auch ein Wort, das dieser Betonklotz gar nicht verdient hat.
Das hier ist nicht mein Zuhause.
Ich habe keins.
Ich lebe hier – mehr aber auch nicht.
Und das auch nur übergangsweise, solange meine Eltern den Dienst quittiert haben. Denn ich bin zu anstrengend, zu schwierig, außer Kontrolle. Noch ein Stempel gefällig? Auf meiner Stirn ist bestimmt noch ein Platz frei. Deshalb haben sie mich hierher verfrachtet. In dieses Haus, in diese Zwangsjacke, in dieses Leben.
Während ich die Haustür öffne, kommt Patricia durch die Eingangshalle gelaufen.
»Guten Morgen, Mr. Sullivan. Wollen Sie frühstücken?«, fragt sie kokett.
»Nein, danke, Patricia«, gebe ich zurück und lächle mein bestes Lächeln. In Gedanken sehe ich sie vor mir, wie sie über den Küchentisch gebeugt ist, den Rock ihrer niedlichen Hausmädchenuniform weit über ihre Hüfte hochgeschoben. Für einen kurzen Moment hält sie den Blickkontakt. Vermutlich denken wir gerade an dasselbe zurück. Ihre Wangen werden zartrosa. Ertappt. Doch bevor ich noch etwas ergänzen kann, wendet sie sich ab und geht vor mir her ins Esszimmer. Ich nutze die Gelegenheit, ihren perfekten Hintern zu betrachten, der mit laszivem Schwung vor mir herwackelt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Absicht ist. Aber die Zeiten sind vorbei. Keine Ausrutscher mehr für mich. Nie mehr, wenn es nach Onkel Alexander geht.
»Hey, Junge! Blick auf Augenhöhe halten«, schallt es da auch schon durch die Eingangshalle. Ich erlaube mir ein kurzes Augenverdrehen, solange er es nicht sehen kann, und reiße mich dann wieder zusammen.
»Guten Morgen, Onkel Alexander.«
Er hat jetzt meine Höhe erreicht und wirft einen prüfenden Blick in mein Gesicht. »Wo kommst du her?«
»Vom Strand.«
»Vom Strand?«
»Ich war spazieren. Das machen Menschen gelegentlich.«
Es klingt so schnippisch, dass ich mich im selben Moment darüber ärgere, nicht wenigstens einen Funken Impulskontrolle zu besitzen. Andererseits - wenn ich die hätte, dann wäre ich nicht hier. Es ist wohl alles ein Kreislauf.
»Sicher darfst du spazieren gehen. Du siehst nur nicht aus, als wäre das alles. Und leider kann man dir auch nicht genug vertrauen, um sich eine Nachfrage zu ersparen.«
Oh, Vertrauen.
Mein Onkel und meine Tante sind große Fans vom gegenseitigen Vertrauen. Und sie sind immer so enttäuscht, wenn ich ihr Vertrauen missbrauche. Es wäre fast herzerwärmend, wäre es nicht mein armseliges Leben. Onkel Alexander schaut mir fest in die Augen, geht dann aber weiter, weil er keine Antwort bekommt.
»Ich fahre nachher zu Ariel.«
Ruckartig bleibt er stehen. Man kann selbst auf ein paar Meter Entfernung sehen, wie sehr seine Schultern sich verkrampfen, während er sich in Zeitlupe umdreht.
»Meinst du nicht, dass du dieses Thema endlich ruhen lassen solltest?«
»Warum sollte ich?«
»Was erhoffst du dir davon? Tu ihr doch den Gefallen und lass es auf sich beruhen. Niemand kann in der Vergangenheit leben.«
Sein scharfer Blick trifft mich härter als jede Faust es könnte. Wir wollen nichts mehr damit zu tun haben, sagen seine Augen. Und genau das ist es. Es gibt bloß niemand offen zu.
»Ist das dein Ernst?« Ich trete ein paar Schritte näher. Meine Augen sind auf einer Höhe mit denen meines Onkels, denn wir sind fast gleich groß. Sonst haben wir wenig gemeinsam. Onkel Alexanders Halbglatze glänzt im hellen Licht der Deckenspots, seine wässrig blauen Augen haben während unseres Gesprächs jeglichen Elan verloren.
»Wenn du noch eine Chance auf eine Zukunft haben willst, dann musst du dich in den Griff bekommen. Doch jedes Mal, wenn du dort warst, eskalieren wieder irgendwelche unergründlichen Dinge in deinem Hirn. Es ist furchtbar anstrengend für alle Beteiligten. Und es schadet. Du weißt, was für dich auf dem Spiel steht.«
Sein Blick ist so hart und kalt, dass es sich wie eine Fessel um mein verkrüppeltes Herz legt. Ja, ich weiß, was auf dem Spiel steht. Nur zu gut. Er würde niemals zulassen, dass ich das auch nur eine Sekunde vergesse.
»Ich fahre Bus. Keine Sorge.« Damit rausche ich an ihm vorbei die Treppe hoch und knalle meine Zimmertür so laut zu, dass er es sicher bis runter ins Foyer hört. Ich hasse das. Die Bevormundung. Die guten Tipps. Die superklugen Lebensweisheiten. Ich könnte kotzen. Was wollen die eigentlich alle? Einerseits soll ich mein Leben in den Griff bekommen, aber gleichzeitig nur egoistisch an meine eigene Zukunft denken? Keine Ahnung, was hier falsch und was richtig ist.
Die Wut peitscht immer weiter durch meine Blutbahn. Auch noch, als ich mich auf den Schreibtischstuhl fallen lasse und mit dicken Kopfhörern das nächstbeste Musikalbum anschalte, das vom Streamingdienst vorgeschlagen wird. The Subliminal Verses. Das aggressive Brüllen fließt durch jede Zelle meines Körpers und der Druck lässt endlich nach.
Währenddessen scrolle ich durch den einzigen Fotoordner, der mir etwas bedeutet. Es sind nicht viele Bilder, nur eine Handvoll, aber jedes Mal, wenn ich sie ansehe, dann wünschte ich, dass ich die Zeit zurückdrehen könnte. Dass ich damals anders entschieden hätte und nicht so feige gewesen wäre. Wie könnte mein Leben heute aussehen?
Wäre sie dann noch bei mir?
Wäre sie wieder gesund?
Hätten wir eine Zukunft gehabt?
Die Gewissheit, dass ich es nie erfahren werde, treibt mich in den Wahnsinn.
Und genau aus diesem Grund war ich heute Morgen bei June: weil sie mich an Cass erinnert hat. Nicht optisch. Das mit Sicherheit nicht, denn diese beiden Frauen haben äußerlich absolut nichts gemeinsam. Aber dieser Blick, dieses wutentbrannte Feuer in den Augen. So hat Cass damals auch ausgesehen, wenn sie sich aufgeregt hat. June hat gestern richtig Angst vor uns gehabt, glaube ich. Vor mir. Weil es wieder passiert ist. Weil ich das, was da in mir schwelt, noch nie unter Kontrolle hatte. Weil die Zündschnur so kurz ist und die Wut so groß. So diffus. So unkontrollierbar. Wie ein Dämon, der immer dann vorbeikommt, wenn niemand ihn eingeladen hat.
Bevor ich weiter darüber nachdenken kann, vibriert mein Handy. Wenn man über Dämonen spricht, ist der Teufel nicht weit. Dabei hat Rebel Romero nach außen hin die weißeste Weste. Weil er es jedes Mal wieder schafft, sich selbst aus der Scheiße zu ziehen. Ich bin dafür mittlerweile einfach zu müde. Mit einem Tippen aufs Display öffnet sich die Nachricht.
Was geht.
Mehr hat er nicht geschrieben. Er ist kein Mann der großen Worte.
Nicht viel.
Er tippt.
Hattest du einen guten Morgen?
Oh, Rebel, nicht mit mir.
Mit einem Grinsen schlage ich die Beine übereinander und formuliere eine weitere Antwort.
Natürlich. Und selbst?
Mit Sicherheit hat Knight bei Rebel gepetzt, dass ich June besucht habe. Man kann über diese Jungs sagen, was man will, die Klappe halten kann keiner von denen.
Wir besprechen das später, schreibt Rebel jetzt.
Dann ist er offline. Ich schicke ihm trotzdem eine Antwort.
Sicher besprechen wir das. Soll ich noch einen Kuchen backen? Bringst du Tee mit?
Er ist wieder online. Tippt.
Wichser.
Und was soll ich sagen? Er hat recht.
Ich hänge den Gedanken daran, dass Knight schon wieder nichts für sich behalten konnte, noch eine Weile nach. So lange, bis Tante Camilla ihren Kopf ins Zimmer steckt. Die Perlenkette um ihren Hals bewegt sich und ihre faltigen Lippen formen Worte, ohne dass der Ton zu mir durchdringt. Als ihre Gesten immer ausladender werden, reiße ich mir die Kopfhörer vom Kopf. Die Musik hat trotzdem fast Zimmerlautstärke.
»Dein Onkel wünscht, dass du mit uns zu Mittag isst.« Ihr strenger Blick bleibt auf mir haften. Die ganze Zeit. Beim Aufstehen, während ich mein Handy in die Hosentasche stecke, auf dem Weg zur Tür. Als ich direkt vor ihr stehen bleibe, zieht sie erfolglos den ausgerissenen Ausschnitt meines Shirts höher.
»Wie willst du in dem Aufzug bloß jemals eine Arbeit finden?«
Gar nicht, Tante Camilla. Im Moment gar nicht.
»Fehlt mir dafür nicht ohnehin etwas Entscheidendes?«
»Ja und glaub mir, das werden wir ändern. Ich habe deiner Mutter versprochen, dass wir hier einen respektablen jungen Mann aus dir machen und so wahr mir Gott helfe, mache ich das.« Ihre Habichtsnase kräuselt sich.
Es wird mir für immer ein Rätsel bleiben, wie Onkel Alexander es schafft, ihr beim Ficken ins Gesicht zu gucken. Schon der Gedanke daran ist gruselig. Vielleicht tut er es auch gar nicht mehr. Vielleicht guckt er ebenfalls lieber in Patricias braune Augen und reagiert deshalb so bissig, wenn ich mit ihr flirte. Womöglich hat Tante Camilla deshalb dauerhaft schlechte Laune. Wer weiß das schon.
Mit einem Schnauben entlässt sie mich aus ihrem Blick, wendet sich ab und geht mit stockgeradem Rücken vor mir her. Den elendig langen Flur und die Treppe hinab. Die eisige Kälte, die von ihr ausgeht, würde mich frösteln lassen, wenn ich nicht schon längst innerlich erfroren wäre.
Und weil das Grauen sich immer noch um eine Stufe steigern lässt, geht das Spektakel unten gleich weiter. Denn im Foyer werden wir von meinem Onkel und einem seiner Kollegen oder Golfkumpel oder Klienten erwartet – käme alles aufs Gleiche raus. Es ist ein glatt geleckter Typ in einem Anzug. Ich hasse ihn jetzt schon.
Meine Tante begrüßt den kleinen Mann überschwänglich und auch ich reiche ihm die Hand.
»Und das ist dein Sohn, Alexander?« Der Typ mustert mich auf eine ekelhaft deutliche Art und Weise.
Onkel Alexander lacht bloß heiter. »Ach, du liebe Zeit, nein. Das ist mein Neffe. Er lebt seit drei Jahren hier und … Nun, wie auch immer. Kommt, das Essen wird gleich aufgetragen.« Damit verlässt er gemeinsam mit seinem Besuch das Foyer und geht ohne weitere Erklärungen in Richtung Esszimmer. Tante Camilla folgt. Brav wie ein Schoßhündchen.
Vielleicht ist es gar nicht dumm, wenn jetzt alle mit dem schmierigen Typen beschäftigt sind. Vielleicht ist das meine Chance, hier ohne große Diskussion abzuhauen. Wenn ich den nächsten Bus erwische, bin ich immer noch pünktlich zum vereinbarten Termin in Palo Alto. Die Stimmen von Onkel Alexander und dem anderen Mann entfernen sich weiter. Nur Tante Camilla ist stehen geblieben.
»Kommst du bitte?« Die Worte hallen furchtbar laut von den Steinwänden und dem Marmorboden zurück. Der einzige Kitsch, den sie sich erlaubt hat, sind zwei überdimensionale Zimmerpflanzen, die neben dem Treppenaufgang stehen.
»Ihr müsst ohne mich essen. Ich habe einen Termin.«
»So plötzlich?«
»Onkel Alexander weiß Bescheid.« Ich trete einen Schritt näher an sie heran. Und noch einen, bis ich so nah vor ihr stehe, dass sie den Kopf in den Nacken legen muss. »Oder gibt’s damit ein Problem?«
»Was für ein Termin soll das bitte sein?«
»Ich fahre nach Palo Alto.«
»Ich dachte, diese Sache wäre anderweitig geregelt worden? Was willst du dort noch? Du machst dich lächerlich.«
»Ist mir egal.«
»Dein Onkel riskiert Kopf und Kragen für dich, vergiss das besser nicht. Alles hat Grenzen.«
»Im Ernst, Tante Camilla? Du willst mir drohen? Vergiss nicht, wie oft wir beide hier allein sind. In diesem großen, großen Haus. Und dann überleg dir gut, was du jetzt noch zu sagen hast.«
Sie schaut beiseite.
In dem Moment, in dem ich mich gerade wieder in Richtung Treppe drehen will, um meinen Rucksack zu holen, hallen Schritte durch die Empfangshalle. Sekunden später packt mich Onkel Alexander am Arm.
»Ich glaube, ich habe mich vorhin klar und deutlich ausgedrückt. Du bleibst zum Essen hier.«
»Nein. Ich fahre nach Palo Alto, das ist ein offizieller Termin.«
»Du hast nur Termine, wenn ich dir Termine mache. Dieser gehört nicht dazu.«
»Willst du mich verarschen? Ich gehe jetzt. Ich bin erwachsen.«
»Du bist nichts weiter als ein armseliger Idiot, der keine Grenzen kennt. Wenn ich dir sage, dass du hierbleibst, bleibst du hier.«
»Gar nichts mache ich. Das ist mein Leben, verdammt.«
»Ja, und genau deshalb wirst du jetzt in dieses Esszimmer gehen, dich an den Tisch setzen und mit Mr. Brown Konversation betreiben, wie ich es von dir erwarte.«
Ich versuche den Arm aus seinem Griff zu lösen, aber er hat verflucht viel Kraft für so einen alten Sack. Seine Hand packt mich fester und seine Nase berührt fast meine.
Wir stehen einander gegenüber wie zwei Gewitterfronten, die aufeinanderprallen. Das Grollen ist beinahe in der Luft zu spüren.
»Ich scheiß auf Konversation mit diesem Arschkriecher.«
Mit jedem meiner Worte beißt Onkel Alexander die Zähne fester zusammen. Einen Moment noch hält er meinen Blick, dann lässt er mich mit einem Ruck los.
»Weißt du was? Das muss ich mir nicht anhören«, sagt er kalt. »Du willst gehen? Dann verschwinde. Verschwinde und tu sonst was. Du willst weiterhin jede Chance auf eine Zukunft wegwerfen? Bitte. Es ist mir gleich. Aber ich sage dir eins: Wenn du nicht am Montagmorgen an meinem Frühstückstisch sitzt, wirst du das bereuen. Und das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen.«
Eine halbe Stunde später stehe ich mit einem gepackten Rucksack an der Bushaltestelle. Keine Ahnung, wo ich die Tage bis Montag pennen soll. Eigentlich war das so gar nicht geplant. Aber zurück kann ich jetzt auch nicht mehr. Eher würde ich mir die Hand abhacken, als vor Ablauf meines Ultimatums wieder in diesem Betonklotz aufzutauchen.
Ich zünde mir eine Zigarette an und ziehe die Kapuze meines Hoodies in die Stirn. Neben mir wartet eine Mutter mit ihrer Tochter an der Hand. Beide schauen zu mir rüber. Ich spüre den Blick der Frau auf meinem Gesicht, ohne dass ich dafür aufsehen muss. Es ist sehr deutlich.
Sie reißt das Mädchen an der Hand näher zu sich, aber die wendet den Blick nicht ab, sondern betrachtet mich über die Schulter hinweg weiterhin sehr eingehend. Dann lächelt sie breit und entblößt dabei eine gewaltige Zahnlücke. Sie ist vielleicht vier oder fünf. Ihr Anblick löst einen undefinierbaren Anflug von Wehmut in meiner Brust aus, dem ich lieber gar nicht nachgehe. Stattdessen lächle ich zurück und strecke ihr die Zunge raus. Sie schlägt eine Hand vor den Mund und kichert vergnügt. In dem Moment dreht sich ihre Mutter zu ihr um. »Amalie, guck da nicht so hin.«
Als wäre ich ein Autounfall. Mit Kollateralschaden.
Amalie wendet brav den Blick ab, aber nicht, ohne mir noch ein letztes Mal verschwörerisch zuzuzwinkern.
Zwei weitere Zigaretten später kommt endlich der Bus. Amalies Mutter, die sich extra weit vorn auf den Bürgersteig gestellt hat, weicht erschrocken zur Seite, als ich mich vor sie drängle. Typen wie ich müssen schließlich den Schein wahren. Wenn sie schon glaubt, dass ich ein asozialer Schmarotzer bin, dann sollte ich diese Erwartung besser nicht enttäuschen.
Im Bus suche ich mir einen Platz am Fenster. Es sind vielleicht eine Handvoll Leute, die mitfahren. Zu dieser Tageszeit gehen die meisten einem normalen Job nach und hängen nicht so nutzlos rum wie ich oder Amalies Mutter. Die traut sich aus der Entfernung jetzt wieder, mich mit bitterbösen Blicken zu bedenken.
Und plötzlich macht es mich nur noch müde.
Dieses ganze Leben.
Diese ganzen Gedanken.
Diese ganzen Kämpfe.
Jeden Tag wieder.
Ich schalte die Musik auf meinem Handy lauter. So lange, bis es trotz der dicken Kopfhörer den ganzen Bus beschallt. Und wenn schon.
Die genervten Blicke und das Tuscheln der anderen Fahrgäste lösen nichts als Gegenwehr in mir aus. Sollen sie sich doch aufregen. Sollen sie sich doch von mir provoziert fühlen. Ich fühle mich auch provoziert.
Davon, dass die ganze Welt mich hasst.
Dann wissen die halt alle mal, wie das ist, wenn man vor Wut kaum atmen kann.
Wenn man glaubt, dass man keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, weil man so viel Scheiße fühlt.
Auch heute sagt niemand etwas. Der Einzige, der mit sich ringt, ist der Anzugträger schräg gegenüber. Als unsere Blicke sich treffen, schaut er weg. Sie schauen immer weg.
Während meine Füße im Takt der Musik auf dem Sitz neben dem Typ im Anzug wippen, schließe ich die Augen. Keine Ahnung, wann mein Leben so gekippt ist. Vielleicht war ich auch schon immer so. Vielleicht brauche ich das. Dieses kleine bisschen Kontrolle, wenn man nichts anderes mehr kontrollieren kann. Es ist das, was meine Eltern in den Wahnsinn getrieben hat. Grenzen waren immer nur dafür da, um sie zu sprengen. Eine Zeit lang haben sie mich jeden zweiten Tag von der Polizeiwache abgeholt. Sie haben getobt und geschrien. Das Beste daran war, dass mein Verhalten sie dazu gezwungen hat, sich zu kümmern. Doch je ausschweifender ich wurde, desto mehr haben sie resigniert. Aber ich konnte nicht mehr damit aufhören. Ich habe es immer weiter auf die Spitze getrieben, bis ich hierherkam. Bis ich einen Schritt zu weit gegangen bin und jetzt in der Falle sitze.
Eigentlich gab es nur eine Zeit in meinem Leben, in der dieser Sturm in mir wenigstens ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Das war, als ich Cass kennengelernt habe. Weil sie die Erste war, die mich gebraucht hat. Die mich gesehen hat.
Ich habe bis heute keine Ahnung, was sie damals auf dieser Party wollte, aber sie war da. Und das erste Mal im Leben hatte ich das Gefühl, dass mein Herz in Flammen steht. So lichterloh, dass am Ende nichts als ein verkohlter Klumpen übrig geblieben ist.
Ich fahre mir übers Gesicht und lege die Hände danach im Schoß ab, betrachte die schwarzen Linien auf meinem Handrücken, die zu einem großen Mandala gehören, und streiche sie nach. Das ist das Einzige von ihr, das ich auf ewig bei mir tragen werde, und das Einzige meiner Tattoos, das nicht zum Rest passt. So wie Cass nicht zu irgendetwas anderem gepasst hat. Egal, wie viel ich trinke, egal, wie viele Mädchen ich ficke, ich sehe immer nur ihr enttäuschtes Gesicht und es macht mich krank.
Es ist egal, ob ich guten Willen zeige.
Es ist egal, ob ich mich bemühe.
Diese Schuld werde ich niemals begleichen können.
Kapitel 4
Ist es bedenklich, wenn man eine halbe Stunde mit jemandem verbracht hat und er einem danach den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf geht?
Obwohl ich mich darauf konzentrieren wollte, die Kisten auszupacken und mich im Haus einzurichten, denke ich ständig wieder über meine Begegnung mit Rain nach.
Dabei würde ich ihn am liebsten aus meinen Gedanken streichen. Ihn, diesen katastrophalen Morgen, den gestrigen Abend.
Aber es klappt nicht.
Weil er irgendetwas an sich hat, das mich nicht loslässt. Irgendetwas in seinen Augen. Wie ein winziger Funke, der nicht zu dem abschreckenden Rest passt. Und wer weiß, vielleicht komme ich schneller dazu, die Sache weiter zu ergründen, als mir lieb ist. Denn ich habe ihm zwar gesagt, dass ich ihn niemals wiedersehen möchte, aber er wirkte nicht wie jemand, der solchen Aussagen besondere Bedeutung beimisst.
Nachdem ich endlich den letzten Kleiderstapel in meinen Schrank geräumt habe, rufe ich meine Mutter an und bringe auch Olive auf den neusten Stand. Meine morgendliche Begegnung mit Rain lasse ich dabei allerdings aus. Was hätte ich dazu auch sagen sollen? Der bedrohliche Typ von gestern ist bei mir eingebrochen, aber ich habe mich spontan entschieden, mit ihm zu frühstücken, statt die Cops zu rufen. Das klingt nicht wirklich, als hätte ich noch alle meine Sinne beisammen. Und das Letzte, was ich heute brauche, ist ein Vortrag über meine schwindende Zurechnungsfähigkeit.
Mein Nervenkostüm ist nach den letzten Tagen ohnehin schon mehr als angeschlagen. Und das ändert sich auch nicht, während ich ein paar Bahnen im Pool schwimme oder zum ersten Mal in meiner neuen Küche koche. Es ist wie eine undefinierbare Nervosität im Bauch, die darin gipfelt, dass ich abends durch die Räume wandere, der Stille nachspüre und mich schrecklich abgeschnitten von meinem eigenen Leben fühle. All meine Habe ist hier in diesen vier Wänden, trotzdem ist es, als würde ich nicht länger dazugehören. Als wäre das hier bloß noch die blasse Hülle eines Lebensentwurfes, dem ich nicht mehr gerecht werden kann.
Ich bleibe vor der bodentiefen Scheibe im Wohnzimmer stehen und betrachte die Lichtreflexionen auf dem Glas. Es sieht aus wie ein Lagerfeuer, das da unten am Strand brennt. Die Sehnsucht nach Lebendigkeit und Gesellschaft wird mit jedem Herzschlag drängender.
Ich sollte ein weiteres Mal bei Olive anrufen.
Ich sollte ihr Angebot annehmen und sie bitten herzukommen.
Doch stattdessen öffne ich aus einem Impuls heraus die Terrassentür. Die Nachtluft ist angefüllt vom Lachen der Menschen, das der Wind zu mir herüberträgt. Unzählige Silhouetten tanzen da in der Dunkelheit umher. Je näher ich komme, desto mehr heben sie sich voneinander ab.
Ich höre die Musik, die ausgelassene Fröhlichkeit. Sie zieht mich an wie das Licht die Motten. Das Tosen der Wellen vermischt sich mit den psychedelischen Technomelodien.
»He, Kleine! Suchst du wen?« Ein massiv aussehender Typ mit Gesichtstattoos gesellt sich neben mich und lächelt eine Spur zu freundlich. Ich winke nur ab und gehe einen Schritt schneller.
»Falls du Rebel suchst, der ist im Strandhaus.«
Rebel? Klingt genauso komisch wie … Rain. Vielleicht ist er hier? Während ich durch den Sand eile, werden meine Gedanken immer konfuser. Bis ich mir nicht mehr sicher bin, was ich hier überhaupt tue.
Lass dich wieder auf das Leben ein.
Olives Stimme echot in meinem Kopf.
Schon wieder.
Wieder und wieder.
Kapitel 5
Die dröhnende Musik ist selbst im Badezimmer noch laut genug, dass sie meine Gedanken überlagert. Ich halte meine Hände unter den eiskalten Wasserstrahl, fühle mich schrecklich müde und gleichzeitig so, als könnte ich niemals wieder Ruhe finden. Wie immer, wenn ich bei Ariel war. Ich wünschte, dass alles anders wäre. Dass ich die Zeit zurückdrehen könnte. Dass ich es besser machen könnte. Dass ich ein besserer Mensch wäre. Für sie. Und vielleicht auch für mich selbst.
Im Grunde ist mir total egal, was die Leute von mir denken und über mich sagen, aber dort nicht.