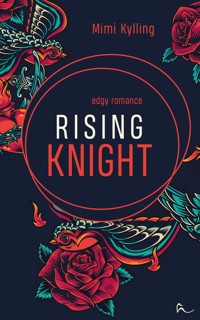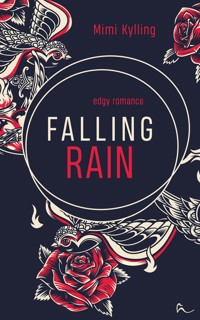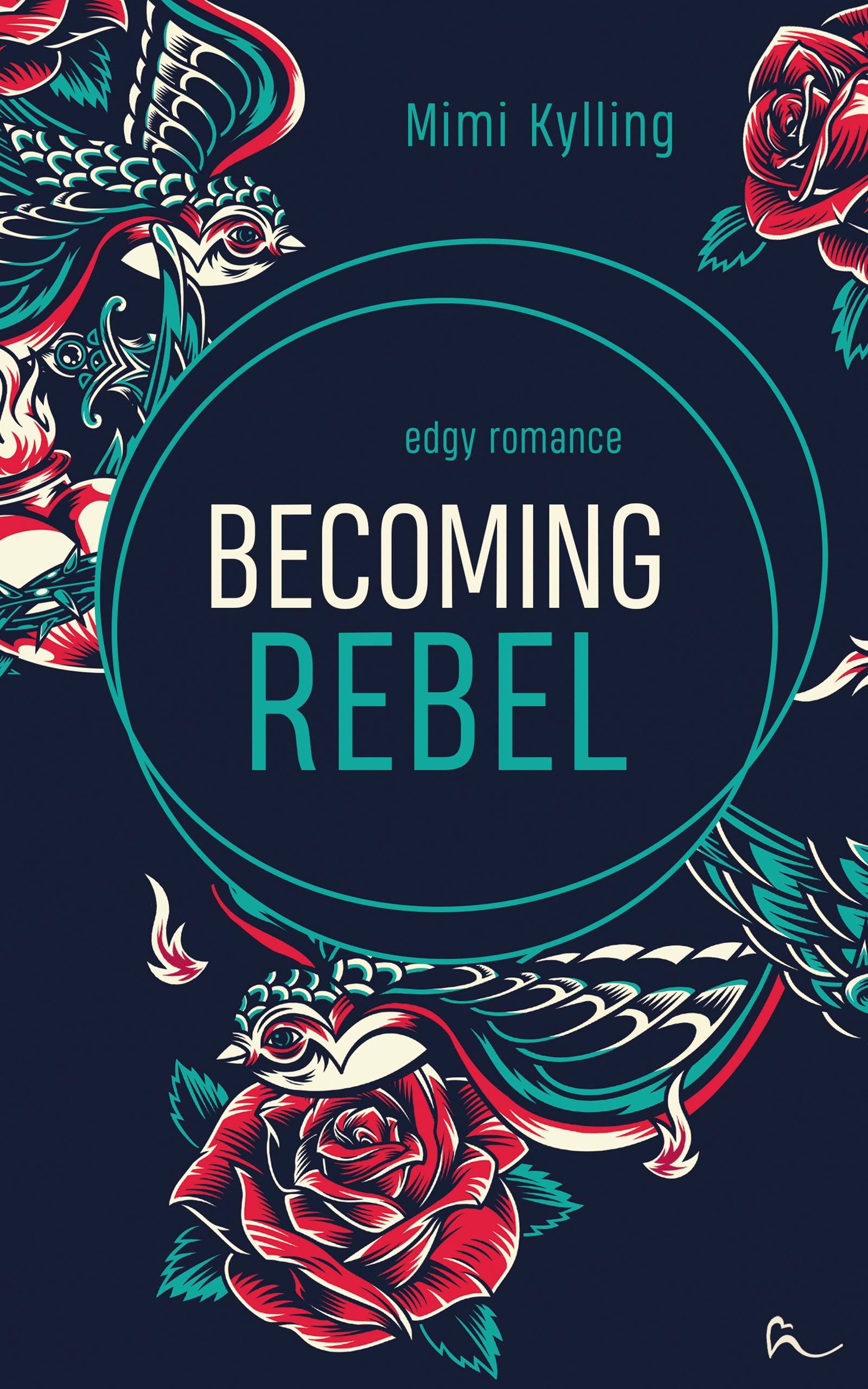
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rinoa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Womit habe ich verdient, zu leben? Sag du es mir. Denn ich weiß es selbst nicht mehr.«
Lou hatte große Pläne für ihr Leben. Doch statt niemals endender Party und Unieskapaden sitzt sie mit ihrem dementen Vater in einem baufälligen Haus fest und kommt trotz ihrer Jobs kaum über die Runden.
Als sie während einer Schicht im Nachtclub den undurchschaubaren Rebel kennenlernt, gerät ihr Herz das erste Mal seit Jahren aus dem Takt. Doch über den Mann mit dem Todesblick wird im „All Saints“ nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Wo er auftaucht, gibt es Ärger.
Rebel ist sein Ruf recht. Trotzdem hilft er Lou bei jedem Aufeinandertreffen erneut aus der Klemme.
Dabei weiß er besser als jeder andere, dass Mitgefühl nichts ist, für das man seinen Kopf riskieren sollte und dass Liebe am Ende immer Schmerz bedeutet.
Mafia Romance, Light Dark Romance
Kein Cliffhanger
In sich abgeschlossen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Inhalt
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Epilog
Danksagung
Leseprobe
Impressum
© 2024 Rinoa Verlag
c/o Emilia Cole
Pater-Delp-Straße 20, 47608 Geldern
ISBN 978-3-910653-52-8
rinoaverlag.de
mimikylling.de
Alle Personen und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden. Jedwede Ähnlichkeit zu lebenden Personen ist rein zufällig.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für alle, die frei sein wollen.
Kapitel 1
Wie viele Tiefpunkte kann ein einziger Tag eigentlich haben?
Ein weiteres Mal drehe ich den Wasserhahn zu und wieder auf, doch nichts tut sich. Das darf doch nicht wahr sein. Wie oft hatten wir das im letzten halben Jahr?
Frustriert lasse ich die Stirn an die kalten Fliesen sinken. Aber alles Selbstmitleid und aller Ärger bringen mich jetzt auch nicht weiter. Das Wasser wird davon nicht wiederkommen. Also nehme ich das verwaschene Handtuch vom Haken und wickele es mir um den Körper, bevor ich umständlich aus der Badewanne steige.
»Dad?«, rufe ich in den Flur und warte auf seine Reaktion. Nichts. »Dad!«
»Was denn, Louisa? Was ist denn?« Endlich nähern sich Schritte. Kurz darauf steht mein Vater in seinen alten Pantoffeln und dem immer gleichen Wollpullover in der angelehnten Tür. Er verzieht keine Miene über meinen desolaten Anblick.
»Das Wasser geht nicht mehr und ich muss duschen. Ich habe gleich eine Nachtschicht. So kann ich nicht los.«
Er seufzt nur. »Tut mir leid Mäuschen, wenn du wirklich richtig aufgedreht hast und trotzdem nichts kommt, dann gibt es wohl kein Wasser mehr.«
»Dad. Entweder hast du die Rechnung vergessen oder die Bankverbindung falsch angegeben. Es gibt immer Wasser, wenn man welches bezahlt hat.«
»Aber, Louisa. Da ist eine Wasserknappheit. Sie haben in der Zeitung davor gewarnt. Wir sollten Vorräte anlegen.«
»Dad …«, sage ich erneut, merke aber selbst, dass es keinen Sinn hat. »Hast du die neue Wasserrechnung denn nicht gesehen? Ich hatte sie direkt auf den Küchentisch gelegt. Da klebte ein gelber Zettel drauf.«
»Natürlich habe ich die gesehen. Und den gelben Zettel auch. Ich habe das sofort bezahlt. Ganz, ganz sicher. Ich würde so etwas Wichtiges nie vergessen, das weißt du.« Sein eifriges Nicken und der Blick, den er mir dabei zuwirft, stechen in meiner Brust.
»Schon gut. Ist okay.«
Die Wahrheit ist, dass nichts okay ist. Ich könnte spontan gar nicht sagen, seit wie vielen Jahren wir schon so leben.
Immer am Minimum.
Immer am Ende.
Von Rechnung zu Rechnung.
Und es wird schlimmer.
Als Dad arbeitslos wurde, dachte ich noch, dass es sich um eine vorübergehende Durststrecke handeln würde. Es entwickelte sich zu einer Wüstendurchquerung.
Anfangs habe ich seine Vergesslichkeit gar nicht wirklich ernst genommen. Ich dachte, dass ihn unsere Gesamtsituation mitnimmt oder er eben älter wird. Doch irgendwann konnte ich es nicht mehr länger ignorieren. Wir waren bei so vielen verschiedenen Ärzten, die Diagnose ist eindeutig.
Dad steht weiter neben mir und starrt ins Leere.
»Geht es dir heute nicht so gut?«
Meine Frage lässt ihn hochschrecken, doch er schüttelt nur lächelnd den Kopf. »Wird schon, Sophia. Wird schon. Aber wenn du zur Arbeit musst, dann will ich nicht weiter stören. Ich gehe die Ziegen füttern.« Damit wendet er sich ab und schlurft davon, wie er gekommen ist.
Sophia. Sophia war leider meine Mom, aber Dad kann das manchmal nicht mehr richtig auseinanderhalten. Genauso wie er oft nicht mehr weiß, dass die Socken nicht in den Kühlschrank gehören oder welcher Schlüssel für welche Tür ist. Oder dass wir keine Ziegen haben.
Sein Arzt Dr. Hamilton sagt, dass Dad bald in eine Einrichtung ziehen sollte. Ich wurde schon ein paarmal von unseren Nachbarn angerufen, dass Dad umherirrt und nicht nach Hause findet. Manchmal auch vom Supermarkt oder der Tankstelle. Als hätte ich mich nicht schon längst darum gekümmert, wenn ich es mir leisten könnte.
Mit dem läppischen Job im Burgerimbiss schaffe ich es gerade so, die laufenden Kosten zu decken. Und der Job im Nachtclub, den ich seit ein paar Wochen habe, wird auch nur ein Zubrot sein. Davon weiß Dad nicht einmal.
Dabei ist an der Arbeit im AllSaints nichts Verwerfliches. Ich kümmere mich um die Bar. Was meine Kolleginnen dort so machen, ist nicht meine Sache. Wenn ich allerdings sehe, mit welchen Summen die anderen nach Hause gehen, wäre es schon eine ehrliche Überlegung wert, ebenfalls die Jobsparte zu wechseln.
Mit einem tiefen Durchatmen schüttle ich diese deprimierenden Gedanken ab, trete an den Spiegel und versuche zu retten, was noch zu retten ist.
Meine fettigen Haare werden mit viel Haarspray zu einem ultraglatten Zopf, mein müdes Gesicht verschwindet unter zu viel Make-up. Der Boss mag es so. Und wenn der Boss es so mag, dann halten wir uns natürlich alle daran. Angeblich mögen die Kunden das ebenfalls. Mehr brauche ich zur Klientel in dem Laden wohl nicht zu sagen.
Ich ziehe mich in meinem Zimmer an und packe meine Tasche, dann laufe ich die Treppen hinab und will mich von Dad verabschieden, aber der schnarcht schon auf dem Sofa. Hat seine Ziegen wohl vergessen.
Keine Ahnung, wie lange das noch so gehen soll.
Vor dem AllSaints quetsche ich mich an den wartenden Gästen vorbei bis zum Seiteneingang und werde von Mack ohne Nachfrage in den Club gelassen.
Ein paar Typen grölen mir Sachen hinterher, die ich großzügigerweise überhöre. Wenn man hier anfängt, sich über jede anzügliche Bemerkung aufzuregen, würde man niemals fertig werden. Innerlich macht es mich trotzdem wahnsinnig. Jeder Blick und jeder Spruch. Jedes Mal, wenn sich irgendwelche Vollidioten Dinge herausnehmen, die ihnen nicht zustehen.
Aber vielleicht ist hier auch der falsche Ort, um Anstand und gutes Benehmen zu fordern. Denn das All Saints ist ein Club der besonderen Art hier in San Francisco. Offiziell ist es ein Nachtclub wie jeder andere auch. Inoffiziell kann man hier alles bekommen, was man möchte. Jedwede Droge, Illusionen von atemberaubendem Sex und die trügerische Fantasie, dass man der tollste Typ des Planeten ist. Applaus.
Mit meiner Tasche im Schlepptau durchquere ich den leeren Gastraum und steuere auf die schwarze Tür neben der Bar zu. Wenn keine Gäste da sind, ist es fast unheimlich hier drinnen. Als hätte Zeit in diesen Räumen keine Bedeutung.
Alles stinkt nach altem Rauch, Alkohol und Schweiß.
Der Wunsch, einfach wieder nach Hause zu fahren, wird übermächtig. Am liebsten hätte ich mich vorhin mit ein paar Snacks auf dem Sofa eingekuschelt. Wenn Dad von seinem Nickerchen aufgewacht wäre, hätten wir die Aufzeichnung vom letzten Footballspiel der 49ers ansehen können. Jetzt warten bloß ewig lange Stunden Arbeit auf mich.
Im Personalraum sitzen bereits einige Frauen, die rauchen oder vor der Arbeit einen Kaffee zusammen trinken. Sie unterhalten sich angeregt auf den verschiedensten Sprachen durcheinander, lachen und gestikulieren wild. Für jeden Geschmack das Passende.
Dabei ist die Arbeit dieser Frauen keine Sache, bei der man sich als Außenstehende Sarkasmus erlauben sollte. Die Gründe, hier zu arbeiten, sind so vielschichtig wie die Frauen selbst. Viele von ihnen haben keine gute Ausbildung und machen diesen Job, um ihre Familie über die Runden zu bekommen. Manche finanzieren sich das Studium und wieder andere ihren teuren Lebensstil. Was auch immer es ist – es geht nur sie selbst etwas an.
»Hey, Lou.« Lucys Kopf kommt hinter der Tür zum Vorschein. Im nächsten Moment drückt sie mich fest an sich und verpasst mir einen Kuss auf die Wange. »Na, alles gut?«
»Geht. Bei dir?«
Sie winkt ab. »Ist ein Scheißtag heute. Ich soll schon wieder tanzen, weil Diana krank macht. Als ob die echt eine Grippe hätte. Die hat nur keine Lust, weil ihr Typ sie besuchen kommt. Ich hasse diese Tanzerei. Alle glotzen einen an, man muss stundenlang den Bauch einziehen und die ganze Zeit so dämlich gucken.« Sie macht einen übertrieben lasziven Gesichtsausdruck, der am Ende in eine Grimasse kippt.
»Tja, immerhin geht deine Dusche noch.«
»Was?«
»Wir haben zu Hause kein Wasser mehr. Dad hat die Rechnung vergessen.«
»Shit. Schon wieder? Brauchst du irgendwas?«
»Wenn du mit einer Betreuung für ihn dienen kannst? Oder mit einem Heimplatz oder einem Sechser im Lotto? Oder am besten mit allem zusammen?« Ich lächle gezwungen, wende mich von ihr ab und stelle meine Tasche auf den freien Stuhl neben Tiffany. Die schaut ebenso bedauernd, reicht mir aber im gleichen Atemzug eine volle Kaffeetasse.
»He, Lou. Trink erst mal einen Schluck. Du siehst total fertig aus.« Sie streckt den Arm aus und hebt mit der Spitze ihres Zeigefingers meinen Mundwinkel. Der warme Glanz in ihren Augen lässt mein Herz ganz schwer werden.
Auch die anderen lächeln mir aufmunternd zu. Wenn man sie hier alle so in Jeans und Shirts sitzen sieht, dann könnte man fast glauben, dass man in einer netten Plauderrunde im Café gelandet ist und nicht in einem Nachtclub.
Während ich noch meine Kolleginnen mustere, kommt Tizian durch die Tür. Mit seiner breiten Statur und der Glatze wirkt er wie ein zu groß geratener Pitbull auf Abwegen.
Das allgemeine Gemurmel im Raum verstummt sofort. Denn obwohl Tizian als rechte Hand unseres Bosses immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Mädchen im Saints hat, alles wissen muss er auch nicht.
Er bekommt ebenfalls eine Tasse Kaffee gereicht, lehnt sich an die Küchenzeile und überschaut die Runde.
»Euch ist schon klar, dass wir in einer halben Stunde aufmachen und ihr alle ausseht wie Hausfrauen im Supermarkt, ja? Trinkt euren Kaffee aus und dann Abflug. Umziehen.« Sein Ton ist streng, doch sein Lächeln verrät ihn. Er scheucht die anderen Mädchen unter Protestlauten heraus, hält mich jedoch am Arm fest.
»Halt mal, Lou. Was ist mit dir? Ich habe grad ein kleines bisschen mitgehört.«
»Belauschst du uns?«
Statt darauf einzugehen, zieht er nur die Augenbrauen in Richtung seines imaginären Haaransatzes.
»Alles gut, Tizian, kein Grund zur Sorge.«
Er mustert mich weiterhin prüfend, erst ein paar lange Sekunden später nickt er. »Ist okay. Dann zieh dich auch um. Abmarsch.«
Ich folge den anderen in die Umkleide und tausche meinen Hoodie und die Leggings gegen eine knappe Hotpants und ein bauchfreies Top. Mittlerweile weiß ich, wie man Trinkgeld bekommt. Anfangs habe ich mich noch zurückhaltend gekleidet, weil ich mir furchtbar lächerlich vorkam. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass jeder Zentimeter Haut zählt. Und da für mich auch jeder Dollar zählt, bin ich mit mir übereingekommen, dass ich hier eben die Version von mir sein muss, die lasziv mit den Wimpern klimpert und knappe Höschen trägt.
Job ist Job. Geld ist Geld.
Kurz darauf strömen die Gäste in den Club und ich bin damit beschäftigt, Bier zu zapfen und Longdrinks zu mischen.
Drei Männer, die hier scheinbar so etwas wie einen trostlosen Junggesellenabschied feiern, sitzen direkt vor mir an der Theke und unterhalten sich laut über die Braut - auf eine Weise, bei der ich mich zusammenreißen muss, nicht meine gute Erziehung zu vergessen. Sie trinken einen Shot nach dem anderen und sind unendlich nervig.
»Darf es für euch noch was sein?«, brülle ich gegen die Musik an. Zwei der drei Männer drehen ihre Köpfe zu mir. Weg von Lucy, der sie vorher beim Tanzen zugesehen haben.
»Drei Whiskey noch. Es sei denn, du meintest was anderes?«, lallt der Linke mir entgegen. Ich kann seinen Atem über die Theke hinweg riechen.
»Drei Whiskey. Macht achtzehn Dollar. Fünfundzwanzig, weil du es bist«, witzele ich. Er grinst breit. Manchmal klappt der Spruch sogar, wenn der Alkoholpegel stimmt.
»Vielleicht kommt ja noch mehr dazu?« Sein Arm wandert über den Tresen. Im nächsten Moment packt er mein Handgelenk. Ich versuche, ihn abzuschütteln, aber sein Griff wird nur fester.
»Komm schon, Kleine. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nur die Getränke machst. In dem Aufzug. Ihr Weiber hier seid doch alle käuflich. Was ist dein Preis, hm?«
Ich reiße an der Hand und schaue mich nach Tizian um.
»Hey, Süße. Augen zu mir.«
»Lass mich los, verdammt.«
Der Typ lacht nur. »Und was, wenn nicht?«
Im nächsten Moment entdecke ich Tizian am Durchgang zu den Separees. Er steht neben einem Mann, der fast genauso groß ist wie er selbst. Die beiden scheinen über irgendetwas zu diskutieren, der andere Mann sieht nicht gerade erfreut aus. Ich hebe die freie Hand, Tizian bemerkt es endlich.
Gott sei Dank.
Der Kerl an meinem Arm lässt immer noch nicht locker und fixiert mich weiterhin mit seinem alkoholverwaschenen Blick. Sekunden vergehen, die sich in diesem Klammergriff wie Stunden anfühlen.
Ich schaue erneut zu Tizian, weil ich nicht fassen kann, dass der erst in aller Seelenruhe sein Pläuschchen mit diesem Unbekannten beendet, während mir schon der Arm abstirbt. Doch Tizian hat sich bereits abgewandt. Stattdessen kommt der Typ, der eben noch mit ihm gestritten hat, in meine Richtung. Er mustert mich dabei so eindringlich, dass es mir eiskalt über den Rücken läuft.
»He, Schnecke. Fremdflirten oder was?«, lallt der Kerl an meinem Arm und zerrt mich immer näher. Der Blickkontakt mit dem Typen in Schwarz bricht ab. Dafür bohrt sich die Kante der Theke schmerzhaft in meine Rippen.
»Lass los. Meine Güte.«
Der Kerl lacht dreckig, fährt dann jedoch zusammen, als einen Herzschlag später die Hand von Mister Todesblick in seinem Nacken landet.
»Alles klar hier?«, fragt mein Retter in der Not. Ich schüttle den Kopf, woraufhin der Kopf des Bräutigams in spe Bekanntschaft mit der Theke macht.
Das Überraschungsmoment reicht, damit er endlich meinen Arm loslässt. »Was bist ‘n du für einer?«, blafft er und versucht jetzt wiederum, die fremde Hand in seinem Nacken abzuschütteln.
»Der, der euch das Leben richtig ungemütlich macht, wenn ihr nicht gleich eure Ärsche hier rausschwingt.« Mister Todesblick hebt seinen Shirtsaum leicht an. Was darunter verborgen ist, kann ich hinter dem Tresen nicht sehen.
»Whoa, Mann. Alles cool, ja?« Ruckartig kommen der Typ und seine Freunde auf die Füße.
»Abmarsch.«
»Klar, klar, sind schon weg.« Sie heben beschwichtigend die Hände und verschwinden tatsächlich ohne weiteres Theater in Richtung Ausgang. Mein Retter in Schwarz schaut ihnen einen Moment nach. Dann setzt er sich vor mich an die Bar und bestellt einen Tequila, ohne auch nur ein weiteres Wort zu sagen. Und ich bin zu perplex, um irgendetwas anderes zu tun, als ihn anzustarren. Ich habe noch niemals im Leben einen härteren Gesichtsausdruck gesehen. Jetzt, aus der Nähe, mit dieser Intensität, ist es beängstigend.
»Was?« Die Bissigkeit seiner Stimme steht der Kälte in seinem Blick in nichts nach.
»Äh, danke für eben. Das war nett.«
»Klar.«
»Mein Arm tut ganz schön weh.«
»Tja, Augen auf bei der Jobwahl. Wirds jetzt bald mit dem Shot?«
Okay, ich nehme jeden Gedanken zum Thema Retter in der Not zurück. »Sorry, ich mach ja.«
»Was war das?«
Ich schaue hoch, direkt in seine Augen, die in der schummrigen Clubbeleuchtung beinahe schwarz wirken. »Ich sagte: Sorry. Ich mach ja.«
»Hm-mh. Pass lieber mal ein bisschen auf deine Wortwahl auf, Blondie, sonst bist du die nächste, die hier verschwindet.«
Und weil er womöglich recht hat, hoffe ich, er kann den imaginär erhobenen Mittelfinger wenigstens in meinem Blick erkennen. Während wir uns noch immer anstarren, greife ich nach der Flasche. Ich fülle das Glas bis zum Rand, dann knalle ich es vor ihm auf die Theke. »Bitte sehr. Cheers.«
Er verengt die Augen. »Du bist neu hier, oder?« Mit einer abartig gönnerhaften Geste legt er einen Hundertdollarschein auf den Tresen. »Stimmt so. Kleine Aufwandsentschädigung.«
»Ich mache hier nur die Bar, sonst nichts. Falls das deine Frage war.« Ich zähle das Wechselgeld ab und schiebe die restlichen Scheine in seine Richtung.
Er nimmt sie in die Hand, aber faltet sie nur und beugt sich dann vor, um sie in den Träger meines Tops zu stecken.
Ist das sein verfluchter Ernst?
»Wenn ich sage, es stimmt so, dann stimmt es so.«
Wir starren uns für einen weiteren, endlos langen Moment an und gerade, als ich etwas dazu sagen will, bestellt jemand lautstark drei Bier.
Während ich das bestellte Bier zapfe, kratzen die Scheine über meine Haut, aber ich werde Mister Todesblick jetzt sicher nicht den Triumph gönnen, sie vor seinen Augen herauszuziehen und in meine Tasche zu stecken. Kann er vergessen.
»Sicher, dass du nur die Bar machst?«, fragt er und ich glaube, den Hauch eines kalten Lächelns in seinem Mundwinkel zu erkennen.
»Ja, sehr sicher. Ich jobbe hier bloß.«
»Das sagen sie am Anfang alle.«
»Hm, klar. Sag mal, willst du jetzt noch irgendetwas bestellen oder hältst du mich nur von der Arbeit ab? Wenn es das Zweite ist, dann lass es bitte. Ich habe zu tun.«
»Was für ein verschenktes Potenzial.«
»Meine Güte, was ist denn heute Abend los? Ist das dein Ernst? Ich habe Nein gesagt.«
Er lächelt wissend, erwidert aber nichts mehr, sondern schiebt bloß mit den Fingerspitzen das Shotglas über den Tresen, nickt mir im Aufstehen zu und verschwindet dann langsam in Richtung der Separees.
Um vier Uhr früh ist meine Schicht noch immer nicht beendet. Während ich zum letzten Mal den Lappen auswringe und über die Edelstahlspüle hänge, könnte ich im Stehen einschlafen.
Meine Kollegin Marlen fegt gerade die Scherben auf dem Boden zusammen, das gläserne Klimpern hallt von den Wänden wider.
Wo vorhin die schillernde Illusion aus Spaß und niemals endender Party war, sind jetzt nur noch klebrige Böden, verbrauchte Luft und furchtbar aufgebrachte Stimmen aus Richtung von Tizians Büro übriggeblieben. Über was sie streiten, kann man nicht verstehen.
Irgendwo rauscht eine Dusche und ich beneide die, die daruntersteht. Ich bin verschwitzt und stinke nach Rauch und Alkohol. Meine Highwaist-Shorts drückt mir in den Bauch und mein BH quetscht mir die Luft ab. Ich fühle mich so überreizt, dass ich am liebsten nur alles von mir schmeißen würde, um mit einem kuscheligen Schlafanzug ins Bett zu verschwinden. Nachdem ich ein ausgiebiges Bad genommen habe. Wenn wir mal Wasser für die Wanne zu Hause hätten.
Stattdessen muss ich nachher ebenso hier im Club duschen.
Während meine Gedanken weiterwandern zu der unbezahlten Wasserrechnung, meinem defekten Auto und der Überlegung, was davon zuerst fällig ist, gehe ich mit einem Tablett durch den Raum und sammle alle Gläser und leeren Bierflaschen ein.
Mitten in der Argumentation für die Wasserrechnung tritt Lucy zu mir. Sie trägt jetzt statt des kleinen Glitzerkleidchens eine Sweatjacke und Jeans.
Bevor ich auch nur irgendetwas sagen kann, hat sie sich schon hingehockt und die Flaschen unter der Sitzgruppe vor uns aufgehoben.
»Du musst nicht-«
»Doch. Weil du viel zu müde aussiehst, Lou.«
»Es ist nach vier Uhr. Glaub nicht, dass mit dir optisch mehr los ist.«
Während sie noch stöhnend nach den verlorenen Flaschen angelt, werden die Stimmen im Hintergrund immer lauter. So sehr, dass Lucy innehält und auch ich mich in Richtung des Büros drehe. Wir zucken gleichzeitig zusammen, als es poltert.
»Wenn das so weitergeht, gibts heute noch Tote. Der Typ ist da schon ewig mit Tizian drin und brüllt die ganze Zeit nur.«
»Wer ist denn so lebensmüde, Tizian anzuschreien? Meinst du, das ist der Boss?«, frage ich dämlich nach.
»Quatsch. Das ist nicht der Boss, das ist-«
Bevor sie weitersprechen kann, schlägt eine Tür zu. Schnelle Schritte nähern sich.
Und Überraschung. Es ist tatsächlich nicht der Boss. Es ist Mister Todesblick höchstpersönlich.
»Oha«, mache ich. Lauter als gewollt.
Lucys Blick fliegt zu mir. »Sag nicht, du kennst den?«, flüstert sie und folgt mir an den nächsten Tisch.
»Kennen ist übertrieben. Er saß vorhin kurz an der Bar.«
»Dann sei froh, dass es dabei geblieben ist.«
»Wie meinst du das?«
»Das da, meine liebe Lou, ist Rebel. Keine Ahnung, wie der wirklich heißt, keine Ahnung, wo der herkommt. Aber er hat einen Ruf hier. Was glaubst du, warum selbst Tizian Schiss hat, wenn der auftaucht. Wenn es Stress gibt oder irgendetwas nicht läuft, dann schickt der Boss immer ihn.«
Sie deutet in Richtung Tür. Dort ist Rebel stehengeblieben und redet wieder mit Tizian, der ihm eilig hinterhergekommen ist. Ihre Stimmen sind jetzt gedämpft, trotzdem sieht man selbst auf die Entfernung, dass sie streiten.
Und obwohl es vermutlich alles andere als klug ist, aber ich kann auch nicht damit aufhören, die Konturen von Rebels Kinnlinie und seinen geschwungenen Mund zu betrachten. Würde er nicht für den Boss arbeiten, wäre er ein attraktiver Mann.
Gerade noch rechtzeitig, bevor er sich von Tizian abwendet, senke ich den Kopf.
Mit langen Schritten stürmt er auf Lucy und mich zu, direkt in Richtung Ausgang. Ich kann seinen harten Blick am ganzen Körper fühlen, während er uns passiert. Doch diesmal schaue ich nicht hoch. Ich habe keine Lust, die nächste zu werden, die seinen Zorn zu spüren bekommt.
Diese Nacht war zu lang, um es darauf anzulegen.
Kapitel 2
Um fünf ist meine Schicht endlich vorbei. Erschöpft trete ich in die sommerwarme Nachtluft hinaus, in der sich bereits ein ganz zartes Dämmerlicht aus verwaschenem Grau am Horizont erhebt.
Mein Herz ist schwer, mein Körper ausgebrannt und zu allem Überfluss habe ich den nächsten Bus verpasst, weil das Aufräumen länger gedauert hat.
Sonst bin ich meistens mit dem Auto unterwegs, aber das ist noch in der Werkstatt. Wer weiß, ob ich es jemals zurückbekomme oder ob sie es bloß noch für schrottreif erklären.
Also schiebe ich die Hände in die Hoodietaschen und mache mich zu Fuß auf den Weg. Es ist nicht wirklich weit. Vielleicht ist es sogar schlauer, sich das Geld für die Fahrkarte zu sparen. Laufen kostet immerhin nichts.
Noch während ich im Kopf die Dinge durchrechne, die diese Woche so anstehen – Dads nächster Arzttermin, die Werkstatt, diese verdammte Wasserrechnung – höre ich hinter mir Schritte. Erst weit entfernt und leise, doch sie kommen näher. Ich beschleunige, der Abstand wird geringer. Mein Herz rast.
Vor mir ist niemand zu sehen, die Straße ist wie ausgestorben.
Dann sind da Stimmen. Mehrere.
Vielleicht sind das nur Partygänger auf dem Weg nach Hause? Wie viele sind das?
Die Stimmen klingen tief, das ist keine Mädchengruppe. Mein Bauchgefühl sagt mir mit jeder Sekunde mehr, dass ich laufen sollte.
Bei einem kurzen Schulterblick kann ich zwei Typen erkennen, die die Köpfe zusammenstecken und sich weiterhin leise unterhalten. Gefährlich leise.
Ich zupfe im Gehen den Saum meines Pullovers nach unten und verfluche mich doppelt, weil ich vorhin nach dem Duschen statt meiner Leggings eine knappe Sportshorts angezogen habe, die ich noch in meiner Tasche hatte. Weil mir so warm war. Weil man als Frau tragen dürfen sollte, was man will, wann man will, verdammt noch mal.
Die restliche Welt scheint das nicht so zu sehen.
»Hey, du mit dem süßen Arsch da vorne! Bleib doch mal stehen«, ruft jetzt einer der Männer, während ich in einen leichten Laufschritt falle. Mir bricht der Schweiß aus, ich besitze nicht mal Pfefferspray.
»Suchst du dein Zuhause? Oder bloß ein bisschen Gesellschaft?« Ein Lachen folgt, das meinen Herzschlag nur weiter in die Höhe treibt.
Mit zittrigen Fingern taste ich in der Tasche nach meinem Handy, aber der Akku ist schon lange leer. Vielleicht kann ich wenigstens so tun, als würde ich die Polizei rufen.
Bevor ich dazu komme, bremst ein riesiger Geländewagen auf meiner Höhe. Der schwarze Lack glänzt so sehr, dass das Teil mehr einem Raumschiff gleicht als einem normalen Auto. Und weil ich natürlich nicht stehenbleibe, fährt er im Schritttempo neben mir her und lässt die Scheibe herunter.
Wenn der jetzt fragt, was es kostet, dann platze ich. Das wäre der unangefochtene Tiefpunkt meines Tages. Womöglich sogar meines Lebens.
»Gibts ein Problem?« Die tiefe Stimme aus dem Fond des Wagens bringt mich ins Stocken, denn sie ist die letzte, mit der ich gerechnet habe.
Das kann doch nicht wahr sein.
Ich riskiere einen weiteren Seitenblick und bin unschlüssig, was ich tun soll. Im Auto sitzt Mister Todesblick. Rebel, dessen echten Namen scheinbar niemand kennt.
»Ey, Kleine!«, ruft einer der Kerle hinter mir, als ich das Tempo weiter anziehe. Das Auto wird ebenfalls schneller.
»Meine Fresse, willst du jetzt echt einen auf cool machen?« Das ist wieder Rebel. Im nächsten Moment beschließt mein Hirn, dass er die kleinere Gefahr ist. Wer weiß, ob es stimmt.
Mit einem Haken nähere ich mich dem Wagen, er hält an. Die Tür geht auf, die Tür geht zu und die Zentralverriegelung schließt.
Die beiden Typen, die hinter mir waren, drehen einfach ab, als wäre nichts gewesen. Und für sie ist es das auch nicht. Für sie sind es nur ein paar Sprüche. Ihre Welt dreht sich weiter, während meine gerade erschüttert wurde.
Ich brauche ein paar hektische Atemzüge, bis ich das Zittern meines Körpers unter Kontrolle bekomme.
Verdammt. Verdammt.
Endlich beschleunigt das Auto.
Mein Kopf ist weiterhin damit beschäftigt, mir immer wieder die Horrorszenarien vorzuspielen, die hätten passieren können, obwohl ich mit aller Kraft versuche, dagegen anzuarbeiten.
»Wie wäre es mit einem Danke?«, fragt Rebel irgendwann. Da sind wir aber sicher schon drei Blocks unterwegs. Keine Ahnung, wo er überhaupt hinwill. Ich war zu sehr mit meiner Panik beschäftigt, als dass ich wirklich auf die Straße geachtet hätte.
»Oder soll ich dich lieber wieder zurückbringen?«
»Ich wollte gar nicht laufen. Ich habe bloß den Bus verpasst.«
Er seufzt. »Großartig. Warum in aller Welt wartest du dann nicht auf den nächsten? Oder nimmst dir ein verficktes Taxi, statt hier halbnackt durch die Dunkelheit zu irren wie eine Wahnsinnige?«
»Bin pleite.«
»Hm-mh. Und scheinbar ziemlich lebensmüde.«
»Warum? Als wäre es meine Schuld, dass solche Idioten herumlaufen. Außerdem habe ich dich erkannt. Zu einem Fremden wäre ich niemals ins Auto gestiegen.«
»Natürlich nicht.«
Dann herrscht erneutes Schweigen. Zumindest so lange, bis er eine Zigarette zwischen seine Lippen schiebt und sie im Auto anzündet.
»Das ist giftig«, bemerke ich schlicht. Wieder schaut er herüber. Ich glaube, er explodiert gleich.
Mit einer schwungvollen Handbewegung drückt er die Zigarette aus und legt die Hand zurück ans Lenkrad. »Sonst noch Sonderwünsche? Ich fange an zu bereuen, dass ich nicht einfach weitergefahren bin.«
»Bist du aber nicht. Danke dafür. Ehrlich.«
»Vielleicht ändere ich meine Meinung. Ich kann jederzeit anhalten, also provozier es lieber nicht.«
Mein Blick fällt auf seine Hände, die locker auf dem dunklen Leder des Lenkrads liegen. Auf die abgeschürften Fingerknöchel, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind.
»Was ist da passiert? Sieht übel aus.«
»Du lernst es auch nicht, oder?«
»Ich wollte nur nett sein.«
»Dann hör auf damit.«
Während er Gas gibt, schaue ich auf sein Profil.
»Darf ich eine letzte Frage stellen?«
»Bitte. Wenn du danach endlich die Fresse hältst.«
»Wo fahren wir hin?«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Ähm …«
»Wenn man kein Ziel hat, kann man nicht ankommen.« Er starrt aus der Windschutzscheibe und ich bin einfach nur noch verwirrt. Von diesem Abend, von diesem Typen. Von meinem ganzen Leben.
»Vielleicht ist es doch besser, du schmeißt mich hier raus. Ich laufe den Rest.«
»Genau. Tolle Idee. Damit gleich die nächsten Vollidioten da weitermachen, wo die eben aufgehört haben?«
»Wie kann das eigentlich sein, dass man Angst haben muss, nach Hause zu gehen? Dass man immer und überall Angst haben muss? Nur, weil man eine Frau ist. Das ist doch nicht fair.«
»Was ist schon fair in dieser Welt, Blondie?«
»Ich heiße Lou.«
Keine Reaktion.
»Und du?«
»Was?« Er wirft mir einen Seitenblick zu.
»Wie heißt du?«
»Ich brauche keinen Namen.«
»Jeder braucht einen. Die anderen im Club haben dich Rebel genannt. Aber so heißt du doch nicht echt, oder?«
Er schweigt.
»Schmeißt du mich jetzt irgendwo raus? Ich muss in die andere Richtung und wenn du noch weiterfährst, dann komme ich nie zu Hause an.«
Er macht es nicht, sondern biegt um die nächste Ecke. Mit jedem Meter entfernen wir uns mehr von meinem Zuhause. Vermutlich interessiert ihn das nicht. Was für ein merkwürdiger Abend. Das ist doch völlig hirnrissig. Was mache ich hier eigentlich?
Dann, kurz bevor wir die nächste Ampel passieren, macht der Wagen einen rasanten U-Turn auf der breiten Straße.
»O Gott, bist du irre?«, rufe ich und kralle mich am Türgriff fest.
»Nicht mehr als du. Also, wo gehts hin?«
Als Rebel in meiner Auffahrt hält, geht der Bewegungsmelder an der Haustür an. Das warme Licht der Lampe mischt sich mit dem Schimmer des Sonnenaufgangs auf unseren Gesichtern. Seins ist bei Weitem nicht mehr so streng und hart wie vorhin.
Jetzt gerade sieht er einfach nur furchtbar müde aus.
»Danke fürs Fahren. Und für die Rettung. Die zweite heute.«
Die einzige Antwort, die ich darauf bekomme, ist ein knappes Nicken.
»Sehen wir uns mal wieder? Bist du öfter im Saints?«
»Sei lieber vorsichtig mit deinen Wünschen.«
»Was, wenn nicht?«
»Dann könnte es sein, dass du das morgen bereust.« Quälend langsam dreht er sich in meine Richtung, schaut zwischen meinen Augen hin und her und lässt den Blick schließlich auf meinem Mund ruhen.
Mit einer harten Handbewegung greift er an mir vorbei und stößt die Beifahrertür auf. »Und jetzt raus aus meinem Auto.«
Es klingt beinahe verführerisch. Als wäre es entgegen seiner Drohung das sinnvollste, einfach sitzenzubleiben. Und weil das so ist, tue ich genau das. Ich sitze wie erstarrt auf diesem weichen Ledersitz und hänge in den hypnotischen, dunkelbraunen Augen dieses Mannes fest, der mich noch immer mustert, als könnte er nicht glauben, was hier gerade passiert. Und damit ist er nicht allein.
»Du bist wirklich lebensmüde, Blondie«, haucht er. So lockend und leise, dass ich keuchend ausatme. Ich sollte von hier verschwinden. Schnellstens.
Und weil Rebel mir noch immer so nahe ist, schnalle ich mich ab, drücke die Lippen eine kaum spürbare Sekunde lang auf seine Wange und bin dann aus dem Auto raus, bevor er reagieren kann. Ich höre nur noch sein erstauntes Schnauben, das sich in ein wütendes Knurren wandelt.
»Kleine Aufwandsentschädigung«, wiederhole ich seine Worte von vorhin. »Danke fürs Fahren. Hat mich gefreut.«
Kapitel 3
Was war das bitte für eine beschissene Nacht? Erst hat mich der Typ bei den Docks ewig zugequatscht und als ich endlich auf dem Weg nach Hause war, hat mein Vater angerufen und gesagt, dass ich ins Saints fahren soll.
Nachts um zwei.
Als hätte ich nichts Besseres zu tun.
Aber was solls. Neuer Tag, neues Glück oder wie heißt es so schön? Also klopfe ich hart an die lederbezogene Bürotür meines Vaters und höre sein herein schon, bevor ich überhaupt die Hand sinken lassen kann.
Er erwartet mich mit einem hochherrschaftlichen Blick, der mich so dermaßen auf die Palme bringt, dass ich mich zum Atmen zwingen muss.
»Was ist, Luca?«, fragt er sofort, weil er meinen Gesichtsausdruck deuten kann, egal wie undurchdringlich ich ihn halte.
»Was soll sein?«
»Wenn nichts wäre, dann würdest du nicht um Viertel vor Zehn am Morgen bei mir klopfen. Aber es passt sich gut, du schuldest mir ohnehin noch einen Bericht.«
»Es gibt nichts zu berichten. Tizian regelt das. Er war … einsichtig.«
»Gut. Was ist mit der Sache an den Docks?«
»Alles verpackt.«
»Sehr schön. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse?«
Ich schüttle den Kopf, trete näher an den riesigen Mahagonischreibtisch und setze mich in den Sessel davor. Meine Hände baumeln im Schoß, während mein Blick auf das Foto fällt, das in einem Goldrahmen auf dem Schreibtisch steht. Es ist ein paar Jahre alt. Alle lächeln. Bei meiner Mutter und meiner Schwester ist das Lächeln echt.
Weil ich weiterhin nichts sage, schaut mein Vater noch eine Spur eindringlicher. Ich weiche dem Blick aus und lasse meinen Kopf in den Nacken fallen.
»Ich habe dir eine Frage gestellt, auf die ich gern eine Antwort hätte, Luca.«
»Was willst du denn hören? Möchtest du demnächst wörtliche Abschriften?«
»Bring mich nicht auf Ideen, die du später bereust.«
Ich balle unter dem Tisch die Hände und versuche, ruhig zu atmen. »Seit wann muss ich eigentlich diese Scheiße für dich erledigen, hm? Ich komme mir langsam vor wie ein Laufbursche. Hast du keine anderen Pfeifen mehr, die das machen können? Tizian hat mich stundenlang zugelabert.«
Dads Lächeln wird noch herablassender, meine Faust pumpt unter dem Tisch mit meinem Herzen um die Wette.
Einmal, zweimal.
»Tja, Luca. Du bist leider meine Lieblingspfeife, um bei deinem eigenen Wortlaut zu bleiben. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern, denn ich möchte, dass du lernst, wie unser Geschäft funktioniert. Da du aber bedauerlicherweise nicht dieselben Pläne hegst, werde ich dafür sorgen, dass du in Zukunft ein bisschen mehr eingebunden bist. Irgendwann wirst du auf diesem Stuhl hier sitzen und dann wirst du mir für diese umfangreiche Ausbildung dankbar sein.«
Ausbildung? Ein Studium ist eine Ausbildung. Oder ein Handwerk zu lernen, das ist eine Ausbildung. Das hier ist doch keine verdammte Ausbildung.
»Außerdem bist du mir in letzter Zeit ohnehin etwas eskalativ unterwegs. Ich habe einen Anruf von unserem sehr geehrten Herrn Bürgermeister erhalten. Du weißt sicher, um was es geht?«
»Das war ein Unfall.«
»Mit einem Schaden, den du gar nicht ermessen kannst. Weißt du, was es mich kosten wird, diese Eskapade geradezubiegen?«
Die Sache mit Sabina vor ein paar Tagen war im Grunde eher ein Kollateralschaden als ein wirklicher Unfall. Wir haben uns im Winter auf einem Empfang zur Wahl ihres Vaters kennengelernt. Sie war die, die irgendwann damit angefangen hat, dass sie in ihrem trostlosen Alltag mal was erleben will. Als wir dann was erlebt haben, ist es etwas aus dem Ruder gelaufen.
Wir wurden nach einem illegalen Autorennen in meinem Auto erwischt. In eindeutiger Angelegenheit. Das fanden die Polizisten nicht so schön.
Ich bin mir nicht sicher, was schlimmer war. Dass Sabina nackt auf meinem Schwanz saß oder dass sie bis unter die Augenbrauen zugekokst war. Also haben sie uns verhaftet. Ordnung muss schließlich sein.
»Die Polizei hat die Sache fallengelassen.«
»Ja, aber Sabinas Vater nicht. Und wenn wir Pech haben, hängt er das an die ganz große Glocke.« Dad lehnt sich in seinem riesigen Lederstuhl zurück und stützt das Kinn auf eine Faust. Sein Haar hat exakt die Farbe des Leders. Faszinierend.
»Das Problem ist ja nicht einmal, dass so etwas passiert ist, sondern unter welchen Umständen es passiert ist. Und dass es sich häuft. Du musst verdammt noch mal lernen, zu funktionieren. Ich habe keine Lust mehr, ständig hinter dir aufräumen zu müssen. Das wird auf Dauer durchaus lästig.«
»Dann hör doch auf damit.«
»Provoziere mich nicht. Wenn ich noch einmal einer derartigen Verfehlung von dir gewahr werde, haben wir beide ein ernstes Problem miteinander, Luca. Solche Geschichten schaden meiner Reputation genauso wie deiner.«
»Ja, verdammt und es tut mir auch leid, dass es Ärger gegeben hat. Aber-«
»Nein, kein aber. Die Sache hat Kreise gezogen. Du bist kein kleiner Junge mehr, Luca. Du musst Geschäft und Vergnügen trennen lernen. Ich kann es mir nicht leisten, dass mein Tagesgeschäft von so etwas in den Dreck gezogen wird. Romero Estate lebt vom guten Ruf. Es ist unsere Rückversicherung und unsere wichtigste Deckung. Außerdem möchte ich nicht, dass Miguel dos Santos dich für einen unzuverlässigen Idioten hält.«
»Mein Gott, jetzt fang nicht auch noch damit an.«
»Ich rede hier, über was ich möchte. Das ist meine Familie, meine Entscheidung und mein Geschäft. Bekomm dich verdammt noch mal in den Griff.«
»Und was soll ich denn deiner Meinung nach tun?«
»Das alles wird aufhören. Keine Eskapaden mehr. Du wirst tun und lassen, was ich dir sage und nichts weiter. Keine illegale Scheiße, keine Drogen. Und vor allem: keine Weiber. Die machen nur Ärger.«
»Gilt das für uns beide?«
Er atmet angestrengt durch. Vermutlich betet er innerlich zu seinem beschissenen Gott und fragt, womit er einen Sohn wie mich verdient hat. Aber mal ehrlich: Wer treibts denn ständig mit irgendwelchen namenlosen Frauen in seinen eigenen Clubs? Wer belästigt denn die Hausmädchen? Im selben Haus, in dem meine Mutter wohnt.
Weil er nicht antwortet, übernehme ich das. »Darf ich dich kurz an deine Arbeitsanweisung von gestern erinnern? Und daran, was ich heute Nacht bei den Docks für dich umgeladen habe? Du widersprichst dir selbst, merkst du das eigentlich?«
»Dieses Gespräch ist beendet«, sagt er schließlich, nachdem er mich lange genug in Grund und Boden gestarrt hat. »Und wenn du das nächste Mal glaubst, dass es dir das Risiko wert ist, dann vergiss lieber nicht, gegen wen du spielst. Dieser Deal mit dos Santos ist mir überaus wichtig. Ich möchte, dass der reibungslos über die Bühne geht. Egal, was es mich kostet.«
Während ich noch mit meiner Wut kämpfe, holt er eine Mappe aus der Schreibtischschublade. »Oder bist du anderer Meinung, Luca?« Er schaut gar nicht auf, doch seine Aufmerksamkeit ist trotzdem bei mir. Er hat das perfektioniert.
»Nein, sicher. Ich werde mir Mühe geben.« Lüge. Für diesen dämlichen Vollpfosten dos Santos werde ich absolut gar nichts tun.»Wenn dann nichts mehr ist, würde ich jetzt gern zum Frühstück gehen, Dad. Wie normale Menschen das so machen.« Mit einem knappen Nicken stehe ich auf.
»Natürlich, geh nur. Ich rufe dich an, wenn ich dich brauche.«
Ich salutiere locker vor ihm und wende mich ab. Wird Zeit, hier rauszukommen.
Er schlägt hinter mir den Ordner auf und ich bete zu Gott, dass er da nichts über seine Angestellten vermerkt. Oder noch schlimmer … über mich.
Liebes Tagebuch, Luca war wieder ein böser Junge, aber ich lasse eine harte Hand walten. Ich bin der Vater des Jahrtausends.
Was für ein elender Scheißmorgen.
Ich suche Mom und Vio im Salon, aber finde dort nur die Hausmädchen und Pedro, der einen Kaffee trinkt. Pedro ist einer der engsten Mitarbeiter meines Vaters und immer im Haus, falls mal was sein sollte. Er hat seine Augen und Ohren überall. Er ist eine Plage.
Ich bedenke auch ihn mit einem Nicken, dann drücke ich die Glastür auf und trete in den Sonnenschein auf die Terrasse. Von hier aus hat man einen weitläufigen Blick über den Park und das Meer am Horizont. Ein wahrgewordener Traum.
Am Kopfende des Tischs sitzt Mom und blättert ein Modemagazin durch. Ihre Haare sind adrett zu einer Hochsteckfrisur zusammengenommen und sie trägt ein Kostüm.
Am Samstag. Zum Frühstück. Aber gut.
Neben ihr sitzt meine Schwester Vio und tippt auf einem überdimensionalen Handy herum.
»Einen schönen guten Morgen, meine Damen.«
Mom hebt erst den Blick und dann eine Augenbraue. »Dir auch einen schönen guten Morgen, Luca«, gibt sie scharf zurück und überfliegt mein Gesicht mit den gleichen braunen Augen, die ich ebenfalls habe. »Du warst spät zu Hause.«
»War unterwegs.«
»Für deinen Vater?«
»Nein, für den Heiligen Geist.«
Sie verengt die Augen, soweit das Botox in ihrer Haut es zulässt. »Wo denn?«
Ich deute lediglich mit dem Blick auf Vio, die wieder einmal keinem der Anwesenden ihre Beachtung schenkt, und ziehe meinerseits die Augenbrauen hoch. Das heißt so viel wie: Wenn sie nichts wissen soll, frag nicht so dämlich.
Mom macht daraufhin einen Laut, den ich gar nicht richtig deuten kann, und knallt die Zeitung auf den Tisch. Dann steht sie auf. Ihre Absätze hallen von dem glatten Boden des Salons wider, als sie das Haus betritt. Sie ruft irgendetwas Spanisches, das ich auf die Entfernung nicht wirklich verstehen kann.
»Was musstest du denn nachts für Dad erledigen? Du hast dich doch bestimmt nur wieder mit Sabina getroffen, oder?« Jetzt, wo Mom fort ist, zieht Vio sich die Kopfhörer von den Ohren und nimmt mich genau ins Visier.
»Wer ist bloß Sabina?«, gebe ich lahm zurück.
»Mann, Luca! Das ist doch nicht normal. Kannst du nicht mal eine Freundin behalten? Du musst dir mehr Mühe geben. Mädchen mögen das nicht, wenn man so scheiße ist wie du.«
Was sie nicht sagt.
Weil ich nicht antworte, wendet sie sich wieder ihrem Handy zu, grinst in sich hinein und wird dabei ein bisschen rot. Mit flinken Fingern tippt sie auf dem Display herum.
»Wem schreibst du?«, frage ich und nehme mir ein Toast aus dem Korb, der auf dem Tisch steht.
»Niemandem.«
»Echt? Niemandem?«
Sie beugt sich als Antwort nur noch weiter herunter, sodass ich gar nicht mehr sehen kann, was sich in ihrem Gesicht abspielt. Ihre dunklen Haare hängen wie ein Vorhang davor und lassen sie echt gruselig aussehen. Wie dieses Mädchen aus dem Horrorfilm mit dem Brunnen. Nur nicht so blass.
Bevor ich sie mir weiter in dieser Rolle vorstellen kann, vibriert mein Handy in der Hosentasche.
Es ist Knight.
»Rebel«, sagt er, ohne wirkliche Begrüßung.
»Hey, was gibts. Alles klar?«
»Ja, ja, alles gut. Bei dir? Wollte nur fragen, ob wir nachher an den Strand wollen. Bisschen abhängen.«
Bisschen abhängen. Es klingt bei ihm so verflucht normal. Weil es für ihn auch normal ist. Weil sie alle ein ganz normales Leben leben, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, welche Scheiße bei mir wirklich abgeht.
»Rebel?«
»Hm?«
»Hast du Zeit?«
»Ja, müsste klappen. Ich habe heute Nachmittag keine Termine. Vierzehn Uhr bei unserem Zugang?«
Er macht noch ein grummelndes Geräusch und legt dann einfach auf.
Auch in diesem Teil meines Lebens gibt niemand viel auf Freundlichkeiten.
Knight ist trotzdem einer meiner besten Freunde und davon haben Menschen wie ich nicht viele. Weil es zu gefährlich ist. Für mich und im Zweifel auch für sie.
Aus diesem Grund wissen er und Rain auch rein gar nichts über mein Leben. Es ist besser so. Für alle Beteiligten.
»War das etwa Knight?« Vio deutet übertrieben beiläufig auf mein Telefon.
»Kann sein.«
»Trefft ihr euch?«
»Möglich.«
»Am Strand?«
»Mein Gott, ja. Willst du die genauen Koordinaten, oder was?«, blaffe ich, doch sie lächelt nur. Meine kleine Schwester ist eine der wenigen, die sich nicht von mir einschüchtern lassen. Genau wie diese wahnsinnige, blonde Irre von der Bar gestern Abend. Lou. Statt einfach die Fresse zu halten und aus meinem Wagen zu verschwinden, hat sie mich zugequatscht und sich dann zum Abschied noch erdreistet, mich auf die Wange zu küssen. Sie. Mich. Das ist mir in all den Jahren auch noch nie passiert.
»Kommt denn nachher nur Knight oder Rain auch?«
Meine Schwester hat eine unnormale Obsession für Rain. Dabei ist der hundert Jahre zu alt für sie und seit erschreckend langer Zeit mit June Reed zusammen. Aber das ist eine andere Geschichte.
»Also? Ja oder nein?«
»Was weiß ich, nerv mich nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.«
Sie überlegt noch kurz, nickt dann aber. »Gut. Wir treffen uns um kurz vor zwei auf der Terrasse. Ich komme so oder so mit.« Damit steht sie auf, reißt klirrend ihren Teller hoch und stakst anschließend mit ihren viel zu dürren Teenie-Beinen ins Haus.
Hatte ich schon erwähnt, dass das hier ein Scheißmorgen ist?
Kapitel 4
»Sagen Sie es nur offen, Miss Boyd. Ich muss wissen, in welcher Häufigkeit und Intensität sein Gedächtnisverlust im Moment auftritt, sonst kann ich Ihnen leider nicht helfen. Wenn Sie jedes Mal versuchen, es zu rechtfertigen, wird es nicht besser werden.«
Dad schaut konfus zu mir und dreht sich dann zu Dr. Hamilton, bevor ich antworten kann. »Was denn für ein Gedächtnisverlust? Da täuschen Sie sich. Sie meinen bestimmt meinen Vater Bernie. Aber der ist noch nicht wieder aus dem Krieg zu Hause. Diese verdammten Drecksschweine werden nie klein beigeben, sag ich Ihnen.« Er untermalt seine Wutrede mit einer nachlässigen Handbewegung.
»Dad, du sollst doch nicht immer fluchen«, flüstere ich und werfe Dr. Hamilton einen entschuldigenden Blick zu.
Dabei kann Dad nichts dafür. Sein kranker Kopf hat einfach vergessen, dass dieser Krieg zum Glück schon lange vorbei ist. Und auch, dass es furchtbar respektlos ist, was er da von sich gibt. Früher war Dad ein offener und weltgewandter Mann, heute gibt er nur noch die Sprüche wieder, die ihm in seiner Kindheit von seinem eigenen Vater so lange eingetrichtert wurden, dass selbst die Demenz sie nicht vertreiben konnte.
Dr. Hamilton betrachtet mein zerfurchtes Gesicht mit einem nachsichtigen Ausdruck. Vermutlich muss ich gar nicht mehr viel sagen, weil Dads Verhalten schon alles zeigt, was er wissen will.
Dad regt sich unterdessen mit weiteren Beschimpfungen auf. Selbst meine Hand auf seinem Arm stoppt ihn nicht.
»Nun, womöglich habe ich sie tatsächlich verwechselt, Mr. Boyd.« Dr. Hamilton wendet sich von mir ab und schaut Dad an. »Ich meinte wohl Ihren Vater. Wären Sie aber stattdessen so freundlich und würden da hinten in der Zeitschrift auf dem Tisch mal nach dem Artikel über das neue Modell von Chrysler suchen? Ich finde den nicht mehr.«
Dad erhebt sich widerstandslos, zockelt zu dem kleinen Glastisch mit den Heften und lässt sich in einen der schwarzen Ledersessel fallen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann werden wir ihn in der nächsten halben Stunde nicht wiedersehen. Es ist schrecklich, wenn er diese Phasen hat.
»Also, Miss Boyd. Jetzt bitte noch einmal von vorne.« Dr. Hamilton lächelt nachsichtig, während ich mich mit Mühe in meinem Stuhl straffe.
»Sie haben recht. Es wird immer schlimmer. Manchmal erkennt er mich gar nicht. Er spricht mich oft mit dem Namen meiner Mutter an und beschimpft auf der Straße die Leute. Sie haben es ja eben gehört. Ich kann ihn gar nicht mehr rauslassen. Jedenfalls nicht allein«, gebe ich zu, Dr. Hamilton notiert es in seiner Akte. Dann stützt er die Unterarme auf den Schreibtisch und nimmt die Lesebrille ab. Sein Blick wird so eindringlich, dass es mich fröstelt.
»Ich will Ihnen nicht zu nahetreten, Miss Boyd, aber wie regeln Sie denn die Betreuung zu Hause überhaupt? Sie gehen doch sicher arbeiten, oder nicht? Ich denke, dass es besser wäre, wenn Ihr Vater nicht mehr allzu lange am Stück allein ist. Auch hinsichtlich solcher Gefahrenquellen wie dem Backofen oder dem Herd. Oder laufendem Wasser. Es gibt unendlich viele Dinge zu bedenken und langsam macht mich die Situation bei Ihnen nervös.«
Ich wringe meine Hände im Schoß und weiche seinem Blick aus. »Ja, schon. Aber meistens ist er nur nachts allein. Da schläft er eigentlich immer.« Und wenn ich tagsüber im Imbiss arbeite oder wenn ich einkaufe oder wenn ich die Nachbarn besänftige.
»Aber das ist doch kein Zustand, Miss Boyd. Und es wird ja nicht besser. Sie können das nicht ewig so machen. Ich würde Ihnen nachher gern ein paar Broschüren mitgeben. Es gibt wirklich gute Einrichtungen, die auf das Krankheitsbild Ihres Vaters spezialisiert sind. Oder Sie entscheiden sich für eine Tagespflege. Das wäre auch eine Option. Sie können nicht so weitermachen wie bisher. Das ist zu gefährlich. Für Ihren Vater und für sein Umfeld.«
Als hätte er es geahnt, steht Dad plötzlich mit einem Ruck auf. »Sophia!«, ruft er. »Hast du die Tiere gefüttert? Das dürfen wir nicht vergessen, Liebes. Komm. Erzähl doch dem Reverend nicht immer so viele Geschichten. Der Mann hat zu tun. Beten kannst du nachher zu Hause.« Damit nimmt er seine Strickjacke von der Stuhllehne und eilt aus dem Raum.
Ich springe ebenfalls auf. Für einen Moment noch bin ich hin und her gerissen, entscheide mich dann aber, hinter ihm her zu gehen, bevor er das Gebäude verlässt und sonst was anstellt.
Dr. Hamilton lächelt noch aufmunternd und hebt eine Hand. »Ich schicke Ihnen die Unterlagen dann mit der Post hinterher, ja? Denken Sie darüber nach, Miss Boyd. Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an.«
Mein hektisches Nicken geht in dem Versuch unter, Dad auf dem Flur einzuholen.
»Autsch!« Dieser verdammte Herd. Ich verbrenne mich jedes Mal. Fluchend betrachte ich meine Hand und schüttle sie hektisch, als könnte das die Schmerzen vertreiben.
»Louisa? Sind die Burger bald fertig?« Mein Chef Joe steckt den Kopf durch die Luke zur Küche. Ich wende mich von den roten Brandblasen an meiner Hand ab und schaue auf. Direkt in sein freundliches Gesicht.
»Ja, tut mir leid. Geht gleich los.«
Mit Schwung wende ich die Pattys erneut und trete diesmal vorsichtshalber einen Schritt zurück. Kurz darauf schiebe ich die vier Teller nach vorne und tippe das kleine Glöckchen an, das auf dem Tresen steht.
Joes Kopf erscheint erneut. Sein Lächeln wird immer mitleidiger, je öfter er mein erschöpftes Gesicht studiert.
»Sind die letzten Gäste, du kannst dann schon aufräumen. Wird Zeit für den Feierabend.«
Gott sei Dank.
Also wasche ich mir die Hände, wische die Oberflächen ab und reinige die Bratplatte, dann die Pfannen und Töpfe und zuletzt räume ich alles Geschirr, das zurückgekommen ist, in den Geschirrspüler.
Als ich hier angefangen habe, gab es noch einen Abwäscher und eine Servicekraft, aber Joe sagt, dass er sich das nicht mehr leisten kann. Also sind da seit einem halben Jahr nur noch er und ich. Manchmal kommt seine Frau mit. Viel zu tun ist ohnehin nicht. Seitdem das Bistro gegenüber eröffnet hat, essen die Leute lieber dort. Joe sind zwar ein paar Stammkunden geblieben, aber das war es dann auch. Es tut mir wirklich leid für ihn, denn ich weiß, wie viel ihm der Laden bedeutet.
Als ich gerade den Lappen auswringe und über die Spüle hänge, steckt er erneut seinen Kopf in die Küche.
»Wow, Louisa. Das blitzt ja hier.« Sein Gesichtsausdruck sieht jedoch nicht nach ehrlicher Begeisterung aus.
»Für dich gebe ich mir eben besondere Mühe, Joe«, gebe ich zurück, doch der Zug um seine faltigen Augen wird nur immer gequälter.
»Wenn du dich umgezogen hast, kommst du dann mal eben nach vorne? Ich … ich müsste da noch eine Sache mit dir bereden.«
Keine zehn Minuten später sitze ich vor Joe und trinke meine vermutlich letzte Cola hier, denn er hat mir gerade eröffnet, dass er den Laden schließen muss.
»Es tut mir so leid«, sagt er. »Ich wünschte, es hätte nicht so weit kommen müssen. Aber ich bin nicht mehr in der Lage, etwas daran zu verhindern.«
Für ihn ist es das Ende eines Lebenstraums, für mich bedeutet es ein Problem mehr auf dem Berg an Problemen, die im Moment mein Leben darstellen. Das sind locker ein Paarhundert Dollar, die jeden Monat fehlen werden.
»Ach, Joe. Es tut mir so leid«, murmle ich. »Kann ich noch irgendwas für dich tun?«
Er lächelt leicht, seine Augen glänzen feucht. »Meinst du, du kannst vielleicht trotz der Kündigung noch kommen, bis wir schließen müssen? Ein paar Wochen könnte ich noch öffnen, wenn jemand mir zur Hand geht.«
»Ich würde so gern, Joe, aber ich …« Ich brauche einen anderen Job. Einen, bei dem ich Geld für meine Arbeit bekomme. Ich schaffe es nicht, das auszusprechen. »Warst du denn bei der Bank?«
»Die Bank kann mir nicht helfen, da geht es um etwas anderes. Aber das soll dich nicht belasten. Das werde ich schon klären können. Man kann immer alles irgendwie klären. Ich hoffe, du findest schnell etwas Neues.«
»Es tut mir leid, dass ich dich jetzt hängenlasse, Joe.«
Er drückt meine Hand. »Mach dir darum mal keine Sorgen, Kleine, hm? Wird schon werden.«
Während ich aufstehe, fühlt sich mein Körper tonnenschwer an vor lauter Ausweglosigkeit.
Jetzt muss ich wieder zu Bewerbungsgesprächen gehen, Probearbeiten, Absagen kassieren, noch mehr mit dem Geld rechnen.
»Ich wünsche dir alles Gute, Joe«, sage ich, als ich mich auf den Weg zur Tür mache.
Dir und mir. Wir werden es beide brauchen.
Während ich nach Hause fahre, braucht es meine ganze Willenskraft, um nicht in Tränen auszubrechen. Ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Ich denke an die Broschüren, die Dr. Hamilton mir mit dem Arztbericht zuschicken will. An meine Kontoauszüge und an all die Rechnungen, die sich auf unserem Esstisch stapeln. Keine Ahnung, wie lange ich das noch aussitzen kann. Aber ich habe auch keine andere Lösung.
Mit jeder weiteren Straße wird meine Brust enger. Bis ich um die letzte Kurve biege und nur noch Blaulichter sehe. Als ich realisiere, vor welchem Haus die Einsatzkräfte stehen, setzt mein Atem komplett aus.
Mit schwitzigen Händen halte ich mich am Lenkrad fest, während mein Herz so sehr rast, dass mir kurz schwarz vor Augen wird.
Bitte nicht. Bitte nicht jetzt. Bitte nicht schon wieder.
Die Sekunden, bis ich das Auto parken kann, ziehen sich in die Unendlichkeit. Als es endlich zum Stehen kommt, haste ich ins Freie, lasse den Schlüssel stecken und die Tür offen stehen.
Aufgeregte Leute laufen umher und reden miteinander.
Unsere Nachbarn und Menschen, die ich noch niemals zuvor gesehen habe. In der Dunkelheit sind nur ihre Schemen zu erkennen. Meine wackeligen Schritte bringen mich kaum vorwärts. Es ist wie in diesen Träumen, in denen man einfach nicht vorankommt, egal, was man tut.
»Mrs. Cook! Was ist passiert?« Unsere Nachbarin ist die erste, die ich in der Menschenmenge ausmachen kann. Sie steht in unserem Vorgarten und hält die Hände vor den Mund gepresst. Bevor sie mir antworten kann, kommen zwei Sanitäter mit einer Transporttrage aus dem Haus, auf der Dad liegt.
»Dad!« Ich stürme an Mrs. Cook vorbei und stürze auf die beiden Männer zu, die die Trage zum Krankenwagen schleppen.
»Was ist hier passiert? Was ist los?«
Der Sanitäter, der mir am nächsten steht, bedeutet mir mit einer herrischen Geste, einen Moment zu warten.
Ich stehe da wie erschlagen.
Mein Dad sieht auf der Liege aus, als wäre alles Leben aus ihm gewichen. Seine Lider sind halb geschlossen, die Haut fahl und kränklich.
Ich trete wieder an den Sanitäter heran und fasse an seinen Arm. »Bitte, das da ist mein Dad. Was ist denn passiert?«
»Miss! Warten Sie kurz.«
»Nein, ich …«
Ein weiterer Mann kommt hinzu. »Sind Sie eine Angehörige?«
»Ja, seine Tochter.«
»Dann kommen Sie bitte kurz mit rein, Sie müssen ein paar Unterlagen fürs Krankenhaus ausfüllen.«
»Aber was ist denn passiert?«
»Ihr Vater hatte einen Unfall. Scheinbar hat er versucht, auf dem Gasherd Essen zu erwärmen. Dabei muss ein Teil seiner Kleidung Feuer gefangen haben. Er erinnert sich nicht daran und sagt, dass er hier gar nicht wohnt. Eine Nachbarin hat ihn identifiziert.«
»O Gott.«
Gasherd. Feuer. Unfall.
»Passiert das häufiger?«, fragt der Sanitäter leise, während wir in Richtung Haustür gehen.
»Ja, nein, ich muss … ich muss da hinterher. Ich muss jetzt sofort mit ihm ins Krankenhaus«, stammele ich, doch der Mann legt nur seine kräftige Hand auf meinen Arm.
»Miss Boyd, ja? Atmen Sie durch. Er hat ein Schmerzmittel und etwas zur Beruhigung bekommen. Es geht ihm gut. Wir klären alles hier drinnen und dann können Sie mit mir ins Krankenhaus fahren. Und jetzt fangen Sie bitte noch einmal ganz in Ruhe von vorne an.«
Ich erkläre dem Sanitäter die Lage und hole mir einen tadelnden Blick ab, weil ich Dad allein gelassen habe.
»Miss, wenn es so schlimm ist, dass Ihr Vater nicht einmal mehr die Haushaltsgeräte ordnungsgemäß bedienen kann, dann müssen Sie eine Betreuung für ihn organisieren. Sie können ihn nicht einfach sich selbst überlassen.«
Es klingt so erschreckend danach, als würde ich Dad verwahrlosen lassen. Dabei versuche ich doch alles, damit genau das nicht geschieht.
Am liebsten würde ich mich einfach auf den Boden legen und in Tränen ausbrechen, aber das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Genauso wenig, wie darüber nachzudenken, was dieser Rettungseinsatz mich am Ende kosten wird.
Trotz aller Vorhaltungen macht der Sanitäter sein Wort wahr und fährt mich ins Krankenhaus.
Dad wurde schon versorgt und hat überall am Körper Verbände. Es bricht mir das Herz, ihn so zu sehen.
Ich betrachte ihn durch die Scheibe, bis mir eine Krankenschwester Mut macht, dass ich auch ruhig zu ihm hineingehen darf. Meine Hände sind eiskalt, mein Herz rutscht in Richtung Magengegend und mein schlechtes Gewissen macht mich handlungsunfähig.
Es tut mir so leid, dass alles so furchtbar für ihn ist.
Dass er jetzt Schmerzen hat, weil ich nicht auf ihn aufgepasst habe. Das hat er nicht verdient.
»Hey, Dad. Wie gehts dir?«
»Wer sind Sie?«, fragt er. Seine Augen huschen gehetzt umher. »Wo ist die Lazarettschwester?«
»Dad, ich bin es. Louisa.«
»Ich kenne Sie nicht. Schwester?«
Sofort kommt eine Krankenschwester hinein und eilt an mir vorbei zu seinem Bett. »Was ist denn, Mr. Boyd?«
»Wer ist diese Frau da?«, fragt er abschätzig und deutet mit den Augen auf mich.
»Das ist Ihre Tochter.«
»Nein, ich habe keine Tochter. Was soll das? Glauben Sie, Sie können mich verwirren?«
»Dad?«
Er versucht, sich im Bett aufzurichten und die Schwester klingelt noch eine zweite herbei.
»Mr. Boyd, Sie müssen sich beruhigen. Sie dürfen sich nicht so viel bewegen.«
Doch Dad denkt nicht dran und schreit herum. Die zweite Krankenschwester kommt ins Zimmer geeilt und die erste wendet sich an mich.
»Miss, vielleicht ist es besser, wenn Sie morgen wiederkommen. Rufen Sie doch nachher an, dann informieren wir Sie über seinen Zustand, ja?«
In meinen Augen stehen Tränen, mein Nicken geht im Durcheinander unter. Mit hängenden Schultern wende ich mich ab und verlasse das Krankenzimmer.
Es ist die erste Nacht seit Jahren, in der ich mich in den Schlaf weine. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll und weil ich mich so verdammt alleingelassen fühle, dass ich den Druck in meiner Brust kaum mehr aushalten kann.
Was habe ich nur verbrochen, dass das hier mein Leben ist?
Kapitel 5
Wie ich es drehe und wende, es hilft alles nichts. Ich habe die Broschüren von Dr. Hamilton jetzt das dritte Mal durchgeblättert und heute Nachmittag sogar bei zwei von den Einrichtungen angerufen, doch das Ergebnis war bei beiden ähnlich niederschmetternd. Ich wüsste zu gern, welcher normalsterbliche Mensch sich das leisten kann. Ich jedenfalls nicht.
Und weil das so ist und ich keine Kraft mehr habe, das Unvermeidliche noch länger vor mir herzuschieben, habe ich ein langes Gespräch mit Tizian gehabt. Ich habe ihm von meiner Geldnot erzählt, er hat mir daraufhin ein Angebot gemacht, ich habe zugestimmt.
Ab sofort werde ich im Saints nicht mehr an der Bar stehen, sondern in den Separees arbeiten.
Das, was ich nie wollte, wird jetzt Realität.
Aber was bleibt mir für eine Wahl? So schnell, wie es nötig ist, werde ich niemals einen anderen Job bekommen. Vor allem keinen, bei dem ich annähernd genug verdiene, um auch noch diese horrenden Krankenhausrechnungen zu bezahlen. Also werde ich mich jetzt überwinden und die Zähne zusammenbeißen.
Für Dad. Für die Zukunft. Übergangsweise.
Und es ist nicht so, als hätte ich noch niemals zuvor mit fremden Männern geschlafen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal dafür bezahlen lassen würde.
Es ist nicht für immer. Es macht dich nicht zu einem schlechten Menschen. Es ist ein Job. Nur ein Job.
Noch während ich diese trüben Gedanken von einer Seite zur anderen wälze, wird die Tür zum Aufenthaltsraum des Saints geöffnet.
»Nein, das will ich nicht«, regt sich Beverly auf. »Wirklich. Das war mir zu viel. Warum erlaubst du so was? Ich dachte, dass du dafür da bist, dass keiner Scheiße mit uns abzieht.«
Tizian seufzt, während Beverly an ihm hochsieht. Sie bemerken mich gar nicht.
»Ja was, Tizian? Das war nicht in Ordnung.«
»Das ist mir bewusst. Ich habe es dem Boss berichtet und er wird Maßnahmen einleiten, damit etwas Derartiges nicht noch einmal vorkommt. Aber Beverly, so läuft das nun mal. Krieg dich jetzt wieder ein, ja? Du machst den anderen Mädchen Angst, wenn du in einer Tour darüber redest. Was hast du denn gedacht? Das wird nicht dein letzter merkwürdiger Gast gewesen sein, also gewöhn dich besser daran«, rät er ihr und dreht sich dann in meine Richtung. »Hey, Lou. Alles klar?«
Mehr als ein freudloses Lächeln bekomme ich nicht zustande. Beverly sieht nicht besser aus, während sie sich zu mir an den Tisch setzt. Ihr Ausdruck kocht vor unterschwelliger Wut.
»Also Beverly, alles wieder in Ordnung?« Tizian schaut fragend und übergeht damit Beverlys Augenrollen.
»Ja, Ja. Sicher. Es ist ja immer alles in Ordnung«, zischt sie.
»Gut. Dann bis später, Ladys.«
Damit macht er sich aus dem Staub. Als die Tür ins Schloss fällt, weicht mit einem Schlag alle Körperspannung aus Beverly.
»Komischer Gast, oder was?«
»Ja.«
»Was war mit dem?«
Sie lehnt statt einer Antwort den Kopf nach hinten und entblößt ihren Hals. Trotz der sommerlichen Bräune heben sich dunkle Flecken auf der feinen Haut ab.
»Gott, das sieht ja furchtbar aus.«
»Hm. Und hier … und hier …« Sie zieht ihren Ärmel ein bisschen hoch und danach den Saum ihres Shirts.