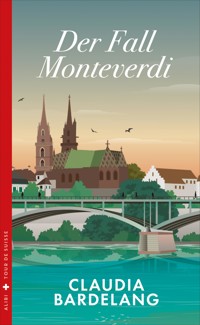Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Lorenzo Riani
- Sprache: Deutsch
Unweit einer Florentiner Polizeibehörde detoniert eine Bombe. Durch die Explosion kommt Signora Ludovica Buonarroti ums Leben, eine gut betuchte Dame mit sagenhafter Kunstsammlung. Der Sprengsatz war in einem Paket versteckt, das an Buonarrotis Nachbarn adressiert war. Alessandro Filipepi ist ein alleinstehender, exzentrischer Millionenerbe. Und er schwebt weiterhin in höchster Gefahr. Denn Commissario Lorenzo Riani und sein Kollege Ispettore Torrini befürchten, dass der Attentäter sein Werk nicht unvollendet lassen wird …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudia Bardelang
Falscher Erbe
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Narvikk / istockphoto.com
ISBN 978-3-7349-3060-7
Widmung
Für meine Eltern
1
Er beendete seine ausführliche Rasur und tupfte das Gesicht sorgfältig mit einem kleinen Handtuch ab, das er von dem Stapel auf der Ablage nahm und anschließend in den Wäschekorb warf. Prüfend wanderte sein Blick über sein Spiegelbild. Er blickte ausdruckslos in seine braunen Augen. Langsam fuhr er mit dem Mittelfinger die dunklen Augenschatten nach, reckte das Kinn und betrachtete lange von beiden Seiten sein Gesicht. Der Warmwasserboiler sprang an und unterbrach seine versonnenen Betrachtungen. Entschlossen griff er nach dem Rasierwasser, tätschelte es großzügig auf die Wangen – ein weiteres Handtuch flog in den Wäschekorb –, dann zog er seine Krawatte fest und ging in die Küche, wo er wie jeden Morgen seinen Espresso zubereitete. Das Gas fauchte, der Anzünder schnippte trocken, und kurz darauf überlagerte der Kaffeeduft den Geruch von Gas und Feuerstein. Er goss den Espresso in eine Mokkatasse, rührte mit kalten Fingern einen Löffel Zucker dazu und stellte sich an das geschlossene Fenster. Noch konnte er alles abbrechen. Es lag allein an ihm. Was, wenn er es darauf ankommen ließe? Im selben Moment schrillte die Türglocke und er zuckte erschrocken zusammen. Mit bebenden Händen stellte er das Tässchen ab, ging lautlos zur Wohnungstür und lauschte. Abbrechen oder nicht? Nach schier endlosem Zögern ergriff er schließlich mit zittrigen und schweißnassen Händen das Telefon und drückte entschlossen auf Wahlwiederholung.
2
Wenige Straßenzüge weiter stand auch Commissario Lorenzo Riani vor dem Badezimmerspiegel und betrachtete resigniert sein müdes Gesicht. Die stoppeligen schlaffen Wangen, die dunklen Augenringe, das wirre grau melierte Haar. Seufzend griff er zum Rasierer und beseitigte den dreitägigen Wildwuchs. Anschließend verteilte er reichlich sein neues Rasierwasser, bürstete das widerspenstige Drahthaar, zog die Krawatte fest und schlurfte schwerfällig in die Küche, wo es schon nach Kaffee duftete. Seine Frau saß am Tisch, schenkte gerade den Espresso in die Tassen und rührte in seine zwei Löffel Zucker hinein. Er bemerkte, dass sie schon fertig angezogen war, und sein Blick fiel auf die große Tüte aus der Pasticceria um die Ecke. Nur mit Mühe unterdrückte er seinen Fluchtreflex und setzte sich.
»Du warst schon weg?«
»Ich konnte nicht mehr schlafen …«
Nach der gestrigen Eröffnung seiner Frau und der anschließenden emotionalen, endlosen und dennoch ergebnislosen Diskussion hatte er die ganze Nacht kein Auge zugetan, aber nach dem Anruf ihrer jüngsten Tochter, heute früh, kurz vor sechs, musste er wohl eingenickt sein, denn er hatte nicht gehört, dass seine Frau das Haus verlassen hatte. Schweigend griff er nach einer Brioche, obwohl sein Magen wie zugeschnürt war. Seine Frau blätterte in der Zeitung. Alles schien wie immer, aber er war auf der Hut. Bloß keine Fortsetzung jetzt! Er brauchte dringend Zeit zum Nachdenken. Viel zu schnell kippte er den heißen Kaffee hinunter, und kaum hatte er den letzten Bissen im Mund, brummte er eine Entschuldigung, küsste seine Frau flüchtig aufs Haar und verließ eilig das Haus. Draußen auf der Straße hielt er inne und rieb sich stöhnend den schmerzenden Magen. Das hastig verschlungene Hörnchen und der zu heiße Kaffee ließen sein Sodbrennen heiß aufflammen. Oh Gott! Tief durchatmend reckte er sich vorsichtig. Überall tat es weh! Sein Ischias strahlte seit vorgestern schmerzhaft ins linke Bein, und sein Nacken war verspannt wie seit Monaten nicht mehr. Er war erst Anfang fünfzig, aber momentan fühlte er sich wie hundert. Wie zum Teufel sollte er in diesem Zustand noch einmal Vater werden? Wenn das Kind in die Schule käme, würde er mit einem Rollator dabei sein.
Mit Riesenschritten stürmte er die Viale Spartaco Lavagnini entlang, während der kalte Novemberregen unangenehm in seinen Kragen fiel und seine Hosenbeine bereits nach den ersten hundert Metern bis auf Knöchelhöhe durchnässt waren. Wie hatte das nur passieren können? Er könnte bereits Großvater sein! Er war mit großer Hingabe Vater und er liebte seine drei Töchter – aber jetzt noch einmal ein Kind? Jetzt, wo die Jüngste gerade ihre Maturità abgelegt hatte? Riani, der gemütliche, der unerschütterliche und meist gut gelaunte Fels in der Brandung, fühlte sich mit einem Mal hilflos und schwach, weil er ahnte, dass er dieses Mal kein Mitspracherecht hatte. Dass seine Frau bereits wusste, was sie tun würde. Zwar hatte sie ihm gesagt, dass sie keine Entscheidung, welche auch immer, ohne ihn treffen würde, aber er wurde das unangenehme Gefühl nicht los, dass sie bereits entschlossen war, dieses Kind zu bekommen. Außerdem hatte er tatsächlich wenige Gegenargumente. Als gläubiger Christ konnte er gar keine haben! Grimmig rannte er bei Rot über die Ampel und bog kurz darauf in die Via Cavour ein. Glücklicherweise hatte er zurzeit keine laufende Ermittlung, und so könnte er es die nächsten Tage etwas ruhiger angehen lassen. Vielleicht sollte er seinen Chef um ein paar freie Tage bitten, obwohl er wegen Allerheiligen gestern gerade einen freien Montag und somit ein verlängertes Wochenende gehabt hatte. Er musste dringend in Ruhe nachdenken. Vielleicht könnte er ein paar Tage wandern gehen. Mit wehendem Mantel rauschte er zehn Minuten später um die Ecke zur Questura. Hundert Meter weiter vorn, an der zweiten Querstraße, standen ein Krankenwagen und ein halbes Dutzend Feuerwehrwagen mit blinkendem Blaulicht.
»Was ist passiert?«
»Eine Gasexplosion.«
Knapp in Richtung Pforte grüßend, eilte er die Treppe hinauf, direkt zum Büro des Questore, wo im selben Moment neues Ungemach in Gestalt der ewig säuerlichen Sekretärin dräute, die eben das Vorzimmer ihres Chefs verließ. Riani stöhnte innerlich auf, aber er konnte nicht mehr zurück, da sie ihn schon gesehen hatte.
»Ah, Commissario! Da kommen Sie ja endlich. Der Questore möchte Sie sehen.«
Riani ließ diese Dreistigkeit stoisch über sich ergehen und setzte ein mechanisches Lächeln auf. Irgendwann würde er ihr den faltigen Hals umdrehen. »Auch Ihnen einen wunderschönen guten Morgen, Signora Marta, ich bin gerade auf dem Weg zu ihm …«
Es sollte noch schlimmer kommen. Der Questore empfing ihn bereits an der Tür, mit einem entschuldigenden Lächeln, was nichts Gutes verhieß.
»Commissario Riani! Buongiorno! Si accomodi! Treten Sie näher.«
Sein Vorgesetzter, der Polizeipräsident von Florenz, war ein umgänglicher Chef, stets freundlich und verbindlich, für seine Mitarbeiter jedoch mit Vorsicht zu genießen. Wenig entschlussfreudig und stets darauf bedacht, es allen recht zu machen, besonders so kurz vor seiner Pensionierung, ließ er Commissario Riani und seinen Kollegen zwar einen verhältnismäßig großen Handlungsspielraum, nötigte ihnen aber nicht selten Verpflichtungen ab, die nicht wirklich in ihren Aufgabenbereich fielen. Commissario Riani hatte richtig vermutet. Der Questore war nicht allein. Als er eintrat, erhob sich ein Besucher aus dem Sessel und streckte ihm breit grinsend seine Hand entgegen, der andere blieb sitzen und nickte ihm nur zu.
»Commissario Riani, darf ich vorstellen, Ian McNair, Reporter bei der BBC London …« Er machte eine kurze Pause, um seinem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, diesen Tatbestand entsprechend zu würdigen, bevor er fortfuhr: »Er ist hier in Florenz, um Sie zwei Wochen lang auf Ihren Ermittlungen zu begleiten … Das hier ist Robert Harris, sein Kameramann.«
War das nicht schön, ergänzte Riani in Gedanken und verzog keine Miene. Was zur Hölle sollte das bedeuten? Er warf den Männern einen ungeduldigen Blick zu und unterbrach seinen Chef, bevor dieser seine Vorstellung fortführen konnte: »Signor Questore … dürfte ich Sie kurz unter vier Augen sprechen?«, und als er dessen Widerstand bemerkte, setzte er nach: »Jetzt gleich … bitte!«
»Sicher … Äh … Kommen Sie … Äh, Signori, would you please excuse us for an instant?«
Sein Englisch war gar nicht übel, wie Riani missgünstig feststellte. Er lotste ihn auf den Gang, vorbei an den gespitzten Ohren von Signora Marta. »Signor Questore, bei allem Respekt, ich kann mich um diese Leute nicht kümmern … Ich muss unbedingt ein paar Tage freinehmen.«
»Freinehmen? Ausgeschlossen! Dieser Mann ist Ian McNair. Der Reporter bei der BBC! Wenn er unsere Stadt beehrt, können wir ihm diesen Wunsch unmöglich abschlagen.«
»Signor Questore … Per cortesia … Ich bitte Sie … Es ist ungeheuer wichtig!«
»Was ist denn wichtiger als das?«
Das würde er ihm ganz bestimmt nicht auf die Nase binden. Riani fühlte ungeahnten Widerstand in sich aufkeimen: »Er kann doch mit Commissario Mauro gehen. Ich sehe nicht, wo da ein Problem sein sollte. Großer Gott!«, ergänzte er genervt: »Mit Kameramann.«
Der Questore wand sich wie ein Wurm: »Senta, hören Sie … Genau das geht nicht … Er hat ausdrücklich nach Ihnen verlangt …«
»Nach mir? Wieso nach mir? Wie zum …«
»Commissario …«, bat der Questore beschwörend: »Ich versichere Ihnen, dass ich Ihrem Antrag auf Urlaub unter anderen Umständen liebend gerne stattgeben würde … aber …«
»Aber was …?«
»Aber die BBC …« Er sprach das aus, als handelte es sich um den Heiligen Stuhl persönlich: »Das heißt Signor McNair, hat ausdrücklich nach Ihnen verlangt, und wir können diesen Mann doch jetzt unmöglich …«
»Ach, ist es wegen der Sache mit dem amerikanischen Studenten?«
Vor etwa drei Jahren war ein amerikanischer Student von einem wütenden Anwohner mit einem Jagdgewehr erschossen worden, als dieser, sturzbetrunken, zum wiederholten Mal in dessen Garten urinierte. Das Problem der dauerbetrunkenen, lärmenden, an die Hausecken und in die Gärten kotzenden und pinkelnden Studenten war in Florenz das heiße Eisen schlechthin. Und ein Problem, das sich kaum lösen ließ. Florenz lebte von den Besuchern aus aller Welt, aber es war nicht zu leugnen, dass besonders die Austauschstudenten, und vor allem die amerikanischen Austauschstudenten, für manchen Einheimischen zur unerträglichen Belastung geworden waren. Die Florentiner, ohnehin im jahrhundertealten Ruf, etwas speziell zu sein, hatten damals beängstigend offene Sympathien für den Mörder gehegt – überwiegend natürlich die Anwohner der dauerbelasteten Straßenzüge. Riani hatte seinerzeit mit viel Fingerspitzengefühl die binational hochkochenden Emotionen beschwichtigen können und war für kurze Zeit zu einer lokalen Berühmtheit geworden. Vielleicht hatte ihn der Reporter aus diesem Grund angefragt. Mannaggia! So ein Mist! Sauer blickte er auf seinen Vorgesetzten herunter. Der Questore, der die Kapitulation seines Untergebenen schon spürte, schlug einen beschwichtigenden Ton an: »Commissario, Sie sind für die ein Held. Verstehen Sie doch bitte, dass ich der BBC den Wunsch unmöglich abschlagen kann … zumal der Antrag bereits vor einem Jahr gestellt worden und von mir bewilligt worden ist …«
»Vor einem Jahr?«, unterbrach ihn Riani gereizt: »Und wann genau hatten Sie die Güte, mich davon in Kenntnis zu setzen?«
»Nun … Ähm … Das tue ich doch gerade, nicht?«
Riani hätte ihn schütteln können. Das war so typisch. Coniglio! Dieser … Angsthase hatte genau gewusst, dass er es sich ausdrücklich verbitten würde, einen Mühlstein in Gestalt eines Reporters am Hals zu haben. Geschweige denn zwei! Also konfrontierte er ihn einfach mit den vollendeten Tatsachen. Stöhnend rieb er sich die Stirn und sah auf seinen sichtlich zerknirschten Chef hinunter: »Ihr letztes Wort?«
»Mi dispiace tanto … Es tut mir sehr leid … Ja … Es ist ja nur für zwei Wochen. Außerdem sagte mir Signora Marta, dass derzeit ohnehin nichts Wichtiges anliegt …«
Aha. Signora Marta Hari also, dachte Riani böse, aber er gab sich geschlagen. Es war, als würde man gegen eine Gummiwand anrennen. Zwecklos. »Va bene …«, seufzte er ergeben: »Dann gehen wir wieder hinein und bringen es hinter uns …«
Leutselig klopfte ihm der Questore auf die Schulter: »Sie werden es nicht bereuen, Commissario …«
Riani musterte McNair argwöhnisch, er konnte und wollte ihn vom ersten Moment an nicht ausstehen. Der Brite war etwa Mitte dreißig, sehr groß, größer als er selbst und ziemlich gut aussehend. Genau genommen ausgesprochen gut aussehend, smart und überflüssigerweise sichtlich gut in Form. Riani zog unwillkürlich seinen Bauch ein. Wenn der Kerl nicht aufhörte, ihn dauernd anzugrinsen, brauchte er eine Sonnenbrille, dachte er bissig und drückte unwillig die dargebotene Hand. Der Kameramann war das genaue Gegenteil, was ihm, in des Commissarios Augen, klare Sympathiepunkte einbrachte. Typ Computerfreak, blass, leicht übergewichtig, mit zu langen Haaren und scheußlicher Brille. Ian McNair sprach ziemlich gut Italienisch, was Riani zusätzlich verbitterte, da sein Englisch über rudimentäre Grundkenntnisse nie hinausgelangt war. Nun gut. Auch diese Prüfung würde irgendwann vorbei sein. Ruppig bat er seine Gäste, ihm in sein Büro zu folgen, als sein Telefon klingelte.
»Pronto?«
Aus den Augenwinkeln sah er innerlich aufstöhnend, dass sein Anhängsel einen kleinen schwarzen Block zückte und der Kameramann die Kamera schulterte.
»Wo? Das ist doch gleich hier vorne. Arrivo subito, ich komme sofort!« Er klappte sein Telefon zu und eilte zur Treppe, ohne sich darum zu kümmern, ob ihm die Männer folgten. Vor dem Portal lenkte er seine Schritte nach links, wo die Feuerwehrautos bereits eines nach dem anderen abzogen. Riani kannte das Haus. Es war eines der ältesten Gebäude in der Straße. Ein Renaissance-Palazzo mit typischem Bossenwerk im Erdgeschoss und einem weit auskragenden Kranzgesims. Rechts und links des massiven, mit großen Nieten beschlagenen Portone waren schwere Eisenringe im Mauerwerk eingelassen, an denen früher die Pferde angebunden worden waren. Die Squadra Mobile und die Scientifica waren bereits vor Ort, und er musste nur den hin und her eilenden Beamten folgen. Der Geruch war extrem unangenehm. Riani stieg trocken schluckend das steinerne Treppenhaus ins zweite Obergeschoss hoch. Die Wohnungstür stand weit offen. Er trat ein und grüßte seine Kollegen. Voll kindischem Trotz ignorierte er die neugierigen Blicke auf seine Begleiter und wandte sich direkt an den Einsatzleiter der Squadra Mobile.
»Buongiorno Ispettore. Was liegt an?«
Der Beamte musterte interessiert die beiden Männer, und erst als er Rianis ungehaltenen Ausdruck bemerkte, beeilte er sich zu antworten: »Eine tote Frau. Höchstwahrscheinlich Signora Buonarroti. Maria Ludovica Buonarroti, zweiundsiebzig …« Er zeigte in die Diele der großen Wohnung, wo ein Körper unter einem weißen Tuch verborgen lag. Riani trat heran. Der Medico Legale erhob sich gerade, hielt dem Commissario den Ellenbogen zur Begrüßung hin und fragte: »Wollen Sie sie sehen?« Auch er betrachtete aufmerksam die beiden Fremden, aber Riani winkte mit einer Handbewegung ungeduldig ab.
»Cosa sappiamo? Was wissen wir?«
»Nun … Sie wurde höchstwahrscheinlich durch einen Sprengsatz getötet, den sie in ihrer Hand gehalten haben muss …« Der Mann zog seine Handschuhe aus und gab seinen Männern ein Zeichen, dass die Leiche weggebracht werden konnte. »Sie war sofort tot. Der Hund hat überlebt.«
»Der Hund?«
»Ja, ein kleiner Zwergspitz. Die Feuerwehr hat ihn mitgenommen.«
»Hm …« Riani sah sich überrascht um. Die Wohnung war wie eine Schatzkammer aus längst vergangenen Zeiten. Er ließ den Rechtsmediziner stehen und ging langsam von Raum zu Raum. So etwas hatte er außerhalb eines Museums noch nie gesehen. Die hohen hölzernen Deckenbalken waren kunstfertig geschnitzt und vergoldet, die Wände mit dunkelroter Seide bespannt und über und über mit Gemälden in vergoldeten Rahmen behängt. Landschaftsbilder, Porträts und Madonnen, so, wie es aussah, ausschließlich aus Renaissance und Barock. Wie in der Galleria Palatina im Palazzo Pitti, dachte er bewundernd. Sein Blick fiel auf ein Marientondo. Du meine Güte! Wenn das echt war, wenn das alles hier echt war, waren sie von einem Vermögen umgeben. Die zierlichen, etwas abgenutzten Möbel mit den verschossenen Seidenbezügen standen auf kostbaren Teppichen, die das Intarsienparkett fast durchgängig bedeckten. Auf allen Tischchen und Kommoden fanden sich unzählige gerahmte Schwarz-Weiß-Fotos.
Riani trat näher: »Ist sie das?«
Die Mitarbeiter zuckten mit den Schultern. Ausschließlich alte Aufnahmen aus den Fünfzigern oder Sechzigern. Wenn es denn Signora Buonarroti war, auf allen diesen Fotos, war sie eine ausgesprochene Schönheit gewesen. Typ Silvana Mangano. Riani wanderte staunend die kleine Galerie ab. Signora Buonarroti in Abendrobe, vermutlich am Arm ihres Gatten, mit verschiedenen Staatsoberhäuptern und Prominenten. Cavolo. Da war sie mit Henry Kissinger. Und hier mit Sofia Loren und Carlo Ponti. Hier mit Renata Tebaldi, auf einem anderen mit Maria Callas und Aristoteles Onassis. Riani schüttelte ungläubig den Kopf. Accidenti! Er wandte sich zu dem Beamten um, der ihnen gefolgt war: »Hat die Signora hier alleine gelebt? Gibt es einen Ehemann? Kinder?«
»Das wissen wir noch nicht, tut mir leid …«
»Gut …« Riani betrachtete die Mitarbeiter der Spurensicherung, die überall Fingerabdrücke nahmen: »Seien Sie bitte vorsichtig.« Dann wandte er sich wieder an seinen Kollegen: »Wer hat die Explosion gemeldet?«
»Der Briefträger und ein gewisser Alessandro Filipepi. Er wohnt im Stockwerk darunter. Wenn Sie mit ihm sprechen wollen. Ich habe ihn gebeten, sich zur Verfügung zu halten.«
»Va bene.« Und nach einem Blick in die Runde: »Ich werde dann mal hinuntergehen und ein paar Worte mit dem Nachbarn wechseln. Wir sehen uns später auf der Questura.«
Mit den beiden Engländern im Schlepptau, die er noch immer ignorierte, klingelte er bei Filipepi. Ein blasser junger Mann öffnete die Tür: »Sì?«
Riani zückte seinen Ausweis: »Commissario Riani. Signor Filipepi?«
»Sì, sono io …«
»Kann ich Sie einen Augenblick sprechen?«
»Certo«, erwiderte der Mann zögerlich, warf einen misstrauischen Blick auf die Männer mit der Kamera und hob abwehrend die Hand: »Aber diese beiden nicht.«
Riani wandte sich um. »Sie haben es gehört, meine Herren, tut mir leid.«
McNair nickte widerstrebend, und Harris ließ die Kamera sinken. »Well, you’re the boss …«
Filipepi stand noch immer in der Tür. »Geht es um die Gasexplosion? Ich weiß nichts. Ich habe nur die Feuerwehr gerufen … Wie geht es Signora Buonarroti? Ist sie verletzt?«
Riani ignorierte die Frage: »Darf ich einen Augenblick hereinkommen?« Die Frage ließ keine Widerrede zu, und widerstrebend trat Filipepi zur Seite, um Riani hineinzulassen.
»Accidenti!« Riani war verblüfft. Hier sah es fast haargenau so aus wie ein Stockwerk obendrüber. »Leben Sie hier alleine?«, fragte er und ging einfach voraus. Dieselben geschnitzten Decken, dasselbe Intarsienparkett, nur hier ohne Teppiche, dieselben seidenbespannten Wände, nur in dieser Wohnung waren sie in jedem Raum anders: golden, dunkelgrün und altrosa. Die Wände waren auch hier über und über mit Gemälden behängt. Und auch hier standen Dutzende von Fotos herum. Riani war überhaupt nicht bewusst, dass er soeben in eklatanter Weise seine Befugnisse überschritt. Neugierig ging er hin und her und betrachtete die Bilder. Auch diese hier waren fast ausschließlich älteren Datums, der Mode nach aus den Neunzigern, aber auf diesen war überwiegend ein hübscher kleiner Junge zu sehen. Häufig in Begleitung einer schönen jungen Frau und eines attraktiven, grau melierten Herrn. Mal saß das Kind auf einem Pony, mal in einem Spielzeugauto, eines zeigte es auf dem Schoß einer dunkelhäutigen Nanny, ein anderes auf einem Bärenfell. Die kleine Familie posierte auf einer Jacht, in einem exotischen Garten, auf der Veranda eines großen Hauses im Kolonialstil und in einem italienischen Sportwagen. »Sind Sie das? Und Ihre Eltern?«
Der junge Mann wirkte, als würde er jeden Moment einen Schwächeanfall erleiden.
»Ist Ihnen nicht gut? Sollen wir uns irgendwo setzen?« Riani sah sich um. Die zierlichen Sessel schienen ihm ungeeignet.
»Gehen wir doch in die Küche …« Er folgte dem Hausherrn in die Küche, wo dieser ein Glas Wasser trank und wieder etwas Farbe bekam.
»Setzen Sie sich doch«, forderte der Commissario den jungen Mann auf. »Ich bin sofort wieder weg. Ich möchte Ihnen lediglich ein paar Fragen zu Ihrer Nachbarin stellen.« Als sein Gegenüber nickte, fuhr er fort. »In welchem Verhältnis standen Sie zu Signora Buonarroti? Sind Sie verwandt?«, fragte Riani im Hinblick auf die auffallend ähnlichen Wohnungen.
»Oh nein! Ganz und gar nicht. Wir sind nur Nachbarn.«
»Wie war Ihr nachbarschaftliches Verhältnis?«
»Gut. Das heißt … Nein. Gut wäre wohl etwas übertrieben. Ich habe manchmal ihren Hund ausgeführt oder ein paar Besorgungen für sie gemacht … Sie sagten waren … Ist Sie …?«
»Ja. Es tut mir leid. Sie ist tot.«
Filipepi seufzte tief auf.
»Leben Sie hier alleine?«, fragte Riani noch einmal und machte eine ausholende Armbewegung. »Ich muss sagen, dass das nicht gerade die Wohnung ist, die ich bei einem Mann Ihres Alters vermuten würde.«
»Meine Mutter ist vor einem Jahr gestorben …«
»Und Sie haben das alles hier geerbt?«
»Ja.«
»Sind Sie der einzige Erbe?«
»Ja.«
»Sind Sie nach dem Tod Ihrer Mutter wieder hierhergezogen?«
»Nein. Ich habe immer hier gelebt.«
»Und Ihr Vater? Verzeihen Sie meine Neugier.«
Die Miene seines Gegenübers verdüsterte sich nur einen Augenblick: »Mein Vater ist schon lange tot.«
»Hm.« Riani sah sich in der Küche um und blickte durch die hohen Fenster in den Garten. »Hatte Signora Buonarroti Kinder?«, fragte er unvermittelt.
»Ja. Einen Sohn. Pierfrancesco. Er wohnt nicht hier.«
»Wissen Sie, ob sich die beiden gut verstanden haben?«
»Das kann ich nicht beurteilen. Ich hatte, wie schon gesagt, nicht allzu viel Kontakt, und über private Dinge haben wir überhaupt nie gesprochen. Die Signora lebte sehr zurückgezogen.«
»Hm … Können Sie sich vorstellen, dass Signora Buonarroti Feinde hatte?«
»Feinde? Wieso fragen Sie das?«
»Nun, sie wurde durch einen Sprengsatz getötet.«
»Ein Sprengsatz? Großer Gott! Ich dachte, es handle sich um eine Gasexplosion.«
»Ja, eine Bombe«, antwortete Riani knapp. »Ist Ihnen heute Morgen etwas Besonderes aufgefallen? Haben Sie etwas gehört? Also bevor Sie die Detonation hörten. Irgendjemand im Haus vielleicht?«
»Nein.«
»Was haben Sie heute Morgen gemacht? Wann sind Sie aufgestanden?«
»Äh …« Filipepi räusperte sich. »Ich bin um halb acht aufgestanden.«
»Und dann?«
»Ich habe mir einen Caffè gemacht, wie jeden Morgen. Und dann habe ich die Explosion gehört und sofort den Notruf gewählt.«
»Konnten Sie hören, woher die Explosion kam?«
»Ja. Ich wusste sofort, dass es über mir, bei Signora Buonarroti war.«
»Sind Sie nach oben gegangen, um zu sehen, was passiert ist?«
»Großer Gott, nein! Das schien mir zu gefährlich zu sein.«
Riani nickte. »Stehen Sie immer um halb acht auf? Mit was verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt, Signor Filipepi, wenn ich fragen darf? Aus reiner Neugier.«
»Ich arbeite die halbe Woche in der Galleria Palatina im Palazzo Pitti, als Custode, und den Rest der Zeit sitze ich an meiner Dissertation.« Auf den fragenden Blick des Commissario ergänzte er: »Ich habe Kunstgeschichte studiert und forsche über Sandro Botticelli.«
»Aha … Und davon können Sie leben?«
»Wovon?«
»Von Ihrem Teilzeitjob im Museum.«
»Natürlich nicht. Meine Mutter hat mir nicht nur diese Wohnung, sondern auch etwas Geld hinterlassen … Ich komme zurecht.«
Riani wechselte das Thema. »Sagen Sie, wer wohnt denn im Erdgeschoss? Ich habe keinen Namen am Klingelschild gefunden.«
»Niemand. Dort waren einst Büroräume für Pierfrancesco vorgesehen, aber sie stehen schon immer leer.«
Der Commissario hatte genug gehört und erhob sich. »Signor Filipepi, ich danke Ihnen.« Als er schon in der Tür war, fiel ihm noch etwas ein. »Sie haben nicht zufällig die Adresse von Pierfrancesco?«
3
Drei Stunden später sah Commissario Riani etwas klarer. Der Magistrato hatte ihm Ispettore Torrini und die beiden Agenti Rocca und Fabbri zugeteilt, und so hatte er bereits am Vormittag die ersten Aufträge vergeben können. Jetzt saß die kleine Ermittlungstruppe in Rianis Büro und wartete auf Ian McNair und seinen Kameramann, die noch eine Unterredung mit dem Questore hatten. Riani saß hinter seinem Schreibtisch, drehte sich in seinem Bürostuhl hin und her, spielte mit seinem Stift und scherzte mit seinen Mitarbeitern. Als McNair und Harris hereinkamen, wurden alle ernst, und Riani beugte sich vor. »Allora, comminciamo. Ispettore, wollen Sie beginnen?«
Der Angesprochene straffte sich: »Va bene. Bei der Toten handelt es sich um Signora Maria Ludovica Buonarroti, verwitwete Della Valle, Tochter von Conte Ludovico Buonarroti und seiner Gattin Mariateresa Fucini. Sie ist zweiundsiebzig Jahre alt geworden, hat mit neunzehn den jungen Diplomanten Walter Della Valle geheiratet, ein Conte aus sehr altem Adel. Die beiden hatten zwei Kinder. Eine Tochter namens Teresa und einen Sohn namens Pierfrancesco. Die Tochter starb im Alter von zwölf Jahren an einer Blutvergiftung in Mexiko-Stadt, der Sohn war damals zwei und ist heute zweiundvierzig. Die Familie ist weit herumgekommen. Sie haben unter anderem in Mexiko-Stadt, Riad, Washington und Mumbai gelebt. Im Jahr achtundachtzig starb der Conte in London, und Signora Buonarroti kehrte nach Florenz zurück.«
»Und der Sohn?«, fragte Riani dazwischen.
»Pierfrancesco studierte Wirtschaftswissenschaften in Washington, arbeitete eine Zeit lang bei der UNO als Berater und wechselte dann zu einer internationalen Bank in Hongkong. Im Jahr zweitausendzehn kehrte er nach Italien zurück, wo er als Banker in Rom arbeitete, bevor er vor drei Jahren freigestellt wurde …«
»Freigestellt? Warum?«
Ispettore Torrini sah seinen Vorgesetzten an. »Mi dispiace, das konnte ich bisher noch nicht in Erfahrung bringen.«
»Gut, macht nichts. Machen Sie weiter.«
»Nun, viel gibt es nicht mehr …«
»Haben Sie etwas über das Verhältnis von Mutter und Sohn erfahren können?« Riani dachte an die vielen Fotos, auf denen fast ausschließlich die Eheleute Buonarroti-Della Valle abgebildet waren. Keines hatte den Sohn gezeigt, wenn er sich richtig erinnerte.
Torrini grinste. »Ich habe ein bisschen mit der Zugehfrau geplaudert.«
»Torrini, per cortesia«, mahnte Riani rasch. Er kannte die charmanten Verhörmethoden seines Ispettore nur zu genau, und er wollte auf gar keinen Fall, dass seine ungebetenen Zuhörer falsche Schlüsse über die hiesige Polizeiarbeit zogen. Harris bannte die ganze Sitzung immerhin auf Film, und wer weiß, wer den alles zu sehen bekam.
»Va bene, Commissario.« Der Beamte wurde augenblicklich wieder ernst. »Also, Signorina Rina sagte mir, dass Pierfrancesco nie da war. Also ich glaube, dass sich die beiden … ich meine Mutter und Sohn … nicht wirklich gut verstanden haben.«
»Aha«, sagte Riani. »Warum? Gibt es dafür einen Grund? Erwähnte sie etwas Konkretes?« Er dachte an die fehlenden Fotos des Sohnes, dennoch fragte er: »Irgendein Vorfall, ein Streit in letzter Zeit?«
»Nein. Leider. Sie sagte nur, dass er nie da war.«
»Ach so.« Riani musste ein Lächeln unterdrücken. Torrini, das Lämmchen. Ganz der brave Sohn, telefonierte er mindestens einmal am Tag mit seiner Mamma, und allein deshalb ließ ihn ein nicht ganz so fürsorglicher Sohn fast automatisch an ein schlechtes Mutter-Sohn-Verhältnis denken.
»Und woher wusste sie dann, dass sich die beiden nicht verstanden? Hat ihr Signora Buonarroti etwas in der Richtung erzählt?«, erkundigte er sich grinsend.
»Nein, Commissario. So vertraut waren die beiden nicht. Sie sagte, dass die Signora sehr verschlossen gewesen sei.«
»Ich verstehe. Wie häufig ist sie denn im Haus, die Signorina Rina?«
»Nun, sie ist jeden Tag von zehn bis achtzehn Uhr da … Äh, Montag bis Freitag.« Ispettore Torrini bemerkte die Schwachstelle augenblicklich und verstummte kleinlaut.
»Dann hätte sie den Sohn also gar nicht sehen können, wenn er danach oder gar am Wochenende gekommen wäre. Hatte die alte Dame Freunde? Bekam sie ab und zu Besuch?«
»Nein. Nicht so weit Signorina Rina es mitbekam«, antwortete der Mann leicht errötend.
»Irgendwelche Feinde? Menschen, die der Signora Böses wollten? Soweit es die junge Signorina mitbekommen hat, natürlich«, foppte ihn Riani gutmütig.
»Nein, Commissario. Nichts. Wie schon gesagt, die alte Dame lebte offensichtlich sehr zurückgezogen.«
»Na gut. Haben Sie die Adresse des Sohnes?«
»Sì, Commissario.« Torrini erhob sich und reichte Riani einen Notizzettel.
Riani nahm ihn in Empfang und legte ihn nachdenklich auf die Seite. Sein Ispettore lag möglicherweise gar nicht so falsch mit seiner Schlussfolgerung. Er sah wieder auf. »Vielen Dank, Torrini. Agente Fabbri, was haben wir über die Finanzen der Toten?«
Der junge Mann klappte eifrig seine Mappe auf, als hätte er schon ungeduldig auf diesen Augenblick gewartet: »Also, um es kurz zu machen: Die alte Dame war steinreich«, verkündete er, ehrfürchtig jede Silbe betonend.
»Steinreich?« Riani zog belustigt die Augenbrauen hoch. »Können Sie das ein bisschen präzisieren?«
»Also Commissario, wirklich steinreich! Also …« In dem Moment bemerkte er seine lachenden Kollegen und räusperte sich. »Also, sie hat auf diversen Konten über zwanzig Millionen Euro liegen. Zwanzig Millionen! Wissen Sie, wie viele Nullen das sind? Und dazu etliche Immobilien. Allein der Palazzo hier ist rund fünf Millionen wert. Andere Immobilien gibt es unter anderem in Genf, auf den Bahamas, in Wien und in London.«
Riani war beeindruckt. Und wenn man die Kunstwerke und Antiquitäten in der Wohnung mitzählte … Nicht schlecht. Es gab entschieden weniger interessante Mordmotive. »Wer erbt das alles?«
»Der Sohn.«
»Der Sohn also. Haben Sie ihn eigentlich erreicht?«, fragte Riani seinen Ispettore.
»Nein, leider nicht, aber ich habe jemanden dort gelassen. Er behält das Haus im Auge.«
»Gut.« Riani nickte nachdenklich. »Das ist wirklich interessant. Und was sagen die Nachbarn? Gibt es irgendwelche Zeugen?« Er ließ versehentlich seinen Stift fallen und bückte sich ächzend. Als er wieder auftauchte, kam ihm ein Gedanke: »Hat eigentlich schon jemand mit dem Briefträger gesprochen? Der hat doch ebenfalls den Notruf getätigt. Der könnte etwas gesehen haben.«
Rocca schüttelte den Kopf. »Der Briefträger hat unmittelbar nach Alessandro Filipepi den Notruf gewählt, aber er war bisher nicht aufzutreiben. Vielleicht ist sein Akku leer? Spätestens nach Schichtende um vier werde ich ihn hierherbringen. Was die Nachbarn angeht, gibt es nichts wirklich Erhellendes. Die Signora war allen vom Sehen bekannt, aber niemand sprach je ein Wort mit ihr. Man grüßte sich verhalten, e basta. Sie bestellte ihre Einkäufe telefonisch und ließ sie liefern. Und nein, es ist nicht, wie ihr vielleicht denkt, sie gab immer ein üppiges Trinkgeld«, beantwortete er die unausgesprochene Frage seiner Kollegen. »Die Botenjungen gingen immer gerne zu ihr.«
»Hat sie manchmal einen von ihnen hereingebeten?«, fragte Riani dazwischen.
»Nein. Nie. Sie stellten die Waren in der Diele ab und gingen wieder. Die Signora gab großzügig Trinkgeld, aber sie war immer sehr reserviert … Nessuna chiacchierata, kein Schwätzchen, nie.«
Riani rieb sich nachdenklich die Wange. Selbst für eine Florentinerin war eine derartige Zurückhaltung ungewöhnlich. Es schien, als hätte sich die alte Dame vollkommen vom Leben zurückgezogen, aber der Medico Legale hatte ihm berichtet, dass sie ausgesprochen chic angezogen war, als sie starb. Das heißt, dass sie tadellos gekleidet und manikürt, vollendet frisiert und vermutlich auch geschminkt gewesen war, was sich leider nicht mehr zweifelsfrei feststellen ließ. Den Fotos nach hatte Signora Buonarroti einst ein Leben im internationalen Jetset geführt. Wenn sie mit den normal sterblichen Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung keinen Umgang pflegte, hieß das noch lange nicht, dass sie sich vollkommen zurückgezogen hatte. Es war zwar nicht auszuschließen, dass sie sich nur für sich allein so herrichtete, immerhin war das auch eine Form der Selbstachtung, aber er könnte sich auch vorstellen, dass sie in ihren Kreisen durchaus noch Kontakte pflegte. Er sollte ein kleines Gespräch mit dem Questore führen. Der tummelte sich in der Upperclass. Oder besser noch mit einer alten Freundin, einer Journalistin, die bei Rai 1 moderierte und hin und wieder für die zahlreichen Boulevardblätter des Landes schrieb. Möglicherweise gab es in diesem Umfeld jemanden, der die Signora lieber tot als lebendig sehen wollte? Plötzlich kam ihm ein Gedanke, und er sah auf. »Wie sieht es aus mit Maniküre, Kosmetikbehandlungen und Friseur? Torrini, ob Sie vielleicht das Hausmädchen diesbezüglich noch einmal befragen könnten?« Und als er das erfreute Grinsen seines Ispettore sah, fügte er mit strengem Blick hinzu: »Torrini, nur wer der Signora die Haare und Nägel machte. Mi raccomando!«
»Agli ordini, Commissario«, salutierte Torrini ernst, und Riani fühlte sich genötigt, noch einen warnenden Blick hinterherzuschicken. Für alle Fälle.
In dem Moment klopfte es, und der Mann aus der Technik kam herein. »Commissario? È permesso?«
»Certo, si accomodi.« Riani deutete auf einen Stuhl. »Gibt es etwas Neues?«
»Ja. Der Sprengsatz war klein. Wir haben Bestandteilreste eines Mobiltelefons gefunden und Spuren von Kaliumchlorid.«
»Eine USBV also«, unterbrach Riani.
»Sì, Commissario, eine unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung. Wir gehen im Augenblick davon aus, dass es sich um ein Selbstlaborat handelt, das durch ein Mobiltelefon ausgelöst wurde.«
»Das heißt, der Mörder hat die Explosion durch einen Anruf ausgelöst?«
»Ja. Davon gehe ich aus.«
Riani machte eine unbestimmte Handbewegung. »Und denken Sie, dass es möglich wäre …«
»Sie meinen, den Anrufer ausfindig zu machen?«, unterbrach ihn der Mann. »Nein. Ausgeschlossen. Die SIM-Karte ist vollständig geschmolzen.«
»Aber warum ein so kleiner Sprengsatz? Ist das nicht eine ziemlich ungewöhnliche Mordwaffe?«
»Ha ragione, Commissario, Sie haben recht. Sie muss das Päckchen in der Hand gehalten haben, sonst wäre die Detonation für sie nicht zwingend tödlich gewesen.«
»Ach, das ist ja interessant.«
Der Techniker verstand sofort, auf was Riani hinauswollte. »Genau, der Mörder muss in der Nähe beziehungsweise sich sicher gewesen sein, dass sie dieses Päckchen im Augenblick der Zündung in der Hand hält.«
»Jemand, der sein Opfer genau beobachtet haben muss«, warf Torrini ein.
»Ja«, erwiderte der Mann. »Vorausgesetzt natürlich, dass das Ganze kein Versehen war.«
»Ein Versehen? Das verstehe ich nicht.«
»Nun, wie schon gesagt, ein Sprengsatz dieser Größe hätte an einem anderen Ort weit mehr Schaden anrichten oder Panik auslösen können. Also wenn Sie mich fragen, ist so etwas als Mordwaffe in der Tat ziemlich ungewöhnlich.«
Riani betrachtete den Mann nachdenklich. »Das heißt im Klartext, dass wir unsere Ermittlungen zunächst darauf konzentrieren müssen, wie das Päckchen in ihre Hände gelangte und ob die alte Dame eventuell beobachtet wurde.« Er zögerte kurz. »Und dann müssen wir klären, ob der Anschlag tatsächlich ihr gegolten hat.« Mannaggia, fluchte er in Gedanken. »Also, meine Herren, wir konzentrieren uns jetzt zunächst auf den Briefträger. Rocca, Sie bringen mir so schnell wie möglich den Mann bei, bitte, Fabbri, Sie überprüfen alle Zustell- beziehungsweise Kurierdienste, ob sie heute früh zwischen acht und neun Uhr etwas an diese Adresse ausgeliefert haben, und befragen die Nachbarn, ob ihnen in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Und Sie, Torrini, sehen sich bitte noch einmal den Sohn näher an, besonders seine Finanzen und den Grund seiner Freistellung, und bringen ihn hierher, sobald er auftaucht.«
Riani erhob sich. »Meine Herren, ich danke Ihnen. Wir sehen uns um vier wieder.«
Sein Magen knurrte, und er war plötzlich hundemüde. Eilig verließ er den Raum, bevor irgendjemand auf die Idee kommen konnte, ein gemeinsames Mittagessen vorzuschlagen. In einer kleinen Bar in der Nähe aß er ein Panino, trank ein Bier und ging dann für ein kurzes Mittagsschläfchen nach Hause.
Zehn vor halb drei schloss er die Wohnungstür auf. »Sono io«, rief er, aber niemand antwortete. Nur Arturo, der schwarze Familienkater, trabte ihm freudig entgegen. Den tonnenschweren Kater auf dem Arm ging er in die Küche, wo er auf dem Tisch eine Nachricht seiner Frau fand:
Bin in der Schule – Konferenz – kann später werden. Habe im Caffè Italiano auf halb neun einen Tisch reserviert, ist es dir recht? Bacio, Vanna.
Er öffnete eine Dose Katzenfutter für den gierigen Kater, zog den Mantel und das Sakko aus und ließ sich anschließend seufzend aufs Bett fallen. Alles war so normal und der Vormittag so hektisch gewesen, dass er seine Sorgen von heute Morgen vollkommen vergessen hatte. Das Letzte, was er mitbekam, war, dass ihn der Kater mit seinem Whiskas-Atem angurrte, bevor er sich laut schnurrend neben ihm fallen ließ.
4
Kurz nach fünf saß er, ohne die Entourage der BBC, mit Pierfrancesco Della Valle in dem kleinen, vollkommen überheizten Verhörraum und biss sich an ihm die Zähne aus. Die Heizung gluckerte altersschwach, und in der trockenen, linoleumschweren Stille war nur das leise Ächzen von Rianis Stuhllehne zu hören. So jemand war ihm noch nie untergekommen. Heute Morgen hatte man seine Mutter in die Luft gesprengt, und der Kerl zeigte nicht die leiseste Emotion. Riani beobachtete ihn scharf, und er war sich sicher, dass er das nicht spielte, sondern dass es ihm tatsächlich gleichgültig war. Nicht dass er froh darüber gewesen wäre, nein, das schien nicht der Fall zu sein, aber dass er wirklich emotionslos war. Und es schien ihn auch nicht aus der Ruhe zu bringen, dass er als Tatverdächtiger Nummer eins galt. Er ließ sich von Rianis prüfendem Blick nicht im Mindesten irritieren. Der Mann erwiderte Rianis gefürchteten Bullenblick offen und vollkommen gelassen.
Der Commissario lehnte sich energisch vor, griff sich die Unterlagen über Della Valle und blätterte darin herum. Er hatte alles schon gelesen und im Prinzip auch nichts mehr zu fragen, aber vielleicht konnte er sein Gegenüber doch noch ein bisschen verunsichern, indem er ihn warten ließ. Er legte die Papiere wieder hin, musterte ihn eindringlich und räusperte sich dann gewichtig: »Signor Della Valle, alles in allem sieht es nicht besonders gut aus für Sie. Wie genau stellen Sie sich das jetzt vor? Sie sind unser Hauptverdächtiger, Sie haben kein Alibi und Sie haben ein Motiv, das Sie uns freundlicherweise auf dem goldenen Tablett serviert haben.«
Der Gefragte sah ihm gerade in die Augen und antwortete ruhig: »Nun, Commissario, ich sagte Ihnen bereits mehrfach, dass ich meine Mutter nicht getötet habe. Aber wenn Sie mir nicht glauben, tun Sie, was Sie tun müssen. Wenn Sie Beweise für Ihre Anschuldigungen haben, bitte verhaften Sie mich. Wenn nicht, lassen Sie mich gehen.«
Commissario Riani betrachtete hinter seiner grimmigen Miene den Mann auf dem Besucherstuhl. Er war groß und schmal und hatte eine auffallende Ähnlichkeit mit seiner Mutter auf den alten Fotos. Das kurze Haar war bereits stark ergraut, und er war dezent gekleidet. Auf seinen gepflegten Händen waren noch Reste der Fingerabdruckfarbe zu sehen. Er wirkte sympathisch. Etwas reserviert vielleicht, aber im Anbetracht der Situation war das nicht verwunderlich. Seinen Angaben zufolge war sein Verhältnis zur Mutter unterkühlt beziehungsweise nicht vorhanden gewesen. Bereits nach dem Tod der älteren Schwester hatte die Mutter jegliches Interesse an ihrem Jüngsten verloren, der damals erst zwei Jahre alt gewesen war, und hatte ihn der Obhut wechselnder Kindermädchen überlassen. Als er sechs war, siedelte die Familie nach London über, wobei er seine geliebte Nana in Mexiko-Stadt zurücklassen musste. Wieder vier Jahre später, mit zehn, schickten ihn die Eltern ins Internat. Ein Familienleben im herkömmlichen Sinne hatte nie existiert. Die Ferien verbrachte er zwar zu Hause, die Eltern jedoch waren so sehr mit ihren gesellschaftlichen Terminen beschäftigt, dass der Junge sie kaum zu Gesicht bekam. Keine wirklich gute Voraussetzung für ein enges emotionales Verhältnis.
Riani ließ seinen Blick über den dunklen Anzug des Mannes wandern und blieb an dessen blank polierten Schuhen hängen. Er war freigestellt worden, weil ihn ein anonymer Hinweis der Betätigung von Insidergeschäften beschuldigt hatte. Man hatte ihm nichts nachweisen können, deshalb nur die Freistellung mit vollen Bezügen für die nächsten drei Jahre, reputationsmäßig jedoch der Todesstoß. Dem Mann war in seinem Leben nichts erspart geblieben. Riani holte tief Luft.
»Signor Della Valle, können Sie mir noch einmal erklären, warum Sie sich ausgerechnet in Florenz niedergelassen haben, nachdem Sie …?«
»Commissario«, Della Valle zeigte keinerlei Ungeduld, »ich sagte Ihnen bereits, dass ich wegen meiner Mutter hierhergezogen bin. Auch wenn Sie das vielleicht nicht verstehen können, fühlte ich mich als Sohn verpflichtet, in ihrer Nähe zu sein, für den Fall, dass sie mich brauchen würde.«
»Nach allem, was Ihnen angetan wurde?«
»Ja. Nach allem, was sie mir angetan hat. Ich nehme an, sie konnte nicht anders. Sie war keine Mutter im herkömmlichen Sinne. Sie lebte in ihrer eigenen Welt.«
»Und Ihr zu erwartendes Erbe hatte mit dieser Entscheidung nichts zu tun?«
»Das sagte ich ebenfalls bereits. Nein. Ich wusste, dass ich der Erbe sein würde, auch wenn sie mir bei unserem besagten letzten Streit drohte, mich aus dem Testament zu streichen.«
»Wie können Sie da so sicher sein?«, hakte Riani nach. »Ich verstehe das nicht. Also ich hätte mir an Ihrer Stelle nicht unerhebliche Sorgen gemacht! Ganz besonders in Anbetracht Ihrer künftig angespannten finanziellen Situation.«
Della Valle schlug ein Bein über das andere und hielt kurz inne. »Sehen Sie, Commissario, Sie kannten sie nicht. Sie hatte trotz aller fehlenden mütterlichen Gefühle einen gewissen Familienstolz. Nie hätte sie ernsthaft in Erwägung gezogen, ihren einzigen Sohn zu enterben und durch eine derartige Tat ihren guten Namen ins Gespräch zu bringen. Für sie wäre das einer gesellschaftlichen Bloßstellung gleichgekommen, der sie sich nie und nimmer ausgesetzt hätte. Nicht einmal postum.«
»Auch nicht, wenn Sie Ihre … sagen wir unstandesgemäße Verlobte tatsächlich geheiratet hätten?«
»Auch dann nicht«, erwiderte er bestimmt.
»Nur, dass Sie das nicht beweisen können«, warf Riani ein.
»Nun, Commissario …« Della Valle lächelte jetzt fein. »Sehen Sie: Ich muss überhaupt nichts beweisen. Das ist Ihr Part.«
Da hatte er leider recht. So, wie die Dinge lagen, hatten sie bisher nichts außer einem fehlenden Alibi und einem hinreichend interessanten Motiv. Nichts! Und eventuell vorhandene DNA-Spuren wären frühestens nach drei Tagen ausgewertet.
»Signor Della Valle, Sie können jetzt gehen, aber ich muss Sie bitten, die Stadt nicht zu verlassen. Und ich muss Sie bitten, mir noch die Adresse Ihrer Verlobten hierzulassen.«
»Die Adresse meiner Verlobten? Wozu das denn?«
»Nun, weil sie der Anlass Ihrer Auseinandersetzung mit Ihrer Mutter gewesen ist. Ich werde in jedem Fall mit ihr sprechen müssen. Und selbstverständlich werden wir ihr Alibi prüfen.«
»Sie denken doch nicht ernsthaft, dass …?«
»Warum nicht? So, wie die Dinge liegen, hatte auch Ihre Verlobte einiges zu verlieren, wenn ihre künftige Schwiegermutter ihr Testament zu Ungunsten ihres Sohnes geändert hätte, nicht?«