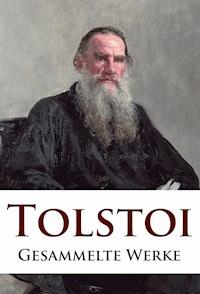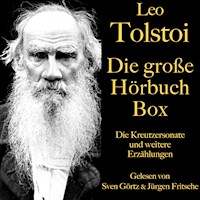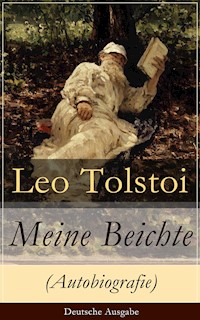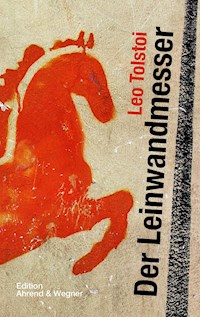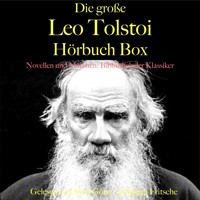Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Die junge Mascha heiratet nach dem Tode ihrer Mutter ihren älteren Vormund Sergeij. Gemeinsam beziehen sie ein Landgut. Doch schon bald beginnt sich Mascha zu langweilen. Sie will zurück nach Petersburg, wo sie sich dem Rausch der Bälle und des Adels hingeben kann. Ihre Vergnügungssucht belastet die Ehe zunehmend. Ein fesselnder Roman, der entgegen Tolstois manchmal moralisierenden Ausführungen, beim Leser Mitleiteid mit der lebenshungrigen Heldin weckt. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leo Tolstoi
Familienglück
Ein Roman
Leo Tolstoi
Familienglück
Ein Roman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: August Scholz 2. Auflage, ISBN 978-3-954188-35-2
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
1.
2.
3.
4.
5.
Zweiter Teil
1.
2.
3.
4.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erster Teil
1.
Wir hatten Trauer nach unserer Mutter, die im Herbst gestorben war, und lebten zu Dreien – Katja, Sonja und ich – den ganzen Winter still für uns auf dem Lande.
Katja war eine alte Freundin unseres Hauses, unsere Gouvernante, die uns alle erzogen hatte. Soweit ich zurückdenken konnte, hatte ich sie gekannt und geliebt. Sonja war meine jüngere Schwester. Wir verlebten einen düsteren, traurigen Winter in unserem alten Hause in Pokrowskoje. Das Wetter war kalt und windig, der Schnee war zuweilen bis über unser Fenster hinauf angeweht; die Fenster waren fast immer zugefroren und trübe, und den ganzen Winter hindurch waren wir kaum einmal ausgegangen oder ausgefahren. Nur selten einmal besuchte uns jemand. Und wenn schon jemand kam, trug er jedenfalls nicht dazu bei, daß Lust und Fröhlichkeit in unserem Hause herrschten. Alle hatten betrübte Gesichter, alle sprachen leise, als fürchteten sie jemanden zu wecken, vermieden das Lachen, seufzten und weinten häufig, wenn sie mich oder die kleine Sonja im schwarzen Kleide sahen. Es war, als fühle man im Hause noch die Anwesenheit des Todes; die Trauer und der Schrecken des Todes schienen unsichtbar in der Luft zu schweben. Mamas Zimmer war verschlossen, und wenn ich an ihrer Tür vorüberkam, um mich im Zimmer nebenan schlafen zu legen, ward mir ganz unheimlich zumute. Zugleich aber zog mich etwas dorthin und drängte mich, in den öden, kalten Raum einen Blick zu werfen.
Ich zählte damals siebzehn Jahre; und gerade in dem Jahre, als Mama starb, hatte sie nach der Stadt ziehen wollen, um mich in die Gesellschaft einzuführen. Der Verlust der Mutter war für mich ein großer Schmerz gewesen, doch muß ich bekennen, daß neben diesem Schmerz mich auch das Gefühl bedrückte, daß ich jung und, wie man mir sagte, auch schön war und nun schon den zweiten Winter nutzlos in ländlicher Einsamkeit zubringen mußte. Gegen Ausgang des Winters hatte dieses Gefühl der Trauer und Vereinsamung oder, kurz gesagt, der Langenweile sich so in mir gesteigert, daß ich gar nicht mehr aus dem Zimmer ging, nicht mehr das Klavier öffnete und kein Buch mehr in die Hand nahm. Wenn Katja mir zuredete, mich doch mit diesem oder jenem zu beschäftigen, antwortete ich: »Ich habe keine Lust, ich kann nicht« – in meinem Herzen aber sagte ich mir: »Wozu? Welchen Zweck hat es, überhaupt etwas zu tun, während doch meine beste Lebenszeit so nutzlos dahingeht? Wozu also überhaupt etwas tun?« Und auf dieses »wozu?«, fand ich keine andere Antwort als Tränen.
Man hatte mir gesagt, ich sei während dieser Zeit mager und häßlich geworden, doch auch das ließ mich völlig gleichgültig. »Wozu? Für wen?«, sagte ich mir. Es war mir, als müsse mein ganzes Leben in dieser einsamen Abgeschiedenheit, dieser hilflosen Schwermut vergehen, der mich zu entwinden ich nicht die Kraft, ja nicht einmal den Wunsch besaß. Katja hatte gegen Ende des Winters wirklich schon Angst um mich und war entschlossen, mich um jeden Preis ins Ausland zu bringen, um mich meiner trostlosen Stimmung zu entreißen. Aber dazu war Geld nötig, und wir wußten gar nicht, was uns eigentlich nach dem Tode der Mutter zugefallen war. Tag und Nacht erwarteten wir den Vormund, der doch einmal kommen mußte, um unsere Angelegenheiten zu ordnen.
Im März kam der Vormund endlich an.
»Nun, Gott sei Dank!«, sagte eines Tages Katja zu mir, als ich ohne Beschäftigung, ohne Gedanken, ohne Wunsch wie ein Schatten von einem Winkel zum andern irrte. »Sergeij Michajlytsch ist auf seinem Gute angekommen, er hat hergeschickt, um nach unserem Ergehen zu fragen, und wollte zum Mittagessen hier bleiben. Du mußt dich aufraffen, meine kleine Mascha«, fügte sie hinzu – »was soll er denn sonst von dir denken? Er liebt euch alle so sehr.«
Sergeij Michajlowitsch war ein Nachbar von uns, und er war ein Freund meines verstorbenen Vaters gewesen, obschon er weit jünger gewesen war als dieser. Abgesehen davon, daß seine Ankunft unsere Pläne änderte und uns die Möglichkeit gewährte, vom Lande wegzuziehen, hatte ich von Kindheit an Liebe und Achtung für ihn empfunden, und als Katja mich jetzt ermahnte, ich solle mich aufraffen, war dies sicher in der Erwartung geschehen, daß ich unter allen unseren Bekannten mich am wenigsten vor Sergeij Michajlowitsch in ungünstigem Lichte würde zeigen wollen. Ich war ihm nicht nur, wie alle im Hause, von Katja und seinem Patenkind Sonja bis zum letzten Kutscher, aus bloßer Gewohnheit zugetan – es lag da vielmehr noch ein besonderer Grund vor, weshalb ich seinem Erscheinen mit Spannung entgegensah. Eine Äußerung, die Mama einmal in meiner Gegenwart getan, war hier mit im Spiele: sie wünsche sich solch einen Gatten für mich, hatte sie gesagt. Ihre Worte waren mir damals sonderbar vorgekommen, ja sogar peinlich gewesen: mein Held sah ganz anders aus. Mein Held war ein schlanker, hagerer, bleicher, melancholischer Jüngling. Sergeij Michajlowitsch dagegen war nicht mehr jung, er war groß, untersetzt und, wie mir schien, immer vergnügt; gleichwohl hatten jene Worte Mamas auf meine Phantasie stark eingewirkt, und schon damals, vor sechs Jahren, als ich eben elf Jahre zählte, als er mich noch duzte, mit mir spielte und mich ein »kleines Veilchen« nannte, hatte ich mir bisweilen nicht ohne Gefühl der Angst die Frage vorgelegt, was ich wohl tun würde, wenn er plötzlich um meine Hand anhielte.
Kurz vor dem Essen, zu dessen Menu Katja noch ein Spinatgericht und eine süße Speise hinzugefügt hatte, kam Sergeij Michajlowitsch an. Ich sah durchs Fenster, wie er in einem kleinen Schlitten sich unserem Hause näherte. Als er jedoch um die Ecke bog, eilte ich in den Salon: ich wollte mir den Anschein geben, als hätte ich ihn gar nicht erwartet. Sobald ich aber im Vorzimmer das Geräusch seiner Schritte, seine laute Stimme und Katjas Schritte vernahm, hielt ich es nicht länger aus und ging ihm selbst entgegen. Er hielt Katjas Hand in der seinen, sprach laut und lächelte. Als er mich erblickte, schwieg er und betrachtete mich eine Weile, ohne mich zu grüßen. Ich wurde verlegen und fühlte, daß ich errötete.
»Ach, sind Sie es wirklich?«, sagte er in seiner bestimmten, schlichten Art, während er mit einer Bewegung der Hände, die seine Überraschung ausdrückte, auf mich zutrat. »Ist eine solche Wandlung denn möglich? Wie groß Sie geworden sind! Das ist nun das Veilchen von einstmals – Sie sind ja zu einer vollen Rose erblüht!«
Mit seiner großen Hand ergriff er die meine und schüttelte sie so bieder und kräftig, daß es mir fast weh tat. Ich dachte, er würde sie mir küssen, und hatte mich bereits zu ihm vorgeneigt, doch er drückte sie mir nur noch einmal und sah mir mit seinem sicheren, klaren Blick gerade in die Augen.
Ich hatte ihn seit sechs Jahren nicht gesehen. Er hatte sich sehr verändert: er war älter geworden, sein Teint war dunkler, und er trug einen Backenbart, der ihn gar nicht kleidete; aber seine schlichten Manieren, das offene, ehrliche Gesicht mit den kräftigen Zügen, die klugen, glänzenden Augen und das liebenswürdige, fast kindliche Lächeln waren unverändert geblieben.
Nach fünf Minuten bereits hatte er aufgehört, nur schlechtweg ein Gast zu sein – er war einfach für uns alle, selbst für die Dienerschaft, die durch ihre Bereitwilligkeit ihre Freude über seine Ankunft an den Tag legten, ein lieber Hausfreund geworden.
Er benahm sich durchaus nicht so wie die übrigen Nachbarn, die nach dem Tode der Mutter bei uns vorgesprochen und es für ihre Pflicht gehalten hatten, schweigend dazusitzen und mit uns zu weinen; er war im Gegenteil gesprächig und vergnügt und erwähnte die Mutter nicht mit einem Worte, so daß ich anfangs diese Gleichgültigkeit vonseiten eines uns so nahestehenden Mannes ein wenig sonderbar und sogar unpassend fand. Dann aber begriff ich, daß dies nicht Gleichgültigkeit war, sondern Aufrichtigkeit, für die ich ihm dankbar war. Am Abend servierte uns Katja den Tee an der alten Stelle im Salon, ganz so, wie es zu Mamas Zeiten gewesen war; ich saß mit Sonja neben ihr; der alte Diener Grigorij brachte ihm Papas Pfeife, die er irgendwo gefunden hatte, und er begann ganz so wie in früheren Zeiten im Zimmer auf und ab zu gehen.
»Wenn ich so bedenke, welche furchtbaren Veränderungen in diesem Hause vor sich gegangen sind!«, sagte er stehenbleibend.
»Ja«, entgegnete Katja mit einem Seufzer, legte den Deckel auf den Samowar und sah den Gast an, während ihr die Tränen in die Augen stiegen.
»Ihres Vaters werden Sie sich wohl noch erinnern?«, wandte er sich an mich.
»Ja, ein wenig«, antwortete ich.
»Wie schön wäre es, wenn Sie ihn jetzt noch hätten!«, sagte er leise, während er nachdenklich über meine Augen hinweg auf meinen Scheitel blickte. »Ich hatte Ihren Vater sehr gern«, fügte er noch leiser hinzu, und es schien mir, daß der Glanz seiner Augen bei seinen Worten noch zunahm.
»Und nun hat Gott auch unsere Mutter zu sich genommen!«, sprach Katja, und gleich darauf legte sie ihre Serviette auf die Teekanne, zog ihr Taschentuch hervor und begann zu weinen.
»Ja, es sind furchtbare Veränderungen, die hier stattgefunden haben«, wiederholte er, während er sich abwandte. »Sonja, zeig’ mir doch einmal deine Spielsachen«, fügte er nach einem Weilchen hinzu und verließ das Zimmer. Die Augen voller Tränen, blickte ich, während er hinausging, auf Katja.
»Ach, welch ein trefflicher Freund«, sagte Katja.
Und in der Tat ward mir warm und wohl ums Herz angesichts der Teilnahme dieses guten, wenn auch mir fernstehenden Menschen.
Aus dem Zimmer nebenan vernahmen wir Sonjas feines Stimmchen und ihr Lachen – sie unterhielten sich offenbar gut miteinander. Ich schickte ihm den Tee hinein. Gleich darauf hörten wir, wie er sich ans Klavier setzte und Sonjas Händchen auf die Tasten loshämmerten.
»Maria Alexandrowna!«, ließ er seine Stimme vernehmen – »kommen Sie doch herein und spielen Sie etwas!«
Es war mir angenehm, daß er in dieser einfachen, freundschaftlich bestimmten Weise sich an mich wandte; ich erhob mich und ging zu ihm hinein.
»Spielen Sie doch einmal das hier«, sagte er, ein Heft von Beethoven bei dem »Adagio quasi una fantasia« aufschlagend. »Wir wollen einmal sehen, wie Sie spielen«, fügte er hinzu und trat mit seinem Glase in eine Ecke des Zimmers.
Ich hatte die Empfindung, daß es mir unmöglich sein würde, ihm diese Bitte abzuschlagen oder mich zu zieren, unter dem Vorwande, daß mein Spiel nicht weit her sei; ich setzte mich folgsam wie ein Kind an das Klavier und begann zu spielen, so gut ich es verstand. Dabei war mir insgeheim doch vor seinem Urteil bange, denn ich wußte, daß er die Musik liebte und ein Kenner war. Das Adagio war im Tone jener Empfindungen gehalten, die durch das Gespräch beim Tee und all die wieder lebendig gewordenen Erinnerungen in mir geweckt worden waren, und so spielte ich auch, wie mir schien, gar nicht übel. Das Scherzo jedoch ließ er mich nicht spielen.
»Nein, das werden Sie nicht gut spielen«, sagte er, zu mir tretend, »das lassen Sie lieber. Das erste aber war nicht übel. Es scheint, daß Sie Verständnis für Musik haben.«
Dieses gemessene Lob erfreute mich so sehr, daß ich sogar errötete. Es war mir so neu und so angenehm, daß er, der Freund und Vertraute meines Vaters, mit mir so ganz ernsthaft sprach und nicht mehr in halbscherzendem Tone, wie früher, als ich noch ein Kind gewesen. Katja begab sich nach oben, um Sonja zu Bett zu bringen, und wir blieben allein im Salon zurück.
Er erzählte mir von meinem Vater, wie er ihm nähergetreten sei, und wie vergnügt sie damals, als ich mich noch mit meinen Schulbüchern und Spielsachen befaßte, zusammen gelebt hätten; und in diesen Schilderungen erschien mir mein Vater zum erstenmal als ein einfacher, liebenswürdiger Mensch, wie ich ihn bisher nicht gekannt hatte. Er fragte mich über dies und das aus, wofür ich eine besondere Neigung hätte, was ich läse, welche Pläne ich für die Zukunft hätte, und gab mir Ratschläge. Er war jetzt für mich nicht mehr der fröhlich scherzende Kamerad, der mich neckte und Spielzeug für mich verfertigte, sondern der ernste, offene Mann, der mir freundlich gesinnt war, und für den ich unwillkürlich Hochachtung und Sympathie empfand. Es war mir so leicht und so wohl ums Herz, als ich so mit ihm sprach, zugleich jedoch empfand ich eine gewisse Beklemmung. Ich wog gleichsam jedes Wort, das ich sprach; es lag mir soviel daran, mich seiner Zuneigung zu versichern, die er mir schon darum entgegenbrachte, weil ich die Tochter meines Vaters war.
Als Katja Sonja zu Bett gebracht hatte, kam sie wieder zu uns und klagte ihm gegenüber über meine Apathie, von der ich ihm gar nichts gesagt hatte.
»Wie denn? Von der Hauptsache hat sie mir also gar nichts erzählt?«, sprach er lächelnd und schüttelte, während er mich ansah, mißbilligend den Kopf.
»Was hätte ich auch davon erzählen sollen?«, sagte ich. »Das ist doch so langweilig, und dann wird’s ja auch vorübergehen.« Ich hatte in der Tat jetzt das Gefühl, daß meine schwermütige Stimmung schwinden werde, ja daß sie bereits geschwunden sei und nicht mehr wiederkehren werde.
»Es ist nicht gut, wenn jemand die Einsamkeit nicht zu ertragen weiß«, sagte er. »Sie sind doch ein gebildetes junges Fräulein, nicht wahr?«
»Ich halte mich wenigstens dafür«, antwortete ich lächelnd.
»Nun denn – es ist kein Zeichen wirklicher Bildung, wenn eine junge Dame nur so lange klug und geistreich ist, als sie von andern bewundert wird, sich dagegen gehen läßt und gegen alles gleichgültig wird, wenn sie allein ist. Alles nur des Scheines wegen, nicht um seiner selbst willen und für sich selbst tun – nein, das ist nicht das Richtige!«
»Sie haben ja eine schöne Meinung von mir!«, bemerkte ich, um überhaupt etwas zu sagen.
»Nein«, versetzte er nach einigem Schweigen – »nicht umsonst sehen Sie Ihrem Vater ähnlich, in Ihnen steckt etwas!« Und sein guter, aufmerksam beobachtender Blick ruhte wieder freundlich auf mir und versetzte mich in eine freudige Erregung.
Jetzt erst fiel mir dieser nur ihm allein eigene, zuerst hell leuchtende, dann immer eindringlicher werdende, ein wenig schwermütige Blick auf, der gleichsam hinter dem ersten, heiteren Ausdruck seines Gesichtes auftauchte.
»Sie dürfen um keinen Preis die Langeweile aufkommen lassen«, sagte er – »Sie haben die Musik, für die Sie Verständnis besitzen, Sie haben Ihre Bücher, Ihre Studien, Sie haben ein ganzes Leben vor sich, auf das Sie sich nur jetzt vorbereiten können, wenn Sie später keine Reue empfinden wollen. In einem Jahre schon wird es dazu zu spät sein.«
Er sprach mit mir wie ein Vater oder wie ein älterer Verwandter, und ich fühlte, wie er sich fortwährend Mühe gab, um sich nach Möglichkeit meinem Standpunkte anzupassen. Aber es verletzte mich einerseits, daß er der Meinung war, ich stehe geistig unter ihm, während es mir andrerseits schmeichelte, daß er sich überhaupt die Mühe machte, von seiner Höhe zu mir herabzusteigen.
Den Rest des Abends verbrachte er damit, mit Katja über geschäftliche Angelegenheiten zu reden.
»Nun leben Sie wohl, meine liebe Freundin«, sagte er, sich erhebend, kam auf mich zu und ergriff meine Hand.
»Wann sehen wir uns wieder?«, fragte Katja.
»Im Frühjahr«, antwortete er, noch immer meine Hand haltend. »Jetzt fahre ich nach Danilowka« – so hieß unser zweites Gut – »sehe mich dort um, ordne alles, soweit ich das vermag, und gehe dann in meinen eigenen Angelegenheiten nach Moskau. Im Sommer werden wir uns wiedersehen.«
»Warum wollen Sie uns denn so lange fern bleiben?«, sagte ich aufrichtig betrübt – ich hatte wirklich schon gehofft, ihn von nun an täglich zu sehen. Es ward mir plötzlich so traurig ums Herz, und ich fürchtete, daß meine Schwermut und Langeweile wiederkehren würde. In meinem Blick und meiner Stimme muß das wohl zum Ausdruck gekommen sein.
»Suchen Sie sich so viel wie möglich zu beschäftigen, werden Sie nicht zur Grillenfängerin!«, sagte er in einem Tone, der mir allzu kühl und gleichgültig klang. »Im Frühjahr werde ich Sie dann examinieren«, fügte er, ohne mich anzusehen, hinzu und ließ meine Hand los.
Im Vorzimmer, wohin wir ihm das Geleit gegeben hatten, zog er eilig seinen Pelz an. Auch hier würdigte er mich keines Blickes.
»Er strengt sich ganz vergeblich an«, dachte ich. »Meint er vielleicht, ich empfinde es schon als ein besonderes Glück, wenn er mich nur ansieht? Er ist ein guter Mensch, ein sehr guter Mensch, gewiß – aber weiter auch nichts …«
Wir konnten an diesem Abend lange nicht einschlafen und plauderten mit Katja – nicht sowohl von ihm, als davon, wie wir den Sommer verleben, und wo wir den nächsten Winter zubringen wollten. Die schreckliche Frage: »Wozu?«, bedrückte mich nun nicht mehr. Ich sagte mir ganz einfach und klar, man müsse leben, um glücklich zu sein, und ich stellte mir eine Zukunft voll hellen, freudigen Glückes vor. Leben und Licht war gleichsam plötzlich in unser altes, düsteres Haus in Pokrowskoje eingezogen.
2.
Es war Frühling geworden. Meine schwermütige Stimmung war verschwunden, und an ihre Stelle war jenes schwärmerische Sehnen und Hoffen getreten, das der Frühling in der Seele erweckt. Ich führte nun nicht mehr dasselbe Leben wie im Beginn des Winters, sondern beschäftigte mich mit Sonja, trieb Musik, las viel, ging häufig im Park spazieren und machte lange Promenaden in den Alleen, oder ich saß auf einer Bank und träumte, hoffte und schwärmte Gott weiß, wovon. Zuweilen brachte ich, namentlich wenn der Mond schien, die ganze Nacht bis zum frühen Morgen am Fenster meines Zimmers zu; mitunter ging ich ganz leise, damit Katja nichts merkte, in der bloßen Nachtjacke in den Garten hinunter und lief über das tauige Gras nach dem Parkteich, und einmal wagte ich mich sogar aufs Feld hinaus und ging mitten in der Nacht ganz allein um den ganzen Park herum.
Es fällt mir jetzt schwer, mir jene Träumereien, die damals meine Phantasie beschäftigten, ins Gedächtnis zurückzurufen und sie zu verstehen. Und wenn sie mir wieder einfallen, kann ich es kaum glauben, daß dies wirklich meine Träumereien sind, so seltsam und lebensfremd scheinen sie mir.
Gegen Ende Mai kehrte Sergeij Michajlowitsch, wie er versprochen hatte, von seiner Reise zurück.
Das erstemal besuchte er uns am Abend, zu einer Zeit, da wir ihn gar nicht erwarteten. Wir saßen auf der Terrasse und wollten soeben Tee trinken. Der Garten prangte bereits in frischem Grün, und in den dichtbelaubten Bosketts ließen die Nachtigallen schon ihre Lieder erklingen. Die buschigen Fliedersträucher waren da und dort mit etwas Weißem oder Lilafarbigem bestreut – es waren die Blüten, die jeden Augenblick aufbrechen konnten. Das Laub der Birkenallee erschien ganz durchsichtig in den Strahlen der untergehenden Sonne. Auf der Terrasse lag ein kühler Schatten. Ein dichter Abendtau hatte sich auf den Rasen gesenkt. Vom Hofe her vernahm man das Brüllen der eingetriebenen Herde und die letzten Geräusche des schwindenden Tages. Der schwachsinnige Nikon fuhr mit dem Wasserfaß auf dem Wege vor der Terrasse vorüber, und der kühle Wasserstrahl seiner Gießkanne zeichnete schwarze Kreise auf dem frisch gelockerten Boden um die an Stäbe gebundenen jungen Georginen. Vor uns blinkte und brodelte auf dem weißen Tischtuch der blankgeputzte Samowar, daneben stand die Rahmkanne, und Brezeln und sonstiges Gebäck fehlten nicht. Katja spülte als sorgsame Hausfrau mit den runden, weichen Händen die Tassen aus. Ich konnte den Tee nicht erwarten und aß, da ich nach einem Bade Hunger hatte, eben eine mit frischer, dicker Sahne bestrichene Brotschnitte. Ich trug eine leinene Bluse mit offenen Ärmeln und hatte das feuchte Haar mit einem Tuche umhüllt. Katja war die erste, die den Gast durch das Fenster kommen sah.
»Ah, Sergeij Michajlowitsch!«, rief sie aus. »Wir haben soeben von Ihnen gesprochen.«
Ich stand auf und wollte fortgehen, um mich umzukleiden, doch traf er mich gerade in der Tür und suchte mich zurückzuhalten.
»Nun, was für Umstände machen Sie hier auf dem Dorfe«, sagte er lächelnd, mit einem Blick auf das Tuch, mit dem ich den Kopf bedeckt hatte. »Sie genieren sich doch auch vor Grigorij nicht, und ich bin doch für Sie, denk’ ich, ebensoviel wie Grigorij.« Doch gerade in diesem Augenblick schien es mir, als blicke er mich so ganz anders an als Grigorij, und ich ward ein wenig verlegen.
»Ich bin gleich wieder hier«, sagte ich und entfernte mich.
»Was ist denn an Ihnen auszusetzen?«, rief er hinter mir her – »Sie sehen ganz wie eine junge Bäuerin aus!«
»Wie seltsam er mich ansah!«, dachte ich, während ich mich oben in meinem Zimmer rasch umzog. »Nun, Gott sei Dank, daß er gekommen ist, es wird jetzt hier bei uns lustiger werden.«
Ich warf einen Blick in den Spiegel und eilte vergnügt die Treppe hinunter. Ich gab mir durchaus keine Mühe zu verheimlichen, daß ich mich beeilt hatte, und kam ganz atemlos auf die Terrasse zurück. Er saß am Tische und sprach mit Katja über unsere Angelegenheiten. Als er mich erblickte, lächelte er, fuhr jedoch fort zu sprechen. Unser Vermögensstand war, wie er sagte, in bester Ordnung. Wir sollten nach seiner Meinung noch den Sommer auf dem Lande zubringen und dann nach Petersburg ziehen, um Sonjas Erziehung zu vollenden, oder ins Ausland reisen.
»Ja, wenn Sie mit uns ins Ausland reisen wollten!«, sagte Katja. »Aber so werden wir uns dort wie im Urwalde vorkommen.«
»Ach, wie gern möchte ich mit Ihnen um die ganze Welt herumreisen!«, sagte er halb scherzend, halb im Ernst.
»Nun denn«, sagte ich, »so machen wir also zusammen eine Reise um die Welt!«
Er lächelte und schüttelte den Kopf.
»Und mein Mütterchen? Und meine Geschäfte?«, sagte er. »Reden wir nicht davon. Erzählen Sie lieber, was Sie in der letzten Zeit getrieben haben. Haben Sie wieder Grillen gefangen?«