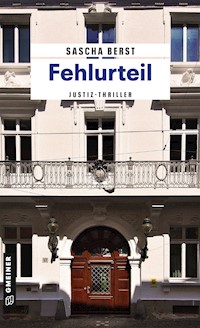
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Antonio Tedeschi und Margarethe Heymann
- Sprache: Deutsch
Freiburg 1992. Die Staatsanwältin Margarethe Heymann wird von einem Mann um Hilfe gebeten. Vor zehn Jahren hat er Strafanzeige gegen mehrere Richter erstattet und seitdem nichts mehr von der Justiz gehört. Sein Vater hatte das eigene Geschäftshaus einem Angestellten übertragen, damit es nicht in die Hände der Nazis fällt. Doch die versprochene Rückübertragung blieb aus. Widerwillig und mit privaten Problemen belastet, nimmt sich die Staatsanwältin des Falles an. Bald stößt sie auf Ungereimtheiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sascha Berst
Fehlurteil
Justiz-Thriller
Zum Buch
Contra omnes Die junge Staatsanwältin Margarethe Heymann wird von einem alten Mann angesprochen, der vor zehn Jahren eine Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen einen ganzen Senat des Oberlandesgerichts gestellt hat. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nie Nachricht von der Staatsanwaltschaft erhielt. Margarethe Heymann sieht in dem Mann zunächst nur einen weiteren Querulanten, der einen Fall aufrollen lassen will, weil ihm angeblich Unrecht widerfahren war. Doch Margarethe kann sich ihm nicht entziehen. Sie übernimmt seinen Fall, der zurück ins Jahr 1938 reicht, als der Vater des alten Mannes sein Kaufhaus dem ehemaligen Prokuristen übertrug, damit es nicht in die Hände der Nazis fällt. Beide Parteien versicherten sich damals die Rückübertragung, zu der es nie kam. Margarethe recherchiert und stößt auf Ungereimtheiten. Kurz darauf hat sie ihren Lebensgefährten und hohe Richter gegen sich. Ein schwerer Kampf beginnt.
Sascha Berst genoss seine Schulbildung in Deutschland sowie Italien. In Freiburg und Paris studierte er Germanistik und Rechtswissenschaften. Inzwischen ist der promovierte Jurist in Freiburg als Rechtsanwalt niedergelassen. Im Jahr 2013 gewann der Autor den Freiburger Krimipreis und im Mai 2015 die »Herzogenrather Handschelle«, den Krimipreis der Stadt Herzogenrath. Im Gmeiner-Verlag erschienen »Fehlurteil« und»Reue«.
Impressum
Was auch immer Sie auf den folgenden Seiten lesen, das Buch ist ein Roman. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen und Ereignissen sind also rein zufällig.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Joergens.mi/Wikipedia
ISBN 978-3-8392-4318-3
Vorwort des Herausgebers
Der hier erstmals veröffentlichte Bericht des früheren Freiburger Staatsanwalts Antonio Tedeschi erreichte mich etwa zwei Jahre, nachdem Tedeschi seinen Dienst bei der baden-württembergischen Justiz quittiert und Deutschland verlassen hatte. Dass er ihn mir anvertraute, hat mich überrascht, waren wir uns doch bis dahin nur vier oder fünf Mal begegnet und kannten uns nur oberflächlich, obwohl – oder vielleicht weil – uns unsere Herkunft und unsere Berufswahl verband. Das erste Mal traf ich Tedeschi aus Anlass der Feier des italienischen Nationalfeiertages im alten Freiburger Kaufhaus. Ich erinnere mich an einen gedrungenen Mann mit dunkelbraunen Augen, blauschwarzem Haar und der olivfarbenen Haut eines Orientalen, dessen schwäbelndes Deutsch in einem eigentümlichen Kontrast zu seinem Äußeren stand. Eine gemeinsame Freundin machte uns bekannt, aber wir wurden nicht warm miteinander. Ich lachte und scherzte an jenem Abend viel, Tedeschi blieb so ernst und still, dass ich fast erschrocken darüber war, wie sehr er bemüht war, sich in Sprache und Verhalten ganz dem anzupassen, was im Allgemeinen als Deutsch verstanden wird, während er Temperament und Lebenslust des Südens ganz verleugnete. In der Folge grüßten wir uns aus der Ferne und manchmal glaubte ich, dass er mich mied. Trotzdem übergab er mir nun sein Manuskript und bat mich in einem kurzen Brief darum, frei zu entscheiden, ob seine Beobachtungen einem breiteren Publikum zugänglich gemacht oder für immer vergessen werden sollten. Den Justizskandal des Jahres 1992, den der ehemalige Staatsanwalt schildert, hatte ich aus einigen Artikeln der Badischen Zeitung in gerade noch vager Erinnerung, aber keine Vorstellung von der Dramatik der Ereignisse. Es stand für mich daher schnell außer Frage, den Bericht über die Vorgänge innerhalb der südbadischen Justiz zur Veröffentlichung zu bringen, wenn ich die Namen der beteiligten Personen auf Bitten des Verlages auch ändern und die Beschreibung ihrer körperlichen Merkmale verfremden musste.
Obwohl ich an der Wahrhaftigkeit der Schilderung keine Zweifel hege, habe ich dem baden-württembergischen Justizministerium ein Exemplar des Buches vorab zur Überprüfung vorgelegt. Dort war man zu keiner Stellungnahme bereit.
S. B.
1
Was war das für eine Frau, die es wagte, einen hohen Richter, ehemaligen Staatssekretär und Abgeordneten anzuklagen, allen Einflüssen und Einflüsterungen, Drohungen und Verlockungen zum Trotz, die ihr bei dieser Aufgabe täglich begegneten, die Hohn und Spott ihrer Gegner ebenso zu ertragen vermochte, wie den Applaus und das Lob falscher Freunde? Was war anders, was war besonders an dieser jungen Staatsanwältin, von der man vor den Ermittlungen, die sie für die einen berühmt und für viele andere berüchtigt machten, nie etwas gehört hatte? Und wie könnten diese Fragen beantwortet werden, ohne einen Blick in ihre Seele zu werfen und vielleicht auch in meine?
Wie war sie also? Engagiert? Ja. Zielstrebig? Ja. Leidenschaftlich? Ja – all das ohne Zweifel und vielleicht alles ein bisschen zu sehr … Vor allem war sie auf der Suche, und dies schon zu einem Zeitpunkt, als sie selbst es noch gar nicht wusste, lange bevor dieser kleine alte Mann sie ansprach und in ihr Leben trat …
Margarethe würde sagen, es sei ihr Schicksal gewesen, dass sich ihr gerade diese Aufgabe stellte und sie hätte damit recht, wenn man mit dem Begriff Schicksal weniger die Vorsehung, als vielmehr die Eigenart unseres Lebens verbindet, die Rätsel, die es uns stellt, eines Tages zu unserem Glück oder Unglück auch zu lösen und die Fragen zu beantworten, die unsere Lebensläufe nun einmal begleiten. Gibt es nur ein Leben, das nicht auf ein Geheimnis weist? Wir alle werden von unseren Schatten verfolgt.
Meine Rolle bei den Ereignissen war schlichter, bin ich doch durch bloßen Zufall zu ihnen gekommen, durch Zufall und auch ein wenig durch Zuneigung, das will und werde ich nicht leugnen. Nennen wir es Schicksal, so war ich dabei, als Margarethe ihm begegnete. Zufällig, wie gesagt, zufällig und ohne jeden Anlass, aber eben doch dabei, und dieser Moment hat uns verbunden und verknüpft, wie zwei Pflanzen, die umeinander ranken, auch wenn mir die Bedeutung dieses Treffens nicht von Anfang an klar war und nicht klar sein konnte, obwohl ich die Bestürzung in ihrem Blick sah. Ja, Bestürzung.
Margarethe begegnete ihrem Schicksal in Gestalt eines geradezu zarten alten Mannes mit weißem Haar, feinen Gliedern und klugem Gesicht. Es war ein regnerischer Tag im März. Ich kam ein wenig zu spät zur Arbeit und war zu allem Überfluss in einen heftigen Regenschauer geraten, dem weder mein Schirm noch mein dünner Mantel hatten standhalten können. Als ich endlich bei der Staatsanwaltschaft ankam, konnte ich kaum durch meine Brille sehen; das Wasser tropfte an mir herunter, als regnete es aus meinen Kleidern. Während ich meinen Mantel am Eingang auszog und sich zu meinen Füßen kleine Lachen bildeten, entdeckte ich Margarethe. Sie stand ein paar Meter von der Pforte entfernt und sprach mit eben jenem Mann, der ihr, gerade als ich zur Begrüßung verstohlen winkte, einen Stapel Papiere in die Hand drückte, die er zuvor aus einer unansehnlichen Plastiktüte gezogen hatte. Den Alten hatte ich in den letzten Tagen schon ein paar Mal vor der Staatsanwaltschaft warten und unentschlossen zur Eingangstüre schielen sehen. Er war mir aufgefallen, weil er so zart war, fast zerbrechlich, ganz und gar ungewöhnlich für einen Mann, selbst für einen Mann seines Alters. Als ich ihn neben ihr stehen und auf sie einreden sah mit seinem schwarzen Hut, von dem der Regen tropfte, der dicken Jacke, deren schwarz-weißes Fischgräten-Muster zuletzt vor 20 Jahren modern gewesen sein mochte, den eindringlichen Gesten und einem Blick, der wie besessen schien, hielt ich ihn für einen Querulanten, wie man sie auf den Gängen der Gerichte, Behörden und Kanzleien immer wieder trifft. Männer meist, oft ungepflegt und ungewaschen, die davon überzeugt sind, dass ihnen bitterstes Unrecht geschehen ist, und nun, bewaffnet mit Stapeln von zerschlissenen Papieren, Unterlagen, Urteilen, ausgerissenen Zeitungsartikeln, Briefen, Bittschriften und Petitionen einen Richter oder einen Anwalt suchen, der ihnen helfen soll, ja, helfen muss, das vermeintliche Unrecht ungeschehen zu machen. Sie fordern Gerechtigkeit!,lautstark und unbedingt, und ahnen dabei nicht, dass das Wort allein schon den Juristen unangenehm berührt, vielleicht ebenso wie den Theologen die Frage nach Gott!, weil es uns in Verlegenheit bringt, dieses Wort Gerechtigkeit. Es ist uns unangenehm, ein wenig peinlich, so wie uns Eltern etwas niedrigerer sozialer Stellung, als wir sie selbst erwerben konnten, peinlich sind. Die Wahrheit ist, wir wissen nicht, was das ist, Gerechtigkeit! Wir suchen daher gar nicht nach ihr. Gesetze sind das, was wir statt der Gerechtigkeit anzubieten haben, Regeln, Definitionen, Verfahren. Sie zu beherrschen, ist schwer genug. Sie sind die kleine Münze, in der wir zu zahlen in der Lage sind. Daher scheint uns die Frage nach Gerechtigkeit naiv, wir haben uns abgewöhnt, sie zu stellen. Solche Gestalten kennt jedes Mitglied unserer Zunft, und nur ein ausgesprochener Anfänger kann sich ihnen nicht innerhalb von nur ein paar Minuten entziehen.
Margarethe würde ihn gleich abwimmeln, dessen war ich mir sicher. Vielleicht sollte ich einfach auf sie warten. Das Gespräch mit ihm war ihr unangenehm, sichtlich wollte sie ihn loswerden und die Unterlagen, die er ihr in die Hand drückte, nicht haben. Sie wusste, wenn sie die Papiere erst einmal in Händen hielt, blieb ihr nichts anderes übrig, als sie anzusehen, zumindest einen Blick darauf zu werfen, und sich dabei blitzschnell eine Ausrede einfallen zu lassen, um sie und den Bittsteller wieder loszuwerden und mit ihm die Frage nach Gerechtigkeit, um sich wieder ihrer eigentlichen Aufgabe zu widmen, der Kärrnerarbeit der Justiz. Gleich würde sie ihm erklären, dass sie seine Lage verstehe und ihm wirklich gerne helfen würde, aber leider, ja leider nicht zuständig sei, dass es gewiss das Beste wäre, einen Rechtsanwalt zu suchen, der sich seiner annimmt. Empfehlen? Nein, empfehlen dürfe sie niemanden, das sei ihr nicht erlaubt, aber die Anwaltskammer werde ihm weiterhelfen. Dort, ja, dort wisse man Rat, gewiss gebe es einen Anwalt, spezialisiert auf dem Gebiet, um das es gehe. Und ja, vielleicht bekomme er auch Prozesskostenhilfe; sei schließlich sein gutes Recht.
Doch das tat sie nicht. Der Alte redete auf sie ein – ich konnte leider nicht verstehen, was er sagte, dazu war ich zu weit entfernt, meinte allerdings in seiner Aussprache einen eigentümlichen Akzent zu hören, rau, guttural – redete und redete bis Margarethe sich mit einem Mal die Hand auf den Mund legte. Ich sah ihre Augen; sie waren weit aufgerissen. Der kleine Mann musste etwas gesagt haben, das sie überrascht, sogar bewegt hatte, anders war diese Geste, war ihr Ausdruck nicht zu erklären. Es war Bestürzung, die ihre Gesichtszüge formte; das sah ich, habe es jedoch erst später verstanden.
Ich war wieder einigermaßen hergestellt und hatte keinen Grund mehr, unten stehen zu bleiben. Ich wandte mich also zur Treppe, um nach oben in mein Büro zu gehen, wo meine Kunden warteten: Diebe, Räuber, Vergewaltiger … wie es gerade kam … Dabei versuchte ich Margarethes Blick auf mich zu ziehen, damit sie mir ein Zeichen geben konnte, falls sie mich brauchte, um den Alten loszuwerden. Doch sie war ihm und seinen Papieren schon ganz und gar zugewandt.
Drei Tage später stand sie in meinem Büro. Ich weiß noch, dass sie ein steifes grünes Kostüm und eine weiße Bluse anhatte, in denen sie blass und kränklich wirkte wie ein Gesicht im Neonlicht und die so gar nicht zu ihrer lebensfrohen Art passten. Wenn sie diese Art förmlicher Kleidung trug, dann immer nur ihrem Freund zuliebe – einem Freiburger Anwalt aus verarmtem Adel, den man stets im grauen Anzug antraf und der seinen ganzen Ehrgeiz daran setzte, zu dem aufzusteigen, was er als die besseren Kreise dieser Stadt bezeichnete.
»Ich möchte, dass du dir das einmal ansiehst«, sagte sie und reichte mir eine gerade angelegte Akte über den Schreibtisch. Das war nicht ungewöhnlich. Margarethe und ich tauschten uns oft aus, wenn uns ein Fall besonders beschäftigte, und da wir es in unserem Beruf nun einmal mit der dunklen Seite des Lebens zu tun hatten, und wir beide noch lange nicht so abgestumpft waren wie einige unserer älteren Kollegen, die sich auch von den Bildern eines misshandelten Kindes nicht ihren Appetit verderben ließen, geschah das an fast jedem zweiten Tag.
Was sie mir reichte, waren die Unterlagen des Alten, und sie sahen genau so aus, wie ich es erwartet hatte: zerfledderte Papiere, mit tausend Farben unterstrichene, immer wieder gelesene Dokumente, abgegriffene Blätter mit zerfaserten Rändern. Natürlich waren auch Kopien von zwei Urteilen dabei, hektografiert, in blauen Buchstaben auf jenem glasglatten beigefarbenen Papier, das ich schon seit meiner Schulzeit nicht mehr gesehen hatte, aber sofort die Erinnerung an jenen intensiven alkoholischen Geruch der Druckfarbe in mir erstehen ließ, der mir jedes Mal in die Nase gestiegen war, wenn unser Lehrer die Blätter ausgeteilt hatte.
Die erste Seite enthielt eine Strafanzeige, aufgegeben beim Polizeiposten Freiburg-Herdern im Jahr 1981 gegen – als ich die Namen las, musste ich unwillkürlich durch die Zähne pfeifen – gegen die Richter am Oberlandesgericht Dr. Joseph-Georg Müller, Thomas Meinrad und Martin von Kempf. Rechtsbeugung warf ihnen der Anzeigenerstatter vor. Was auch sonst?, dachte ich bei mir. Darunter machten es Querulanten selten. Der aufnehmende Beamte hatte sich große Mühe gegeben, den Sachverhalt so neutral zu schildern, wie er nur konnte, wenn auch bei jeder Zeile und bei jedem Wort zu spüren war, wie wenig er von dieser Anzeige hielt. Man konnte sich leicht vorstellen, wie er sie, angetan mit dem immer etwas zu engen gelbgrünen Uniformhemd unserer Polizei, vielleicht übergewichtig und ein wenig schwitzend, mit zwei Fingern in eine alte graue Schreibmaschine hämmerte. So erfuhr ich, dass am Morgen des 15. Mai 1981 der angeblich Geschädigte Hermann Mordechai Stein, geboren am 26.06.1926 in Freiburg, israelischer Staatsangehöriger, beim ›UZ‹ Polizeihauptmeister Jeckle vorgesprochen und eine Strafanzeige gegen die Mitglieder des in Freiburg ansässigen fünften Senats des Oberlandesgerichts Karlsruhe erstattet hatte. Der angeblich Geschädigte sei der Meinung, das Gericht habe in einem Verfahren auf Rückübertragung des Grundstückes Münsterweg 7 vorsätzlichdas Recht gebeugt, indem es die Klage abgewiesen und die Zulassung eines weiteren Rechtsmittels gegen diese Entscheidung ausgeschlossen habe, Vergehen strafbar nach den Paragrafen usw. usw. usf. Urschriftlich mit einer Ablichtung der angeblichrechtswidrigen Entscheidung des Oberlandesgerichts an die Staatsanwaltschaft Freiburg mit der Bitte um weitere Veranlassung. Einstellungsnachricht erwünscht …
Die weiteren Unterlagen sah ich mir gar nicht erst an.
»Hast du das von dem kleinen alten Mann?«, fragte ich Margarethe.
»Ach ja, du hast ihn gesehen«, antwortete sie. »Was hältst du davon?«
»Das fragst du mich nicht im Ernst?«, gab ich zurück. »Das ist Unsinn, reiner Unsinn. Du weißt, dass das Unsinn ist!«
»Ah …«, sagte Margarethe und blieb ganz ruhig. Sie war mein manchmal etwas schroffes Temperament gewohnt und verzieh es mir in der Regel, so wie ich ihr ihre Ausbrüche verzieh. Sie räumte die Akten von meinem Besucherstuhl, setzte sich und sah mich mit einem Ausdruck an, der zwischen Nachsicht und Tadel schwankte.
»An der Sache ist etwas faul«, sagte sie.
»Was heißt das, ›an der Sache ist etwas faul‹?«, fragte ich ungläubig. Ich konnte es nicht glauben. Sie wollte sich ernsthaft mit einer Strafanzeige wegen Rechtsbeugung befassen, auch noch mit einer Strafanzeige gegen einen ganzen Senat des Oberlandesgerichts.
»Ich habe mir die Unterlagen angesehen. Wenn du etwas weiterblätterst, findest du die Eingangsanzeige der Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 1981. Das Verfahren war hier anhängig, über zehn Jahre lang. Man hat die Beschuldigten sogar über das Verfahren informiert, aber es gibt keine Akte und es gibt keine Kartei im Haus.«
»Keine Kartei?«, wiederholte ich und wurde etwas vorsichtiger. Das war allerdings ungewöhnlich, denn mit jedem Strafverfahren – und sei es noch so banal oder aussichtslos – wurde eine Karteikarte mit den Grunddaten des Beschuldigten angelegt, die nach der Einstellung des Verfahrens noch Jahrzehnte in unserer Registratur blieb. Jedes Strafverfahren hinterließ also zumindest diese eine papierene Spur, mochten die Vorwürfe noch so haltlos und die Unschuld des Betroffenen noch so eindeutig sein. Hunderte von unbescholtenen Bürgern hatten eine Karteikarte bei uns, viele wussten es nicht einmal.
Ich sah mir die Akte etwas genauer an, bis ich auf die Eingangsanzeige und damit auf den Namen des Kollegen stieß, in dessen Hand das Verfahren 1981 gelegen hatte.
»Ich glaube, ich weiß, woran das liegen kann«, sagte ich und gab Margarethe die Akte zurück. »Maier-Rolfs hat die Sache bearbeitet.«
»Maier-Rolfs? Nie gehört. Was war mit ihm?«, fragte Margarethe.
»Du hast nie von ihm gehört? Der Mann war berüchtigt. Er war Alkoholiker und jahrelang praktisch arbeitsunfähig. Es hat nur keiner bemerkt. Damit niemandem auffiel, wie viele Fälle er verschleppte, hat er alle Akten, mit denen er nicht zurechtkam, zu sich nach Hause genommen und in seinem Keller gestapelt, bis unser Chef von einem Strafverteidiger einen Tipp bekam. Der Keller soll bis unter die Decke voll gewesen sein mit seinen unbearbeiteten Akten. Die Wachtmeister haben einen Transporter gebraucht, um sie wieder herzubringen … Vielleicht hat er Akten nicht nur gehortet, wie wir damals dachten, sondern weggeworfen.«
»Das kann natürlich sein«, gab Margarethe zu. »Ich wusste gar nichts von diesem Maier-Rolfs … Aber ich muss die Sache trotzdem zu einem Ende bringen. Ich sollte das Verfahren zumindest ordentlich einstellen. Der alte Mann war völlig außer sich, weil er nach seiner Strafanzeige weder von der Polizei noch von uns je wieder etwas gehört hat. ›Und das in Deutschland!‹, hat er immer wieder gesagt. Ich habe ihm versprochen, mich darum zu kümmern.« Sie stand auf und sah nachdenklich auf die Akte. »Ich kann ihm kaum sagen, dass seine Anzeige nicht bearbeitet worden ist, weil der zuständige Staatsanwalt getrunken hat, nicht wahr?«
»Nein, das kannst du wohl nicht«, antwortete ich, »und ich fürchte, die Sache mit der fehlenden Karteikarte musst du melden.«
Margarethe nickte und wandte sich zur Tür. Sie fühlte sich unwohl, und das nicht nur wegen des grünen Kostümchens, das ihr nicht stand und das sie ersichtlich nicht an sich mochte. Da gab es etwas anderes, was sie beschäftigte, beunruhigte.
»Keine Angst, du kommst schon an Thekla vorbei«, scherzte ich breit grinsend in dem sicher schwachen Versuch, Margarethe aufzuheitern. Die Rede war von der Sekretärin unseres Chefs, einer knochigen Sechzigjährigen mit gefärbten blonden Haaren und dem Gemüt einer Spinne, die auf ihre Beute wartet. Aufgrund irgendeiner unerklärlichen Vorahnung mussten schon ihre Eltern gefühlt haben, welches Kind ihnen geboren war, dass sie es ausgerechnet auf den Namen Thekla getauft hatten. Thekla saß nun im Vorzimmer unseres Chefs und beäugte jeden argwöhnisch, der bei ihm vorsprechen wollte – vor allem Margarethe.
»Warum beschäftigt dich der alte Mann so sehr?«, fragte ich unvermittelt, denn natürlich war es nicht der Gedanke an Thekla, der Margarethe die Tür so langsam öffnen ließ, wie sie dies nun tat.
»Der alte Mann?«, wiederholte sie. Sie zögerte einen Moment, bevor sie weitersprach, und wurde verlegen. »Nichts, es ist nicht wichtig.«
»Komm schon, raus mit der Sprache … Ich hab euch doch gesehen. Er hat dir irgendetwas gesagt.«
Margarethe sah zu Boden und holte tief Luft. »Er kannte meinen Vater«, antwortete sie endlich, wandte sich ab und ging schnell hinaus.
Ihren Vater.
2
Margarete und ich arbeiteten damals seit etwa drei Jahren zusammen. Sie kam mit etwas mehr als 30 Jahren zur Staatsanwaltschaft und hatte gerade die Ochsentour als Richterin an verschiedenen kleinen Amtsgerichten hinter sich, die die meisten Rechtsassessoren durchlaufen müssen, bevor sie endlich eine feste Stelle bekommen. Ich erinnere mich genau, wie sie bei uns anfing und das Arbeitszimmer neben meinem Büro bezog, das schon seit Jahren leer stand, weil es unter dem Dach lag und den anderen Kollegen viel zu heiß war in den berüchtigten Freiburger Sommern. Aber Margarethe fürchtete die Hitze ebenso wenig wie ich, und wie ich liebte sie den Blick über das Meer der Dächer, den wir von unseren ansonsten dunklen und schmucklosen Mansarden aus genossen.
An ihrem ersten Tag hatte ich Sitzungsdienst in mehreren Strafverhandlungen und konnte daher nicht bei dem kleinen Begrüßungstreffen sein, das unser Chef für sie organisiert hatte. In der Mittagspause klopfte ich an ihre Tür, um mich als Büronachbar und neuer Kollege vorzustellen, und fand sie fröhlich und schwitzend inmitten dreier Umzugskisten stehen. An jenem Tag trug sie ein weißes T-Shirt, eine verwaschene Jeans und Leinenschuhe. Ihr wildes aschblondes Haar hatte sie mit einem hellen Kopftuch zu bändigen versucht und nach hinten gebunden. Als sie mich sah, machte sie einen Satz, um über die Kisten zu springen und kam in burschikosen Schritten auf mich zu. Sie war ein wenig größer als ich und entsprach mit ihren kräftigen Schultern und breiten Hüften ganz dem Bild der selbstbewussten blonden Deutschen, das durch die Köpfe italienischer Männer geistert. Ich mochte sie sofort – aber nicht nur deswegen.
»Sie müssen Tedeschi sein«, sagte sie und drückte mir so fest die Hand, dass ich unwillkürlich zusammenzuckte. »Margarethe Heymann. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ich finde übrigens, wir können uns duzen.«
»Oh, ich hoffe, nichts allzu Schlechtes«, antwortete ich ungeschickt und fragte mich, wie ich wohl zur Ehre dieses frühen Du kam, das mir seit dem Studium niemand mehr so leicht angetragen hatte. »Antonio, ich heiße Antonio.«
»Ich weiß«, sagte Margarethe, »ich heiße Margarethe. Weißt du, die Amtsrichter kennen und fürchten dich.«
»Die Amtsrichter fürchten mich, aber wieso denn?«
»Wieso? Na, weil du ihnen widersprichst«, antwortete sie mit einem schelmischen Blick.
»Oh«, sagte ich ehrlich erstaunt, »und so etwas fürchten sie?«
»So etwas fürchten sie.« Sie lachte und zwinkerte mir zu.
Ich wurde ein wenig verlegen und wusste nicht recht, was ich antworten sollte. Dabei muss ich gestehen, dass es vielleicht den ein oder anderen Amtsgerichtsdirektor gab, mit dem ich hin und wieder, nicht wirklich oft, aber eben ab und zu ein kleines Scharmützel in Sachen Prozessrecht hatte ausfechten müssen. Das musste man verstehen. Die Herren hatten den Zenit ihrer Karrieren überschritten und weder mit Versetzung noch gar mit einer Beförderung zu rechnen. Da ihnen in den Kleinstädten, wo sie arbeiteten, der Austausch mit Juristen fehlte, die ihnen auf Augenhöhe begegneten, war es kaum verwunderlich, wenn ihr Wissen nicht immer auf dem neuesten Stand blieb und sich ein paar schlechte Gewohnheiten in ihre Verhandlungsführung einschlichen. Ich dachte, es sei meine Pflicht als deutscher Staatsanwalt, hier ein Gegengewicht zu bilden, und wunderte mich, Kollegen zu haben, die dies für ungewöhnlich genug hielten, um sich hierüber zu unterhalten. War es nicht die unverbrüchliche Treue zum Recht, die dieses Land trug? In Italien wäre es unhöflich, einen Richter daran zu erinnern, dass es die Prozessordnung einzuhalten galt – so vermutete ich wenigstens – aber in Deutschland?
Zwischen Margarethe und mir blieb ein Augenblick verlegenen Schweigens. Wie sie mir später einmal gestand, dachte sie, sie hätte mich mit dieser Bemerkung verletzt und einmal mehr ihre Offenheit bereut, mit der sie Menschen begegnete, wenn sie sie sympathisch fand.
Gerade in diesem Moment fiel mein Blick auf ein kleines Figürchen, das auf ihrem Schreibtisch stand und mit dem ich an dieser Stelle am wenigsten gerechnet hätte: Es war ein Schlumpf, genauer, ein boxender Schlumpf.
»Der ist ja nett«, rief ich aus und hielt den kleinen blauen Kämpfer mit seinen roten Boxhandschuhen und dem hübschen Grinsen hoch.
»Der ist toll, nicht?«, sagte Margarethe genauso enthusiastisch wie ich, ballte die Fäuste und nahm die Grundstellung ein. »Das ist Manni Boxschlumpf, das Maskottchen unseres Frauenboxrings.«
»Ich sehe, meine neue Büronachbarin ist voller Überraschungen«, antwortete ich und konnte es mir nicht verkneifen, gleichfalls die Fäuste zu heben, sodass wir uns mit einem Mal gegenüberstanden, als warteten wir auf den Gong zur ersten Runde. Dabei gaben wir sicher ein ziemlich dummes Bild ab. Und natürlich tauchte genau in dem Moment ein großer schlanker Mann im dunkelgrauen Dreiteiler im Türrahmen auf, der uns verständnislos ansah und unangenehm berührt schien.
»Oh Schatz, schön, dass du da bist«, sagte Margarethe und ging lachend auf den Besucher zu. »Darf ich vorstellen, Eckhard von Hansen, mein Freund, Antonio Tedeschi, ein neuer Kollege.«
»Sehr erfreut«, sagte ich und reichte von Hansen die Hand. »Ich nehme an, das sah jetzt komisch aus. Es ist nur, weil wir den Boxschlumpf …«
»Angenehm«, erwiderte von Hansen kühl und blickte dabei – er war einen Kopf größer als ich – so blasiert auf mich herab, dass jede weitere Erklärung überflüssig wurde. Er konnte mich nicht ausstehen, und man sah ihm förmlich an, wie er sich gerade fragte, was denn wohl dieser kleine übergewichtige Itaker bei der Staatsanwaltschaft zu suchen hatte. Er hielt mich keiner weiteren Aufmerksamkeit mehr für würdig und wandte sich wieder an Margarethe.
»Ich wollte dich zum Essen abholen«, sagte er in einem Ton, der bei aller Höflichkeit klang wie Galle. »Wir waren verabredet, hast du das vergessen?«
In dem Moment entdeckte ich die Narbe auf seiner Wange, drei Zentimeter lang, knapp unter dem Jochbein, nicht sehr groß, aber doch auffällig genug, um von jedem, der sie erkennen sollte, auch erkannt zu werden. Es war ein Schmiss, eindeutig. Der Herr war Burschenschaftler und seine Verbindung schlagend. Mit Grauen erinnerte ich mich an diese Herrschaften, die mir während des Studiums zum ersten Mal begegnet waren: Söhne aus wohlhabenden Häusern und solche, die zumindest dafür gehalten werden wollten, die in Streifenhemden und flaschengrünen Pullovern – zu meiner Zeit war es niemals eine andere Farbe – in den Vorlesungen saßen und in den Pausen mit ihren guten Beziehungen und ihrer exzellenten Herkunft prahlten, eine Herkunft, die sie allerdings selten davon abhielt, an den Paukabenden in ihren Burschenschaftshäusern eimerweise Bier in sich hineinzuschütten, gegen Mitternacht alle vier Strophen des Deutschlandlieds zu grölen, um sich danach glücklich zu übergeben und halb ohnmächtig in ihrem Erbrochenen einzuschlafen …
»Vergessen? Natürlich nicht«, antwortete Margarethe kopfschüttelnd. Ihr konnte nicht entgangen sein, wie groß die Antipathie war, die zwischen mir und von Hansen herrschte. »Ich bin doch hier.«
Ich hielt es für klüger, zu gehen, und verabschiedete mich unter dem Vorwand, den nächsten Gerichtstermin vorbereiten zu müssen, was von Hansen mit so etwas wie einer überheblich zur Schau getragenen Erleichterung und Margarethe mit einem entschuldigenden Lächeln quittierte.
»Wohin führst du mich denn?«, hörte ich Margarethe noch fragen, während ich hinausging, und ihn »in den Salatgarten!« antworten. Überflüssig zu erwähnen, dass er Margarethe für zu dick hielt und ihr immer wieder damit in den Ohren lag, ein wenig mehr auf ihre Figur zu achten.
Margarethe und ich wurden Freunde, obwohl von Hansen mich nicht leiden konnte. Wir erwähnten ihn einfach nicht. Es war für uns, als ob es ihn nicht gäbe. Darin waren wir uns einig, ohne ein Wort zu verlieren. Der Preis, den wir für diese Übereinkunft bezahlten, war allerdings hoch. Sie konnte mich kaum zu sich einladen, selbst der Feier zu ihrem 33. Geburtstag blieb ich fern, und musste sich immer wieder von ihm anhören, wie wenig der Umgang mit mir angemessen sei. Ich dagegen fragte nicht nach, warum sie an viel zu vielen Tagen mit von Tränen geschwollenen Augen zur Arbeit kam, denn ich wusste oder ahnte, dass sie sich mit van Helsing – wie ich ihn bald nannte – gestritten hatte. Vielleicht, weil sie sich nicht in die Rolle fügen mochte, die er und seinesgleichen ihr zugedacht hatten, vielleicht aus irgendeinem anderen, nichtigen Anlass. Hätte ich sie darauf angesprochen, sie hätte sich mir offenbaren und ihn dadurch verraten müssen, und das brachte sie nicht übers Herz.
»Hey, Antonio, boxt du auch?«, rief sie mir ein paar Tage später nach, als wir uns zufällig auf dem Gang begegneten.
»Früher war ich mal aktiv, aber das ist lange her, wie man mir ansieht«, sagte ich und zeigte mit entschuldigender Geste auf meinen Bauchansatz, den ich zwischenzeitlich auch mit meinem weitesten Leinenanzug nicht mehr kaschieren konnte. »Als ich 13 war, konnte mein Vater es einfach nicht mehr mit ansehen, wie ich jeden Tag mit einer blutigen Nase von der Schule nach Hause kam, und hat mich in einen Verein geschickt, in dem ein Cousin von ihm trainierte.«
»Und, wurde es besser? Ich meine mit der blutigen Nase?«, fragte Margarethe.
»Irgendwann schon«, antwortete ich, »nachdem ich dem Sohn des Dorfmetzgers ein Veilchen verpasst hatte, ließ man mich in Ruhe. Dafür nannten sie mich dann einen Schläger.«
Margarethe prustete laut los vor Lachen; offenbar machte ich keinen allzu harten Eindruck auf sie. »Du, ein Schläger? Wie kamen die denn da drauf?«
»Na ja, das ist einfach: Wenn deine deutschen Klassenkameraden dich verprügeln wollten und du als Italiener einfach abgehauen bist, warst du natürlich ein Feigling. Wenn du dich gewehrt und dafür eins auf die Nase bekommen hast, warst du ein Schwächling, und wenn du dem Metzgerjungen ein Veilchen verpasst hast, warst du ein Schläger. Aber das ging nur so lange, bis die Türken kamen. Von da an waren die die Schläger. Das war eine große Entlastung für die italienische Gemeinde in Sindelfingen. Die Türken hatten allerdings Pech. Die mussten warten, bis die Albaner kamen, und das hat gedauert.«
»Klingt ein wenig verbittert«, sagte Margarethe.
»Ist es vielleicht auch«, sagte ich. »Aber, hey, sieh mich an: Ich bin ein eingebürgerter Italo-Schwabe, voll integriert und isch ’abe sogar ein Auto, Signorina.«
»Du heißt ja auch nicht Angelo«, entgegnete Margarethe schnippisch.
»Und ich mag keinen Cappuccino!«
»Ah …«, sagte Margarethe.
3
Und jetzt also ihr Vater. Schon als sie zum ersten Mal davon sprach, dass der kleine alte Mann ihren Vater gekannt hatte, hätte ich wissen müssen, dass sie den Fall nicht einfach abschließen und vergessen konnte. Etwas Dunkles, Unergründetes lag um diesen Vater, den sie in ihrem Leben kaum hatte kennenlernen dürfen, und an den sie sich, wie sie mir einmal anvertraut hatte, nur in verblassten Bildern zu erinnern vermochte. Er war verstorben, noch bevor sie die Grundschule beendet hatte, war ihr aber auch zu seinen Lebzeiten fremd geblieben, fremd und schwer zu greifen.
Es gab eine Fotografie von diesem Vater, ausgestellt in einer kleinen Vitrine, mit der sie ihr Arbeitszimmer geschmückt hatte, und in der sie einige Schätze ihres Lebens verwahrte: Ein schmaler, nachdenklicher Mann mit feinen Gesichtszügen und großen Augen. Obwohl es sich um ein Schwarz-Weiß-Bild handelte, schien es mir sicher, dass er von bleichem Teint war, die Haare, die Augen und Augenbrauen jedoch waren dunkel, vielleicht sogar schwarz. Zusammen mit den hohen Wangenknochen gaben sie dem Gesicht eine zarte, fast weibliche Schönheit, in der man Margarethes Züge wiederfand. Seine Augen standen fern, als ruhte sein Blick auf etwas, das weit, weit draußen lag.
Margarethe machte sich auf die Suche. Tagelang durchkämmte sie Registratur und Keller, zog unseren Archivar ins Vertrauen und durchmaß gemeinsam mit ihm Regalmeter um Regalmeter abgelegter Akten. Was sie unternahm, war nicht die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, es war schlimmer. Es war die Suche nach dem Halm. So unwahrscheinlich es auch sein mochte, dass sie die Akte zwischen all den anderen Akten finden würde, so sicher und unbeirrt blieb sie bei der Suche. Denn an einer Kleinigkeit sollte diese zu identifizieren sein, wie ihr unser Archivar, ein schrulliger Fünfzigjähriger mit dicken Brillengläsern und feuchten Augen, begeistert von ihrer detektivischen Mission erklärte: Zu erkennen war die Akte an der fehlenden Ablagenummer.
»Ablagenummer?«, wiederholte ich erstaunt, als sie mir vom Herrn unserer Archive berichtete, einer Art menschlichen Maulwurfs, der von uns Staatsanwälten beinahe ebenso gemieden wurde wie Thekla – nicht etwa weil er unfreundlich war, sondern weil man sich schon zu langweilen begann, wenn man ihn nur sah, in etwa so wie bei dem Ausdruck ›Ablagenummer‹.
»Ablagenummer!«, bestätigte Margarethe.
Dem Archivar oblag es, alle erledigten Verfahren zu ordnen und in unseren Kellern für die nächsten Jahre aufzubewahren, bis sie weitergeleitet wurden an das Zentralarchiv. Hierzu gab er jedem Aktenstück eine Nummer, die er in großen Ziffern auf den Aktendeckel auftrug, sodass sie bei der Durchsicht leicht zu sehen war. Da er hierzu eine eigene Kartei führte, für deren Vollständigkeit er mit dem verbliebenen Rest seines spärlichen Augenlichts zu bürgen bereit war, musste eine im Archiv versteckte Akte entweder an der fehlenden oder einer doppelt vergebenen Nummer zu erkennen sein.
Sie fanden nichts. Nach drei Tagen zuckte sogar der Maulwurf mit den Schultern, nahm die Brille von der Nase, putzte die dicken Gläser und bedeutete Margarethe resigniert, er gebe auf, obwohl ihm bewusst sein musste, dass er damit die gesamte weibliche Aufmerksamkeit wieder verlor, die ihm in den letzten Tagen so ersichtlich gutgetan hatte – gewiss mehr weibliche Zuwendung, als ihm sonst während eines ganzen Jahres seines dunklen und staubigen Lebens zuteil geworden war.
Margarethe dagegen gab nicht auf, fasste sich ein Herz und rief bei ihrem Vorgänger an, dem Mann, der sein Amt auf nicht allzu rühmliche Weise hatte aufgeben müssen, weil er die Akten, anstatt zu bearbeiten, in seinem Keller gehortet hatte.
Staatsanwalt a. D. Dieter Maier-Rolfs bewohnte die Parterre-Wohnung seines Elternhauses in der oberen Wintererstraße, Freiburgs erster Adresse, das er wegen seiner vorzeitigen Pensionierung und anschließenden Scheidung nicht mehr hatte halten, dafür aber doch geschickt in drei Eigentumswohnungen aufteilen können, von welchen er eine verkaufen und die zweite seiner Frau überschreiben musste, um sie abzufinden. Er begrüßte Margarethe erstaunlich liebenswürdig und führte sie in ein mit alten Möbeln bescheiden, aber ordentlich eingerichtetes Wohnzimmer, dessen breite Fensterfront in den Osten zeigte, sodass es den Blick von den Höhen des Schlossbergs auf die halbe Stadt freigab. Der alte Herr war nicht allzu gut rasiert, trug jedoch ein frisches Hemd. Er hatte eine Krawatte angelegt, Tee zubereitet und den Tisch gedeckt.
»Es kommt nicht alle Tage vor, dass man Besuch von Kollegen bekommt«, sagte er freundlich und bat Margarethe, Platz zu nehmen. »Wie geht’s der alten Truppe?«
»Gut! Jammert über zu viel Arbeit und verlässt das Büro trotzdem freitags um drei«, antwortete Margarethe, die sich hatte sagen lassen, dass Maier-Rolfs Spaß verstand.
»Na, dann hat sich ja nichts geändert!«, bemerkte er vergnügt und schenkte ihr mit leicht zitternder Hand ein. »Und Meißner?«, fragte Maier-Rolfs weiter, während er Zucker in seine Tasse gab.
»Ist zwischenzeitlich befördert: Leitender Oberstaatsanwalt«, sagte Margarethe, obwohl ihr nicht wohl war bei diesem Namen. Maier-Rolfs’ vorzeitige Pensionierung ging, wie sie jetzt wusste, auf Meißner zurück, und sie fürchtete, er mochte mit seinem früheren Chef nicht die angenehmsten Erinnerungen verbinden.
»LOSTA also, alle Achtung! Dann hat er ja erreicht, was er erreichen wollte«, setzte Maier-Rolfs die Unterhaltung ungerührt fort. »Was halten Sie von ihm?«
»Ich komme gut aus mit unserem Chef,« antwortete Margarethe, obwohl sie das Thema lieber schnell gewechselt hätte.
»Ist ein guter Mann«, sagte Maier-Rolfs zu ihrem Erstaunen. »Er hat mir damals das Leben gerettet. Mit einem Tritt in den Hintern zwar, aber den habe ich offenbar gebraucht.«
»Ah …«, bemerkte Margarethe nur.
»Sie wissen bestimmt, wieso ich in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde«, begann Maier-Rolfs und sah dabei aus dem Fenster auf die Stadt, die vor ihnen lag wie ein unbewegter roter See.
»Ich habe etwas gehört«, antwortete Margarethe beiläufig.
»Ich habe getrunken, ziemlich viel, schon morgens nach dem Aufstehen«, sagte Maier-Rolfs, als ob Margarethe nicht geantwortet hätte. »Stellen Sie sich vor, nachdem ich zwangspensioniert war, habe ich keinen Tropfen mehr angerührt, noch nicht einmal als meine Frau mir offenbarte, dass sie ein Leben neben einem Versager wie mir nicht mehr ertragen konnte. Keinen Tropfen – ohne die geringste Mühe! Und wissen Sie warum?«
»Nein.«
»Weil ich keine Fälle mehr hatte! Weil ich diese Akten nicht mehr sehen musste. Weil ich … frei war.« Maier-Rolfs lächelte Margarethe offen an und reichte ihr den Teller mit den Keksen. »Sie hatten doch bestimmt schon Verfahren, die sie nicht losgelassen haben. Fälle, die sie den ganzen Tag beschäftigen und ihnen nachts den Schlaf rauben, nicht wahr? Sie wachen auf, morgens um vier, und denken an ihren Fall; sie versuchen wieder einzuschlafen, wälzen sich im Bett und denken an den Fall. Sie stehen gerädert auf – und denken an den Fall. Jeder in unserem Beruf hat das erlebt. Manchmal hat man zu großes Mitleid mit dem Opfer, manchmal ist einem der Angeklagte besonders zuwider oder wir haben Angst vor seinem Verteidiger, weil der uns schon einmal reingelegt hat … Wir wollen das Verfahren gewinnen, unbedingt, und stehen deswegen dauernd unter Spannung. Den meisten Kollegen, die ich kenne, und mit denen ich darüber gesprochen habe, passiert das ein, höchstens zwei Mal im Jahr und das ist schon schlimm genug.« Er schwieg einen Augenblick und sah dabei zu Boden. »Wissen Sie, wie oft ich das erlebt habe?«
Margarethe schüttelte den Kopf.
»Jeden Tag, jede Nacht … Jeden Tag und jede Nacht meines vermaledeiten Berufslebens«, sagte Maier-Rolfs. »Können Sie sich das vorstellen? Es war die Hölle – zumindest kommt es meiner Vorstellung von Hölle ziemlich nah. Ich wurde meine Fälle nicht los. Sie verfolgten mich 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, das ganze Jahr. Ich trank, um einen Moment Ruhe zu finden vor den Verfahren, um die Akten zu vergessen, die ich nicht mehr bearbeiten konnte, um einzuschlafen … und obwohl ich jeden Abend betrunken ins Bett fiel, voll wie eine Haubitze, bin ich Morgen für Morgen um vier Uhr aufgewacht und grübelte weiter über meine Fälle.«
Maier-Rolfs verstummte, sein Gesicht schien grau. Es war, als habe ihn mit einem Mal so etwas wie bleierne Müdigkeit ergriffen, als genügte bereits die Erinnerung an jene schwere Zeit, um ihm jede Kraft zu nehmen. Er lächelte müde. Schließlich atmete er tief durch, seine Miene hellte sich auf und er nickte. »Aber das ist jetzt vorbei, ich bin erlöst. Ich schlafe wieder. Es geht mir gut.« Er nahm seine Tasse und trank einen Schluck Tee. Dann sah er Margarethe versonnen an. »Und jetzt zu Ihnen«, sagte er. »Ich glaube kaum, dass Sie hierhergekommen sind, um sich die Lebensgeschichte eines überforderten alten Staatsanwalts anzuhören. Was kann ich für Sie tun, Frau Kollegin?«
Margarethe stellte ihre Tasse ab und sah Maier-Rolfs in die Augen. Sie mochte diesen Mann und das würde ihr helfen, ihm einige Fragen zuzumuten, die in die Zeit der Schlaflosigkeit zurückreichten. »Ich suche nach einer Akte, die Sie einmal bearbeitet haben. Vielleicht erinnern Sie sich. Eine Strafanzeige gegen drei Richter des Oberlandesgerichts …« Mehr brauchte sie nicht zu sagen. Die Tasse in der Hand des alten Herrn zitterte und klingelte wie ein Glöckchen. Er stellte sie auf den Tisch vor sich und atmete tief durch. Margarethe ließ ihn nicht aus den Augen und wartete.
»Ja«, sagte er mit trockener Stimme, »ich kann mich an das Verfahren erinnern, sogar gut erinnern. Es ging um einen jüdischen Kaufmann und ein Grundstück in Freiburg. Ich meine, sein Sohn hätte die Anzeige erstattet. Rechtsbeugung, darum ging es. Gut möglich, dass ich die Akte damals mit nach Hause genommen habe … wie viele andere auch.«
»Dann wäre sie bei denen gewesen, die in Ihrem Keller gefunden wurden«, meinte Margarethe.
»Müsste sie«, sagte Maier-Rolfs abweisend und zuckte scheinbar gleichgültig mit den Schultern. Er war leicht zu durchschauen. Margarethe konnte gar nicht entgehen, wie er sich abzuschotten versuchte. Sie wusste, sie hatte einen bestimmten Punkt berührt, ein wenig so, wie bei einer empfindlichen Pflanze, die ihre Blüte verschließt, wenn man über ihre Blätter streicht.
»Wir haben die Akte gesucht, mehrere Tage lang. Sie ist nicht bei uns im Archiv«, sagte Margarethe mit klarer Stimme. »Sie wüssten nicht, wo sie sein könnte?«
»Nein, nein«, antwortete Maier-Rolfs schnell – viel zu schnell.
»Könnte es nicht sein, dass …«, begann Margarethe vorsichtig, »dass Sie damals die Akten nicht nur in Ihrem Keller aufbewahrt, sondern vielleicht auch einige weggeworfen haben?«
Maier-Rolfs schüttelte den Kopf. »Nein!«, sagte er, diesmal ganz im Brustton der Überzeugung. »Weggeworfen habe ich eine Akte nie, keine einzige. Dazu war ich viel zu sehr Beamter.«
»Ja, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Da sind wir alle gleich!«, sagte Margarethe und lachte. »Aber vielleicht haben Sie sie nicht nur im Keller aufbewahrt, sondern auch noch an einem anderen Ort. Es ist lang her und Sie waren krank damals, vielleicht haben Sie es vergessen.« Sie hielt einen Augenblick inne, um ihre Worte auf ihr Gegenüber wirken zu lassen.
Maier-Rolfs schwieg, und Margarethe wunderte sich, wie still es in diesem Zimmer auf einmal war. Kein Laut drang durch die breite Fensterfront, nicht der Pfiff eines Vogels, kein Geräusch eines Motors, kein von Menschen gesprochenes Wort. Sie sah Maier-Rolfs weiter freundlich an. Sie wusste, er würde, ja, er konnte ihr nur dann helfen, wenn er dabei nicht sein Gesicht verlor. Sie musste ihm Zeit geben.
»Es wäre nicht weiter schlimm«, fuhr sie fort. »Es wäre Teil Ihrer Krankheit, die Sie aus eigener Kraft überwunden haben. Niemand würde es Ihnen vorwerfen. Die Verfahren, die gegen Sie geführt wurden, sind abgeschlossen. Es kann Ihnen nichts mehr geschehen.«
Maier-Rolfs antwortete nicht. Das war besser, als weiter zu lügen, dachte Margarethe. Aber wie könnte sie ihm jetzt eine Brücke bauen? Wenn er ihr nicht sagen würde, wo die Akte geblieben war, musste sie eine Durchsuchung anordnen. Und wenn sie die Akte dabei nicht fand, weil er sie zu gut versteckt hatte?
»Helfen Sie mir, bitte!«, sagte sie plötzlich. Sie wusste selbst nicht, wie sie dazu kam, so mit ihm zu sprechen. Sie sah ihn an und fühlte, wie sie ein wenig rot wurde. Maier-Rolfs dagegen senkte den Kopf und blickte betreten zu Boden. Sie sollte nicht sehen, dass er sich schämte. Margarethe fühlte, wie er mit sich rang.
»Es war anders«, sagte er nach einer Weile. »In diesem Fall war es anders.«
»Ja?«, sagte Margarethe.
»Ich wollte das Verfahren führen, so wie es sich gehört«, begann er stockend. »Irgendwann habe ich bemerkt, dass Aktenteile verschwunden sind. Irgendjemand hat sie gestohlen – bei der Staatsanwaltschaft. Da habe ich sie hierher gebracht, um sie … um sie zu schützen. Ich wollte die Akte schützen.«
»Verstehe«, sagte Margarethe, »Sie haben die Akte geschützt. Das war gut.«
»Ja!«, sagte Meier-Rolfs, der sie wieder ansah, wenn auch mit eigentümlich starrem Blick. »Das war das Einzige, was ich tun konnte.«
»Ja«, sagte Margarethe. »Das war richtig. Aber jetzt können Sie sie mir geben. Ich werde mich darum kümmern.«
Maier-Rolfs nickte erneut, und seine Mundwinkel zuckten. »Kümmern, das ist gut«, sagte er, stand auf und ging zu einem großen Eichenschrank, der der breiten Fensterfront gegenüber an der Stirnseite des Zimmers stand. Er angelte einen kleinen Schlüsselbund aus seiner Strickjacke, schloss auf und öffnete beide Türen. Der Schrank war leer, leer bis auf ein altes Kaffeeservice und eine einzige Akte. Der ehemalige Staatsanwalt hielt sich die Brust, als bekäme er schwer Luft, dann nahm er die Akte und drehte sich Margarethe zu. Der starre Ausdruck seiner Augen verließ ihn keine Sekunde.
»Ich nehme an, das ist die Akte, die Sie vermissen, Frau Kollegin«, sagte er kaum hörbar. Er kam Margarethe vor wie eine Puppe.
Margarethe stand auf, ging zu Maier-Rolfs und strich ihm über die Schulter. Er war ein kranker Mann, aber er war nicht böse. Dann nahm sie ihm die Akte aus der Hand. ›Ermittlungsverfahren gegen Dr. Joseph-Georg Müller, Thomas Meinrad und Martin von Kempf wg Rechtsbeugung‹ stand auf dem grauen Vorblatt. Endlich schien sich Maier-Rolfs verkrampfter Blick zu lösen.
»Wie konnten Teile der Akte verschwinden?«, fragte Margarethe, nachdem Maier-Rolfs sich beruhigt hatte.
Er zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht!« antwortete er, sichtlich bemüht, seine Fassung zu wahren. »Sie wissen ja, wir schließen unsere Büros nicht ab. Jeder konnte an meinen Schreibtisch.«
Margarethe nickte. So wie damals war es heute noch. »Und wo ist die Karteikarte?«, fragte sie.
»Die Karteikarte?«, wiederholte Maier-Rolfs verständnislos.
»Die Karteikarte zu dieser Akte«, erklärte sie. »Es gibt zu dieser Akte hier keine Kartei.«
Maier-Rolfs zuckte mit den Schultern. »Das tut mir leid, aber damit habe ich nichts zu tun. Die Karteikarten habe ich nie an mich genommen. Daran habe ich noch nicht einmal gedacht. Sie können das überprüfen, Sie werden die Karten zu den anderen Akten ganz sicher finden.«
»Aber, was ist mit der Karte zu dieser Akte geschehen?«, fragte Margarethe.
»Ich weiß es nicht. Ich schwöre!«, beteuerte Maier-Rolfs eigentümlich heftig. Margarethe fiel auf, dass er schwitzte. Er sah sich um, so als wäre jemand heimlich in seine Wohnung getreten, vor dem man sich in Acht nehmen musste. Dann ging er ganz nah an Margarethe heran, so nah, dass sie seinen Altherrenatem riechen konnte.
»Nehmen Sie sich in Acht«, flüsterte er ihr ins Ohr, »sie sind überall.« Kaum hatte er das gesagt, nahm er den verlegenen Ausdruck eines kleinen Jungen an und blickte wieder zu Boden.
»Ah …«, sagte Margarethe.
4
Die Familie des jüdischen Kaufmanns Jakob Stein lebte schon seit mehreren Generationen in Freiburg. Sie betrieb zunächst ein kleines Aussteuergeschäft und später unter der Adresse Münsterweg 7 ein beliebtes und gut gehendes Kaufhaus. Anfang der Dreißigerjahre galt Jakob Stein als angesehenes Mitglied der jüdischen Gemeinde und zugleich als glühender deutscher Patriot. Er war im Krieg ausgezeichneter Frontkämpfer und gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Freiburger Sektion des Centralvereins der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens





























