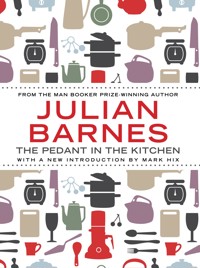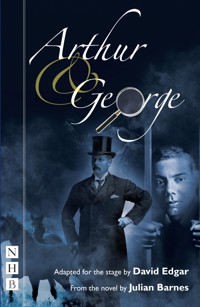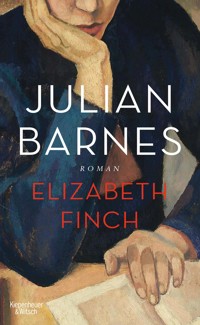9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit Esprit gewürzt und Witz getränkt – Julian Barnes kocht Wer selber kocht, der weiß: Zwischen Rezept und fertigem Gericht können Welten liegen. Ob das Ergebnis zu Triumph oder Niederlage führt – bei der Lektüre des Rezepts dominiert vor allem der Zweifel. Der Pedant in der Küche, der keinen Fehler machen möchte, gläubig und ängstlich Kochbücher konsultiert, sieht sich vielen Unwägbarkeiten ausgesetzt. Wie groß ist eine mittelgroße Zwiebel, wie heiß schwache Hitze? Und wie viel Salz ist eine Prise?Er möchte doch alles richtig machen: gutes und schmackhaftes Essen zubereiten, seine Freunde nicht vergiften, sein Repertoire langsam erfolgreich erweitern.Ein Muss für jeden, der gern kocht, ein Muss für jeden, der gern isst. »Und schon ist es passiert: reines Entzücken über ein wunderbares, kluges, witziges, realistisches, verträumtes Buch!« (Essen & Trinken)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Julian Barnes
Fein gehackt und grob gewürfelt
Der Pedant in der Küche
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Julian Barnes
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Julian Barnes
Julian Barnes, geboren 1946, erhielt zahlreiche europäische und amerikanische Literaturpreise, zuletzt den Man Booker Prize. Er hat ein umfangreiches erzählerisches Werk vorgelegt, u.a. die Romane »Flauberts Papagei«, »Die Geschichte der Welt in 10½ Kapiteln«, »Darüber reden« und »Arthur & George«. Sein Roman »Vom Ende einer Geschichte« verkaufte sich über 130000 Mal.
Die Übersetzerin
Gertraude Krueger, 1949 geboren, lebt als Dozentin und freie Übersetzerin in Berlin. Zu ihren Übersetzungen gehören u.a. Sketche der Monty-Python-Truppe und Werke von Julian Barnes, Alice Walker, Valerie Wilson Wesley, Jhumpa Lahiri und E. L. Doctorow.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wer selber kocht, der weiß: Zwischen Rezept und fertigem Gericht können Welten liegen. Ob das Ergebnis zu Triumph oder Niederlage führt – bei der Lektüre des Rezepts dominiert vor allem der Zweifel. Der Pedant in der Küche, der keinen Fehler machen möchte, gläubig und ängstlich Kochbücher konsultiert, sieht sich vielen Unwägbarkeiten ausgesetzt. Wie groß ist eine mittelgroße Zwiebel, wie heiß schwache Hitze? Und wie viel Salz ist eine Prise?
Er möchte doch alles richtig machen: gutes und schmackhaftes Essen zubereiten, seine Freunde nicht vergiften, sein Repertoire langsam erfolgreich erweitern.
Ein Muss für jeden, der gern kocht, ein Muss für jeden, der gern isst.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Anmerkung der Übersetzerin
Ein kochender Spätzünder
Vorsicht: Pedant am Werk
Man nehme zwei mittlere Zwiebeln
Wie es im Buche steht
Der Zehnminuten-Maestro
Nein, das mach ich nicht
Der Kaktus und der Fächerpantoffel
Der Klapperstorch
Die guten Gaben Gottes
Service mit bösem Blick
Einmal und nie wieder
Und keiner sagt mir was!
Lob der Einfachheit
Im Purpurkleid
Keine Einladung zum Dinner
Die unterste Schublade
Die Moral des Ganzen
Für die Bekochte
Anmerkung der Übersetzerin
Wie jedes Land seine kulturellen Besonderheiten, seine nationale Küche und seine nationalen Spezialitäten hat, so hat es auch seine Kochbuchklassiker, seine Meisterköche und kulinarischen Zitierautoritäten: In Großbritannien hat Mrs Beeton die Küche von Generationen ebenso geprägt wie hierzulande Henriette Davidis, und die Bücher von Elizabeth David und Jane Grigson gelten noch heute als Standardwerke.
Es ist daher nur natürlich, dass Julian Barnes sich mit anderen Autoren auseinandersetzt, als es ein kochender Schriftsteller in Deutschland, Österreich oder der Schweiz tun würde.
Einige dieser Werke liegen auch auf Deutsch vor, bei anderen wird man sich an Namen und Werke erinnert fühlen, die aus der eigenen Küche, Familie oder Geschichte vertraut sind – und die Freuden und Leiden pedantischer Köche sind sicherlich grenzüberschreitend.
Gertraude Krueger
Ein kochender Spätzünder
Als Koch bin ich ein Spätzünder. In meiner Kindheit blieb das Geschehen in Wahlkabine, Ehebett und Kirchenbank hinter dem Schleier konventioneller Vornehmheit verborgen. Mir fiel gar nicht auf, dass es in einem mittelständischen englischen Haushalt noch einen vierten geheimen – jedenfalls für Jungen geheimen – Ort gab: die Küche. Aus der kamen Mahlzeiten und meine Mutter heraus; die Mahlzeiten basierten oft auf den Gartenerträgen meines Vaters, doch weder er selbst noch mein Bruder oder ich fragten je, wie diese Verwandlung zustande gekommen war, und wir wurden auch nicht dazu ermuntert. Niemand ging so weit zu behaupten, Kochen sei Weiberkram; die Männer im Haus hatten einfach nicht das Zeug dazu. An Schultagen machte mein Vater morgens das Frühstück – aufgewärmten Porridge mit goldgelbem Sirup, Speck und Toast, während seine Söhne zum Schuheputzen und zur Versorgung des Küchenherds eingeteilt waren: Asche auskratzen, Koks nachfüllen.
Mit solchen morgendlichen Handlangerdiensten war die Grenze der männlichen Küchenkompetenz aber schon klar erreicht. Das zeigte sich einmal in aller Deutlichkeit, als meine Mutter verreisen musste. Mein Vater machte mir mein Lunchpaket zurecht, und da ihm das Prinzip des Sandwichs fremd war, tat er liebevoll kleine Extras dazu, von denen er wusste, dass ich sie besonders gern mochte. Dieses Paket öffnete ich dann etliche Stunden später in einem Southern-Region-Zug zu einem auswärtigen Sportplatz vor den Augen meiner Rugby-Kameraden. Meine Sandwiches waren aufgeweicht, in ihre Bestandteile zerfallen und knallrot von den väterlichen Rote-Bete-Scheiben; sie erröteten für mich wie ich für ihren Schöpfer.
Auch sonst war es mit dem Kochen so wie mit Sex, Politik und Religion: Als ich allmählich selbst dahinter kam, konnten meine Eltern mir nichts mehr darüber erzählen. Sie hatten mich nicht aufgeklärt, und zur Strafe würde ich sie jetzt nicht fragen. Mit Mitte zwanzig studierte ich Jura, aber die Gerichte, die ich ausheckte, waren mitunter kriminell. Ganz oben auf meiner Liste stand Nackenkotelett mit Erbsen und Kartoffeln. Die Erbsen kamen natürlich aus der Tiefkühltruhe, die Kartoffeln aus der Dose, wo sie fertig geschält in einer süßlichen Lake schwammen, die ich gern trank; das Kotelett hatte keinerlei Ähnlichkeit mit irgendetwas, das mir im späteren Leben unter diesem Namen begegnete. Knochenfrei, vorgeformt und leuchtend rosa zeichnete es sich dadurch aus, dass es seine fluoreszierende Farbe auch nach stundenlangem Braten nicht verlor. So konnte der Koch nicht viel falsch machen: Solange das Fleisch nicht mehr eiskalt und noch nicht kohlschwarz verbrannt war, war alles in Ordnung. Dann wurde großzügig Butter über Erbsen, Kartoffeln und in der Regel auch über das Kotelett gegossen.
Die wesentlichen Elemente meiner damaligen »Kochkünste« waren Armut, Unfähigkeit und kulinarischer Konservatismus. Andere hätten sich vielleicht von Innereien ernährt; ich zog die Grenze bei Zunge aus der Dose, obwohl Corned Beef zweifellos auch Körperteile enthielt, die mir im Originalzustand nicht zugesagt hätten. Ein Standardgericht war Lammbrust: einfach in der Zubereitung, Garpunkt relativ leicht zu erkennen, ausreichend für drei Mahlzeiten hintereinander, Gesamtpreis rund einen Shilling. Dann wagte ich mich an Lammschulter. Dazu gab es bei mir eine gewaltige Pastete aus Lauch, Möhren und Kartoffeln nach einem Rezept aus dem Londoner Evening Standard. Die Käsesoße zu der Pastete schmeckte immer stark nach Mehl, was sich beim täglichen Wiederaufwärmen aber allmählich legte. Den Grund habe ich erst später herausgefunden.
Mein Repertoire erweiterte sich. Vor allem Fleisch und Gemüse galt es zu beherrschen oder doch einigermaßen im Griff zu haben. Dann kamen Nachspeisen und die eine oder andere Suppe, später – viel später – Gratins, Pasta, Risotto und Soufflés. Fisch war immer ein Problem, das bis heute nur halb gelöst ist.
Bei Besuchen zu Hause kam heraus, dass ich kochte. Mein Vater beobachtete diese Entwicklung mit demselben sanften, liberalen Argwohn, den er zuvor schon gezeigt hatte, als ich bei der Lektüre des Kommunistischen Manifests ertappt wurde oder ihn nötigte, sich Streichquartette von Bartók anzuhören. Wenn es nur das ist, schien er zu denken, kann ich wohl damit leben. Meine Mutter war eher erfreut; sie hatte keine Töchter, aber immerhin ein Kind, das ihre jahrelange Küchenfron im Nachhinein zu würdigen wusste. Nicht, dass wir etwa zusammengehockt und Rezepte ausgetauscht hätten, aber sie bemerkte sehr wohl, welch begehrliche Blicke ich nun auf ihre uralte Ausgabe von Mrs Beeton warf. Mein Bruder lebte unter dem schützenden Dach von akademischen Einrichtungen und Ehe und schlug bis zu seinem fünfzigsten Lebensjahr höchstens mal ein Ei in die Pfanne.
Infolge dieser Umstände – und ich gebe beharrlich »den Umständen« die Schuld statt mir selbst – koche ich heute zwar mit Vergnügen und Begeisterung, aber mit wenig Fantasie und Experimentierfreude. Ich brauche eine präzise Einkaufsliste und ein gouvernantenhaftes Kochbuch. Der unbeschwerte Gang über den Markt – einfach mit einem Weidenkorb über dem Arm losspazieren, in aller Ruhe das Beste aus dem Tagesangebot auswählen und dann etwas daraus zusammenbrutzeln, das es vielleicht schon mal gegeben hat, vielleicht aber auch nicht – ist ein Ideal, das für mich ewig unerreichbar bleiben wird.
In der Küche bin ich ein ängstlicher Pedant. Ich halte mich an vorgegebene Temperaturen und Garzeiten. Ich traue Instrumenten mehr als mir selbst. Wahrscheinlich werde ich nie eine Garprobe machen, indem ich den Zeigefinger in ein Stück Fleisch stupse. Bei Rezepten nehme ich mir nur eine Freiheit heraus, nämlich die Menge einer Zutat zu erhöhen, die meinen besonderen Beifall findet. Die Fallstricke dieses Ansatzes zeigten sich eines Tages bei einem sagenhaft widerlichen Gericht aus Makrelen, Martini und Semmelbröseln: Es machte die Gäste eher betrunken als satt.
Ich koste auch nicht gern zwischendurch und habe dafür stets eine Entschuldigung parat. Zum Beispiel: Jetzt am Nachmittag, wo ich noch das Aroma von süßem Tee im Mund habe, kann das doch überhaupt nicht so schmecken, wie es heute Abend nach einem aufmunternden Gin Tonic schmecken wird und soll. Im Klartext: Ich fürchte mich vor der Entdeckung, dass es in diesem Stadium gar nicht wie richtiges Essen schmeckt. Ein anderes bewährtes Hintertürchen ist, sich einzureden, Kosten sei überflüssig, weil man das Rezept bis aufs i-Tüpfelchen befolgt hat. Und da das Rezept a) nicht vorschreibt, an dieser Stelle zu kosten, und b) von einer anerkannten Autorität stammt, kann dabei nur herauskommen, was herauskommen soll.
Dass dies von einer gewissen Unreife zeugt, ist mir durchaus bewusst. Dasselbe gilt für meine infantilen Anwandlungen von Meisterkoch-Allüren. Sollten Sie in meiner Küche stehen, beiläufig den Finger irgendwo hineintunken und verkünden, das schmecke gut, wäre ich stinksauer, weil ich mich darauf gefreut hatte, Sie damit bei Tisch zu überraschen. Wenn Sie hingegen ganz sachte, hochherzig und höflich andeuteten, hier könnte ein zusätzlicher Hauch Muskat nicht schaden oder die Soße ließe sich womöglich noch etwas weiter reduzieren, würde ich das als äußerst unfeine Einmischung betrachten.
Oft richtet sich mein Zorn auch gegen die Kochbücher, auf die ich mich so verlasse. Dabei ist Pedanterie auf diesem Gebiet doch ebenso verständlich wie wichtig, und wer könnte pedantischer sein als ein autodidaktischer, ängstlicher Haus-Koch, der finsteren Blicks auf die Seiten starrt? Und warum sollte ein Kochbuch weniger präzise sein als ein chirurgisches Handbuch? (Immer vorausgesetzt, chirurgische Handbücher sind tatsächlich so präzise, wie man nervenbebend annimmt. Womöglich lesen sich manche ja auch wie ein Kochbuch: »Man kippe einen Schuss Betäubungsmittel in den Schlauch, hacke ein Stück von dem Patienten ab, sehe zu, wie das Blut rausrinnt, trinke ein Bier mit seinen Kumpels, nähe das entstandene Loch wieder zu …«) Warum sollte ein Wort in einem Rezept weniger Gewicht haben als ein Wort in einem Roman? Hier kann es körperliche Beschwerden auslösen, dort geistige.
Manchmal wünsche ich mir, es wäre alles anders; das habe ich mit den meisten kochenden Spätzündern gemein. Hätte meine Mutter mir damals nur beigebracht, wie man kocht und bäckt … Von allem anderen abgesehen würde ich dann heute nicht so erbärmlich nach Lob gieren. Kaum ist die Haustür hinter den letzten Gästen ins Schloss gefallen, quillt mir das gewohnheitsmäßige Gejammer über die Lippen: »Ich hab das Lamm/Rindfleisch/sonst was zu lange im Ofen gelassen.« Soll heißen: »Ich hab es doch nicht etwa zu lange im Ofen gelassen, und wenn doch, war es nicht schlimm, oder?« Meistens ernte ich dann den ersehnten Widerspruch und ab und zu eine sanfte Erinnerung an die Regel der Hausordnung, dass man nach dem fünfundzwanzigsten Geburtstag die Eltern für nichts mehr verantwortlich machen darf. Ja, man darf ihnen sogar verzeihen. Also gut, Dad, diese Rote-Bete-Sandwiches damals, die waren völlig okay, eigentlich ganz lecker und – nun ja – wirklich originell. Hätte ich selbst nicht besser machen können.
Vorsicht: Pedant am Werk
Als ich Anfang dreißig war, wandelte sich die Küche von einem Raum notwendigen Übels langsam zu einer Stätte angespannten Vergnügens, und ich versuchte mich zum ersten Mal an Vichy-Karotten. Naturgemäß schlug ich ein Rezept in einem Buch nach. Wie es der Zufall wollte, hatte dieses Buch eine Freundin der von dem Pedanten Bekochten verfasst. Karotten, Wasser, Salz, Zucker, Butter, Pfeffer, Petersilie: Das klang alles recht harmlos. Ich entwickelte fast so etwas wie wahres Selbstvertrauen. Ich fand sogar Zeit für die Überlegung, ob der Name Vichy etwas mit Pétain zu tun hatte (die Zutaten als Kollaborateure) oder mit Gesundheit und Kuren (aber was sollten dann Butter, Zucker und Salz?) oder einfach nur ein althergebrachtes Rezept aus dieser Gegend bezeichnete.
Das Rezept sah selbst für einen Menschen mit übernatürlichem Gespür für mögliche Gefahren und Risiken kinderleicht aus. Im Grunde nur schälen, klein schneiden, kochen, würzen, ein bisschen aufpassen, dass nichts festklebt oder anbrennt. Schon wollte ich mich munter ans Werk machen, da fiel mir auf, dass mit dem Text etwas nicht stimmte. Er war in drei Abschnitte gegliedert, aber diese Abschnitte waren mit 1, 2 und 4 nummeriert. Ich zeigte es der Bekochten, die sich über das fehlende segue gleichermaßen bestürzt zeigte. Sie schlug vor, die Köchin anzurufen; schließlich sei es deren Buch.
Ich fand, das könne ich doch nicht machen. Jeder Arzt fürchtet den Moment, wo sein Tischnachbar mitten in einem geselligen Mahl plötzlich ein Hosenbein hochkrempelt und murmelt: »Ob Sie da mal eben einen Blick drauf werfen könnten …?« Jeder Romanautor fürchtet den Moment, wo sich unversehens herausstellt, dass ein freundliches Wesen eine Kurzgeschichte geschrieben hat – gar nicht lang, nur 130 Seiten –, zu der seine Meinung außerordentlich geschätzt würde. Genauso müssen Kochbuchautoren den Anruf fürchten – immer gerade dann, wenn ihr eigenes Abendessen in Arbeit ist –, der sie auf ein obskures Problem in einem längst vergriffenen Band hinweist oder verkündet, man finde keine gemahlenen Stachelschweinborsten in der Speisekammer und ob es sehr viel ausmachen würde, wenn …
Doch da uns Gäste ins Haus standen, gab ich mir einen Ruck und griff zum Hörer. Ich schilderte das Problem.
»Lies mir das Rezept vor«, sagte die Köchin. Ich tat wie geheißen. »Klingt doch okay«, meinte sie. »Nein, meine Frage ist«, erwiderte ich pedantisch, »meine Frage ist, ob es auch einen Schritt 3 gibt, der im Buch übersprungen wurde, und wenn ja, worin besteht der? Oder ob 4 ein Druckfehler ist und eigentlich 3 heißen müsste.«
»Lies noch mal vor«, sagte sie (wobei sie vermutlich den Hörer auf die Schulter geklemmt hatte und nebenbei ein Seeigel-Soufflé schaumig schlug). Ich tat wie geheißen. »Klingt doch okay«, wiederholte sie, hörbar erstaunt über meinen Anruf.
In dem Moment begriff ich das wahre Ausmaß der Kluft, die die Menschen voneinander trennt. Die Reichen sind anders als wir, weil sie mehr Geld haben, und die Köche, an deren Rezepte wir uns halten, sind anders als wir, weil sie die Ratschläge nicht mehr brauchen, nach denen wir so begierig verlangen. Ein großer Koch muss noch lange keine vernünftigen Kochbücher schreiben können, dazu gehört – wie bei einem Roman – Fantasie, Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit zu präziser Beschreibung. Im Gegensatz zu einer verbreiteten romantischen Vorstellung haben die meisten Menschen keinen Roman in sich und die meisten Küchenchefs kein Kochbuch.