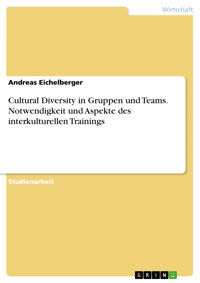Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
2002: Konrad Friedrichson, vierzig, mittellos, entdeckt auf einem Spaziergang den verwilderten Fußballplatz seiner Kindheit und begibt sich auf die Suche nach einem Freund aus Jugendtagen. Die Spur führt ihn auf abenteuerlichen Wegen zu einer geheimen Organisation. Er wird in deren Machenschaften verwickelt…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
2002: Konrad Friedrichson, vierzig, mittellos, entdeckt auf einem Spaziergang den verwilderten Fußballplatz seiner Kindheit und begibt sich auf die Suche nach einem Freund aus Jugendtagen. Die Spur führt ihn auf abenteuerlichen Wegen zu einer geheimen Organisation. Er wird in deren Machenschaften verwickelt...
Andreas Eichelberger, geboren 1962 in Karl-Marx.Stadt,
verheiratet, ein Sohn
05/2008 „Nichts von alledem“
10/2008 „Dämmerung“
Mir fielen zuerst die merkwürdigen hohen Binsen auf...
Doch ich muss von vorn beginnen. Ich begab mich auf einen Weg, den ich noch nie gegangen bin.
Vor einer Woche hatte mir mein Arbeitgeber gekündigt. Die Obrigkeit begründete das mit wirtschaftlichen Engpässen. Tatsächlich stieß den Herren meine fehlende Bereitschaft zu Kraft raubenden Sonderschichten auf. Ich war nur ein bescheuerter Einsteller an Maschinen, mehr nicht; man würde einen neuen finden. Ich hatte mich quergelegt. Das konnte man nicht zulassen. Man musste klarstellen, wer am längeren Hebel sitzt.
Ich hatte mit einem Schlag eine Unmenge Zeit, die auszufüllen mir leicht fiel, konnte tun, wozu ich sonst nie gekommen wäre. Das betraf nicht nur die Ordnung in meinem Junggesellenhaushalt.
Ich will mich nicht mehr binden, jedenfalls momentan nicht. Als Saskia sechsunddreißig wurde, verschwand sie aus meinem Leben. Wir hatten uns einige Jahre gekannt, aßen und schliefen zusammen, bis es vorbei war. Meine sonderbare Art, das drahtige Gehabe, die ruhigen Augen und das blonde wirre Haar hatten sie zum Zeitpunkt unseres Kennenlernens fasziniert. Mit mir und einer zurückliegenden Scheidung wollte sie es ruhiger angehen lassen. Doch es blieb zu still und leidenschaftslos in unserer Beziehung. Jeder kochte sein Süppchen, bis sie sagte, das wird nichts mehr. Das alles war erst vor einigen Monaten und ich vergaß langsam ihr dunkles Haar und den forschenden Blick.
Nein, das Ende meines bezahlten Tagewerks wirkte sich auch auf mein Hobby aus, das Schreiben von Kurzgeschichten. In dem Dreischichtrhythmus war es mir kaum möglich gewesen, irgendetwas zu Papier zu bringen. Doch jetzt hatte sich alles gewandelt. Ich schlief mitunter lange; tagsüber räumte ich auf, machte sparsame Einkäufe, und abends setzte ich mich endlich an meine unausgegorenen halbfertigen Stories, um sie in Ruhe zu überarbeiten und zu vollenden. Und der beginnende Frühling gab mir Optimismus. In gewissen Abständen besuchte ich meine Mutter, die zwar Rente bezog, mir aber in dieser Situation nicht helfen konnte. Mein Vater war vor drei Jahren verstorben.
Ab jetzt würde ich Arbeitslosengeld beziehen. Nun, für ein paar Bier, die Miete und die Versicherungen reicht das. Ich lebe sowieso spartanisch und schreibe. Mit vierzig einen Traum von einer Veröffentlichung zu haben, kommt mir nicht prätentiös vor. Einen Job konnte ich mir immer noch suchen.
So fiel mir eines Abends meine ehemalige Literaturlehrerin ein, beim Nachdenken am Monitor. Vielleicht kannte sie einen Verleger, eine Szenekneipe, Bohemiens mit heißem Draht.
Gut rasiert begab ich mich am nächsten Tag auf diesen Weg, den ich tatsächlich noch nie gegangen bin. Die Adresse von Frau Boysen war mir noch im Gedächtnis haften geblieben. Dazu musste ich eine Gegend mit vielen stillen Einbahnstraßen und etlichen Villen hinter hohen Zäunen durchqueren. Doch weiter hinten wusste ich die Anfang der Sechziger erbauten Blöcke.
Wie oft ich beim Schreiben an die Lehrerin gedacht habe, kann ich nicht mehr sagen. Meine verschrobenen Schulaufsätze in der achten und neunten Klasse hatte sie mit süffisantem Lächeln beurteilt. Offensichtlich nahm sie mir das Zeug nicht ab, dachte wohl, ich hätte den Text aus irgendeinem Buch abgekupfert. Das war keineswegs der Fall. Im Gegenteil, sie hätte diese Neigung von mir fördern müssen, die Neigung, selbst etwas zu verfassen. Ständig erwischte sie mich beim Lesen einer Schwarte mitten im Unterricht. Sie musste doch ahnen, dass es mein Faible war. Wie auch immer, ich würde es ihr beweisen. Einige ausgedruckte Exemplare der Kurzgeschichten hatte ich dabei.
In der achten Klasse... Wann war das? Sechsundsiebzig. Ich erinnerte mich noch an die Sitzordnung. In der ersten Reihe rechts saß der lässige Belarski und hatte seine langen Beine unter der Schulbank durchgeschoben. Die Lehrer stolperten ab und an über seine Quanten und maßregelten ihn...
In meine Überlegungen vertieft, achtete ich nicht auf ein halb geöffnetes schmiedeeisernes Tor. Beinahe wäre ich dagegen gestoßen. Es war der Zugang zu einer Villa, die umgeben von einem Garten rechter Hand thronte. Dabei fielen mir diese hohen Binsen auf. Langsam ließ ich meine Augen über das Gebäude wandern. Am Straßenrand parkten keine Wagen. Hinter den Fenstern konnte man Gardinen erkennen. Interessiert öffnete ich das Tor und erklomm einige Stufen, die mich zu dem mannshohen Schilf führten. Sie umrahmten einen kleinen Weiher, eine stehende Wasserfläche, vielleicht zehn Quadratmeter. Vom Grund, den ich nicht sehen konnte, stiegen unablässig Blasen auf. Links in fünfzig Metern Entfernung stand ein verwitterter hölzerner Schuppen, der oben mit einer Art Ochsenauge versehen war.
Wilde Hecken schützten den unteren Teil der Villa vor neugierigen Blicken. Durch eine Lücke in ihnen, die zum Bogengang geformt war, trat ich vor das Haus. Hier befand sich eine malerische Sitzecke; Bänke mit verschnörkelten Eisenbeschlägen gruppierten sich um einen runden Marmortisch. Wem mochte dieses Anwesen gehören? Auf der Rückseite musste der Eingang mit dem Namensschild sein. Ich nahm mir vor, später noch einmal danach zu sehen.
Ich lief an dem hölzernen Schuppen vorüber. Doch plötzlich musste ich wiederum verharren. Hinter dem Holzbau erstreckte sich ein verfallener Fußballplatz. Das Spielfeld war übersät von im Laufe der Jahre hochgeschossenem Gesträuch; doch die zwei gegenüberliegenden Tore hatten der Zeit getrotzt.
Lange stand ich vor dieser ehemaligen Kampfarena, bis es mir auffiel. Ich war früher selbst hier gewesen. Doch, das war die Stelle. Mit vierzehn hatte ich mir mit meinem Kumpel Rainer gnadenlose Duelle geliefert, bis uns die Uhr zum Mittagessen mahnte. Wir hüteten abwechselnd das Tor. Hier stellten wir die Schüsse und Dribbelkünste von Beckenbauer und Grabowski nach. Und wenn der Ball im Dreiangel einschlug, hörten wir den tosenden Applaus zehntausender Fans.
Vermutlich hatten wir uns damals von der anderen Seite genähert, von der Gegend, in der meine Großmutter wohnte. Ich weilte in den Ferien bei ihr, kaufte für sie ein und bolzte mit Rainer. Er war ein Jahr älter als ich, doch das tat dem Vergnügen keinen Abbruch.
Nach ihm zu forschen, eine alte Freundschaft aufleben lassen, würde sich möglicherweise lohnen. Doch erst musste ich die Boysen mit meinem Besuch beehren; das andere würde ich verschieben.
Mit einemmal wurde mir bewusst, dass ich zu diesen Ideen nie gekommen wäre, wenn ich mich noch in meiner Arbeitswelt befunden hätte. Mein Leben hatte sich bis jetzt in eingefahrenen Geleisen bewegt.
Ich wandte mich zum Gehen, als ich rechts von dem Fahrweg, auf dem ich mich befand, eine Reihe von Garagen sah. Eins der Tore war geöffnet. Vor ihm stand ein Mann und blickte starr zu mir herüber. Es schien mir, dass er unmerklich den Kopf schüttelte. Ich näherte mich ihm. Er trug eine Lederjacke, hatte graues schütteres Haar, stechende Augen und mochte Mitte Sechzig sein. Statt eines Grußes bemerkte er: „Was schnüffeln Sie hier herum?“
„Stellen Sie sich das vor“, sagte ich, „früher, als Junge, hab ich dort Fußball gespielt.“ Ich wies mit der Hand auf den Platz.
„Nein, ich meine, da hinten.“ Er deutete auf die Villa.
„Sehr pittoresk“, sagte ich, „sieht interessant aus.“
„Jaa, die Fassade“, meinte er gedehnt. „Das Drumherum. So ist es immer. Was wissen Sie schon, was hinter Mauern passiert?“
„Ich weiß das nicht“, gab ich zu. „Das geht mich in der Tat nichts an. Werden Sie mir’s erzählen?“
„Warum sollte ich das tun?“ Der Mann drehte sich weg. „Da treffen sich Leute. Das hab ich schon des Öfteren festgestellt. Bis spät in die Nacht brennt Licht. Auch samstags. Das ist keine Firma...“
„Das sind ja dann doch viele Einzelheiten“, unterbrach ich ihn.
„Ich würde mich an Ihrer Stelle fernhalten. Die beobachten mich.
Meine Garage werde ich verkaufen.“ Mit diesen Worten stapfte er davon.
Wieder wanderte mein Blick über das Anwesen. Es kam mir durch die Äußerungen des Garagenbesitzers ein wenig düsterer vor. Ob man mein Erscheinen bemerkt hatte? Doch nichts regte sich dort, kein Fenster wurde aufgerissen, keine Gardine bewegt.
Um fünfzehn Uhr klingelte ich bei Boysens. „Guten Tag, Frau Boysen“, sagte ich, nachdem sie mir geöffnet hatte. „Konrad Friedrichson“, stellte ich mich nach den vielen Jahren vor. „Ich war einer Ihrer Schüler. Sie gaben Deutsch, damals, in den Siebzigern.“
Sie musterte mich nachdenklich. Frau Boysen, klein von Statur, hatte immer noch ihr blondes kurzes Haar und aufmerksame Augen, in denen sich doch tatsächlich die alte Spur dieser gewissen Süffisanz erkennen ließ, mit der sie uns in der Klasse nervös gemacht hatte.
„Konrad, ja, ich erinnere mich“, sagte sie und nickte.
„Nur, wenn Sie eine Viertelstunde Zeit haben“, sagte ich.
„Zugegeben platze ich etwas überraschend in Ihr Privatleben.“
„Aber nein, ganz und gar nicht. Kommen Sie, oder kann ich weiterhin Konrad sagen...“
„Natürlich.“
Sie bat mich ins Wohnzimmer, brühte Kaffee. Ich konnte sie von der Couch aus sehen, wie sie in der Küche werkelte.
Frau Boysen schätzte ich Anfang Fünfzig ein. Als Schüler waren wir stets dem Eindruck erlegen, dass die Lehrer viel bejahrter seien, als sie tatsächlich waren. Doch damals, frisch von der Hochschule an unsere Penne versetzt, konnten wir schwerlich ihr Alter beurteilen. Der Unterschied macht sich später nicht mehr so bemerkbar. Ich hätte gut und gern eine Affäre mit ihr haben können, jetzt, nach dieser langen Zeit, ohne dass es jemandem groß aufgefallen wäre. Ehrlich gesagt, hatte sie mich schon in meiner Jugend fasziniert, obwohl wir oft aneinander geraten waren. Sie wirkte damals hochmotiviert, gewandt, das Wissen in Literatur platzte ihr aus allen Nähten.
Als schien sie meine Gedanken erraten zu haben, rief sie aus der Küche: „Ist gleich so weit. Mein Mann kommt erst um sechs aus der Uni. Wir werden ein wenig Zeit haben, uns zu unterhalten.“
Frau Boysen erschien mit dem Kaffee. Sie lächelte wie früher, nahm Platz, verteilte die Tassen und schenkte ein. Dann sah sie mich lange an. „Konrad Friedrichson“, sagte sie, „ja, ich erinnere mich. Dass du mich besuchst... Es ist erstaunlich. Wusstest du, dass man in längst verschollenen Zeiten den Sohn nach dem Vater benannte? Sohn des Friedrich. Friedrichson, leicht abgewandelt.“
„Ja, davon habe ich gelesen, Frau Boysen.“ Ich lehnte mich zurück. „Ich bin quasi auch der Namensvetter eines vielleicht nicht gänzlich vergessenen Mannes. Ekkehard Friedrichson.
Meister Nadelöhr.“
„In der Tat“, sagte Frau Boysen.
„Wissen Sie, ich finde das traurig; er hat so viele Kinder mit seinem Märchenlandzeug – nun ja – beglückt, will ich mal sagen, aber er starb mit nur sechsundvierzig Jahren. Ich glaube, an einem Herzinfarkt. Kann man das begreifen? Ist das der Lohn?“
„Es ist eben so, Konrad. Ein Leben ist manchmal von kurzer Dauer. - Warum bist du nun hier?“
Ich trank vom Kaffee. „Ja, es ist so: Man wendet sich schließlich an seine Literaturlehrerin. Ich habe ja schon immer gern gelesen und geschrieben. Jetzt will ich mal Nägel mit Köpfen machen und habe Kurzgeschichten fabriziert. Ich möchte, dass Sie sie beurteilen. Womöglich könnte man sie verlegen.“ Ich zog die Mappe aus der mitgebrachten Tasche.
„Na, dann lass mal sehen“, sagte sie. „Zugegeben warst du ja doch einer meiner Lieblingsschüler, weil du tatsächlich gelesen hast. Im Grunde habe ich keinem von euch so etwas zugetraut: die Nase in Bücher zu stecken und dabei ernsthaftes Interesse zu entwickeln.“
„Wobei Sie uns das doch nahe bringen sollten“, sagte ich.
„Ich glaubte nicht daran“, widersprach sie mir.
„Ich denke, das nennt man wohl dann Voreingenommenheit.“
„Her jetzt mit den Sachen“, forderte Frau Boysen, und ich reichte die Mappe hinüber. Sie blätterte in den Seiten, ging dann zurück zum Inhaltsverzeichnis. „Ist allerhand.“
„Sie können das behalten, Frau Boysen. Es hat Zeit.“
„Na, Moment. Ist was Kurzes dabei?“
„Ja, die drei ersten.“
„Der Konsum.“
„Ja, zum Beispiel.“
„Ich bin direkt neugierig geworden“, sagte Frau Boysen und schlug die Seite auf. Sie angelte sich ihre Lesebrille. Ich stellte mir vor, wie sie kritisch Zeile für Zeile scannte. –
Der Konsumladen meiner Kindheit ist der Dreh- und Angelpunkt der Story. Ich schildere seinen Werdegang aus der Sicht meiner verschiedenen Altersstufen. Er verändert sich, ich verändere mich. Der Gang zu ihm ist ein wichtiger Faktor. Jedesmal betrachte ich diesen Laden mit anderen Augen. Auch der Weg zu ihm wandelt sich; die ganze Umgebung zeigt nach und nach den Charakter einer gewissen Erneuerung und Entfremdung, einem langsamen Sterben. Der Laden schließt am Ende seine Pforten für immer. Nur an die Gaslaternen legt man keine Hand. Sie bilden die größte Bedeutung für mich. Sie bleiben als schummrig glimmendes Relikt der Vergangenheit.
Ich lese letztlich das Buch ,Tom Sawyer’, um meine Kindheit zurückzuholen, und nehme mir vor, etwas zu tun. -
Nach der Lektüre nahm Frau Boysen ihre Brille ab. „Hast du etwas getan, Konrad?“
„So sehen Sie das zunächst?“
„Allerdings.“
„Um ehrlich zu sein, kann man nicht allzuviel tun. Die Dinge überrollen uns.“
„Du hast diese kleine Welt also interpretiert.“
„Ja, ich weiß“, ich winkte ab, „es kommt darauf an, sie zu verändern. Ich habe zumindest schriftlich kritisiert, darauf verwiesen, zum Nachdenken angeregt. Das ist doch schon ein Anfang.“
„Das stimmt“, sagte Frau Boysen versöhnlich.“
„Und sonst? Wie fanden Sie die Geschichte?“
Sie strich mit ihrer Hand über die Tischdecke. „Nun, mir fiel auf, dass es viele Wortwiederholungen gab.“
„Das war Absicht. Ich wollte das alles mit Nachdruck schildern.
Es ist ja auch nur eine Story von mehreren.“
„Schlecht ist sie nicht. Die eingeschobenen Zwischenstücke mit dem Schnee und den Passanten, über das Leben, finde ich gut, das lockert auf. Aber nun hebe nicht gleich ab. Lass mir die Sachen da, ich werde sie in Ruhe sichten. Das interessiert mich.“
„Wollten Sie nie Schriftstellerin werden?“ fragte ich.
„Ich wollte Lehrerin werden und bin es geworden. Ich lese auch gern und viel, aber von irgendetwas muss ich leben. Ernsthaft spielte ich nie mit diesem Gedanken. Das waren für mich Hirngespinste. Man braucht viel Zeit.“
„Heutzutage soll es ja schwierig sein, Bücher zu veröffentlichen“, warf ich ein.
„Man braucht Verbindungen“, sagte sie. „Das merkt man schon daran, welcher Mist jetzt herausgebracht wird. Es erweckt in mir den Eindruck, dass jeder ein Buch schreiben will. Dreißigjährige Prominente geben ihre Memoiren heraus, Kinder von reichen Eltern pinseln ihre Phantasien in bunte Einbände, und perfekt aussehende Frauen, die uns von den Werbebroschüren anlächeln, machen uns mit ihren Männerproblemen bekannt. Aber lassen wir’s gut sein. Ich brauche deine Telefonnummer noch, Konrad.“
Ich wählte den Weg zum ehemaligen Mietshaus meiner Großmutter. Als ich angekommen war, sah ich hoch zu dem Fenster, aus dem sie früher immer geschaut hatte. Sie lebte schon lange nicht mehr. Seit vielen Jahren beherbergten die Räume neue Mieter, andere Menschen, die die Wohnung nach Belieben ausgestattet hatten. So ist das eben. Selten war ich diesen Weg seit ihrem Tod gegangen, und manchmal, wenn eine mir völlig fremde Person sich dort auf das Fenstersims lehnte, dachte ich, man hätte die Etage requiriert und die alte Frau vertrieben.
Gegenüber hatte früher Rainer bei seinen Eltern logiert. Nach dem Tod meiner Großmutter stand ich mit Rainer noch in Verbindung, doch als er zur Armee eingezogen wurden, trennten sich unsere Wege und hatten sich seitdem nicht wieder zusammengefunden.
Doch der Name stand nicht mehr am Briefkasten. In meiner Ratlosigkeit kam mir der Zufall zu Hilfe. Eine ältere Dame in einer Wickelschürze holte ihre Post. Ich trat zur Seite. „Zu wem möchten Sie denn?“ fragte sie. „Vielleicht kann ich Ihnen helfen.“
„Weikerts haben hier mal gewohnt. Ich suche einen alten Freund, Rainer.“
„Oh, das tut mir leid. Weikerts sind schon lange weggezogen. Ich weiß allerdings nicht, wohin.“
„Und es könnte sonst niemand im Haus wissen?“
„Nein, ich glaube nicht.“
„Schade“, sagte ich.
„Was Ihnen aber nützen würde: seine jüngere Schwester hat in Dresden schon länger eine Praxis. Deshalb sind sie aus der großen Wohnung raus. Aber ich habe keine Telefonnummer und ob sie dort noch ist...“
„Was für eine Arbeit?“
„Tierärztin. Das war ihr Traum.“
Ich fand im Internet ihre Praxis und rief am nächsten Vormittag an, gab mich zu erkennen, erläuterte kurz meinen raschen Entschluss, diese fixe Idee, mich mal wieder mit Rainer zu treffen. Wie ich darauf gekommen wäre, fragte sie. Ich hätte durch einen Zufall den alten Platz wieder gesehen, auf dem wir damals gebolzt hatten. Er melde sich kaum, riefe selten an, erläuterte sie spitz, obwohl sie ihn zu gelegentlichen Geburtstagen, auch der Eltern, träfe. Warum das so sei, wollte ich wissen. Sie könne dazu nichts sagen. Ich fügte zusammenhanglos ein, dass auch wir uns früher gut gekannt hätten. Auf die Schwester von Rainer hätte auch ich stets ein Auge geworfen, als Beschützer sozusagen. Doch das überging sie. Die Zeiten hätten sich geändert, olle Kamellen. Schließlich besann sie sich, wurde gesprächiger und erklärte, nach seiner Armeezeit sei Rainer ausgezogen und der Kontakt nach und nach abgerissen. Er hätte damals tatsächlich eine Wohnung in der Nähe dieses Fußballplatzes gemietet, die Lage sei gut, erfuhr sie aus den spärlichen Telefongesprächen. Sie hätte ihn nie bei spontanen Besuchen angetroffen, nachdem sie die Adresse nach langem Forschen herausbekommen hatte, klagte sie. Ihre Eltern hätten ihren Vorwürfen gleichmütig zugehört und beschwichtigt; er würde auf eigenen Beinen stehen. Auf den Familientreffen sei er ihr seltsam zugeknöpft vorgekommen. Als die Wende kam, hatte man die Wohnung weitervermietet. Ich erfuhr am Ende doch noch die Hausnummer.
Noch am Nachmittag suchte ich das Gebäude, das mir Rainers Schwester genannt hatte. Es lag doch weiter vom Platz entfernt, als ich vermutete. Durch einen Torbogen konnte ich den Hinterhof betreten. Eine Frau stand hinten, eine Zigarette rauchend. Sie hatte kurzes schwarzes Haar und trug Jogginghosen.
„Guten Tag. Ich wollte zu Herrn Weikert, aber ich weiß schon, er wohnt nicht mehr hier“, sagte ich.
„Na, wenn Sie’s schon wissen, warum sind Sie dann hier?“
„Wissen Sie vielleicht, wo er hingezogen ist? Ich bin ein alter Freund von ihm.“
„Keine Ahnung“, murmelte sie.
„Wann ist er denn weggezogen?“ fragte ich.
„Bin ich die Auskunft?“
„Was habe ich Ihnen denn getan? Außer Ihnen kann mir niemand helfen.“ Ich bemühte mich um Versöhnlichkeit. „Ist Ihr Mann vielleicht zu sprechen?“
„Nein“, sagte sie.
Ich wandte mich zum Gehen. Ich würde einen anderen Hausbewohner ausfindig machen.
„Wollen Sie einen Kaffee?“ fragte mich plötzlich die Frau. Sie wies nach oben. „Ich kann Ihnen etwas über den Weikert erzählen.“
Ich ging ihr auf den Treppenstufen bis zur Wohnung hinterher. Am Klingelschild stand „Kronach“. In der Küche setzte ich mich auf einen Stuhl. Während sie den Kaffee bereitete, sah ich mich im Raum um.
„Der Weikert“, sagte sie, „war ein merkwürdiger Mensch.“
„Wieso?“
„Er lebte still, zurückgezogen, sprach mit keinem Hausbewohner. Gott, wann hatte er sich eingemietet?“ Sie sah zur Decke. „Dreiundachtzig, glaub ich. Damals war ich neunzehn.“ Sie lächelte, wie um ihre frühere Jugend in ihr Gesicht zurückzubringen. „Ich war allein und wollte unabhängig von meinen Eltern sein. Wir sind fast zugleich eingezogen, dieser Weikert und ich mit meinen gebrauchten Möbeln. Wissen Sie“, sie beugte sich zu mir herunter, „meine Eltern waren der Meinung, ich tauge zu nichts. Also verließ ich sie. Wenn die einzigen Menschen, die man hat, nichts von mir halten, dann kann ich mich auch von ihnen lösen.“
Ich wich beeindruckt zurück. „Sie müssen mir das nicht erzählen.“
„Wem soll ich es sonst erzählen?“
„Und Weikert?“
„Wie gesagt, er war seltsam. Kaum, dass er im Haus beim Vorbeigehen grüßte. Er war mürrisch, ein hagerer Kerl mit rotem Haar.“
„Ich kannte ihn“, warf ich ein.
„Wie auch immer: Ich hatte kein Interesse an ihm und er keins an allen. Oben war es immer ruhig. Er wohnte über mir und hatte die Zimmer einer kürzlich verstorbenen alten Dame angemietet. Von einer brutalen Räumung nahm er Abstand und einigte sich mit den Angehörigen und der Wohnungsverwaltung. Er hat Stück für Stück die alten Möbel ersetzt, welche die Frau besessen hatte und übereignete sie den Hinterbliebenen. Das fand ich überaus menschlich. - Ich achtete nicht mehr auf Weikert, denn ich lernte einen Mann kennen, den ich überstürzt heiratete. Der ging dann laufend fremd. Und er begann, mich zu schlagen. Da hab ich einen Schlussstrich gezogen, Scheidung. Seitdem lebe ich allein.“
„Das tut mir leid“, warf ich ein.
„Kurz nachdem ich meinen Mann los hatte, klingelte Weikert bei mir. Er hat sich lange mit mir unterhalten. Die ganze Sache war ihm nie egal gewesen. Wochen vor der Trennung hatte Weikert meinen Mann einmal zur Rede gestellt, weil er mein Weinen im Haus gehört hatte. Er klopfte an die Tür und bat um Unterlassung dieser Animositäten; so hat er sich ausgedrückt. Mein Mann, körperlich überlegen, lachte nur und sagte: ,Schieb ab.’ Ich stand direkt daneben. Mir sind Weikerts Augen in Erinnerung geblieben, kalt und unnahbar; er nickte, ging die Treppe hoch und lächelte mich kurz an. Später, nach der Scheidung, bat er mir eben seine Hilfe an, wenn mal etwas zu reparieren war und dergleichen. Wir schufen uns ein regelrechtes Ritual, das nachmittägliche Kaffeetrinken, bei dem anstehende Probleme besprochen wurden. Doch blieb er ungewöhnlich ernst. Die Trennung befürwortete er. Angenähert hat er sich mir jedoch nie.“
„Das klingt gut“, sagte ich.
„Das mag sein“, meinte die Frau und brachte den Kaffee. „Ich dachte, es bliebe so; diese vertraulichen Zusammenkünfte, ich war froh, einen Freund zu haben. Weikert hörte mir aufmerksam zu. Meine Sorgen müssen ihm wohl nahe gegangen sein. Ich weiß nicht. Er sagte nicht viel. Und eines Tages war er fort.“
„Wie fort?“
„Er war fort. Die Wohnung hatte er offenbar gekündigt.“
„Er war einfach weg? Hat das niemand bemerkt?“
„Nein. Womöglich hat er nachts seinen Kleintransporter mit dem Kleinkram beladen, den er besaß, so dass es niemand sah.“
„Und beruflich? Was hat er gemacht?“
„Ich weiß nicht. Er sprach von Außendienst.“
„Und gab es eine Frau?“
„Zumindest keine feste. Ich wollte mich auch nicht erkundigen. Seine Art flößte mir Respekt ein.“
Ich sah die Frau nachdenklich an. Es war ein merkwürdiges Bild, was sich da vor mir auftat. War die Wohnung für Rainer nur eine Übergangslösung gewesen? Hatte er andere Pläne gehabt, und welche?
„Und weiter?“ fragte ich.
„Nichts weiter. Ich hörte nie mehr etwas von ihm. Allerdings hatte er mir einen Umschlag mit Geld dagelassen. Er war im Briefkasten. Auf dem Umschlag stand nur: Für die guten Stunden für schlechte Zeiten, Rainer. Es war immerhin eine vierstellige Summe. Das verstehe ich alles bis heute nicht.“
„Und das Geld stammte wirklich von ihm?“
„Kein Zweifel. Ich hatte ihm einmal einige Kuverts mit Naturmotiven gegeben. Ich habe das Papier wieder erkannt.“
„Das war doch um die Wendezeit, nicht?“
„Ja.“
„Vielleicht ist er überstürzt in den Westen.“
„Schon möglich. Aber warum hat er nichts erzählt?“
„Das hat man nicht jedem erzählt.“
„Da haben Sie auch wieder Recht.“
Ich stand auf und ging auf den Balkon. Ich konnte den Giebel des hölzernen Schuppens erkennen. Dahinter erhob sich die Villa. „Aber das alles ist ungefähr zwölf, dreizehn Jahre her“, sagte ich über die Schulter in die Küche. „Sie haben nie wieder etwas von ihm gehört?“
„Nein, nie.“ Sie erhob sich und trat auf den Balkon. „Er hat auch immer so wie Sie jetzt da hinüber gestarrt.“
„Wo hinüber?“
„Zu diesem Gebäude. Er schien fasziniert.“
„Meinen Sie diesen Schuppen? Wo soll man sonst hinsehen?“
„Ach, ich weiß nicht“, meinte sie resigniert. „Da arbeitete übrigens früher mein Mann, als Tischler.“
Was hieß schon Gebäude? Es war nur ein Holzbau, morsch und verwittert, nicht unbedingt eine Augenweide. „Hören Sie“, sagte ich, „wir kommen an dieser Stelle nicht weiter. Es wird Zeit, mich zu verabschieden. Und vielen Dank.“
Beim Nachhause gehen dachte ich über alles nach. Es begann zu dunkeln. Der Tag hatte viel Verwirrung gebracht. Da mich der Weg an dem Fußballplatz vorbeiführte, verweilte ich noch kurz. Doch der seltsame Schuppen begann mich mehr zu interessieren. An der Brettertür war ein verrostetes blaues Vorhängeschloss angebracht. Am Giebel sah ich das Ochsenauge, das runde Fenster, das direkt auf die Villa gerichtet war. Ich ging zurück und umrundete das Geviert. Am Gittertor bei den Treppenstufen stand ein schwarzer Passat mit getönten Scheiben. Ich musste an den mürrischen Garagenmieter denken. Daheim am Monitor kam ich nicht zum Schreiben. Die Vorfälle des Tages geisterten durch mein Hirn. Wenn man einmal den Alltagslauf unterbricht und etwas anderes tut, ist es so, als würde man einen Dominostein umwerfen, der weitere mit sich reißt.
Warum nur war Rainer in die Nähe des Platzes gezogen? Hatte er Bezug zur Vergangenheit gewollt, das Eintauchen in die Kindheit, ein Relikt aus verschollenen Zeiten stetig vor Augen? Warum war er überstürzt verschwunden? Warum hatte er die Jahre wie in einer Warteposition verbracht?
Früher waren wir echte Freunde. Sein Humor wirkte ansteckend, ebenso die Neigung, Abenteuer und Streiche zu ersinnen. Unser Leben damals war spannend. Das Wort Traurigkeit kannte er nicht. Er war mir zum Vorbild geworden.
Deshalb konnte ich mir diese Wandlung nicht erklären, die mir die Kronach geschildert hatte. Still, teilnahmslos schien er demnach zu sein, introvertiert, zurückgezogen lebend. Gewiss, eine lange Zeit war inzwischen ins Land gegangen. Menschen ändern sich. Und selbst das alles war schon zwölf Jahre her. Wir waren vierzig. Was war aus uns geworden, aus den Mitschülern meiner Generation? Möglicherweise besaß manch einer schon eine Firma, eine andere eine Boutique. Vielleicht waren einige Kameraden von damals jetzt gnadenlosen Schikanen ausgeliefert. Wer wusste das schon? Viele würden große Töchter und Söhne und damit einhergehende Probleme haben. Es war überfällig, ein Klassentreffen anzuleiern.
Ich musste plötzlich an eine Mitschülerin denken, die ich damals mit stiller Bewunderung beobachtet hatte, Stella Schönberg. Auch sie hatte schwarzes Haar und besaß einen dunklen Teint; ihre Bewegungen wirkten fast tänzerisch. Wenn sie auf dem Schulhof mit ihren Freundinnen ihre Runden drehte, gingen meine Blicke immer wieder zu ihr hinüber. Sie hatte es bemerkt, Mädchen stellen solche Dinge mit unfehlbarer Sicherheit fest. Doch dabei war es geblieben. Sie reagierte nicht und ich unterließ es aus Feigheit, sie anzusprechen. Ich berichtete Rainer davon; wir erzählten uns alles, und er hörte mir ernsthaft zu, meinte dann nur, dass man warten müsse, bis sich eine passende Gelegenheit ergäbe. Man müsse warten können. Ich begann zu dieser Zeit, die Initialen ihres Namens in Bankstreben zu ritzen, bis Rainer sagte, dass ich das lieber lassen sollte. Man kriegt da Schwierigkeiten, sagte er und sah mich an...
Da fiel es mir wieder ein. Der Passat vor der Villa mit den getönten Scheiben. Das Nummernschild endete mit den Buchstaben WR. Konnte das Zufall gewesen sein?
WR – Weikert Rainer?
Am nächsten Abend, als es dämmerte, machte ich mich auf den Weg zum alten Schuppen. Die Garagen lagen verwaist, niemand war zu sehen. Ich zog unter der Jacke den mitgebrachten Bolzenschneider hervor und knackte das blaue Vorhängeschloss. Die schwere Tür ließ sich nur mühsam in ihren Angeln bewegen, sie war wohl lange nicht geöffnet worden. Durch die blinden Scheiben fiel kaum Licht. Ich zog das Tor hinter mir heran und schaltete die Taschenlampe ein. Zu beiden Seiten waren Werkbänke mit Schraubstöcken aufgestellt. Altes Laub und Holzspäne bedeckten den Boden. Inmitten des Raums stand eine Metallpresse. Links konnte ich eine Treppe erkennen, die ins Obergeschoss führte. Das geknackte Schloss warf ich unter eine Werkbank. Nach kurzem Suchen fand ich einen geeigneten Knüttel; in dieser ehemaligen Werkstatt hatte ich das vermutet. Selbstschutz musste schon sein. Den Rucksack geschultert, nahm ich vorsichtig die Treppe. Die Stufen schienen stabil. Oben standen überall Kartons und Pakete herum. Ich näherte mich dem Ochsenauge und war schließlich überrascht durch die gute Sicht auf die gegenüberliegende Villa. Ich zog mir einen alten Schemel heran, lagerte den Rucksack zu meiner Rechten und packte aus, Zigaretten, Trinkflasche, Stullen.