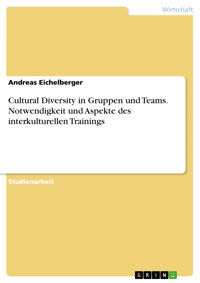Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Adrian Hofler wächst in der DDR auf und tritt in die Fußstapfen seines Vaters, erlernt den Beruf des Metallfacharbeiters. Dann kommt die Wende, und er gerät in die Mühlen von Insolvenz, Abwicklung und Jobwechsel. Er schafft den Übergang, doch ist ihm nicht klar, wie diese Welt der Hierarchien funktioniert. Die Strukturen, Abläufe und Handlungen in den Firmen erscheinen ebenso sinnentleert wie uneffektiv, und er lässt sich zu unbedachten Taten hinreißen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Adrian Hofler wächst in der DDR auf und tritt in die Fußstapfen seines Vaters, erlernt den Beruf des Metallfacharbeiters. Dann kommt die Wende, und er gerät in die Mühlen von Insolvenz, Abwicklung und Jobwechsel. Er schafft den Übergang, doch ist ihm nicht klar, wie diese Welt der Hierarchien funktioniert. Die Strukturen, Abläufe und Handlungen in den Firmen erscheinen ebenso sinnentleert wie uneffektiv, und er lässt sich zu unbedachten Taten hinreißen.
Das Leben ist schmerzhaft und enttäuschend.
Michel Houllebecq
Inhaltsverzeichnis
In der Etappe
Feindberührung
Spätsonne
In der Etappe
Manchmal habe ich das Grab eines Freundes aus Kindertagen aufgesucht. Er war früher mein Spielgefährte. Etwas zu feist geraten, wurde er oft Zielscheibe des Spottes, doch wir verstanden uns gut. Ich nahm daran nie Anstoß. Später, er war schon ungefähr achtundzwanzig, wurde er fettleibig, erkrankte und starb. Das hatte er nicht verdient. An trüben Tagen, wenn ich mir sicher war, dass der Friedhof spärlich besucht war, nahm ich meine Gitarre mit und spielte an seinem Grab ein Lied, das wir beide aus der Jugend kannten, ein mitreißendes Lied. Ich musste weinen, als die letzten Akkorde verklungen waren, erhob mich mühselig, denn ich hatte im Sitzen gespielt und machte mich auf den Heimweg. Und ich lief an den Gräbern und an den Steinen vorüber, in denen die Geburts- und Todesdaten eingemeißelt waren. Mitunter schien es mir, weil ich sehr langsam ging, als würden aus der Erde kaum hörbare Seufzer kommen, von leidgeprüften Seelen, von vergessenen Seelen. Nein, mein Freund hatte dieses Schicksal wirklich nicht verdient, aus dieser Welt gerissen zu werden.
Zweihundert Meter weiter hinten, unter tief hängenden Kastanienästen, lag mein Großvater mütterlicherseits. Mit meiner Großmutter war ich oft hier. Ich war damals noch ein Kind; Trauer war mir fremd. Im Übrigen starb er bereits, als ich nur zwei Monate alt war. Er war ein harter und strenger Mann; das hatte sie mir später erzählt. Trotz allem versorgte sie jahrelang seine letzte Ruhestätte. Wenn wir an den großen Rhododendronbüschen vorbeigingen, kamen wir an den halbverfallenen Brunnen und entnahmen dem verrosteten Hahn das Wasser für die Blumen. Mir bereitete das Vergnügen; die Kindheit ist eine Zeit voller Unschuld. Ich konnte nicht sagen, was im Kopf meiner Großmutter vorging, als sie die Pflänzchen auf seinem Grab goss. Ja, ich war immer ein wenig ergriffen, aber sonst...
Jetzt gibt es Abmachungen, Verträge; vieles wird geregelt. Man kümmert sich meistens nicht mehr so um die Verblichenen. Der Tod ist wahrhaftig eine Zäsur.
Jahre später dachte ich in meiner Gefängniszelle über diese und andere Dinge nach. Das sogenannte Millennium war schon fünfzehn Jahre her; ich war Mitte Fünfzig. Hier hatte man eine Menge Zeit. Ich kräftigte mich mit sogenannten Leibesübungen und las mich durch die Bibliothek; das wurde einem hier gelassen, ebenso wie das Rauchen in den Zellen.
Ich bin einsachtundsiebzig, habe kurzes Haar, wiege zu wenig, bin sehnig, und ich habe einen stechenden Blick, was viele meiner Zeitgenossen abschreckt, aber die Augen sind graugrün wie die meiner Großmutter. Darauf bin ich stolz. Etwas lebt weiter.
Mein Name ist Adrian Hofler; ich bin beziehungsunfähig. Ich habe mich mehrfach verliebt, aber irgendwie schaffte ich es nie, eine Familie zu gründen. Das ist garantiert ein Fehler, aber geht es nicht vielen so?
Den Mitgefangenen begegnete ich gleichgültig; es war wie überall, wo man in Gruppen existiert. Einige waren großspurig, andere kleinlaut, diese kapselten sich ab, jene suchten Gesellschaft. Das alles ödete mich an. Ich war hier, weil ich Scheiße gebaut hatte, doch davon später.
In diesen eintönigen Tagen kamen die Erinnerungen an alte, vergangene Zeiten und Geschehnisse. Ich legte mich oft auf das Bett und starrte an die Decke. Was konnte man sonst schon tun, außer Bücher zu lesen?
In meiner Kindheit wohnte ich mit meinen Eltern in einer Stadt in Sachsen, in einer malerischen Siedlung, die kleine Straßen durchkreuzten. Fast nie kam ein Wagen vorüber, selbst die Fahrbahn wurde zum Spielplatz.
Im Konsumladen an der Ecke kam mir stets das Pinkeln an. Der granitene Fußboden strahlte Kälte aus. Doch die Regale waren voller Wärme, die Flaschen, Gläser, Büchsen sorgfältig geordnet. Er lag nur hundertfünfzig Meter entfernt. Ich ging diesen Weg mit Frohsinn, sommers wie winters. Ich sah immer dasselbe. Den Ahorn, den Kindergarten mit den lärmenden, wilden, unbeschwerten Kleinen, die wenigen Häuser.
Brannte hinter einem Fenster abends Licht, wurde es interessant. Wer mochte wohl sein Unwesen treiben oder still arbeiten im Schein einer Schreibtischlampe?
Meine Mutter war früher Friseuse, man nannte diesen Beruf damals so; (jetzt heißt das Friseurin; die Umbenennung schien außerordentlich wichtig, sie war längst fällig), Mutter trug selbstverständlich blondes Haar und hatte einen ruhigen besonnenen Blick.
Mein Vater arbeitete in einer Maschinenfabrik, Teil eines Kombinats. Er war Dreher, und als ich ihn einmal an seiner Drehbank aufsuchen durfte, bleibt mir dieses Bild im Gedächtnis, ein großer schwarzhaariger bebrillter Mann, gewissenhaft über eine glänzende Welle gebeugt, die zwischen zwei Spitzen eingespannt war. Begeistert sah ich zu, wie die Späne abrollten.
Wir hatten eine gute Zeit. Ich war ungefähr zwölf, samstags dudelte das im Flur stehende Kofferradio Seemannslieder und ich lag auf der Wiese hinter dem Haus und las Benno Voelkner Das Tal des zornigen Baches.
Auf dem Nachbargrundstück, auf dem eine riesige Kastanie wuchs, knüppelten wir als Kinder die braunen rotbraunen Schätze herunter. Mitunter kam der Pächter, ein bejahrter Mann mit schütterem Haar, mit einem Stock und bedrohte uns. Wir flohen nach allen Richtungen.
Ungefähr um diese Zeit, es war Sommer, traf ich auf Ulrike. Meine Eltern konnten sich selten Urlaub leisten, meine Freunde waren mit ihrer Familie verreist oder in ihren gepachteten Gärten, die sich außerhalb der Stadt befanden.
Ulrike erschien, ja, sie erschien, sie kam nicht einfach daher. Sie stand eines Tages, es war ein sonnenheller Nachmittag, auf unserer Straße, die still und friedvoll, fast träge im Halbschatten des Ahorns lag. Ulrike hatte dunkles braunes Haar; sie war eine Schönheit, das konnte ich trotz meiner Jugend schon ermessen. Wir beobachteten uns eine Zeitlang, bevor ich sagte: „Ich bin Adrian.“
„Ulrike“, entgegnete sie und lächelte, spielte bei diesem Wort mit einer Strähne ihres Haars. Sie wirkte eigentümlich vertraut auf mich, obwohl sie doch eine Fremde in dieser Gegend war. Hier kannte praktisch jeder jeden. Ulrike war schlank, trug eine Kordhose und einen hellbraunen Pullover. Sie war mit ihren Eltern erst vor einer Woche hergezogen, die wahrscheinlich noch mit der Einrichtung beschäftigt waren, während Ulrike hier herumstromerte und die Örtlichkeit sondierte. Wir freundeten uns problemlos und schnell an. Sie war völlig anders als die zickigen intriganten Weiber meiner Nachbarschaft, und wir spielten tatsächlich Verstecken. In meinem Alter war das unter Jungs verpönt, aber mit einem Mädchen, das war schon etwas anderes. Ulrike - ich spürte sie natürlich auf, sie ließ sich auch bereitwillig fangen - war überhaupt nicht sauer. Sie ergab sich und ließ mich gewähren; ich schnappte sie und lächelte auch sie an; mich befiel ein leichtes Zittern. Auch sie lachte und warf ihren Kopf zurück. Ich hatte sie an einem Zaun erwischt; sie lehnte sich dagegen, ich nahm sie bei den Schultern, und erst da bemerkte ich zum ersten Mal, wie zerbrechlich ein weiblicher Körper ist. Ich griff mit meinen Fingern in ihr dunkelbraunes Haar, und es glitt wie Sand durch meine Finger.
Nachts geisterte Ulrike durch meine wirren Träume, und ich konnte den nächsten Tag kaum erwarten, bis sie an der gewohnten Stelle wieder auftauchte. Sie hatte eine freche und irgendwie jungenhafte Art, und ich spürte, dass sie die Zeit gern mit mir zusammen verbrachte. Ich trat damals in ein Zauberland. Das alles währte drei Wochen, die ich nie vergessen werde.
Doch eines Tags, als sie wieder herangeschlendert kam, war sie eigentümlich verschüchtert. Die Abendsonne blinkte durch die Wipfel des Ahorns, der die Straße flankierte.
„Was ist, Ulrike?“ fragte ich. Sie schluckte und im Braun ihrer Augen begann es zu glitzern. Weinte Sie?
„Nichts“, sagte sie. „Es ist nichts.“ Ich berührte ihre Wangen und stellte fest, dass nun doch Tränen darüber liefen.
„Aber es muss doch etwas sein“, drängte ich.
„Wir ziehen wieder weg“, schluchzte Ulrike und umarmte mich. Ihr kleiner Körper wurde von Krämpfen geschüttelt. „Es hat – es hat – irgendwas nicht... Wir nehmen die Wohnung nicht...“ Plötzlich riss sie sich los und rannte davon. Ich sah ihr erschüttert noch lange nach.
Anderntags war ich an der Stelle am Zaun, an der wir uns immer getroffen hatten. Warum war ich nicht hinterher gelaufen? Hätte ich an der Sache rütteln können? Die hölzernen Pfähle der Befriedung standen stumm vor mir, die Sonnenstrahlen spielten ungerührt mit den Gräsern der Wiese.
Der Schmerz, den eine Trennung von einem Mädchen, für das man Zuneigung empfindet, in diesem zarten Alter hervorruft, ist mit keinem anderen vergleichbar. Das Glück ist oft nur von kurzer Dauer.
Im darauffolgenden Sommer fuhr ich nun doch einmal mit meinen Eltern nach Mecklenburg an einen See. Wir kampierten dort in Zelten und das Wetter blieb durchgehend sonnig und warm. Fünf weitere Paare mit ihren Kindern waren ebenfalls untergebracht. Die Plätze hatten alle über die Gewerkschaft im Kombinatsteil meines Vaters ergattert, ohne Luxus, aber preiswert.
Meine Mutter, groß, blond und schlank, machte praktisch eine gute Figur. Sie hatte Optimismus und Tatkraft. Mein Vater, drahtig, fast ein wenig dünn, war eher introvertiert und nachdenklich. Sie passten womöglich nicht richtig zusammen, sagte ich mir mitunter, doch Gegensätze ziehen sich ja manchmal an. Wenn mich mein Vater durch seine Brille ansah, wirkte er streng und unnachgiebig. Doch ich war immer noch jung, und ich sollte mich in vielem noch irren.
Wir badeten jeden Tag, aßen an frischer Luft, sonnten uns und streunten durch den angrenzenden Kiefernwald. Das Bergfest, wenn der Urlaub zur Hälfte vorbei ist, wurde traditionell an zusammengerückten Tischen in der Mitte des Zeltplatzes zelebriert. Es wurde gut gegessen, Bier und Likör wurde aufgetafelt. Sie saßen enger beieinander als sonst. Wir als Kinder durften länger aufbleiben; es herrschte Aufregung und hervorragende Laune. Als die Dunkelheit hereinbrach, leuchteten Lampions auf, welche die Erwachsenen zwischen den Zeltstangen befestigt hatten. Sie rissen Witze, und das laute Lachen schaffte eine Atmosphäre von Eintracht. Man feierte wilde Verbrüderung, stieß miteinander an, und zwischen den Zelten geisterte fahles Licht. Falter umschwirrten die Lampions. Das Bergfest, das Zählen von Tagen, bedeutet auch eine Beschneidung der Zeit.
Wie auch immer, es wurde manch alter Hader begraben, den man in der Vergangenheit angezettelt hatte. Dass nach dem Urlaub der Alltag wieder seine Zähne blecken würde, daran dachte in dieser Nacht niemand. Ich wusste nicht, dass es die letzten gemeinsamen Ferien mit meinen Eltern sein sollten.
Meine Mutter hatte in ihrem Frisiersalon einen Mann kennengelernt, dem sie die Haare machte. Dort herrschte Hochbetrieb, denn man bediente mindestens dreißig Kunden und es gab ein ausgeklügeltes Wartesystem.
Dem Friseur erzählt man alles, so war das üblich. Das sanfte Schneiden und Streichen, das eröffnet offenbar Horizonte. Die Sorgen und Nöte sowie auch Hoffnungen und Sehnsüchte kommen zur Sprache.
Der Mann hieß Alfred Gregorek, wie ich später erfahren sollte. Er war Leiter eines Reisebüros und erwähnte die Sonnenstrände der bulgarischen Schwarzmeerküste und andere Ziele. Auch besaß er ein Haus am Rande des Erzgebirges. Er sei nur zufällig hier in der Stadt gewesen. Die lange Wartezeit hier im Salon hätte ihn nicht gestört, und meine Mutter sei ihm sofort aufgefallen. Nun, er hätte darauf beharrt, von ihr bedient zu werden, obwohl er schon eher an der Reihe gewesen wäre. Man machte eine Ausnahme. Ihre zwanglose Unterhaltung endete damit, dass sie sich vielleicht einmal in einem Cafe nach ihrer Schicht treffen könnten. Gregorek gab ihr seine Visitenkarte.
Meine Mutter war offensichtlich begeistert von der Küste Bulgariens, denn sie rief ihn eine Woche später aus einer Telefonzelle unweit unseres Mietshauses an. Überdies hatte ich selbst schon damals bemerkt, dass irgendetwas zwischen meinen Eltern nicht mehr funktionierte. Abends schwiegen sie sich lange an, auch während des Essens fiel kaum ein Wort. Ich hörte nurmehr das quälende Ticken unserer Wohnzimmeruhr.
Manchmal, wenn ich schon im Bett lag, stritten sie sich, und ich hörte oft die Worte „Arbeit“ und „Lohn“.
Eines Abends, Monate später, wandte sich mein Vater direkt an mich: „Adrian, Elisabeth kommt heute nicht nach Hause.“
„Warum sagst du plötzlich Elisabeth?“ fragte ich.
„Sie hat – Adrian – deine Mutter hat einen anderen Mann.“
„Und warum?“ fragte ich erneut. Mein Vater schüttelte entnervt den Kopf. „Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich ihr nicht das bieten, was sie möchte. Im Moment geht es um das Sorgerecht“, sprach er sehr schnell weiter.
„Sorgerecht?“
„Ja“, sagte er etwas ungehalten. „Ich möchte, dass du bei mir bleibst. Und deine Mutter bemüht sich natürlich darum, dass sie dich behält.“
Ich konnte es nicht fassen, dass es jetzt um meine Person Gerangel gab. „Bei wem möchtest du denn bleiben? Ich hoffe, bei mir. Deine Mutter hat – gewissermaßen – das Wohl der Familie aufs Spiel gesetzt.“ Er entnahm einem Fach der Schrankwand eine Flasche Weinbrand, griff nach einem Glas und goss sich ein. Dann drehte er sich brüsk um. „Wir werden zusammenhalten“, stellte er fest. Ich bemerkte, dass er sich seit Tagen nicht rasiert hatte.
Mutter sah ich zum letzten Mal, als sie ihre restlichen Sachen packte. Vater saß wütend im Wohnzimmer. Er wollte sie mit Vorwürfen überschütten, doch meine Anwesenheit hielt ihn davon ab. Als sie ging, kam sie noch kurz zu mir, strich mir über die Wange und sagte: „Wie sehn uns. Bis bald.“ Ich sah sie verständnislos an und schüttelte den Kopf. „Warum gehst du denn?“
„Das verstehst du noch nicht. Ich erklär dir's später.“
„Das glaub ich kaum“, war im Moment die einzige Gegenwehr meines Vaters. Mit hocherhobenem Haupt zog sie die Tür hinter sich zu,
In der Folgezeit entwickelte sich ein nervenaufreibendes Kräftemessen um das Sorgerecht, bei dem schließlich mein Vater den Sieg davontrug. Sie hatte ihn schließlich verlassen. Ich reifte unter diesen Umständen etwas früh heran und konnte meine Mutter einfach nicht begreifen. Mein Vater war im Begriff, in diesem Zeitraum ein wenig abzurutschen, er begann zu trinken, und ich konnte ihn nur sehr schwer davon abhalten.
Er wollte mich natürlich auf seine besondere Art erziehen. Als sich das Weihnachtsfest näherte hörte man im Treppenhaus Getuschel, und in den Kellern hörte man das Geknister von Verpackungen. In unserem Haus wohnten noch mehrere Familien mit ihren Sprösslingen. Doch ich war jetzt nur in einer halben Familie.
Am ersten Adventswochenende saßen wir im Wohnzimmer; es war anheimelnd warm. Im Raum hatte Vater nur einige Nussknacker aufgestellt. Denn seitdem Mutter weggezogen war, maß er den Weihnachtsritualen keine größere Bedeutung mehr bei. „Was wünschst du dir?“ fragte er. „Ich sehe, dass du viel liest.“
„Ein Buch.“
„Dachte ich doch.“ Er lehnte sich zurück und schaltete den Fernseher ein. Ein Knabenchor war zu sehen.
„Es schneit“, sagte ich mit einem Blick aus dem Fenster.
„Ja, es wird Winter“, sagte Vater und nickte bedeutsam.
„Ich möchte ein bestimmtes Buch“, sagte ich.
„Was denn für eins?“
„Eins über die Eroberung des Südpols. Über Scott und Amundsen.“
„Ach“, sagte Vater. „Das interessiert dich. Forscher und Entdecker.“
„Ja.“
Vater drehte sich auf seinem Sessel herum. „Die Story kenn ich.
Hab schon davon gelesen. Du willst wissen, wie Amundsen den Wettlauf gewann.“
„Nein“, sagte ich. „Ich will wissen, wie und warum Scott scheiterte.“ Mein Vater wich etwas zurück. Er überlegte lange.
Dann sah er mich an. „Warum gilt dein Interesse nicht dem Gewinner?“
„Weil auch Scott gekämpft hat“, sagte ich. „Amundsen gebührt natürlich die Ehre, den Pol als Erster erreicht zu haben, aber…“ Ich suchte nach Worten.
„Was aber?“ fragte Vater.
„Aber auch Scott hat Achtung verdient.“
„Aber er hat verloren. An solchen Menschen orientiert man sich nicht.“
„Was heißt, man orientiert sich nicht? Er hat verloren, na gut.
Aber er hat gekämpft. Auch er gilt als Held. Und er hat es mit dem Leben bezahlt.“
„Aber er hat, wie ich mich entsinne, einen Haufen Fehler gemacht.“ Vater machte eine unbestimmte Geste.
„Man kann auch Fehler machen. Aus Fehlern lernt man.“
„Man sollte aber keine Fehler machen, schon gar nicht, wenn man sein Leben dabei aufs Spiel setzt. Wer Fehler macht, muss scheitern.“
„Du willst doch nicht behaupten“, sagte ich, „dass Scott so an diese Aufgabe heranging?“
„Fakt ist“, meinte Vater, „dass Scott mit Motorschlitten aufbrach. Und Technik in winterlicher Umgebung ist unzuverlässig. Amundsen ließ alles mit Hundeschlitten ziehen.“
„Aber Scott hat es gewagt“, wandte ich ein.
„Und dann hat er noch einen Mann hinzugenommen“, erwiderte Vater, „obwohl nicht genügend Proviant da war. Und mit dem Brennstoff… Der ging aus. Das war alles nicht ausreichend gesichert.“
„Gut, vielleicht verlor er deshalb. Aber auf dem Rückweg kam ein Kälteeinbruch. Der hat sie überrascht. Sie sind gestorben“, sagte ich verzweifelt. „Im Übrigen kennst du die Geschichte erstaunlich gut.“
„Du aber auch“, sagte Vater. „Wozu brauchst du dann noch das Buch?“
„Vielleicht brauch ich es ja gar nicht mehr.“
Mein Vater lehnte sich zurück. Mit einer raschen Handbewegung zum Fernsehknopf ließ er den Knabenchor verstummen. „Was willst du eigentlich?“ fragte er. „Ich glaube, deine Mutter fehlt dir.“
„Das hat damit nichts zu tun“, begehrte ich auf.
„Sie hat dir Karten geschrieben“, sagte er übergangslos.
„Ja. Aus Bulgarien.“
„Sie möchte dich sehen. Willst du dich mit ihr treffen?“
„Ich weiß nicht. Ich bin ratlos.“
„Das musst du selbst wissen. Aber jetzt kommt erst mal Weihnachten“, sagte er.
Ich traf mich nicht mit Mutter. Mittlerweile war sie mir merkwürdig entfremdet.
Als Waldemar Cierpinski den Olympiasieg in Montreal holte, begann auch ich zu laufen. Ich hatte das alles mit Mutter nicht verstanden und begann wohl vor mir selbst zu flüchten. Die außerordentliche Athletik der Teilnehmer begeisterte mich derart, dass ich zusätzlich Liegestütze und noch Klimmzüge an den Wäschestangen betrieb.
Täglich siebzehn Uhr startete ich vor dem Haus und umrundete das gesamte Karree; die Strecke belief sich auf ungefähr einen Kilometer; ich hatte es mit meinem Zähler am Fahrrad gemessen. Nach einer Woche erhöhte ich die Distanz auf zwei Runden, und so ging es weiter, bis ich auf zehn Runden kam und Vater sich aufregte, dass ich völlig verschwitzt, demnach zu spät zum Abendessen erschien und überdies keinen Hunger verspürte. Ich magerte ab. Dann verlegte ich das Laufen auf fünfzehn Uhr. Das passte besser; ich war kein Kaffeetrinker, und Vater aß nun allein seinen Kuchen.
Als ich sechzehn wurde, stahl ich einmal Zigaretten in unserem Laden. Er existierte trotzdem weiter. Nur die Verkäuferinnen waren ein bisschen älter geworden.
Unterdessen hatte ich auf Betreiben meines Vaters einen Lehrvertrag als Dreher unterschrieben. Natürlich wollte er, dass ich in seine Fußstapfen trete. Mein Leben änderte sich schlagartig. Ich lernte neue Mitmenschen kennen. Doch die praktische Ausbildung, die mit der schulischen einherging, war eintönig. Mir schwante nichts Gutes. Doch in dieser Zeit erwarb ich den Motorradführerschein.
Letztlich war es so, dass ich nach doch erfolgreichem Abschluss der Lehre mit einem Facharbeiterbrief belohnt wurde, und da ich mich im Schleifprozess besser bewährt hatte, wurde ich im Stammbetrieb an einen Automaten gestellt, an dem ich in zwei Schichten Abertausende von Waschmaschinenwellen bearbeiten musste, die für die Herstellung der legendären WM 66 vonnöten waren.
In meiner Schulzeit waren mir die ersten Vorboten von Hierarchien aufgezeigt worden, die mich von nun an nie mehr loslassen sollten. Das wahre Leben hatte begonnen.
„Adrian“, sagte Vater eines Abends, „Elisabeth ist gegangen, weil ich zu wenig Geld verdiene. Und da hat sie so einen Lackmeier gefunden, der ihr mehr bietet.“ - „Aber du verdienst doch 'ne Menge.“
„Nun, es geht schon. Na eben zwei Schichten... Da fehlt mir der Nachtzuschlag. Da kann man nichts tun. Und Elisabeth war Friseuse. Da kommt auch nicht viel rum.“
„Und wieso hat sie dir dann Vorwürfe gemacht?“
„Ich hätte vielleicht den Meisterlehrgang... Oder nebenbei pfuschen. Das erst noch in meinem Alter.“ Er fuchtelte mit der Hand.
„Und der andere?“ fragte ich.
„Ich weiß nicht, woher der das Moos hat, und sein Anwesen.
Dukatenscheißer gibt’s eben auch. Ehrliche Arbeit lohnt sich wahrscheinlich nicht.“
„Jetzt bin ich auch in deinem Betrieb“, warf ich ein.
„Fang du auch noch an. Ihr habt sie doch nicht alle.“ Vater langte nach seiner Flasche.
„Ist schon gut. So war es nicht gemeint. Wir werden zusammenhalten“, stellte ich diesmal fest. Vater war versöhnt und nickte.
Die Laterne an der Regimentsstraße warf mattes Licht ins Zimmer auf den Tisch. Es war elf Uhr nachts. Im Radio dudelte noch Musik. Der EK, der Stubenälteste, hatte es angelassen. Er konnte ohne diese Klänge nicht einschlafen. Ich war Soldat und Richtschütze eines Panzers der NVA, und ich hatte das seltene Glück, mit zwanzig Jahren an die Friedensfront abkommandiert worden zu sein, um den hinterhältigen Klassenfeind im Falle eines Falles zu bekämpfen.
Im zweiten Diensthalbjahr hatte ich nun die Demütigungen überstanden, jetzt waren die Neuen dran und wurden Ladeschützen.
Heute, zum Sonntag, hatte es ein Stück Kuchen gegeben.
Nachmittags dachte ich darüber nach, wie es zu Hause wohl aussehen würde, auf den Balkonen, wenn die anderen dort in der friedlichen Stille ihren Kaffee trinken würden, fern jeder Qual, und hier machte man sich fertig.