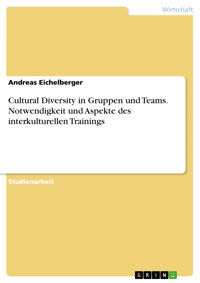Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Leben gibt es nicht nur Erfüllung, Glück und Liebe, auch Gleichgültigkeit und Enttäuschung spielen eine Rolle. Der Alltag ist voller Überraschungen; mag es Verdrängtes sein, was plötzlich aus dem Nichts auftaucht oder dunkle Kapitel der Vergangenheit. Davon handeln diese Geschichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Leben gibt es nicht nur Erfüllung, Glück und Liebe, auch Gleichgültigkeit und Enttäuschung spielen eine Rolle. Der Alltag ist voller Überraschungen; mag es Verdrängtes sein, was plötzlich aus dem Nichts auftaucht oder dunkle Kapitel der Vergangenheit. Davon handeln diese Geschichten.
2008 „Nichts von alledem“ 2008 „Dämmerung“ 2015 „Feldzug mit Burgunder“ 2023 „Die Stufen des Glücks“
Inhalt
Die Postkarte
Der DDR-Laden
Vogelhäuschen
Scott und Amundsen
Die Akte
Die Eule
Zwölf Jahre
Nadjas Sommer
Der Gitarrenlehrer
Die Katze
Der Garten
Am Meer
Erinnerung
Schulkameraden
Die Postkarte
1916
Fritz Strehle klopfte den Staub von seiner Uniform. Er sah hinüber zu seinem Kameraden, der mit dem Karabiner im Anschlag über den Grabenrand spähte. „Mein Bajonett ist weg“, sagte der Kamerad. Fritz kramte wortlos in seinem Tornister. Doch dann sprach er: „Weißt du, ich schreib jetzt eine Karte an Erna.“
„Was denn, mitten im Gefecht?“
„Da kommt nicht mehr viel heute“, sagte Fritz. „Einzelfeuer.“ Er machte eine wegwerfende Handbewegung. Der Kamerad ließ sich in den Graben sinken und nahm den Helm ab, wischte sich über die verschmutzte Stirn. Fritz reichte ihm die Feldflasche. Dann schrieb er: „Liebste Erna! Mir geht es gut. Ich passe schon auf. Leider haben wir heute drei Kameraden verloren, aber unsere Gegenwehr hat auch beim Feind Verluste gefordert. Ich hoffe, du und Walter, Ihr seid gesund. Hüte nur das Haus und umsorge das Kind. Wenn uns der entscheidende Vorstoß gelingt, bin ich bald zu Hause. Dann ist der Krieg vorbei…“
Fritz las schließlich die Karte vor. Doch sein Kamerad war in Schlaf gesunken. Einige Schüsse peitschten durch die Nacht. Das Hindenburglicht im Unterstand flackerte unruhig. –
Die Feldpost überbrachte Erna Strehle die Nachricht. Sie war erleichtert, und Fritz’ Karte lehnte noch zwei Wochen an der Keksdose in der Küche, für jeden sichtbar. –
Noch einmal bekam Erna Strehle Feldpost. Fritz war gefallen.
1941
Walter Strehle übergab dem Vermieter die Wohnungsschlüssel.
Die wichtigsten Gegenstände der Einrichtung seiner Mutter Erna waren verladen.
Walter fuhr nach Hamburg und lagerte die Möbel auf dem Speicher ein. Sie würden vieles noch brauchen. Der Krieg brachte nichts als Not. Man musste vorsorgen.
In Hamburg hielt er sich oft in der verstaubten Kammer auf und kramte in den Fächern der Kommode seiner Mutter. Die Karte des Vaters fiel ihm dabei häufig in die Hände. Walter sah sich nachdenklich um. Unten schlief sein Sohn Rolf, die Frau war zur Nachtschicht in der Wäscherei. –
Dann wurde Walter eingezogen, zuerst an die Ostfront, später dann nach Westen. In der Ardennenoffensive wurde er verwundet, kam nach Hause.
Das Bein verheilte und der Krieg war endlich vorbei. Walter machte auf dem Schwarzmarkt Geschäfte. Es ging ihnen bald etwas besser. Doch später, nach einigen zähen Jahren des Kampfes, erlag er der Schwindsucht.
1966
Rolf Strehle ordnete den Nachlass seines Vaters. Er sortierte a us, behielt manches. Die Zeiten hatten sich geändert. Die Zukunft würde Gutes bringen. Der Aufschwung war nicht zu übersehen.
Vielleicht könnte man sogar ein Häuschen bauen. Sie würden sparen müssen, auf den Pfennig achten. Dazu gehörte wohl auch, sich von altem Tand zu trennen. Die Möbel sollten etwas Geld einfahren. Rolf Strehle brachte auch die alten Karten zum Trödler.
1991
Die Dämmerung war längst hereingebrochen. Sten Frillers betrat den Antikmarkt. Ein Angestellter sah wachsam zu ihm herüber.
„Ich suche was vom Krieg“, sagte Frillers. Der Angestellte wies auf zwei große geordnete Regale. „Erster, zweiter, was soll’s sein?“
„Na ja, ist im Grunde egal; mein Sohn hat in der Schule eine Aufgabe. Material über den Krieg. Wie schlimm das damals war…“ „Hier sind ein Haufen Postkarten und Fotos, suchen sie sich in Ruhe was aus.“
Sten Frillers lächelte. „Okay.“ Der Angestellte entfernte sich.
Frillers blätterte in den Postkarten. Er wirkte ratlos. Was würde das Richtige sein? Dann stieß er auf eines der vielen vergilbten abgegriffenen Dokumente. Feldpost 1916. Die Karte war tatsächlich beschrieben. „…Die Verpflegung ist knapp. Es liegt am Nachschub. Aber das wird schon…“ „Ich nehme die“, sagte Frillers zu dem Angestellten. –
Später am Abend schob Frillers seinem Sohn die Karte auf den Schreibtisch. „Ich hab doch noch was gefunden. Kannst du morgen mitnehmen. Vom Krieg, wie’s die Lehrerin wollte.“
Der Junge nahm die Karte und vertiefte sich im Schein der kleinen Lampe in das Bild auf der Vorderseite. Unüblich, schwarzweiß, fast grau. Das Foto zeigte eine Gegend, über der ein trüber Himmel hing, wie eine Glocke. Gebäude waren zu erkennen, von denen der Putz bröckelte. Einige Uniformierte liefen auf einem schlammigen Weg. Oben rechts stand der Name einer Ortschaft.
Der Junge war schon müde. Wie war der Krieg? Die altdeutsche Schrift konnte er nicht lesen. Er verpackte die Karte in der Schultasche.
2016
Tom Frillers saß über den Computer gebeugt. „Das Zeug ist jetzt gefragt“, rief er seiner Frau zu.
„Nicht so laut“, flüsterte sie hastig zurück. „Der Junge muss schlafen.“
„Ja, ja, ist schon gut.“ Tom Frillers betätigte die Maustaste. Sein Blick glitt über den Bildschirm. „Mein Gott, was da geboten wird.
Die setz ich heute rein.“
„Was?“
„Die Karte. Vom ersten Weltkrieg. Die hab ich in meinem alten Schulzeug im Keller gefunden.“
„Zeig mal“, sagte Frillers Frau und ließ sich die Karte geben. Dann las sie: „…Hier singen keine Vögel mehr. Doch Erna, heb die Karte auf. Ich werde nicht fallen, doch wenn ein Splitter mich trifft, komme ich heim…“ Sie sah ihren Mann an. „Das willst du bei Ebay reinstellen?“
„Warum nicht? Kleinvieh macht auch Mist.“
„Manchmal bist du mir unheimlich.“ Sie gab die Karte zurück, ging in die Küche. Von einem Raum zum anderen begegneten sich ihre Blicke. –
Am nächsten Abend, von der Arbeit zurückgekehrt, ging Frillers in das Zimmer seines Sohnes. „Na, wie lief’s in der Schule?“
„Gut.“
„Gut? Na schön.“
„Der Physiklehrer hat was gesagt.“
„Was hat er denn gesagt?“
„Energie geht nie verloren. Sie wandelt sich ständig um.“
Frillers schwieg lange. „Da ist bestimmt was Wahres dran.“
Der DDR-Laden
Im Konsum an der Ecke kam mir stets das Pinkeln an. Der granitene Fußboden strahlte Kälte aus. Doch die Regale waren voller Wärme und die Flaschen, Gläser, Büchsen sorgfältig geordnet. Als Kind ging ich oft hierher zum Einkauf.
Der Konsum war klein, aber eine Welt für sich. Er besaß auch ein geheimnisvolles Lager. Wenn etwas nicht erhältlich war, sagte man, dass anderntags die Lieferung käme.
Er lag nur hundertfünfzig Meter entfernt. Ich bin diesen Weg mit Frohsinn gegangen, sommers wie winters. Ich habe immer dasselbe gesehen. Den Ahorn, den Kindergarten mit den lärmenden, wilden, unbeschwerten Kleinen, die wenigen Häuser.
Brannte hinter einem Fenster abends Licht, wurde es interessant.
Wer mochte wohl sein Unwesen treiben oder still arbeiten im Schein einer Schreibtischlampe?
Nach dem Einkauf lief ich den Weg zurück. Ich entdeckte wieder Neues, das ich trotzdem kannte.
Als ich größer war, stahl ich einmal etwas in dem Konsum. Es hat niemand gemerkt, und der Konsum existierte auch weiter. Der Weg zu ihm war Teil meiner Jugend; die Bäume, die Häuser, alles war vertraut.
Doch wurde ich so groß, dass ich zur Armee musste. Mein Dasein bekam eine andere Richtung.
Dann heiratete ich und zog aus. Dennoch trieben mich Spaziergänge beständig in die Nähe des Konsums an der Ecke.
Nun, die Verkäuferinnen waren älter geworden, die mich schon als Junge kannten. - Dann kam die Wende.
Das Leben zieht seine Bahnen. Man denkt über vieles nach, handelt, unterlässt, und man kämpft, verbissen, für irgendein kleines Ziel. Die Zeit verrinnt. Man beginnt zu vergessen. -
Eines Tages besuchte ich meine Eltern. Und wie unter innerem Zwang betrat ich auf dem Heimweg den Konsum. Mir kam das Pinkeln nicht an, aber die Verkäuferinnen waren ausgewechselt worden. Alles wirkte befremdlich und unordentlich. Ich sah halbgeöffnete Pappkartons und hörte hektisches Gerede. Es war auch kein Konsum mehr. Das Schild, das ich solange kannte und nie beachtet hatte, war entfernt worden.
Schließlich unterließ ich es gänzlich, in den Laden einzudringen.
Doch den Weg zu ihm ging ich noch gern. Dort angekommen, äugte ich gewohnheitsmäßig durch die Scheiben und kehrte um.
Ich kannte hier alles. Jeden Stein, jede Mauernische. Das ist nicht übertrieben.
Dabei bemerkte ich, dass man den Lattenzaun des Kindergartens durch eine Eisenbefriedung ersetzt hatte. Das begriff ich nicht.
Früher, als meine Hand dort entlang glitt, hatte das so eine Art Knattern ergeben; jeder Pfahl war zu fühlen wie derbe Finger mit wettergegerbter Haut, verlässlich, wegweisend. Es war eben Holz.
Bei dem Metallzaun tat ich das nicht mehr.
Eines Tages schloss der Laden seine Pforten für immer. Das kam überraschend, doch berührt hat es mich nicht in großem Maße. Im Grunde wohnte ich längst weitab, besaß Familie.
Aber ich musste plötzlich an die Zeit denken, als der jetzt geschlossene Laden noch ein Konsum war. Ich sah durch die Scheibe, doch konnte ich nichts erkennen. Sie schien blind geworden zu sein. Der Weg zurück fiel mir etwas schwer. Aber abgeneigt, ihn noch zu gehen, war ich nicht. Er hatte eben geschlossen, der Laden, und der Lattenzaun des Kindergartens bestand heuer aus Metall...
Bäume entlassen ihr Laub, der Schnee bedeckt die Straßen, die Passanten vermummen sich, und die Gedanken kehren sich nach innen. -
Wenig später wurde der Kindergarten seines Daseins beraubt. Ich vermisste die wilden unbeschwerten Kleinen. Die Straße meiner Jugend lag im Sterben... -
Ziellos wandernd lenkten mich meine Schritte neulich an einem Abend wiederum auf den bekannten Pfad. Immerhin, der Ahorn.
Ich bin den Weg mit einer dumpfen Angst gegangen. Hinter keinem Fenster brannte Licht. Es war nicht die Angst vor der Dunkelheit. Die Dunkelheit hat auch Vertrautes. Auf dieser Straße zum ehemaligen Laden schon, vorbei am ehemaligen Kindergarten mit dem ehemaligen Holzzaun.
Als ich vorn an der Gabelung stand, blickte ich mich um. Jetzt brannten links die Gaslaternen, zwischen den Ahornbäumen.
Mit einem Mal erfüllte mich der bohrende Wunsch, heute noch „Tom Sawyer” zu lesen.
Vogelhäuschen
Manchmal kommt mir abends der Gedanke, dass es nichts mehr zu reißen gibt. Alles ist lasch und lau geworden. Im Fernsehen läuft Ulk. Zum Lesen fehlt die Konzentration. Und es widerstrebt mir, irgendetwas zu tun. Gott, ich hab meine Arbeit, ich hab sogar eine. Doch das füllt nicht aus.
Hin und wieder klimpere ich auf der Gitarre einen Song. Doch diesen Mist kann ich niemandem vorspielen. Ich will nicht von Banausen reden, vielleicht bin ich auch dilettantisch.
Es wird Winter, und ich mag aber jetzt kein Vogelhäuschen bauen.
Ich hab eins gekauft.
Das Bier schmeckt mitunter derartig fade, dass ich mich wundere, mir das Gebräu nicht schon längst abgewöhnt zu haben. Andere gehen um diese Zeit schlafen, sie schlafen ruhig ein.
Ich überdenke oft die Finanzen. Nach einer Weile verwerfe ich das und philosophiere ein bisschen. Es wäre Zeit zum Sterben, jedenfalls für heute.
Ich fühle mich nicht gut genug gerüstet für den nächsten Tag, nicht gewappnet gegen Händel jeder Art. Es ist wie ein Hängen zwischen Tod und Wiedergeburt.
Ich erinnere mich häufig daran, wie mein Vater Kreuzworträtsel füllte. Wenn er etwas nicht wusste, knobelte er Stunden daran herum, die Lösung herauszufinden. Die Sonne übergoss den Balkon. Offensichtlich fand Vater einen Sinn, oder er quälte sich damit ab. Ich weiß es nicht. Aber er warf irgendwann den Stift weg, an einem Sonntag. In dieser Nacht schlief er für immer ein.
Eines Tages beobachtete ich eine Fliege im Wohnzimmer. Es war im November. Das kalte Wetter hatte das Tier wohl herein getrieben. Die Fliege saß auf dem Teppich, kroch scheinbar unmotiviert herum, konnte kaum noch fliegen. Sie verhedderte sich später in den Fransen der Tischdecke, wie trunken suchte sie die Nähe eines Halts, fiel auf den Rücken.
Ich hätte sie töten können. Doch es war vermutlich eine der letzten dieses verschwindenden Herbstes. Das machte mich nachdenklich. Sie hatte solange gekämpft. Ich gab ihr Narrenfreiheit.
Neulich träumte ich von einem braunen Plüschsessel. Als ich mir nach dem Traum das gesamte Zimmer ins Gedächtnis zurückrief, fiel mir ein, um was für ein Zimmer es sich gehandelt hatte. Mein Onkel hatte gelegentlich in diesem Sessel gehockt, in der Ecke neben einem alten Radio, niedergeschlagen, zermürbt, in der Wohnung meiner Großmutter.
Ich war damals noch ein Kind. Mein Onkel war ein begnadeter Zeichner, lächelte mich oft müde an und nickte in sich hinein, als wolle er sagen: Du verstehst die Welt zum Glück noch nicht.
Von Beruf war er Schuhmacher. Er hatte einen Kumpel, der ein Schifferklavier besaß. Mit ihm sang und spielte er auf Feiern und sorgte für gute Laune.
Doch in diesem Sessel wirkte er einsam und zurückgezogen und suchte Trost bei seiner Mutter. Doch was konnte sie schon tun?
Des Onkels Frau war dominant, hatte eine Tochter mit in die Ehe gebracht. Sie tanzten ihm auf der Nase herum. Er begann zu trinken. Statt ihm zu helfen, brachte es alle noch mehr in Wallung.
Er war ständig traurig, und eines Tages starb er an einem Gehirnschlag. Ich entsann mich. Ich fand ein altes Foto von ihm und suchte abends auf dem Friedhof nach der Grabstelle. Nach zwei Stunden gab ich auf.
Wenn man immerzu in der Wohnung hockt, ändert man die Welt nicht. Ich verehre Katzen, deshalb vielleicht bellt mich unentwegt der Hund meiner Nachbarin an, als wäre ich ein Verbrecher. Und immer sagt sie zu ihrem vierbeinigen Freund: „Den kennst du doch.”
Heute vorm Haus sagte ich: „Natürlich kennt er mich. Ich wohne seit fünf Jahren hier. Aber er wird weiterhin bellen, wenn sie ihn nicht erziehen.”
„Sie können wohl keine Tiere leiden?” zischte meine Nachbarin und ließ mich zurück.
Ich hatte die Welt nicht verändert, oder doch? Am Nachmittag sah mich ein anderer Nachbar merkwürdig böse an.
An diesem Abend war ich tatsächlich einmal ermüdet. Und noch ein anderer Mieter begann im Keller, zu hämmern und zu sägen.
Wenn man die Wohnung verlässt, ändert man die Welt. Die Vergangenheit kann man nicht ändern. Ich verließ die Wohnung und ging in den Keller hinab.
Der lärmende Mieter war unten. Spärliches Licht drang durch die hölzerne Brettertür. Ohne Zögern lief ich den Gang nach hinten und öffnete den Verschlag.
Er sah nicht einmal hoch von seiner Arbeit. In der Hand hielt er eine Feile. „Ich muss morgen früh raus”, sagte ich.
Er feilte weiter. „Ach ja?” fragte er. „Wann müssen Sie denn raus?”
Seine Frage zog mich in Bann. Ich antwortete: „Viertel vor fünf.”
Der Nachbar war ein älterer Mann, schütteres Haar, schlank, alte Hosen, hemdsärmelig, ständig mürrisch. Mich erschreckte die Forschheit und Aufmerksamkeit. Wie man sich doch irrt! Lauerte da etwas hinter seiner Fassade? Und er reagierte nicht auf meine Ansage.
Ich trat versuchsweise den Rückzug an. „Machen Sie das doch morgen. Sie haben Zeit.”
Er unterbrach das Feilen. „Meine Zeit teile ich mir selbst ein.” Er sah mich an.
Der Rückzug ging weiter. Ich wich seinem Blick aus. „Ich bin sehr müde. Geht’s nicht morgen?”
Plötzlich feilte er wieder. Ich sah mir den Keller an. Er war sorgsam geordnet, behängt mit Werkzeugen und Utensilien aller Art.
Schränkchen, Schubladen, Regale, das Ergebnis jahrelanger Arbeit. .
„Ich nehme Ihnen jetzt die Feile weg”, sagte ich.
Er feilte. Ich überlegte. Wenn ich nichts unternahm, würde ich unglaubwürdig erscheinen. „Was bauen Sie denn?” fragte ich.
„Vogelhäuschen”, sagte er.
Manchmal denke ich an einen Jungen, dessen Name mir entfallen ist. Er war ungefähr neunzehn und geistig behindert. Vor vielen Jahren lungerte er täglich auf der Straße herum. Als meine Großmutter einkaufen ging, begleitete er sie, unterhielt sich mit ihr trotz seiner Zurückgebliebenheit durchaus angenehm, trug ihr die Tasche. Sie gewann ihn lieb. Sie verstand, mit seiner Schwäche umzugehen. Wenn es dämmerte und er immer noch herumstand, sah sie das aus ihrem Küchenfenster, ging hinab und brachte ihn über die viel befahrene Hauptstraße, auf die Seite, auf der er wohnte. Es war zu gefährlich, fand sie. Sie hatte recht. Er war ängstlich, der Autos wegen. Wie er ständig herübergelangte, bekam sie nicht heraus, und seine Eltern lernte sie nie kennen.
Dann lief sie nach Haus, sich abmühend, in der Linken zur Hilfe einen Stock.
So ging das eine ganze Zeit. Eines Tages blieb der Junge aus.