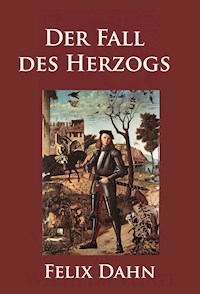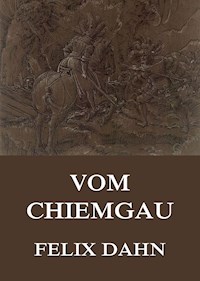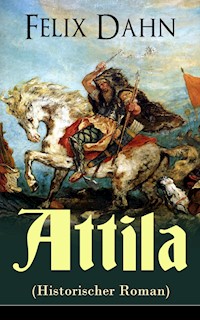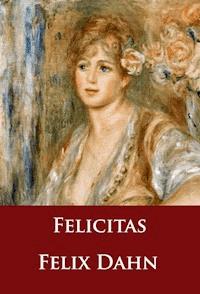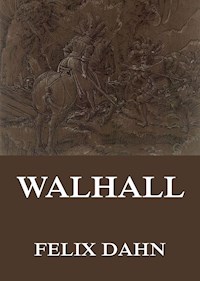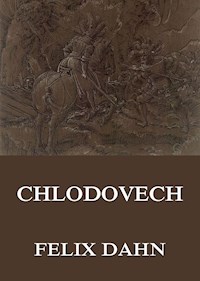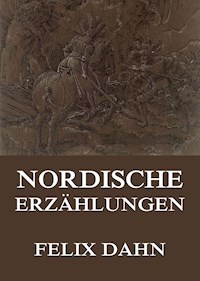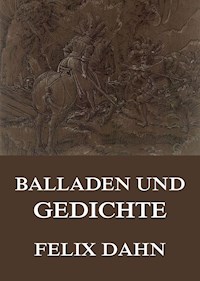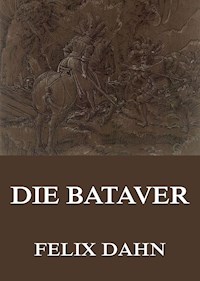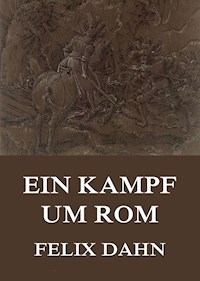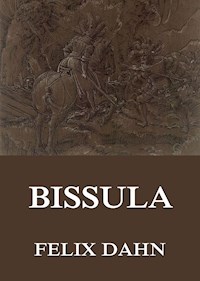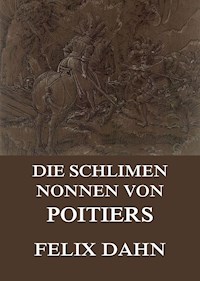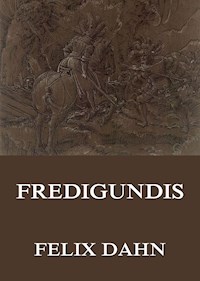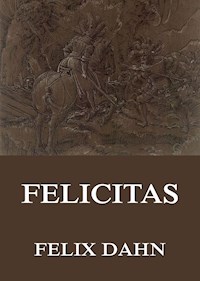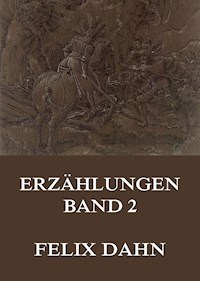Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der historische Roman 'FELICITAS' von Felix Dahn entführt den Leser ins antike Rom des 3. Jahrhunderts nach Christus. Mit einer detailreichen Sprache und einem akribischen Blick für historische Genauigkeit erzählt Dahn die Geschichte der jungen Sklavin Felicitas, die sich inmitten politischer Intrigen und machthungriger Kaiser behaupten muss. Durch die Mischung aus Fiktion und historischer Realität schafft Dahn eine faszinierende Welt, die den Leser in ihren Bann zieht. Der historische Roman ist ein Meisterwerk, das fesselnde Handlung mit tiefgründigen Charakteren vereint und eine authentische Atmosphäre schafft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FELICITAS
Inhaltsverzeichnis
Vor vielen Jahren hatte ich in Salzburg zu arbeiten: im Archiv, in der Bibliothek, in dem Museum der römischen Altertümer.
Meine Studien galten besonders dem V. Jahrhundert: der Zeit, da die Germanen in diese Landschaften drangen, die römischen Besatzungen, mit oder ohne Widerstand, abzogen, während gar viele römische Siedelungen im Lande blieben: Bauern, Handelsleute, Handwerker, die ihre Heimstätten nicht räumen, ihr einträgliches Geschäft nicht aufgeben wollten, nicht weichen von der liebgewordenen langgepflegten Scholle auch unter Herrschaft der Barbaren; diese, war der Sturm und Kampf der Eroberung vorüber und die Landteilung vollzogen, thaten ihnen nichts zuleide. –
War die Arbeit des Tages gethan, streifte ich in der schönen, altvertrauten Landschaft des Salzachthales: die warmen Juni-Abende verstatteten langes Umtreiben bis zu späten Stunden.
Gedanken und Träume waren mir erfüllt von den Bildern des Lebens und der wechselnden Geschicke dieser spätesten Römer in den Alpenländern.
Gerade in und um Salzburg forderte die reiche Fülle von Inschriften, von Münz- und Gerät-Funden, von römischen Denkmalen jeder Art die Phantasie zu eifriger Gestaltung auf: denn diese Stadt, mit dem ragenden Kastell, dem »Capitolium«, auf dem hohen Felsenkopf, Fluß und Thal beherrschend, war unter dem stolzen Namen » Claudium Juvavum« jahrhundertelang nicht nur ein Hauptbollwerk römischer Herrschaft, auch eine Stätte blühender und glänzender Entfaltung römischer Kultur: Zweimänner der Rechtsprechung, Dekurionen, Ädilen für Markt und Spiele, Luxusgewerbe, auch Kunsthandwerker und Künstler, sind durch Inschriften als Richter, Verwalter, Einwohner und Verschönerer der Stadt bezeugt.
Was mir den Tag über die Gedanken der Forschung beschäftigt hatte, erfüllte mir die Spiele der Einbildung, wann ich im Abendschein zum Thore hinauswanderte: Fluß und Straße, Hügel und Thal sah ich alsdann mit Bildern römischen Lebens bevölkert: aber fernher, von Nordwesten, zogen drohend, wie die unaufhaltsamen Wolken, die oft von der bayrischen Ebene heraufstiegen, die eindringenden Germanen. –
Am häufigsten, am liebsten schlenderte ich entlang dem Ufer des Flusses in der Richtung der großen Römerstraße, die sich gegen den Chiemsee hin und über dessen Ausfluß, die Alz, bei Seebruck (Bedaium) und über Pfünz (Pons Oeni), hier den Inn (Oenus) überschreitend, nach Vindelicien hinzog und nach dieser Provinz glänzender Hauptstadt: Augusta Vindelicorum, Augsburg.
Sehr zahlreiche Münzen, Thonscherben, Urnen, Grabsteine, Hausgerät jeder Art waren hier gefunden worden in den jetzt zum großen Teil von Wald und Buschwerk bedeckten, zumal von dichtem Epheu überwucherten Niederungen zu beiden Seiten der alten Hochstraße, wo offenbar Colonengehöfte, aber auch stattliche Villen der reicheren Bürger, häufig bis weit außerhalb der letzten Umwallung der Festungsstadt verstreut, das weite Thal erfüllt und geschmückt hatten.
Auf den Resten dieser noch deutlich wahrnehmbaren Römerstraße oder zu ihren Seiten hin wanderte ich oft, der sinkenden Sonne entgegenschauend und träumend, wie wohl den Bewohnern dieser Villen zu Mut gewesen sein mag, als nicht mehr stolze Legionen von hier nach der Römerstadt am Lech marschierten, sondern umgekehrt von dem eroberten Vindelicien aus die ersten schwachen Reiterhaufen der Germanen, vorsichtig spähend, heransprengten, bald aber immer stärkere Massen anzogen, kecker oder vielmehr in wohlbegründeter Zuversicht, das Land nur noch schwach verteidigt zu finden und sich darin neben den schutzlos zurückgebliebenen Römern als deren Herren dauernd niederlassen zu können. –
In solchen Träumereien, nicht ohne den leisen Wunsch, selbst einmal irgend ein kleines Andenken der Römerzeit aufzulesen aus dieser erinnerungsreichen Erde, verlor ich mich eines Abends immer tiefer in das Buschwerk rechts von der Römerstraße, das schmale Geriesel einer Quelle aufwärts verfolgend, über einem von zerbröckeltem Gestein und von Scherben häufig bedeckten Untergrund, den Moos und Epheu dicht übergrünt hatten.
Aber unterhalb der Moosdecke krachte es nicht selten bei meinen Schritten: Ziegel und Thonscherben hob ich dann manchmal auf. Waren es römische? Kein sicherer Anhalt ließ sich ihnen entnehmen.
Ich beschloß, heute dem Rinnsal höher hinauf als sonst entgegenzuschreiten, bis ich etwa seinen Ursprung erreicht hätte, den ich an der sanft abfallenden Halde eines mäßigen Hügels vermutete. Denn ich wußte, daß die Römer bei friedlichen Villen wie bei militärischen Anlagen gern sich an fließende Gewässer bauten. –
Es war sehr heiß gewesen an jenem Sommertag. Ich ward fußmüde und kopfmüde und kam in der völlig unwegsamen Richtung, die ich, dem Wässerlein entlang, einhielt, durch das oft dichte Buschwerk nur langsam und mühsam vorwärts mit Hilfe meines Bergstockes, den ich mitführte, da ich oft auch die Berge hinaufklomm bei meinen Wanderungen. Gern hätte ich mich schläfrig auf das weich einladende Moos gestreckt; doch bezwang ich die Anwandlung und beschloß, diesmal zu dem schon früher gesteckten Ziel, dem »Ursprink« des Quells, durch und emporzudringen.
Nach einer halben Stunde war die Halde erreicht: der »Heiden-Schupf« hieß die Höhe im Volk.
Auffallend zahlreich und groß waren auf der letzten Strecke die Steintrümmer jeder Art gewesen: darunter auch rötlicher und grauer Marmor, wie er in der Nähe gebrochen wird seit ungezählten Jahrhunderten: und wirklich war's, wie ich vermutet: dicht unter der Krone des Hügels sickerte der Quell aus der Erde. Er war, so schien es, einst in Stein gefaßt gewesen: zum Teil war dies noch wahrnehmbar: sorgfältig geglätteter hellgrauer Marmor umschloß ihn hier und dort in schöner Fassung und ringsherum verstreut lagen ungezählte Ziegel: das Herz schlug mir lebhaft: nicht nur infolge des angestrengten Steigens: wohl auch, ich gestehe es: vor hoffender Erwartung, – ich war noch sehr jung! – ob mir heute und hier Mercurius, der römische, oder Wodan, der germanische Wunsch- und Fund-Gott, das lang ersehnte Andenken an die Römer von Juvavum in die Hand spielen möchte: der Name des Ortes: »Heidenschupf« ging unzweifelhaft auf die römische Besiedlung – denn »Heidenstraße« heißt hier die Römerstraße –: dazu kamen ermutigend der Ursprung der Quelle, die Spuren einer Marmorfassung, die vielen Ziegel –: da brach die Sonne, kurz vor dem Versinken, quer durch das Gebüsch und zeigte mir an der vor mir liegenden Ziegelplatte: – Mörtel. Ich hob den Scherben auf und prüfte ihn: es war zweifellos jener römische Mörtel, der, steinhart werdend im Lauf der Jahrhunderte, so bezeichnend ist für die Bauten der ewigen Roma. Ich drehte die Fläche um: da, o Freude! zeigte sich eingebrannt der zweifellose Stempel der XXII. Legion: primigenia pia fidelis!
Und wie ich mich, hoch erfreut, bücke, den nächsten Ziegel zu prüfen, fällt ein noch schärferer Sonnenstrahl auf ein Stück eigenartigen hellgrauen Steines: es ist Marmor, seh' ich nun, und auf der Mittelfläche drei römische Buchstaben, ganz deutlich:
hic ....
da war der Stein zersprungen, aber dicht neben ihm ragte mit der brüchigen Kante ein Stück gleichen grauen Gesteines schief aus Moos und Epheu: lag die Fortsetzung der Inschrift hier unter der Moos- und Rasendecke begraben? Ich zog an dem noch ungehobenen Stein: aber er war allzuschwer, sei es zu hoch von der Erde belastet, sei es zu wuchtig durch die eigene Größe. Nach vergeblichem Zerren erkannte ich, daß ich erst die ganze Rasen- und Moosschicht entfernen müsse, bevor mir der Marmor sein Geheimnis vertraue. Hatte er ein solches zu erzählen? Gewiß! den Anfang hielt ich ja in Händen: »hic«, »hier« –: was war »hier« geschehen oder bezeugt?
Ich hielt die Bruchfläche des ersten Stückes, nachdem ich sie von Erde und Wurzelfasern mit meinem Taschenmesser gereinigt, an die aus dem Boden ragende Bruchfläche der noch verdeckten Platte: beide paßten genau ineinander. Nun machte ich mich an die Arbeit: sie war nicht leicht, nicht kurz: mit Hand, Messer und der Spitze des Bergstocks mußte ich wohl zwei Fuß Rasen, die aufgerissene Erde, das Moos und – das zäheste Hemmnis – den mit ungezählten Kleinwurzeln angeklammerten Epheu fortscharren und -reißen: auch in dieser Kühle und obzwar die Sonne schon im Versinken war, machte mir die Mühe heiß; von der Stirn troff mancher Tropfen auf den alten Römerstein, der sich als eine ziemlich lange Platte erwies.
Endlich war sie so weit bloßgelegt – schon nach den ersten Minuten hatte mir die zweifellose Wahrnehmung weiterer Buchstaben den Eifer geschärft –, daß ich sie mit beiden Händen an den beiden Seitenrändern fassen und mit manchem kleinen Ruck völlig zu Tage fördern konnte: ich hielt den abgesprengten Stein mit dem entzifferten »hic« daran: so ergab sich sofort die Richtung, in der weiter zu lesen war.
Hastig schabte ich Erde, Steinchen, Moos aus den Vertiefungen der Buchstaben: denn es ward nun rasch dunkler und ich wollte doch sogleich das so lang vergrabene Geheimnis deuten. Es gelang: zwar mit Anstrengung, aber doch völlig zweifellos las ich die beiden, untereinander geschriebenen Zeilen der Inschrift:
Hic habitat Felicit Nihil Intret mali.
Nur die beiden letzten Buchstaben des dritten Wortes fehlten: der Stein war hier abgebrochen und das dazu gehörige Stück nicht zu finden; doch verstand sich die Ergänzung – as – von selbst: die Inschrift bedeutet auf deutsch:
Hier wohnt das Glück: Nichts Böses trete ein!
Offenbar hatte die graue Marmorplatte die Eingangsschwelle des Gartens oder Vorhofs der Villa gebildet: und der sinnige Spruch sollte alles Böse von der Thüre fernhalten. Vergeblich suchte ich nach weiteren Spuren, nach Resten von Gerät. Vergnügt und begnügt beruhigte ich mich denn bei dem Funde des hübschen Spruches. – Ich setzte mich, die heiße Stirn trocknend, auf das schwellende Moos neben meiner Wühlarbeit, wieder und wieder die Worte bedenkend; den Rücken gelehnt an eine uralte Eiche, die aus dem Schutt des Römerhauses, vielleicht aus dem guten Humus seines Gärtleins, emporgewachsen war.
Wundersame Stille waltete auf dem durch Bäume und Büsche ganz von der Welt geschiedenen Hügel. Nur ganz leise, leise vernahm man das Sickern der dünnen, spärlichen Wasserader, die dicht neben mir aus der Erde kam und nur manchmal, wann sie rascheres Gefäll fand, stärker rieselte. Einst hatte sie wohl, stattlich zusammengefaßt in dem hellgrauen Marmor, lauter geredet. In der Ferne sang aus dem Wipfel einer hohen Buche die Goldamsel ihr flötendes Abendlied, das stets tiefster Waldeinsamkeit gemahnt, weil der Hörer den Ton des »Pirols« kaum je anders als in solch' grüner Stille vernommen hat. Hier und da summten Bienen über die Moosdecke hin, aus dem dunkelnden Dickicht heraus, nun die wärmere Lichtung suchend: schläfrig sie selber und einschläfernd in ihrem Surren.
Ich sann: wessen »Glück« hat einst hier gewohnt? Und ist der Wunsch der Steininschrift erfüllt worden? – War der Spruch mächtig genug, alles Böse fernzuhalten? Der Stein, der ihn trug, ist zerschlagen: – ein übles Zeichen! Und welcher Art war dieses Glück? –
Oder halt! – in jener Zeit begegnet »Felicitas« bereits als Frauenname; wollte der Spruch vielleicht, in anmutvollem Doppelsinne spielend, sagen: »Hier wohnt das Glück, das heißt: meine Felicitas; nicht Böses komme über ihre über unsere Schwelle?« Aber »Felicitas«, – wer war sie? Und wer war der, dessen Glück sie gewesen! Und was ist aus ihnen geworden? Und diese Villa, wie...? – – – – Das war wohl das letzte, das ich wachend dachte. Denn mit diesen Fragen war ich entschlafen. Und lange hatte ich geschlummert. Denn als mich der Ruf der Nachtigall dicht an meinem Ohre, laut erjubelnd, weckte, war es finstere Nacht: hell lugte nur ein Stern durch die Wipfel der Eiche; ich sprang auf: »Felicitas! Fulvius!« – rief ich, – »Liuthari! wo sind sie?«
»Felicitas!« scholl das Echo von der Hügelwand leise wieder. Sonst alles still und dunkel.
So war es ein Traum? Nun: ich meine, diesen Traum will ich festhalten. Felicitas! ich halte dich! Du sollst mir nicht entschweben. Poesie allein vermag dich zu verewigen. Und ich eilte nach Hause und zeichnete noch in der Nacht die Geschichte auf, die ich geträumt auf dem Schutt der alten Römervilla.
Erstes Kapitel.
Es war ein schöner Juniabend. Die Sonne ging zu Golde: sie warf von Westen, von Vindelicien her, ihre vergoldenden Strahlen auf den Mercuriushügel und die bescheidene Villa, die ihn krönte.
Nur gedämpft drang hierher das Geräusch von der großen Straße, auf der hier und da ein zweirädriger Karren, mit norischen Rindern bespannt, aus dem Westthore von Juvavum, der porta Vindelica, nach Hause zog: Colonen, Landleute, die an dem eben geendeten Markttage auf dem Forum des Herkules Gemüse, Hühner, Tauben feilgeboten hatten. So war es still und ruhsam auf dem Hügel; außerhalb der nicht mannshohen Steinmauer, die den Garten umfriedete, vernahm man nur das lebhafte Geriesel des kleinen Quellbachs, der, an seinem Ursprung zierlich in grauen Marmor gefaßt, nachdem er den Springbrunnen in der Mitte gespeist und dann den wohl gepflegten Garten in kunstvoll gewundenem Rinnsal durchwandert hatte, nahe dem wohlgefügten, von Hermen überragten, aber offnen, thür- und gitterlosen Thoreingang, unter einer Mauerlücke durch, in einer Steinrinne hügelabwärts eilte.
Nach der Stadt zu, nach Südosten, lagen am Fuße des Hügels sorglich gepflegte Gemüse- und Obstgärten, Wiesen in saftigstem Grün und Getreidefelder mit üppigem Spelt, welche Frucht die Römer in das Barbarenland getragen. Hinter der Villa, nach Norden, aber ragte und rauschte, die Berghalde hinansteigend, schöner Buchwald: und aus seiner Tiefe scholl von fern der metallische Ruf des Pirols. Es war so schön, so friedlich; nur von Westen her – und nicht minder auch von Südosten! – stiegen drohende Wetterwolken auf.
Von dem offnen Thor führte durch den weitgedehnten Garten ein schnurgerader Weg, mit weißem Sand bestreut, zwischen ragenden Steineichen und Taxusbüschen hin, die, entsprechend lang herrschender Mode, mit der Schere in allerlei geometrische Figuren zurechtgeschnitten waren: – ein Geschmack oder Ungeschmack, den das Rokoko nicht erfunden, nur aus den Gärten der Imperatoren neu entlehnt hat.
Auf der langen Wegstrecke von dem Thor zu dem Eingang des Wohnhauses waren in regelmäßigen Abständen Statuen angebracht: Nymphen, eine Flora, ein Silvan, ein Merkur –: schlechte Arbeit, aus Gips; der dicke Crispus machte sie nach dem Dutzend in seiner Werkstatt auf dem Vulkanusmarkt zu Juvavum; und er ließ sie billig ab: denn die Zeiten waren nicht gut für die Menschen und schlecht für die Götter und Halbgötter; aber diese hier waren vollends geschenkt. Denn Crispus war ja der Vatersbruder des jungen Hausherrn.
Von dem Thor des Gartens her schollen, an der Steinmauer der Umhegung widerhallend, ein paar Hammerschläge; nur leise, denn behutsam, von Künstlerhand waren sie geführt: es schienen die letzten, nachbessernden, abschließenden Mühungen eines Meisters.
Nun sprang der Hämmernde auf: er hatte dicht hinter dem Thore gekniet, neben welchem, aneinander aufrecht geschichtet, etwa ein Dutzend noch unbearbeitete Marmorplatten die Behausung eines Steinmetz bekundeten: er steckte den kleinen Hammer in den Ledergürtel, der das Schurzfell über der blauen Tunika zusammenhielt, schüttete aus einem kleinen Ölfläschlein ein paar Tropfen auf ein Wolltuch, rieb damit den Marmor, gerade in der Inschrift, sorgfältig spiegelglatt, drehte den Kopf etwas seitwärts, gleich einem Vogel, der etwas recht genau besehen will, und las nun, wohlgefällig nickend, von der Eingangsplatte ab: »Ja, ja! Hier wohnt das Glück: mein Glück, unser Glück –: so lang als meine Felicitas hier wohnt – glücklich und beglückend hier wohnt. Niemals schreite Unheil über diese Schwelle: gebannt von dem Spruch mache jeder böse Dämon Halt! – Nun ist das Haus erst schön vollendet, durch diesen Spruch. Aber wo ist sie denn? Sie muß es sehen und mich loben. Felicitas,« rief er, gegen das Haus gewendet, »komm doch!«
Er wischte den Schweiß von der Stirn und richtete sich auf: eine geschmeidige Jünglingsgestalt, schlank, nicht über Mittelgröße, dem Mercurius des Gartens nicht unähnlich, den Crispus, nach alter Überlieferung der Gliedermaße, geformt; dunkelbraunes Haar überzog, ganz kurzgekraust, fast wie eine wollige Kappe, den ungedeckten runden Kopf; unter starken Brauen lachten zwei dunkle Augen lustig in die Welt; die nackten Füße und Arme zeigten schöne Bildung, aber wenig Kraftübung: nur im rechten Arm hoben sich kräftiger die Muskeln; das braune Schurzfell war von Marmorabfall weiß besprengt. Er schüttelte den Staub ab und rief nochmals lauter: »Felicitas!«
Da erschien auf der Schwelle des Hauses eine weiße Gestalt, wie ein Bild eingerahmt in die zwei Wandpfeiler des Eingangs, den dunkelgelben Vorhang zurückschlagend, der, an Ringen schiebbar, von einer Bronzestange gerade herabhing, ein ganz junges Mädchen – oder war es ein junges Weib? – Ja, es mußte schon Weib geworden sein, dieses Kind von kaum siebzehn Jahren: denn ohne Zweifel war es die Mutter des Säuglings, den es mit dem linken Arm an den Busen schmiegte: nur die Mutter hält ein Kind mit solchem Ausdruck in Bewegung und Antlitz.
Zwei Finger der rechten Hand, die Innenfläche nach außen gekehrt, legte die junge Mutter warnend an den Mund: »Stille!« mahnte sie – »unser Kind schläft.« Und nun schwebte die noch kaum vollreife Gestalt die vier Steinstufen hinab, die von der Schwelle in den Garten herabführten, vorsichtig das Kind auf dem linken Arm noch etwas höher schiebend und enger andrückend, mit der Rechten aber leise den Saum des ganz weißen Faltengewandes bis an die seinen Knöchel hebend, das tadellos schön geformte Oval des Hauptes vorsichtig leise senkend: es war ein Anblick von vollendeter Anmut: jugendlicher, kindlicher noch als die Madonnen Rafaels: und nicht demütig und doch zugleich mystisch verklärt, wie die Mutter des Christuskindes; da war nichts Wunderhaftes, nur edelste Einfachheit und doch königliche Hoheit in ihrer unbewußten Würde und Unschuld; wie Wohllaut der Musik umfloß es bei jeder der maßvollen, nie das Bedürfnis überschreitenden Bewegungen diese Gestalt einer muttergewordenen Hebe: Weib und doch ewig Mädchen; rein menschlich, vollendet glücklich, abgeschlossen und befriedet in der Liebe zu dem Jüngling-Gemahl und dem Kind an ihrer Brust: rührend, lieblich und ehrwürdig zugleich bei aller vollendeten Schönheit des Wuchses, des Antlitzes, der Farben so keusch, daß, wie vor einer Statue, jedes Verlangen in dieser Nähe schwieg.
Sie trug keinen Schmuck: das Haar, lichtbraun, wann es die Sonne küßte, in leisem Goldglanz leuchtend, floß in natürlicher Wellung von den offnen, edel geformten Schläfen zurück, die gar nicht hohe Stirne frei gebend, im Nacken in einen losen Knoten geschürzt: ein milchweißes Gewand von feinster Wolle, auf der linken Schulter mit einer schön geformten, aber schmucklosen Silberspange gefestet, umschloß in fließenden Falten die ganze Gestalt bis auf die Knöchel und die zierlichen roten Ledersandalen, den Hals, den oberen Teil des zart gewölbten Busens und die glänzenden, aber fast noch kindlichen, deshalb beinah ein wenig zu lang scheinenden Arme zeigend: unter der Brust war ein Zipfel des Gewandes durch den handbreiten Bronzegürtel geschlungen. So glitt sie, unhörbar, wie eine unmerkliche Welle, die Stufen herab und schwebte auf den Gemahl zu. Das längliche, schmale Antlitz trug jenes wunderbare, fast bläulich schattierte Weiß, das nur den Töchtern Ioniens eignet und das keine Mittagssonne des Südlands zu bräunen vermag; die im Halbkreis, streng regelmäßig, wie mit dem Zirkel, gezogenen Brauen hätten dem Antlitz fast etwas Lebloses, Statuenhaftes gegeben: aber unter den langen, langen, leise nach oben gekrümmten, ganz schwarzen Wimpern leuchteten die dunkelbraunen Antilopenaugen, wie sie sich nun auf den Geliebten richteten, in seelenvollstem Leben.
Dieser flog ihr mit raschen Schritten entgegen, löste, sorglich, zärtlich, das schlummernde Kind aus ihrem Arm und legte es in den länglichen flachen Strohdeckel, den er von seinem Arbeitskorbe herabhob, unter den Schatten eines Rosengebüsches: eine voll erblühte Rose warf im Abendwind duftige Blätter auf den Kleinen; er lächelte im Schlummer.
Der Hausherr führte nun, den Arm um die fast allzuschmalen Hüften schlingend, das junge Weib vor die eben vollendete Eingangsplatte und sprach: »Jetzt ist der Spruch fertig, den ich vor dir geheimgehalten, bis ich ihn, rasch fortarbeitend, vollenden konnte; nun lies, und wisse und fühle« – und er küßte sie zärtlich auf den Mund: »Du – Du selber bist das Glück –: Du wohnest hier.«
Das junge Weib hob die Hand vor die Augen, sich vor den durch den offenen Eingang nun fast schon horizontal einfallenden Strahlen der Sonne zu schützen; sie las und errötete: eine Blutwelle stieg sichtbar in die zart weißen Wangen, ihr Busen wallte, ihr Herz schlug lebhaft: »O Fulvius! Du Guter. Wie liebst du mich! Wie sind wir glücklich!« Und sie legte nun beide Hände und Arme auf seine rechte Schulter, auf die andere ihr wunderschönes Haupt.
Innig drückte er sie an sich. »Ja, überschwenglich, ohne Schatten ist unser Glück, – ist ohne Maß und Ende.« Rasch, mit leisem Beben, wie fröstelnd, richtete sie sich auf, und sah ihm bang ins Auge. »O fordere nicht die Heiligen heraus. Man flüstert,« sagte sie, selber flüsternd, »sie sind neidisch.« Und sie hielt ihm die Hand vor den Mund.
Aber er drückte einen lauten Kuß auf die schmalen Finger und rief: »Ich bin nicht neidisch, nur ein Mensch, wie sollten die Heiligen neidisch sein? Das glaub' ich nicht. Nicht von den Heiligen glaub' ich's – wie nicht von Heidengöttern, falls sie etwa doch noch leben und Gewalt haben.« – »Sprich nicht von ihnen! Sie leben freilich –: aber sie sind Dämonen, und wer sie nennt – der ruft sie nahe: so warnt der Presbyter der Basilika.« – »Ich fürchte sie nicht. Viele Geschlechter hindurch haben sie unsere Ahnen geschützt.« – »Ja, wir sind aber abgefallen von ihnen! Sie schützen uns nicht mehr. Nur die Heiligen sind unsere Schirmer – gegen die Barbaren. Wehe, wenn sie hierher kämen, unsere Blumen im Garten zerstampften, unser Kind davonführten.« Und sie kniete nieder und küßte den kleinen Schläfer.
Doch der junge Vater lachte: »Die Germanen, meinst du? die stehlen keine Kinder! Sie haben mehr davon als sie füttern können. Aber es ist wahr –: die könnten wohl einmal ihren Schildruf anstimmen vor den Thoren von Juvavum.«
»Ja, das können sie bald!« fiel eine ängstliche Stimme ein und der dicke Crispus trat, mächtig schnaufend nach erhitzendem Gang, in den Garten.