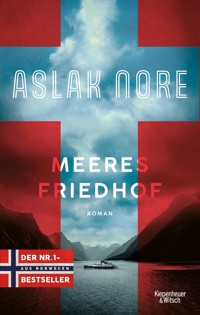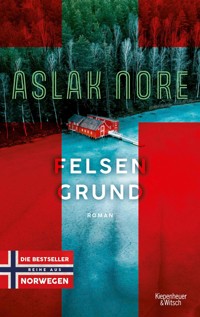
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Falck-Saga
- Sprache: Deutsch
Familienbande, Macht und tödliche Geheimnisse: In Aslak Nores spannendem Thriller »Felsengrund« findet sich Sasha Falck einer explosiven Gemengelage aus Familienintrigen und internationaler Spionage ausgesetzt. Es herrscht trügerische Ruhe auf Rederhaugen bei Oslo, dem Stammsitz der einflussreichen Falck-Familie. Während die neu ernannte SAGA-Direktorin Sasha Falck das Rettungsboot »Falck 3« stiftet und eine Forschungsexpedition nach Spitzbergen anregt, liegt Hans Falck, das Oberhaupt der verfeindeten Familienlinie aus Bergen, nach einem Unfall schwer verletzt im Krankenhaus. Doch dann taucht Connie Knarvik auf, eine entfernte Cousine mit einer Bergbaukonzession auf Spitzbergen – einer Gegend von geopolitischem Interesse, die zu Spannungen zwischen dem norwegischen Geheimdienst und Putins Russland führt. Als ein russischer Oberst vergiftet wird, nachdem er enthüllt hat, dass ein Maulwurf in der SAGA-Stiftung sein Unwesen treibt, drohen die vergrabenen Geheimnisse der Familie Falck ans Licht zu kommen ... Aslak Nore liefert mit »Felsengrund« den fesselnden zweiten Teil seiner Falck-Saga voller Familiengeheimnisse, internationaler Intrigen und Spannung vor der grandiosen Kulisse Spitzbergens. Ein packender Thriller für Fans von Joël Dicker und Stieg Larsson. Die Falck-Saga erscheint in folgender Reihenfolge: - Meeresfriedhof - Felsengrund - Schattenfjord (erscheint im Februar 2026)Die Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aslak Nore
Felsengrund
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Aslak Nore
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Aslak Nore
Aslak Nore, geboren 1978 in Oslo, studierte an der Universität Oslo und an der New School for Social Research in New York. Er war Soldat im norwegischen Elitebataillon Telemark in Bosnien und arbeitete als Journalist im Nahen Osten und in Afghanistan. In Norwegen hat er mehrere Sachbücher und vier Romane veröffentlicht. »Meeresfriedhof« ist der erste Band einer literarischen Thriller-Serie rund um die Familie Falck und wurde in vielen Ländern ein Bestseller. Nore lebt mit seiner Familie in der Provence, Frankreich.
Dagmar Lendt ist Skandinavistin und übersetzt aus dem Norwegischen, Schwedischen und Dänischen. Bisher hat sie rund einhundert Bücher ins Deutsche übertragen, u.a. von Jon Fosse, Kjetil Try und Viveca Sten. Sie lebt in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die Falcks sind eine der mächtigsten Familien Norwegens, und wo Macht ist, ist auch Neid und Gier. Schauplatz ist in diesem zweiten Teil Spitzbergen, einem Teil der Welt, der Reichtümer verspricht. Die Falck-Saga geht in die spannende zweite Runde.
Es ist ruhig auf Rederhaugen. Die neu ernannte SAGA-Direktorin Sasha Falck stiftet das Rettungsboot »Falck 3« und regt eine Forschungsexpedition nach Spitzbergen an, während Hans Falck nach einem Unfall schwer verletzt im Krankenhaus liegt.
Als Connie Knarvik, eine entfernte Cousine, auftaucht, verschärft das die schwelenden Konflikte. Denn diese Cousine besitzt eine Bergbaukonzession auf Spitzbergen, einer Gegend, die von geopolitischem Interesse ist und zu Spannungen zwischen dem norwegischen Geheimdienst und Putins Russland führt.
Als ein russischer Oberst an Gift stirbt, nachdem er enthüllt hat, dass ein Maulwurf in der SAGA-Stiftung sein Unwesen treibe, droht der diplomatische Zwischenfall alle vergrabenen Geheimnisse der Familie zu sprengen …
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Ingen skal drukne
© 2023 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo
Published by agreement with Winje Agency A/S, Norway
Aus dem Norwegischen von Dagmar Lendt
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: buxdesign | Lisa Höfner
Covermotiv: © Oskar Ulvur / Trevillion Images; mauritius images/ClickAlps/StefanoTermanini
Der Verlag dankt Norla, Norwegian Literature Abroad, für die großzügige Übersetzungsförderung und die freundschaftliche Verbundenheit, Tusen takk, Norla!
ISBN978-3-462-31101-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Dank für Übersetzungsförderung
Widmung
Motto
Stammbaum der Familie Falck
Prolog Arktischer Friedhof
Teil 1 Advent
Kapitel 1 330. Rettungsgeschwader
Kapitel 2 Die Zeit der krummen Touren ist vorbei
Kapitel 3 Niemand soll ertrinken
Kapitel 4 Putin ist die einzige Hoffnung des Westens
Kapitel 5 Ich hätte den Job machen können
Kapitel 6 Städte mit B
Kapitel 7 Es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte passieren
Kapitel 8 Das Kriegsbeil begraben
Kapitel 9 Er heißt John Omar Berg
Kapitel 10 Mandel im Reisbrei
Kapitel 11 Eine Menge zu verkraften
Kapitel 12 Die Badeleiter
Kapitel 13 Mein Geburtsname ist Constance Falck
Teil 2 Östlich von Istanbul
Kapitel 14 Sheriff Tiraspol
Kapitel 15 Die Ehrendoktorwürde
Kapitel 16 Eine verdammte Familienberatungsstelle
Kapitel 17 Ein einfacher Junge aus Nydalen
Kapitel 18 Zur Hölle mit Sashas Koalition
Kapitel 19 Herpes fürs Auge
Kapitel 20 Liebst du sie?
Kapitel 21 Wir gehören einer anderen Zivilisation an als ihr
Kapitel 22 Norwegens amtierende Außenministerin
Kapitel 23 Bruderschaft zwischen den Völkern
Kapitel 24 Diebe und Ermittler arbeiten nicht gut zusammen
Kapitel 25 Strategische Tiefe
Kapitel 26 Die Grenze
Teil 3 Die Hauptversammlung
Kapitel 27 Das Ölgemälde von Olav Falck
Kapitel 28 Der Heimkauf
Kapitel 29 To betray, you must first belong
Kapitel 30 Alle Menschen haben das Bedürfnis, an etwas zu glauben
Kapitel 31 Tinker, tailor, soldier, sailor
Kapitel 32 Eine Kleinpartei gibt den Ausschlag
Kapitel 33 Unter uns Veteranen
Kapitel 34 Die dunkle Triade
Kapitel 35 Einzigartiges Objekt – seltene Gelegenheit
Kapitel 36 Das Gefühl von zwölf Milliarden
Kapitel 37 Wir haben nichts zu verbergen
Kapitel 38 Vater zu sein
Kapitel 39 Après-Ski
Kapitel 40 Fünfhundert Millionen Kronen
Kapitel 41 Norwegisch wie der Dovregubben
Kapitel 42 Appendix vermiformis
Kapitel 43 Die Rückerstattung
Teil 4 Die Trennlinie
Kapitel 44 Die Geschichte wiederholt sich
Kapitel 45 Boomer!
Kapitel 46 Der therapeutische Blick
Kapitel 47 Villa Grande
Kapitel 48 Ich denke, ihr geht jetzt besser
Kapitel 49 Die ultimative Reviermarkierung
Kapitel 50 Der Rote Bär
Kapitel 51 Die Geschichte findet sich immer in den Archiven
Kapitel 52 Sankt-Georg-Orden
Teil 5 Der letzte Auftrag
Kapitel 53 Wir sind motherfuckers
Kapitel 54 Norwegischer Promi-Arzt wegen Spionage verhaftet
Kapitel 55 »Seid ihr ein Liebespaar?«
Kapitel 56 Dezinformatsiya
Kapitel 57 Crossroads
Epilog Du und ich
Danksagung
Der Verlag dankt Norla, Norwegian Literature Abroad, für die großzügige Übersetzungsförderung und die freundschaftliche Verbundenheit.
Tusen takk, Norla!
Dieses Buch ist gewidmet
Kjetil Anders Hatlebrekke (1970–2023)
und anderen Veteranen, die für Norwegen gekämpft und den Preis dafür bezahlt haben.
»To betray, you must first belong.«
Kim Philby
PrologArktischer Friedhof
In der Hocharktis hat das Jahr nur einen einzigen Tag – einen Tag und eine Nacht. Der Sonnenuntergang im Oktober dauert knapp eine Woche, bevor sich die winterlange Dunkelheit herabsenkt.
In Longyearbyen hatte die Nacht einen guten Monat gedauert. Der Wind machte aus den elf Grad unter null gefühlte minus neunzehn Grad. Aus der Novemberdunkelheit des Adventdalen tauchte ein Licht auf, schwach zuerst, bevor es langsam stärker wurde und sich ein Frontscheinwerfer abzeichnete.
Später würde die Zeugin, die zuerst angerufen hatte, die Besitzerin des Ferienhauses »Casa Polaris« auf einer Anhöhe über der flachen Talsohle, angeben, dass das Rucken und Schaukeln des Lichts sie stutzig gemacht hätten.
Der Schneescooter folgte dem markierten Weg, der in die Siedlung hineinführte.
Gouverneur Robert Eliassen hatte gerade seinen Arbeitstag nach einer Besprechung mit dem Pfarrer beendet. Eliassen war ein stämmiger Polizist in den Sechzigern, der den Posten des Gouverneurs von Svalbard – der früher als Spitzbergen bekannten Inselgruppe im Nordpolarmeer – nach einer langen und erfolgreichen Karriere im Polizei- und Sicherheitsdienst in Nordnorwegen erhalten hatte. Mit Ohrenklappenmütze und winddichten Fäustlingen ausgestattet, fuhr er nun auf dem Scooter die dreihundert Meter zurück zum Sysselmannsgården.
Der Pfarrer hatte mit ihm über den Friedhof auf dem Hügelkamm Richtung Platåfjellet sprechen wollen, wo der Permafrost langsam alle Särge aus dem Boden drückte. Wer auf Svalbard begraben wird, kommt früher oder später wieder hoch.
Er hatte ihm einen Artikel gezeigt, in dem es hieß, auf der Inselgruppe sei es »verboten zu sterben«. Sicherlich eine Übertreibung, aber das hier war »keine Gegend für ein Leben von der Wiege bis zur Bahre«, wie Eliassen zu sagen pflegte.
Svalbard ist weder ein Ort zum Geborenwerden noch zum Sterben.
Anders als die meisten Besucher von Longyearbyen annehmen, hat der Name des Ortes nichts mit den Jahreszeiten am achtundsiebzigsten Grad nördlicher Breite zu tun. Er bezieht sich nicht auf die Zeiten von Dunkelheit und Mitternachtssonne, Randzonenphänomene, die mit unserer gängigen Kategorisierung der Realität – dass die Sonne morgens auf- und abends untergeht – so gründlich brechen, dass sie Wahnsinn, Delirium oder den sogenannten Polarbazillus hervorrufen können, der das Leben auf dem Festland leer und sinnlos erscheinen lässt. Der Ort wurde nach einem amerikanischen Bergarbeiter benannt.
Eliassen ging auf Sysselmannsgården zu, einen gemütlichen Hof umgeben von roten Holzhäusern, die in starkem Kontrast zum futuristischen Nachbargebäude standen, in dem sich der Verwaltungsssitz des Gouverneurs befand. »Darth Vader ist in Longyearbyen gelandet«, hatte ein zugereister Reporter es beschrieben. Es war, wie die Besucher sagten: Was andernorts Fantasy und Science-Fiction ist, ist auf Svalbard Sozialrealismus.
Kaum angekommen, hörte Eliassen einen Motor aufheulen und sah, wie ein Scooter in hohem Tempo durch einen vom Räumpflug aufgeworfenen Schneewall brach, bevor er jäh auf dem Hofplatz zum Stehen kam.
»He, Sie da!«, rief er und lief die paar Meter hinüber zu dem Fahrzeug.
Auf dem Scooter saß ein kräftiger bärtiger Mann wie versteinert, bevor er sich mit sichtlich großer Mühe vom Sitz erhob und im Schnee zusammenbrach.
Unterkühlung, schloss Eliassen sofort. Die Jahre in der Arktis hatten ihn nicht nur gelehrt, diese Gefahr für sich selbst zu vermeiden, sondern auch zu erkennen, wenn andere, weniger erfahrene Polarbewohner es nicht schafften, sich gegen die Kälte zu schützen.
Er versuchte, Kontakt aufzunehmen, sowohl auf Englisch als auch auf Russisch, ohne eine vernünftige Antwort zu erhalten. Als er den Mann an der Schulter packen wollte, murmelte der Russe etwas.
»Don’t … don’t touch!«
Die Augen des Mannes hatten Mühe, sich auf den Gouverneur zu fokussieren.
»Medical care … emergency …«
»Sie bekommen natürlich ärztliche Hilfe«, sagte Eliassen, »aber Sie können hier nicht liegen bleiben. Sonst erfrieren Sie.«
Es war, als würde der Mann sich zusammenreißen. Er sagte: »P-p-poison.«
»Was?«, fragte der Gouverneur.
»Vergiftet«, stöhnte der Russe auf Englisch mit leiser, metallischer Stimme.
Robert Eliasson richtete sich auf und trat einen Schritt zurück. Hatte er den Mann berührt, der vor ihm auf dem Boden lag? Nein, aber es hätte nicht viel gefehlt. Er griff zum Telefon, rief eine Nummer an und schilderte dem ärztlichen Bereitschaftsdienst kurz die Situation.
»Wie heißen Sie?«, fragte Eliassen den Mann.
»Ich bin … Oberst … Vasilij … Zemljakow …«
»Woher kommen Sie jetzt?«
»B-B-Barentsburg.«
»Ich heiße Robert Eliassen und bin der oberste Regierungsbeamte Norwegens hier auf Svalbard«, stellte sich der Gouverneur streng vor.
Der Russe wand sich im Krampf und blieb auf der Seite liegen, mit dem Kopf in einer kleinen Schneewehe. Eliassen sah, wie ihm Blut aus Mund und Nase zu laufen begann.
»Der Rettungswagen ist unterwegs.«
Schon jetzt waren ihm mehrere Dinge klar. Erstens: Der Mann war todkrank. Zweitens: Falls die Russen ihn vergiftet hatten, dann mochten die Götter wissen, ob er selbst nicht auch in Gefahr war.
Ein vergifteter russischer Oberst auf NATO-Territorium wäre ein internationaler Skandal. In Brüssel könnte so etwas als chemischer Angriff gewertet werden. Eliassen überlief ein kalter Schauer.
»Governor?«, flüsterte Zemljakow und zeigte in Richtung des Adventdalen. »Falck?«
»Falck?«
Gouverneur Eliassen starrte auf den Mann zu seinen Füßen. Natürlich war ihm die Aktivität der Falcks auf Svalbard bekannt. Sie besaßen seit 1916 Bergbaurechte auf Spitzbergen. Hans Falck, der prominente Arzt, war außerdem ein alter Bekannter aus den 1970er-Jahren, als Eliassen alle Hände voll zu tun gehabt hatte, Kommunisten wie ihn zu überwachen.
»Was soll das heißen?«
»Falck hat eine Stiftung und ein Unternehmen … SAGA.«
»Und?«
Zemljakow spuckte Blut.
»Wir haben jemanden innerhalb der SAGA.«
»Wen?«, fragte der Gouverneur.
Im selben Moment traf der Rettungswagen ein, und zwei Sanitäter in Strahlenschutzanzügen kamen mit einer Trage angelaufen. Sie hoben den Russen vorsichtig hoch und legten ihn auf die Trage. Zemljakow drehte den Kopf, als sie ihm eine Sauerstoffmaske aufsetzen wollten. Er sah Eliassen eindringlich an.
»Jemanden in der Familie … Sie bekommen den Namen … wenn Sie mir dafür Schutz garantieren.«
Er verlor das Bewusstsein. Der Rettungswagen fuhr davon.
Robert Eliassen stellte den Motor des Schneescooters ab. Es wurde totenstill. Er blieb eine Weile stehen und starrte hinüber zum Operafjellet auf der anderen Seite des Fjords; der Berg sah in der Dunkelheit aus wie eine Theaterkulisse, nachdem man die Lichter gelöscht hat. Ein Maulwurf in der Falck-Familie?
Er griff zum Telefon und rief den diensthabenden Arzt an.
»Ich muss den Russen vernehmen«, sagte Eliassen, »so schnell wie möglich.«
»Ich fürchte, daraus wird nichts«, antwortete der Arzt und holte tief Luft. »Der Patient ist im Rettungswagen verstorben. Wir konnten nichts mehr für ihn tun.«
Teil 1Advent
Kapitel 1330. Rettungsgeschwader
Der Rettungshubschrauber, ein Sea King, hob vom Helipad ab, als wäre er ein Lift, verharrte einige Meter über dem Boden und schwankte im Wind, bevor er sich zur Seite neigte, die Nase leicht senkte und Kurs auf den Vestfjord nahm.
Die Meldung lautete: Russischer Trawler nordwestlich von Sortland. Kapitän akut erkrankt.
Hans Falck saß ganz hinten in der Maschine, auf dem Sitz rechts vom Rettungssanitäter, in einem wollgefütterten signalroten Überlebensanzug und angeschnallt mit einem Dreipunkt-Sicherheitsgurt. Schneeregen peitschte gegen das Fenster. Sie hatten heftigen Gegenwind, die Kabine rüttelte so stark, dass die medizinischen Geräte sich bewegten. Es war der letzte Tag Bereitschaft in dieser Schicht.
Unter sich erkannte er die Meerenge zwischen Bodø und den hohen Gipfeln auf Landegode. Es war früh am Vormittag, aber das Novemberlicht war so schwach, dass die Kabine in Dämmerung gehüllt war.
Schon seit Hans ein kleiner Junge war und Onkel Herbert ihm den ausgestopften Eisbären im Svalbard-Büro der Reederei Det Hanseatiske Dampskipsselskap gezeigt hatte, zog es ihn in den Norden. Für ihn war das wie ein physikalisches Gesetz, wie ein Objekt, das Bodenhaftung verlieh. Alle Erinnerungen an diesen Landesteil lagen tief in ihm verborgen, so wie Menschen ihre verlorene Jugend oder die Erinnerung an eine alte Liebe in sich tragen. Die Luft konnte sie heraufbeschwören, feucht an der Küste, trocken und eiskalt auf den Hochebenen im Inland. Oder die zerklüfteten und endlosen Landschaften, schneebedeckt und vom Nordlicht erhellt im Winter, in ewige Sonne getaucht im Sommer. Die geradezu südländische Herzlichkeit der Nordnorweger kannte er aus der Levante.
»Doktor Hans«, sagte Rettungssanitäter Giske. Der selbstsichere junge Westnorweger schlürfte einen Becher Tütensuppe und schaute gelangweilt hinaus auf die stürmische See. »War das nicht da unten, wo dieses Hurtigrutenschiff mit deinen Verwandten an Bord im Krieg untergegangen ist?«
Hans blickte nachdenklich hinunter auf die Schaumkronen im Vestfjord. Mit dem Schiffbruch der Hurtigrute war dem Osloer Zweig der Familie Falck die direkte Abstammungslinie gekappt worden. Die größte ihrer vielen Lügen.
Es war außerdem hier gewesen, während einer Konferenz auf einem Hurtigrutenschiff im Trollfjord, als Siri Greve mit einer Kopie von Veras Testament zu ihm gekommen war.
Praktisch hatte Vera ihm und seinem Familienzweig die Kontrolle über eine Gesellschaft im Wert von zwölf Milliarden Kronen, eine gemeinnützige Stiftung und die vielleicht attraktivste Privatimmobilie des Landes vermacht. In letzter Zeit hatte M. Magnus besonders viel Druck gemacht. »Du musst dein Recht einfordern«, hatte er gesagt.
Natürlich konnte Hans gute Gründe nennen, warum er den Kampf nicht aufgenommen hatte. Dass sein radikales Gewissen in direkter Opposition zum Falck-Vermögen stand. Dass sein Idealismus unvereinbar mit modernem Privatkapitalismus war. Dass sein Platz draußen war, im aktiven Einsatz, und nicht in einem Rosenturm auf Rederhaugen.
Ein Leben zu retten bedeutete für ihn, die ganze Welt zu retten.
All das könnte er sagen, und die Leute würden gebannt zuhören, wie sie es immer taten, wenn er sprach, am Esstisch, bei der Verleihung einer Ehrendoktorwürde, in einem libanesischen Flüchtlingslager oder bei einer Bewohnerversammlung in Nordnorwegen, wo man gegen die Schließung eines örtlichen Krankenhauses kämpfte.
Sie ließen sich alle in seinen Bann ziehen.
In den Augen anderer war Hans der Inbegriff von Tatkraft. Wenn Alarm gegeben wurde, wenn die Bomben fielen und Menschen sich in Not befanden, war niemand rascher zur Stelle. Das war seine zentralstimulierende Droge. Aber wenn die familiären Beziehungen schwierig wurden, vergrub Hans seine Geheimnisse unter haufenweise Arbeit.
Der Sea-King-Hubschrauber wurde heftig durchgeschüttelt, gerade als sich auf der linken Seite die Konturen der Lofot-Wand abzeichneten, eingehüllt in Unwetterwolken und tief hängendem Nebel.
Ebenso wie Hans besaß Giske diese ruhepulsartige Gelassenheit, welche so fremd auf Zivilisten wirkte, die von leichten Turbulenzen auf einem Linienflug in Angst versetzt wurden. So etwas hatte Hans nie geschreckt. Es war die Ruhe, die ihm unheimlich war – die Stille nach einer erhitzten Diskussion am Esstisch oder nach einem aufgeflogenen Seitensprung.
Sie hatten die steilen Felseninseln der Vesterålen überflogen und waren auf dem Weg hinaus auf den endlosen Atlantik, als der Pilot sich im Headset meldete.
»Fünf Minuten bis zur angegebenen Position. Giske, mach dich bereit für den Abstieg aufs Schiff.«
Hans entdeckte den Trawler als Erster: ein blauer Rumpf unter einer schwarzen Winsch mit der Kommandobrücke vorn und einem breiten Heck achtern, hoch und plump wie eine schwimmende Fabrik. Vielleicht hundert Fuß lang, obwohl das schwierig abzuschätzen war. Eine starke Bö riss den Hubschrauber hoch und stieß ihn hinab in ein Luftloch, wie ein Schiff auf dem Meer. Der Rettungssanitäter stand auf und hangelte sich vor zur offenen Luke. Eiskalter Wind schlug ihnen entgegen. Der Navigator hatte sich erhoben und stand neben ihm.
»Wir sind auf Position«, sagte der Pilot mit der gleichgültigen, beinahe lässigen Stimme, die einen guten Unwetterpiloten auszeichnet.
»Gibt es Neuigkeiten zum Krankheitsbild des Kapitäns?«, fragte Hans. »Alkoholvergiftung?«
»Sie wirken ziemlich gestresst«, sagte der Navigator. »Wenn du mich fragst, hat er akute Schmerzen.«
»Giske, klarmachen zum Runtergehen«, kommandierte der Pilot.
Der Navigator und der Maschinist überprüften, dass der Sanitäter sicher befestigt war.
Mit beidhändigem Griff um die Stange über der Luke lehnte Giske sich hinaus und ließ sich von der Winde hinabfieren. Schnee wehte ins Innere des Hubschraubers, dicke Flocken schmolzen auf Hans’ signalroten Schenkeln. Die Rotoren lärmten infernalisch.
Nach einer gefühlten Ewigkeit meldete der Sanitäter schließlich, dass er unten war.
»Zustand des Russen?«, fragte der Navigator.
»Sie wollen mich nicht in die Kabine lassen, in der er liegt«, rief Giske. »Aber soweit ich das beurteilen kann, hat er starke Schmerzen im Bauchraum. Schlechter Allgemeinzustand.«
»Sorg dafür, dass sie ihn auf die Trage legen«, rief der Navigator, »dann sehen wir ihn uns hier oben an und bringen ihn nach Bodø.«
Erneutes Rauschen in der Verbindung, sie konnten wütende Rufe hören.
»Die Russen weigern sich, ihn mir mitzugeben«, meldete Giske. »Sie finden, es ist zu gefährlich, und er ist zu krank.«
»Dann können wir nichts tun«, sagte der Navigator. »Wir ziehen dich hoch.«
»Warte!«, rief Hans in den Sprechfunk. »Giske, kannst du die Russen bitten, seinen Unterbauch abzutasten? Sag ihnen, sie sollen den Bauch vorsichtig ein paar Zentimeter tief eindrücken. Tut ihm das weh?«
»Erstaunlich wenig, berichten sie«, antwortete der Sanitäter einige Augenblicke später.
»Dann sag ihnen, sie sollen den Druck schlagartig lösen.«
Der Schrei, der nun folgte, war so heftig, dass kein Zweifel bestand.
Im Cockpit sahen sie einander an, der Navigator, der Maschinist und Hans.
»Ich glaube, wir können den Mann retten«, sagte Hans ernst. »Ich gehe runter.«
Die beiden anderen sagten nichts, sondern nickten stumm.
Hans hakte sich an die Sicherungsleine, stand auf und machte breitbeinig ein paar Schritte durch den schaukelnden Hubschrauber auf die Luke zu. Er befestigte sich am Abseilgurt. Der Navigator überprüfte, dass er festgeschnallt war.
Dann schwang Hans sich hinaus in die Dunkelheit und begann, sich abzuseilen. Der Lärm der Rotoren mischte sich mit dem Wind. Tief, tief unten konnte er die Lichter des Trawlers ausmachen. Wie hoch oben er war! Der Rumpf zeichnete sich auf einem Wellenkamm ab, gleichsam reglos wie ein gestrandetes Schiff bei Niedrigwasser, bevor er in einem weiß schäumenden Tal verschwand. Hans pendelte hin und her, sodass er für einen Moment glaubte, er würde gegen einen der Masten geschleudert werden.
Der Wind war stark, aber Hans fühlte sich in der mit Gewichten beschwerten Steuerleine sicher.
Jetzt konnte er den Trawler deutlich sehen. Ein großes rostiges Ungeheuer.
Noch sieben Meter, fünf Meter, drei Meter …
Unten auf dem Deck löste er sich von der Leine und ging schwankend hinüber.
»Was machen wir?«, fragte Giske.
»Du wartest hier«, rief Hans. »Ich rede mit den Russen.«
Zwei russische Seeleute kamen auf ihn zu. Durch den Wind rief Hans, er sei Arzt und habe eine Vermutung, woran der Kapitän leide.
Einer der beiden gestikulierte und versuchte es mit einer Antwort. »Doktor okay. Operation hier.«
Der andere Russe trat vor, als wollte er den Worten Nachdruck verleihen. Hans nickte und eilte auf die Brücke, wo man ihn in die Kapitänskajüte brachte.
Der Kapitän lag auf einer Trage auf dem Boden. Er war ein athletischer, muskulöser Mann in den Vierzigern.
Hans öffnete die Sanitätstasche und sah nach, was ihm zur Verfügung stand. Hielt ein Skalpell gegen das Licht.
»Really?«, sagte einer der Russe.
Eine Welle ließ das Steuerhaus erbeben.
»Entweder das oder der Tod«, erwiderte Hans ernst.
Er spritzte ein Narkosemittel, und der Kapitän verlor schnell das Bewusstsein. Die Besatzung stand um sie herum.
»Ich brauche noch einen Mann, der mir hilft«, befahl Hans und zeigte auf den, der anscheinend am besten Englisch sprach, bevor er ihm Mundschutz und Handschuhe reichte. »Du.«
Als Erstes schnitt Hans das Hemd des Kapitäns zwischen oberem Beckenrand und Bauchnabel auf. Er tastete vorsichtig nach dem McBurney-Punkt im unteren Teil der Bauchwand und desinfizierte den Bereich mit Alkohol. Mit dem Skalpell setzte er einen rund fünf Zentimeter langen Schnitt, und mithilfe des Matrosen, der den Schnitt offen hielt, legte er die Muskelfasern frei, bis das Bauchfell sichtbar wurde. Das Schiff rollte immer noch, aber es war, als ob dessen Bewegungen mit dem Meer verschmolzen. Mit einem etwas tieferen Schnitt öffnete Hans die Bauchhöhle und steckte seinen behandschuhten Zeigefinger hinein, um den Dickdarm zu finden.
Darunter kam der geschwollene Appendix des Blinddarms zum Vorschein. Er war rot und hatte die Form und Größe eines Regenwurms. Hans zog ihn herauf und suchte nach der Arteria appendicularis, die er sicherte und abband, bevor er sie durchtrennte und das Ende des Blinddarms zurück in die Bauchhöhle schob. Dann verschloss er die Bauchwand und die äußere Haut. Die Operation hatte nur wenige Minuten gedauert.
»Zum letzten Mal«, sagte Hans. »Wir müssen ihn mitnehmen.«
Der Russe fuhr ihn barsch an. »Er bleibt. Thank you, doctor.«
Beim Hinausgehen schnappte Hans sich den Becher, in den er den Wurmfortsatz gelegt hatte, und steckte ihn in einen diffusionsdichten Beutel, den er anschließend versiegelte.
Der Rettungssanitäter kam ihm entgegen. »Und?«
»Er ist bald wieder auf den Beinen«, antwortete Hans.
»Verdammt, was für ein Job«, sagte Giske.
Im Sprechfunk knisterte es.
»Falck, Giske?«, meldete sich der Navigator. »Wir haben nur noch wenig Treibstoff.«
Die Norweger gingen rasch durchs Steuerhaus und an Deck.
»Wir sind bereit zum Hochholen!«, rief Hans, die Stimme voller Adrenalin.
Einen Augenblick später schwebte er am Seil über die Reling hinweg, während der Trawler auf eine Welle zurollte, die höher war als alle davor.
Hans erkannte es sofort. Das würde schiefgehen.
Für eine Sekunde war es, als sei er schwerelos, bevor er im nächsten Moment zurück in Richtung Trawler geschleudert wurde und einen Stahlmast auf sich zukommen sah.
Denn das hier war es, was er immer gefürchtet hatte. Nicht den Tod an sich, sondern die sich verdichtende Todesangst des Free-Solo-Kletterers ab dem Moment, in dem er den Halt an der Felswand verliert, bis zum Aufschlag auf dem Boden, die Sekunde zwischen der Explosion der Landmine und der Druckwelle, die sie freisetzt, die Zehntelsekunde vom Herabsausen der Guillotine bis zum Durchtrennen der Halsschlagader.
Dann fiel der Vorhang.
Kapitel 2Die Zeit der krummen Touren ist vorbei
Eines der ersten Dinge, die Sasha Falck als neue Direktorin der SAGA tat, war, die Statue von Store-Thor abzureißen, die lange den großen quadratischen Rasen vor dem Haupteingang von Rederhaugen geschmückt hatte.
Sie beauftragte einen Bildhauer, als Ersatz eine Büste ihrer Großmutter anzufertigen. Starke Frauen waren eine Spezialität des Künstlers, und wie schwierig Vera Lind auch sonst zu beschreiben war, gehörte sie zweifellos in diese Kategorie. Denn neben ihrem Wirken als Schriftstellerin, das in bestimmten Kreisen Kultstatus genoss, hatte sie unter großem persönlichem Risiko den männlichen Familienmitgliedern getrotzt, um die Wahrheit zu erzählen.
Sasha blickte hinauf zu dem Bronzegesicht. Es war früh am Morgen des 1. Dezember. Vieles musste noch erledigt werden, bevor »Falck 3«, ein Rettungsschiff, das das Familienunternehmen der Norwegischen Seenotrettungsorganisation gestiftet hatte, in der Hauptstadt getauft werden konnte. Anschließend würde es einen Empfang auf Rederhaugen geben. Als SAGA-Direktorin kam Sasha eine Schlüsselrolle zu.
Es nieselte unangenehm, und die Tropfen legten sich wie Schweißperlen auf die Stirn von Großmutters Statue. Sasha zog den bereits feuchten Schal fester um den Hals und stieg über die niedrige Einzäunung, die den Kiesweg vom Rasen mit der Büste trennte. Vera Lind 1920–2015. Natürlich hatte Sasha eine Gedenktafel mit einer Inschrift erwogen, vielleicht etwas aus Veras Büchern, aber ihre Großmutter hatte immer so höhnisch über den Spruch an Store-Thors Büste gelacht, dass sie davor zurückschreckte. »›Weiterzuleben in den Herzen, die wir zurücklassen, heißt, nicht zu sterben‹, hahaha, wie wär’s mit ›Seine irdische Hülle hat uns verlassen, aber die Großspurigkeit möge ewig leben‹.«
Die Züge der Vera-Büste ähnelten ihrem eigenen Gesicht, die markante römische Nase und die hohen Wangenknochen, auch wenn das hochgesteckte Haar andeutete, dass der Künstler eine ältere Version der Großmutter als Modell genommen hatte. Die Haut war glatt, wie nach einem Facelifting, der Blick, mit dem sie auf den Fjordhorizont starrte, hatte die leere Unnahbarkeit von Statuen. Großmutter erinnerte an eine andere Wirklichkeit, eine der Kunst und der Leidenschaft, jenseits der Selbstkontrolle, die Sasha stets anstrebte.
Alles hatte im Jahr zuvor begonnen, als Vera im Alter von fünfundneunzig Jahren Selbstmord beging. Das Testament war verschwunden. Trotz der Warnung ihres Vaters, sie solle »nicht jeden Stein umdrehen«, hatte Sasha sich auf die Jagd nach Großmutters Geheimnissen gemacht. Die Suche hatte sie auf die Spur von Veras Manuskripft Meeresfriedhof gebracht, verfasst im Jahr 1970. Darin hatte sie eine Reise mit der Hurtigrute und anschließendem Schiffsuntergang im Zweiten Weltkrieg benutzt, um das Bild von Stammvater Store-Thor Falck als Kriegsheld niederzureißen. In Wahrheit war er ein Nazikollaborateur und Kriegsgewinnler gewesen. Das Manuskript wurde beschlagnahmt, und Vera wurde von ihrem eigenen Sohn, Sashas Vater Olav, unter Vormundschaft gestellt.
Als Sasha das Testament schließlich fand, wurde ihr klar, warum das Verhältnis zwischen Vera und Olav so traumatisch gewesen war. Der Sohn war das Ergebnis einer Liebesaffäre mit einem deutschen Soldaten. Sasha und die anderen Nachkommen fielen damit aus der Abstammungslinie heraus, die für die Falcks das ausschlaggebende Kriterium für die Kontrolle über ihre Familienunternehmen und Erbschaften war. Im Grunde hatte Großmutter sie alle mit einem Federstrich enterbt. Sasha hatte das Testament verbrannt. Obwohl die Angst, dass dieses Verbrechen eines Tages ans Licht kommen könnte, immer noch da war, wurde sie mit jedem Tag kleiner.
Sasha war auf dem Rückweg zu ihrem Büro, als sie eine Stimme hinter sich hörte.
»Alexandra?«
Sie blieb stehen. Erkannte die leise, fast flüsternde Stimme und die nordnorwegische Dialektmelodie von Martens Magnus, MM unter Kollegen.
»Du bist nicht mein Vater«, sagte sie. »Nenn mich Sasha.«
MM besaß die Art von Anticharisma, wie sie oft Menschen eigen ist, die es in den Labyrinthen der Bürokratie zu etwas gebracht haben. Er hatte sich im Jahr zuvor scheiden lassen, was ihn und Olav einander nähergebracht hatte.
Aber auch wenn M. Magnus Olavs Vertrauter war, ging die Freundschaft nicht so tief, dass sie Olav davon abgehalten hätte, sich über ihn lustig zu machen, wenn sein Name im Gespräch mit den Kindern fiel.
»MM würde das Beatmungsgerät seiner Mutter vom Strom trennen, um sein Handy aufzuladen«, pflegte Olav zu sagen. Aber die Leute hörten auf MMs Rat. Er war absolut jemand, mit dem man sich gutstellen musste.
Er gehörte zu der Sorte von früheren Berufsoffizieren der Spezialeinheiten, die Zynismus mit Eitelkeit kombinierten. An diesem Tag trug er einen schwarzen Zweireiher über einem weinroten Rollkragenpullover. Den kleinen, stämmigen Mann mit dem nagetierartigen Aussehen umgab eine Wolke von Rasierwasserdunst.
»Wir müssen reden«, sagte er jetzt in bestimmendem Ton.
Ungeachtet all seiner Schwächen: Wenn MM darauf bestand, tat man gut daran zuzuhören. Sasha hatte ihn zum Leiter von SAGAs Nordnorwegen-Abteilung ernannt, ein Schritt, der den Beifall ihres Vaters gefunden hatte. Im Norden hatten alle Geschäfte – Immobilien, Häfen, Schifffahrt – große politische Auswirkungen. Es war ein Spiel, das MM besser beherrschte als die meisten anderen. Ihre eigene Lernkurve war steil gewesen, aber mit Teufeln und Engeln wie Martens Magnus auf ihren Schultern hatte sie es geschafft.
»Dir ist bekannt, dass Sverre und der Rest des Afghanistan-Kontingents heute landen?«, fragte MM, während sie hinunter zum Pavillon gingen.
»Wir haben keinen Kontakt«, sagte Sasha. »Du wolltest aus einem anderen Grund mit mir reden.«
Martens Magnus nickte. »Ich komme gerade von einer Besprechung unter anderem mit Vertretern der Verwaltung und dem Gouverneur auf Svalbard.«
Die Nachricht von dem vergifteten russischen Oberst hatte für Furore gesorgt, als sie vor einigen Wochen die Medien erreichte. Longyearbyen war so überschaubar, dass die Einwohner schon von jedem umgestürzten Schneescooter wussten, noch bevor es passiert war, und ein möglicher chemischer Angriff Russlands auf souveränem norwegischem Territorium war nicht gerade ein Warnschuss vor Eisbären, sondern eine potenzielle Weltnachricht. Gouverneur Eliassen war vom Spiegel, der BBC und der New York Times interviewt worden, Premierminister hatten den Vorfall verurteilt, die NATO hatte beratschlagt, und die Russen hatten dementiert.
»Die rechtsmedizinischen Untersuchungen sind abgeschlossen«, fuhr MM fort. »Sie haben ergeben, dass Zemljakow hohe Werte des Gifts Rizin aufwies und an einer Blutvergiftung starb. Mit dem gleichen Giftstoff wurde unter anderem 1978 in London ein bulgarischer Dissident umgebracht. Aber der Zeitaspekt ist wichtig. Rizin tötet einen Menschen normalerweise innerhalb von drei Tagen, es dauert also eine Weile. Laut Obduktionsbericht war Zemljakow mindestens vierundzwanzig Stunden zuvor vergiftet worden. Und aus den Aufzeichnungsdaten über den russischen Schiffsverkehr wissen wir, dass er vier Stunden vor dem Vorfall in Longyear mit einem russischen Schiff in Barentsburg angekommen ist. Direkt von einem russischen Stützpunkt auf Franz-Josef-Land.«
Sasha überlegte einen Moment. »Er wurde also auf russischem Territorium vergiftet?«
»Vieles deutet darauf hin«, antwortete MM. »Der Nachrichtendienst geht davon aus, dass er seine Flucht in den Westen nach der Vergiftung geplant hat. Er schlich sich auf ein Schiff, stahl in Barentsburg einen Motorschlitten und fuhr nach Longyear, eine Fahrt, die im Dunkeln und ohne genaue Ortskenntnisse bis zu drei Stunden dauert.«
»Die Strecke kenne ich«, sagte sie.
»Gerade die Tatsache, dass die Vergiftung vermutlich auf russischem Territorium stattgefunden hat, ist der Grund für die relativ zurückhaltende offizielle Reaktion Norwegens.«
Sie waren unten am Ufer der Øksevika-Bucht angekommen. Die tiefe Wolkendecke und der graue Fjord verschmolzen am Horizont miteinander.
»Die letzten Worte des Obersts«, flüsterte MM, »waren, dass die Russen jemanden innerhalb der SAGA haben. An zentraler Stelle.«
Sie schluckte. Warf einen flachen Stein ins Wasser. Das durfte nicht wahr sein. Sie war gerade dabei, die Erschütterungen zu überwinden, die durch ihren Fund von Großmutter Veras Manuskript und Testament ausgelöst worden waren. Fast wäre die ganze Familie zerrissen worden. Doch das Verhältnis zu ihrem Vater normalisierte sich langsam, sie hatte die Situation unter Kontrolle.
Und jetzt das.
»Wir haben eine Strategie für die Nordgebiete, die unter deiner Verantwortung stehen«, sagte sie. »Inwieweit wird das durch diese Informationen berührt?«
»Genau das versuche ich herauszufinden.«
Sie drehte sich zu ihm um. »Was sagt der PST?«
»Tja, was sagt der? Dass vielfältige Kompetenz wichtig ist und dass die Ermittlungen nicht mit den Urlaubsregelungen kollidieren dürfen. Sie untersuchen die Angelegenheit.«
Sasha hatte genug Militärangehörige getroffen, um zu wissen, dass sie von »der Polizei«, genauer: dem polizeilichen Inlandsnachrichtendienst PST, ebenso wenig hielten wie Polizeibeamte von Wachleuten.
»Die Polizei hat sicherlich fähige Techniker und Fahnder«, sagte MM. »Das muss man ihr lassen. Ich tippe darauf, dass sie mit einer ganzen Mannschaft anrücken, um deine Räume zu verwanzen, eine Überwachung deines Telefons einzurichten und anschließend ein paar Typen zum Mithören abzustellen. Aber glaubst du, dass man einen SAGA-Maulwurf auf diese Weise findet?« Er schüttelte den Kopf.
»Also was schlägst du vor?«
»Johnny Berg«, erwiderte er spontan. Sein Blick wich ihrem nicht aus.
Der Gedanke an John Omar »Johnny« Berg hatte in etwa denselben Effekt auf Sasha wie Filme aus dem Internet, in denen Waghalsige auf den Spitzen von Wolkenkratzern und Kränen herumturnen. Blutdruck und Herzschlag stiegen, sie atmete schneller, und ihre Handflächen wurden feucht. Sie versuchte, sich wegzudrehen, wurde aber von dem angezogen, was sie ängstigte.
Es war Johnny, der ihr geholfen hatte, die Wahrheit über Meeresfriedhof herauszufinden. Er kannte die ganze Wahrheit.
Der Outsider, der Straßenjunge, der heimliche Agent, der Geliebte, der sich unter dem Vorwand, Veras Manuskript finden zu wollen, in die Familie hineinmanövriert hatte, bevor sie die Sache selbst in die Hand nahm.
»Ich habe keinen Kontakt zu Johnny Berg.«
Magnus seufzte, übertrieben resigniert, wie sie fand.
»Dann solltest du in Erwägung ziehen, das zu ändern. Es könnte nützlich sein, die Beziehung zu Berg zu kitten.«
Sasha schwieg. Sie konnte nicht sagen, was sie dachte: Selbst wenn sie gegen alle Vernunft ihren dunklen Instinkten folgte, würde Johnny um nichts in der Welt etwas mit ihr zu tun haben wollen. Sie hatte Veras Testament vor seinen Augen verbrannt und anschließend dafür gesorgt, dass man ihn hinter Gitter brachte.
»Was immer zwischen uns war, ist vorbei«, sagte Sasha und bereute ihre Worte sofort, sie hörten sich an wie ein Liebesgeständnis.
»Berg ist raus aus dem Gefängnis und schreibt Hans Falcks Biografie«, sagte der Offizier. »Er hat einen Teil des Sorgerechts für seine Tochter zurückbekommen. Es geht ihm bestimmt schon viel besser.«
»Hans’ Biografie war ein Bluff, um in die Familie hineinzukommen«, murmelte sie und versuchte, ihre Neugier zu verbergen.
»So hat es vielleicht angefangen, aber jetzt ist es ernst. Berg hat einen handfesten Grund, auf Rederhaugen zu sitzen. Gib ihm einen Platz zum Schreiben. Er soll herausfinden, wer den Russen Informationen liefert. Und kein Wort über dieses Gespräch, verstanden?«
»Martens«, sagte Sasha. »Die Zeit der krummen Touren ist vorbei. Das hier ist eine Aufgabe für den PST. Solltest du jemals wieder versuchen, mir nahezulegen, unter dem Deckmantel von SAGA die Behörden hinters Licht zu führen, werde ich dafür sorgen, dass gegen dich ermittelt wird – durch die Polizei.«
»Alexandra«, protestierte MM, sah dann seine Niederlage aber offenbar ein.
»Und noch etwas«, sagte Sasha. »Falls du Johnny Bergs Namen noch einmal erwähnst, sorge ich dafür, dass du nie wieder einen Fuß auf Rederhaugen setzt.«
Kapitel 3Niemand soll ertrinken
Olav Falck war spät dran für die Schiffstaufe am Pier Honnørbryggen, und als er außer Atem auf einen reservierten Platz in der ersten Reihe sank, merkte er, dass der Sitz nass war und die kleine Regenpfütze durch den Hosenboden seiner Cordhose drang.
Mist, ein feuchter Hintern konnte leicht eine Erkältung nach sich ziehen, und in seinem Alter dauerten Erkältungen ewig.
»Eure Königliche Hoheit, verehrter Herr Präsident, liebe Familie und Freunde«, begann Alexandra auf dem Podium und schaute dabei ins Publikum – da waren die Prinzessin als hohe Schirmherrin des Rettungsschiffes, der ehemalige Parlamentsabgeordnete, nunmehr Präsident der Seenotrettungsgesellschaft, und ihr Vater.
Sensibel für die Dynamik der Macht, wie er war, erkannte Olav sofort die neue Rangordnung. Was war mit familia ante omnia – die Familie vor allem? Er selbst war zum Plebejer geworden. In der Woche zuvor hätte ihm die neue Empfangsdame auf Rederhaugen beinahe ein Namensschild angeklebt, bevor Siri Greve herbeigeeilt kam und die Demütigung abwendete.
Ein roter Teppich führte in gerader Linie vom Rathaus hinaus auf den Pier, wo die »Falck 3« lag und im grauschwarzen Wasser dümpelte. Dass es ein großes Rettungsschiff war, stand außer Zweifel. So groß, dass Olav für einen Moment befürchtete, das Hafenbecken könnte an dieser Stelle zu flach sein. Von einem Heckaufbau mit einem so großen Oberdeck, dass ein Hubschrauber darauf landen konnte, führte eine Gangway hinüber zum Steuerhaus mit einer hohen Kommandobrücke und einem kräftigen Mast auf dem Dach.
Seine Tochter beugte sich auf dem Podium nach vorn. »Wer sind wir? Wer sind wir als Individuen und als Nation?«
Ihre rhetorische Glanzleistung, dachte Olav, zum ersten Mal vorgetragen auf Veras Beerdigungsfeier. Seitdem war sie so etwas wie ein Credo ihrer Mission mit SAGA geworden.
»Wir sind eine Küstennation«, fuhr sie fort. »Meine Großmutter, möge sie in Frieden ruhen, kam von den Lofoten. Sie wuchs auf mit Geschichten von Schiffbrüchen, mit dem Glauben an den Draugr, der ein halbes Ruderboot rudert, mit der ewigen Furcht vor dem Ertrinken, davor, dass unsere Lieben nie mehr zurückkehren. Natürlich machte das die Menschen an der Küste besonders religiös. Hier standen die Gebetshäuser dicht an dicht, der Volksglaube war stark. Das Leben war vom Schicksal bestimmt. Man konnte jederzeit sterben. Im Jahr 1861 wurde festgestellt, dass jährlich zwischen siebenhundertzwölf und siebenhundertneunundfünfzig Fischer umkamen. Jährlich!«
Er erkannte immer mehr von der Geschichtenerzählerin Vera in seiner Tochter. Man konnte viel über die anderen Spender der Seenotrettungsgesellschaft sagen, aber kaum einer von ihnen war rhetorisch begabt. Sie dagegen konnte die Reederaristokraten in ihren Bann ziehen. Deren Nachkommen waren meist geschichtsvergessene Taugenichtse und Partygirls, die sich in der Londoner Gesellschaft herumtrieben.
»Deshalb sind wir den weitsichtigen Menschen dankbar, die an einem Sommertag des Jahres 1889 zusammenkamen, um die Rettungsgesellschaft zu gründen. Es erfüllt meine Familie mit Stolz und Demut, dass wir einen unterstützenden Beitrag zur Geschichte der Seenotrettung entlang der Küste leisten dürfen, und dies seit unserer ersten Schenkung eines Schiffes im Jahr 1916.«
Seine Tochter hatte begriffen, welche Macht darin lag, dass eine junge Frau beherrschte, womit all seine alten Freunde ihren Ruhestand verbrachten: Seefahrtsgeschichte und Genealogie.
»Das war die erste ›Falck‹«, sagte sie, »sie wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren durch die ›Falck 2‹ ergänzt. ›Falck 2‹ übernahm das Echolot eines Rettungsschiffs namens ›Skomvær 2‹ und gab es später an die ›Sjøfareren‹ weiter, wie um zu zeigen, dass die Rettungsschiffe in einer ungebrochenen historischen Linie stehen – eine Tradition, die wir voller Stolz mit der ›Falck 3‹ fortsetzen. Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums unserer unternehmerischen Tätigkeit auf Svalbard werden wir im kommenden Jahr eine Expedition mit dem Schiff zur Inselgruppe durchführen, bevor es an die Seenotrettungsgesellschaft übergeben wird.«
Applaus brandete auf. Olav fröstelte im Nieselregen. Alexandra konnte zwar den Platz der Falcks im Mahlstrom der norwegischen Geschichte mit ein paar eleganten Pinselstrichen bildlich machen, aber besaß sie den Mumm, der nötig war, wenn SAGA Realpolitik betreiben musste?
Als seine Tochter ihn als Direktor und Vorstandsvorsitzenden im Frühjahr ablöste, hatte er sich mit ihr zusammengesetzt und ihr erklärt, was dieser Job in all seinen technischen Einzelheiten beinhaltete. Als er damit durch war, hatte er sie im Kaminzimmer ernst angesehen.
»Das war der offizielle Teil der Anweisung«, hatte er gesagt. »Denn was die SAGA immer war und immer bleiben muss, ist eine Speerspitze im Dienst norwegischer Interessen und letztlich eine Beschützerin unserer Freiheit.«
Alexandra hatte gesagt: »Wir leben in einem demokratischen Land, Papa. Man kann nicht einfach machen, was man will.«
Er hatte geantwortet, dass SAGA ja gerade eine letzte Verteidigungslinie für die Demokratie sei, wenn man auf Gegner treffe, die die Spielregeln der Demokratie nicht akzeptierten.
Alexandra beendete ihre Ansprache an die Anwesenden mit einer rhetorischen Überraschung. »Ich habe über die Verbindungen zwischen der Seenotrettung und unserer Familie gesprochen. Mehr als die meisten anderen haben wir Unglücke auf See zu spüren bekommen. Die Vision und das Motto der Rettungsgesellschaft sind auch unsere eigenen: Niemand soll ertrinken.«
Es gab Beifall, und eine Blaskapelle marschierte den Kai entlang. Das Schiff war geschmückt mit Luftballons und Girlanden in den Farben der Seenotrettungsgesellschaft.
Was ist das hier, dachte Olav, ein Kindergeburtstag?
Sein Verdacht wurde bestärkt, als er die Taufpatin sah, eine blasse Teenagerin umringt von Leibwächtern und Angestellten des Hofes, die die Verleihung des Schiffsnamens und ihre guten Wünsche in ein aufgebautes Mikrofon sprach. Sie ließ das Tau mit der Flasche los, die beim zweiten Versuch am Schiffsrumpf zerschellte.
Die geladenen Gäste klatschten, und die Blaskapelle spielte einen Tusch.
»Fehlen nur noch Papierhüte und Würstchen«, flüsterte Olav seinem Nebenmann zu. Der lachte nicht. Nein, dachte Olav, dies war nicht der Ort für subversive Witze.
»Sie müssen stolz auf Ihre Tochter sein«, sagte der Nebenmann.
Selbstverständlich war er das. Zuerst hatte er Angst vor dem gehabt, was alle Eltern fürchten – Kriminalität, Drogenmissbrauch, schwere Krankheiten –, und als sie größer wurde, ohne dass diese Schreckensszenarien eintrafen, wurde daraus eine eher diffuse Sorge, ob sie ihren Platz in der Welt finden würde. Ein Gefühl, das sich in Bezug auf seine beiden anderen Kinder weiterhin hielt – ruhelos und kinderlos, wie Sverre und Andrea waren.
Nur ein einziges Mal hatte Olav Angst um Alexandra gehabt. Das war, als sie mit diesem manipulativen Skalpjäger John Omar Berg weggeflogen war. In der Sache hatte er ihr aber auch die Meinung gesagt. Gerade weil er so selten seine Stimme gegen sie erhob, hatte sie auf ihn gehört.
Seine Tochter und Martens Magnus winkten Olav zu sich auf die Kommandobrücke. Dort erklärte der Kapitän stolz, dass die »Falck 3« das größte Schiff in der Flotte der Rettungsgesellschaft sein werde, und eines der größten Rettungsschiffe der Welt, zusammen mit dem deutschen Seenotrettungskreuzer »Hermann Marwede«.
Die Prinzessin durfte einen Überlebensanzug ausprobieren und sprang nach einigem Zögern unter großem Beifall in das kalte, schwarze Dezembermeer, bevor sie die Veranstaltung verließ.
Der Regen war stärker geworden, es war einer von diesen Tagen, an denen es nicht richtig hell wird. Olav stand an der Reling, als das Schiff zwischen den Rathauspiers zurücksetzte und Marschfahrt voraus aufnahm. Auf der einen Seite ragten grau und abweisend die Mauern der Festung Akershus in den Himmel, auf der anderen Seite beugte sich das weiße Dach des Astrup-Fernley-Museums zum Wasser hinunter, wie ein gekentertes Segelboot an der Oberfläche.
Wehmut überkam ihn, wie so manches Mal, wenn er an dem Schulgebäude vorbeikam, in dem er vor neunundsechzig Jahren – ja, es war verrückt – eingeschult worden war. Andererseits: Er konnte sich manchmal auch an diesem neuen Leben als Rentner erfreuen.
»Olav«, sagte MM, der neben ihn getreten war und seine starken Fäuste um das Geländer schloss. »Hast du schon von Hans gehört?«
»Was ist jetzt wieder? Haben ihn die Vereinten Nationen zum Hochkommissar für Flüchtlinge ernannt? Oder wurde er in flagranti mit einer jungen Politikerin der Linksradikalen erwischt?«
»Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass er verletzt ist. Schwer verletzt, er hatte einen Unfall.«
Olav drehte sich abrupt zu dem Offizier um. »Was sagst du da? Wo ist er? Im Nahen Osten?«
»Nein«, antwortete MM, »der Unfall ereignete sich auf dem norwegischen Kontinentalsockel, vor den Vesterålen, bei einem Einsatz mit dem 330. Rettungsgeschwader. Die Details kennen wir noch nicht, aber er liegt im Krankenhaus von Bodø im Koma.«
»Grundgütiger«, sagte Olav. Das waren erschütternde Neuigkeiten.
Vor dem Schiffsbug wuchsen die Steilklippen mit Veras alter Hütte auf Stupet in die Höhe, und hinter der Felsformation kam der Rosenturm des Hauptgebäudes in Sicht. Das Schiff verlangsamte seine Fahrt und tuckerte gemächlich zum äußersten Anleger in Øksevika auf der südlichen Landzunge von Rederhaugen. Es war kaum zu fassen. Hans Falck, Verführer und Frauenheld par excellence, die Stimme der Unterdrückten und der Retter der Kriegsversehrten, der Mann mit den neun Leben. Konnte er wirklich im Koma liegen?
»Hoffen wir, dass er nicht stirbt«, sagte Olav.
»Wirklich«, nickte MM.
»Weißt du, Martens«, sagte Olav und lehnte sich über die Reling, »Leute von Hans’ Schlag, Menschenverführer, sind am lebendigsten, wenn sie tot sind. Verstehst du? Möge er um Gottes willen überleben!«
Kapitel 4Putin ist die einzige Hoffnung des Westens
Ein Taxi fuhr durch das Haupttor von Rederhaugen und glitt langsam die Ahornallee entlang. Die Bäume waren ein wenig windschief durch die Herbststürme. Im Fond saß Sverre Falck. Die Paradeuniform kratzte an den Schenkeln. Der Beweis für seinen Einsatz in Afghanistan baumelte an der Uniformbrust, zusammen mit mehreren anderen Medaillen. Man hatte ihm die Einsatzmedaille der Norwegischen Streitkräfte mit Rosette verliehen, die jetzt an der Uniform getragen wurde, nahe am Herzen, für »Tapferkeit und Mut«.
Der Wagen hielt am Wendeplatz.
»Danke«, sagte der Taxifahrer.
»Ich habe zu danken«, erwiderte Sverre und öffnete die Autotür.
Der Fahrer musterte die Uniform. »Für den Dienst, den Sie für unser Land leisten.«
Schultern gerade, Brust raus und Blick in die Ewigkeit. War es nicht das, was der Ausbilder ihnen eingetrichtert hatte, als Sverre ein junger Rekrut war?
Vor dem Afghanistan-Einsatz hatten viele es ihm nicht zugetraut und schlecht über ihn geredet. Sein Vater, die Geschwister, die Kameraden. Aber Tatsache war, um den Kompaniechef zu zitieren, dass Scharfschütze Falck »ganz objektiv die Erwartungen übertroffen hat«.
Kopf hoch und Blick geradeaus. Er kehrte im Triumph zurück. Er hatte die Zeit in Afghanistan genutzt, um nachzudenken. Darüber, wie er bekommen konnte, was ihm rechtmäßig zustand. Die Position an der Spitze der SAGA.
Warum also wurde er den eisigen Atem der Angst im Nacken nie ganz los? War es alter Rotz von früheren Einsätzen dort unten, die Drähte am Straßenrand, der Knall, das Pfeifen im Ohr und der Sand in den Nasenlöchern, nachdem die Landmine hochging? Oder die verängstigten Ausländer im Gästehaus, die sie aus der Gewalt der Terroristen befreiten, oder die Gespenster vom Hotel Intercontinental?
Die Erinnerungen flossen ineinander und formten sich zu verzerrten Gesichtern, so wie man manchmal einen Troll sieht, wenn man nachts im Wald lange genug auf einen Baum starrt.
An der Tür stand Sasha und begrüßte die Gäste. Die eiserne Faust der Eifersucht schloss sich um sein Herz. Einmal, als er noch klein gewesen war, hatte er neben seinem Vater an der großen Tür gestanden. Das war sein Platz. Der Erstgeborene in gerade absteigender Linie.
»Steh breitbeinig, wie ein Feldherr«, hatte Olav ihn ermahnt und ihm mit den rauen Händen den Kopf getätschelt. An den Abenden lasen sie über Karl XII. und Bonaparte. »Du trägst den Generalstab in deinem Rucksack, Sverre. Eines Tages wirst du es sein, der hier steht.«
Immer hatte er versucht, es dem Vater recht zu machen. War dem Pfad gefolgt, den dieser vorgezeichnet hatte. Militärdienst, Jurastudium, Afghanistan, SAGA. Olav war nie zufrieden. »Das Leben eines Mannes ist unvollständig, wenn er nicht Krieg, Liebe und Armut erlebt hat«, pflegte er zu sagen.
Als hätte sein Vater Armut erlebt. Oder Krieg. Sverre war nicht einmal sicher, ob Olav überhaupt jemanden geliebt hatte.
Irgendwann hatte es ihm gereicht. Das letzte Mal war er im Frühjahr auf Rederhaugen gewesen, während des Familienrats, bei dem das Erbe zwischen dem Bergenser und dem Osloer Zweig, dem er selbst angehörte, aufgeteilt werden sollte. Sverre hatte seine Anteile an der SAGA-Gruppe an die Bergenser verkaufen wollen, was sein Vater natürlich als Loyalitätsbruch empfand. Die Konsequenz daraus stand jetzt mit ausgebreiteten Armen vor ihm.
»Sverre!«, sagte Sasha lächelnd und legte ihre schmalen Hände um seine Oberarme.
Sie war älter geworden, oder vielleicht war es ihr Kleidungsstil.
»Ich habe mit dem Oberbefehlshaber der Norwegischen Streitkräfte gesprochen. Die Berichte über dich in Afghanistan sind sehr gut.«
Ein solches Lob hätte Sverre eigentlich mit Stolz erfüllen müssen, aber der herablassende und offizielle Tonfall seiner Schwester verhinderte das. Die Berichte über dich – wer sprach denn so mit seinem Bruder? Sie genoss es offenbar zu sehen, wie er angekrochen kam.
Ein heimeliger Duft von Wein und Gewürznelken, vermischt mit Stimmengewirr und dem Klirren von Gläsern und Porzellan, schlug ihm entgegen, als er eintrat. Noch bevor er die Menschenmenge im Foyer halb durchquert hatte, war ihm bereits von irgendeinem ältlichen Militärfreund ein Sitz im Vorstand einer Stiftung angeboten worden. Er begrüßte Olavs alte Mitstreiterin Signy Ytre Arna, Politikerin der Zentrumspartei und gewiefte Spezialistin für politischen Kuhhandel, deren voluminöse Taille mit mehreren Minister- und Vorstandsposten gepolstert war. »Alles an Signy ist üppig«, pflegte Olav zu sagen, »abgesehen vom Rückhalt in ihrer Partei.«
Sverre entschuldigte sich und ging auf die Toilette. Wusch sich das Gesicht. Blickte in den Spiegel. Rein physisch konnte er sein Ich von vor der Zeit in der Kampfschwimmereinheit wiedererkennen, das lange Gesicht mit der spitzen Falck-Nase, der blassen Haut, die im Sommer goldbraun wurde, den kleinen blauen Augen, die seinem Blick etwas Prüfendes gaben. Ein Gesicht, das früher als arrogant bezeichnet worden war, dem aber jetzt etwas Lebenserfahrenes anhaftete, wie einem antiken Möbelstück, das endlich seinen Wert erhalten hatte.
Ihm gefiel das. Er war ein anderer Mann als der, der nach Afghanistan gegangen war.
Als er wieder in die Halle kam, hörte er hinter sich eine Stimme: »Sverre!«
Andrea bahnte sich einen Weg durch die Menge, genauso hochgewachsen und androgyn wie immer, obwohl ihr dunkles Haar länger geworden war und jetzt hinabhing. Sie umarmten sich.
»Du bist die Einzige, die ich froh bin zu sehen«, sagte Sverre.
Seine kleine Schwester hielt ihn an den Schultern, als wollte sie sich vergewissern, dass er es wirklich war. »Es ist so gut, dich zu sehen, Sverre, ich hatte Angst um dich!«
Sverre setzte ein blasiertes Gesicht auf. »Alles in Ordnung hier in dem Laden?«
»Alles okay. Alexandra die Große regiert mit eiserner Hand.« Sie zuckte die Schultern. »Hab überlegt, ob ich es wie du machen soll und meinen Anteil an dem ganzen Scheiß verkaufe.«
»Warte damit, ich habe noch nicht verkauft«, sagte Sverre schnell. »Ich will mit dir reden, bevor wir irgendwelche Entscheidungen treffen.«
Wie immer bei solchen Empfängen kochte die Eingangshalle über vor Klatsch, Geläster und politischem Ränkespiel.
»Hast du übrigens gehört, dass Hans im Koma liegt?«, fragte seine Schwester.
»Was?«
»Ein Unfall in Nordnorwegen. Marte und ihre Brüder sind hingeflogen.«
Was bedeutete ein außer Gefecht gesetzter Hans für seine eigenen Pläne? Vielleicht nicht die Welt, aber Sverre war derjenige im Osloer Zweig, der definitiv das beste Verhältnis zu dem Bergenser hatte, also war das eine schlechte Nachricht. Konnte er sie zu seinem Vorteil nutzen?
Als Sverre durch die Halle schritt, winkte ihn sofort eine Gruppe alter Trinkkumpane aus dem vornehmen Osloer Westen zu sich, die in eine hitzige Debatte mit einer jungen Frau vertieft waren.
»Und Sie sind …?«, fragte Sverre und sah die junge Frau an.
»Ingeborg«, antwortete sie, und in ihrem Gesicht erschienen zwei Lachgrübchen. »Ingeborg Johnsen.«
Sie wandte sich wieder ihren Gesprächspartnern zu.
»Ihr seid besessen vom Islam«, sagte sie. »Ihr glaubt im Ernst, dass eine Religion, die maximal 5 Prozent der Landesbevölkerung umfasst – und von diesen 5 Prozent will nur eine kleine Minderheit überhaupt einen politischen Islam –, die Theokratie in einer der säkularsten und modernsten Gesellschaften der Welt einführt?«
»Aus Ihnen spricht pure Naivität!«, erwiderte Victor Prydz, ein alter Schulfreund von Sverre, ein Privatier und Investor, der für seine stark reaktionären Standpunkte bekannt war.
»Und weil ihr nichts anderes als Islamisierung seht«, fuhr Ingeborg fort, »seht ihr auch nicht die wirklichen politischen Bedrohungen unserer Gesellschaft. Die autoritären Regime im Osten, in China und Russland.«
Ein blaues Einstecktuch ragte aus Prydz’ Brusttasche, wie immer passend zur Farbe seiner Weste. Er beugte sich näher zu ihr. »Wir sind in einer Liga mit den Russen. Wir sind Hochkulturen, im Gegensatz zu den Wüstenbarbaren. Die meisten im Westen haben kapituliert. Glauben Sie, die Leute in Ungarn und Russland lassen es zu, dass Muslime Schulkinder schikanieren, nur weil die Salami essen?«
»Salami«, erwiderte sie höhnisch, »Sie glauben, hier geht es um Wurst?«
»Das ist ein Symbol für etwas Größeres. Im Osten sind die Menschen stolz auf ihr Land. Sie schämen sich ihrer Kultur nicht. Putin und Orbán sind nicht unsere Feinde. Putin ist die einzige Hoffnung des Westens.«
Prydz drehte sich zu Sverre um. »Aber seht her! Hier ist ein Mann, der tatsächlich für sein Vaterland gegen die Islamisten gekämpft hat. Was sagst du, Sverre Falck?«
Früher, vor seinem Einsatz in Afghanistan, hatte Sverre meist zu Prydz’ Ansichten genickt. Auch er hatte der naiven und fehlgeschlagenen Integrationspolitik des Westens höchst kritisch gegenübergestanden. Aber etwas war passiert.
»Niemand verteidigt das Vaterland, du verteidigst deinen Kameraden. Das wüsstest du, wenn du bei der Musterung diensttauglich gewesen wärst, Prydz«, sagte er jetzt. »Mein Eindruck ist auch, dass der Islamismus auf dem Rückzug ist.«
»Genau!«, rief Ingeborg Johnsen aus und sah ihn interessiert an. »Wenn die Historiker der Zukunft sich einst mit unserer Gegenwart beschäftigen, werden sie davon fasziniert sein, dass die reichste und technologisch fortschrittlichste Zivilisation aller Zeiten sich anno 2015 von einer Bande lumpiger Wüstenextremisten hat einschüchtern lassen.«
Prydz und seine kleine Schar schlichen davon.
»Ihre reaktionären Kumpel verkrümeln sich?«, lächelte Ingeborg, als sie allein in der Menge zurückblieben.
»Prydz meint es nicht böse.«
»Nein, wie so viele Leute am rechten Rand ist er so manisch besessen vom Islam, dass er nicht sieht, wen er sich ins Bett holt. Putin ist ein größenwahnsinniger Faschist. Wenn seine imperialen Ambitionen auf der Krim nicht gestoppt werden, sind wir übel dran.«
Sie musterte seine Uniform. »Tapferkeitsmedaille mit Rosette«, sagte sie kopfnickend.
»Ich hatte keine Zeit, mich umzuziehen«, schwindelte er.
»Geben Sie zu, dass Sie die Uniform angezogen haben, um den Militärfreunden zu imponieren«, neckte sie ihn.
Nun, er hatte in erster Linie die jungen Mädchen aus den Denkfabriken im Sinn gehabt, als er seine Paradeuniform anzog. Aber nicht erwartet, dass sich jemand mit den Details auskannte.
Wieder diese Unbekümmertheit, dieses Selbstvertrauen. Die meisten Menschen brachten sich nicht wirklich ein, wenn sie andere trafen, sie waren in sich selbst gefangen oder benutzten andere als Mittel für irgendeinen Zweck. Sverre Falck vor Afghanistan zum Beispiel. Deshalb sind wir so froh, wenn wir jemandem begegnen, der offen und authentisch ist, der es schafft, uns in wenigen Augenblicken das Spektrum zu zeigen, das uns zu Menschen macht. Ingeborg war so jemand.
»Sind Sie zum ersten Mal auf Rederhaugen?«, fragte er und reichte ihr ein Glas.
»Als Erwachsene, ja. Meine Mutter kannte Olav. Als Kind war ich schon mal hier.«
Natürlich kannte sein Vater die mysteriösen Johnson-Frauen, deren Tentakel reichten vielleicht noch weiter in die norwegische Gesellschaftselite hinein als seine eigenen.
»Lust auf einen Rundgang durchs Haus?«
Sie antwortete mit einem Lächeln. Während er sie durch die Räume und hinunter in die Bibliothek führte, dachte er, wie wenig sie seinem bevorzugten Frauentyp entsprach. Ihr Haar war goldblond, wie reifer Roggen, und sie trug eine grellrote Jacke über einer weißen Bluse.
Die Lampen in der Bibliothek gingen an, eine nach der anderen. Die Stille hier unten fühlte sich nach dem Lärm noch intensiver an.
»Schön hier«, sagte Ingeborg.
Ihr Blick wanderte über die Regale, bevor sie sich zu ihm umdrehte.
»Was machen Sie beruflich?«, fragte Sverre.
Mit einer Stimme, die nicht gerade vor Enthusiasmus sprudelte, antwortete sie, sie sei Stipendiatin am NUPI.
Er lächelte schief. »Komisch, habe ich nicht Artikel von Ihnen in der Presse gelesen?«
»Vorher war ich Journalistin. Momo sagt immer, dass Menschen, die den Journalismus rechtzeitig an den Nagel hängen, alles im Leben erreichen können.«
»Okay«, sagte Sverre, »Traineeprogramm des Außenministeriums?«
Ingeborg lachte kopfschüttelnd. »Ganz schön unverschämt. Sagt Ihnen Pamela Harriman etwas?«
Er schüttelte den Kopf.
»Ich kenne sie auch nur, weil Dick Holbrooke sie die beste US-Botschafterin des 20. Jahrhunderts nannte. Nach unserem Gespräch habe ich sie gegoogelt, und da las ich, dass Harriman als die größte Verführerin des 20. Jahrhunderts galt, mit einer endlosen Reihe von reichen und berühmten Männern. Sie war bekannt dafür, extrem gründliche Vorarbeit zu leisten. Wenn sie es auf einen Mann abgesehen hatte, wusste sie genau, was er sich wünschte. Und all diese Eigenschaften nutzte sie, als sie Botschafterin wurde. Denken Sie mal darüber nach, Sverre Falck. Die Diplomatin jener Zeit war Gesellschaftsdame und Mätresse. Da sage ich Nein, danke.«
Ihm gefiel der grimmige Spott über die Diplomatie, den man nur äußern konnte, wenn man das Selbstvertrauen besaß, weil man in diplomatischen Kreisen aufgewachsen war.
»Was willst du werden, wenn du groß bist, Sverre?«, fragte sie und strich mit dem schlanken Zeigefinger über die Buchrücken.
»Ich denke, ich werde den Deep State regieren«, sagte er und zuckte die Schultern.
»Klingt, als würdest du gerne Direktor der SAGA sein«, erwiderte sie lachend. »Ich dachte, der Posten sei besetzt?«
Sverre lächelte steif. »Und du?«
»Ich werde Premierministerin«, antwortete sie, als sei das eine ebensolche Selbstverständlichkeit wie die Tatsache, dass sie eines Tages das Familienanwesen erben würde.
»Der Empfang ist beendet, Frau Premierministerin«, sagte er und sah auf die Uhr. »Wann können wir die Verhandlungen über den geänderten Haushaltsentwurf fortsetzen?«
Sie lachte. »Du scheinst ziemlich lustig zu sein, König Sverre. Wer sagt, dass wir schon auseinandergehen müssen?«
Kapitel 5Ich hätte den Job machen können
Es war schon nach zehn, als Sasha das Pförtnerhaus betrat. Alles war still, nur aus dem Zimmer der Mädchen waren leise Stimmen zu hören.
»Mads?«, rief sie vorsichtig.
»Du kommst spät«, sagte ihr Mann und gab ihr einen Kuss.
Sie sagte nichts, sondern schmiegte sich an seinen schlanken, sehnigen Oberkörper. Obwohl sie manchmal Witze über seine Midlife-Crisis machte, über all die Stunden, die fürs Training draufgingen, war sie dankbar, dass er kein Mann war, der körperlich abbaute.
»Es war ein sehr langer Tag«, sagte sie, und ihre Stimme verschwand in seinem Pullover.
Der Empfang war ohne große Skandale verlaufen. Siri Greve hatte angemerkt, dass seit Olavs letzten Veranstaltungen das Durchschnittsalter um mindestens zehn Jahre gesunken sei. Das Kompliment freute sie. Die Gäste waren auch internationaler geworden, aber nach der Nachricht über einen Maulwurf in der SAGA hatte Sasha sich gefragt, ob es wirklich klug war, diese ausländischen Diplomaten überall herumstreifen zu lassen.
Der zweite Sekretär des russischen Konsulats in Barentsburg und der dortige Bergbaudirektor waren beide auf dem Empfang gewesen.
Sasha goss sich ein Glas Rotwein ein.
Mads sah sie forschend an. »Gibt’s was Neues von Hans?«
»Großer Gott, nein, nicht, dass ich wüsste.«
Sie checkte noch einmal ihr Handy. In der letzten Nachricht von Marte hieß es, sie seien jetzt vor Ort und lösten sich bei der Wache an Hans’ Bett ab. Die Familie bedanke sich für die Anteilnahme.
Sie drehte den Stiel des Glases zwischen den Fingern. »Sein Zustand ist weiterhin kritisch.«
»Dich plagt etwas anderes, Sasha.«
Sie seufzte. Am liebsten würde sie ihn in das Geheimnis über den SAGA-Informanten einweihen. Er hätte bestimmt etwas Vernünftiges zu der Sache zu sagen. MM hatte zwar gesagt, dies sei als streng geheim zu behandeln, aber galt ihre Loyalität eher dem norwegischen Nagetier als ihrem Ehemann?
Natürlich nicht, doch darüber zu sprechen war gegen das Gesetz.
Sie zündete sich eine Zigarette an und setzte sich ans offene Fenster.
»Es zieht«, sagte er. Sasha wusste, dass er ihr die Feierabendzigarette abgewöhnen wollte, also reagierte sie nicht darauf, blieb auf der Fensterbank sitzen und dachte an Hans. Swipte auf dem Handy durch eine Onlinezeitung. Da stand nichts, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis Schlagzeilen wie »Promi-Arzt kämpft mit dem Tod« auftauchen würden.
Konnte Hans die Wahrheit über Veras Testament kennen? Nein, das konnte er nicht. Was hätte es zu bedeuten, wenn er stürbe? Offensichtlich würde es mehrere Probleme lösen. Aber Sasha merkte, dass es ihr ein schlechtes Gewissen machte, so zu denken.
Andererseits war es keine unwahrscheinliche Hypothese, dass Hans selbst dieser Maulwurf war, von dem MM gesprochen hatte. Kaum ein Norweger hatte sich mit so vielen zweifelhaften Typen eingelassen wie er. Als Linker hatte Hans Zeit mit so unterschiedlichen Leuten verbracht wie militanten Gruppen im Nahen Osten und den Bewohnern exponierter norwegischer Orte wie Svalbard und Kirkenes, wo der Kontakt mit den Russen besonders eng war.
Er könnte der Spitzel der Russen gewesen sein, und das seit Generationen.
Aber das traf auch auf andere zu. Sverre hatte schon gezeigt, dass er der Familie in den Rücken fallen konnte, als er sich im vergangenen Jahr auf die Seite der Bergenser gestellt hatte. Sein verdeckter Narzissmus und verletzlicher Stolz waren wohl genau die Art von Persönlichkeit, nach der ein Talentsucher eines ausländischen Geheimdienstes Ausschau halten würde, wenn er Verräter anwerben wollte. Er war zwar in Afghanistan gewesen, aber wer weiß, was er dort getrieben hatte. Andrea wiederum war zwar noch jung, aber auch sie war im Grunde nicht loyal.
Siri Greve, die Anwältin der Familie, konnte ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Sie hängte ihr Fähnchen nach dem Wind. »Greve kann froh sein, dass sie in jenen Apriltagen 1940 keine Rechtsanwältin war«, pflegte Olav zu sagen.
Aber was wollte eine fremde Macht mit SAGA? Eine Stiftung, deren erklärtes Ziel es war, die Geschichte ihres Heimatlandes zu erzählen, war natürlich für einen Nachrichtendienst interessant. Oder SAGAs geopolitische Dimension als Speerspitze norwegischer Interessen. Sie musste den PST fragen, das war deren Gebiet, nicht ihres.
Ihr Gedankengang wurde von einem Klopfen an der Haustür unterbrochen, und gleich darauf hörte sie die Stimme ihres Vaters im Flur. »Alexandra?«
Ihr Mann zog mit sanftem Lächeln die Augenbrauen hoch, stand auf und drückte ihr einen Kuss auf den Oberkopf. »Ich geh ins Bett.«
Olav kam ins Zimmer. Nach dem Empfang hatte er sich umgezogen und trug jetzt Fleecepullover und Cordhose, sein bevorzugtes Outfit. Er blickte sich neugierig um. Sasha bot ihrem Vater ein Glas Wein an, das er annahm. Er setzte sich ans Ende des Esstisches, in Gedanken vertieft.
»Du wächst in die Rolle hinein«, sagte er.
Sie nickte und murmelte Danke. Ihr Vater hatte offenbar etwas auf dem Herzen.
»Hans«, fuhr er fort, »der Kriege überlebt hat, Putsche und