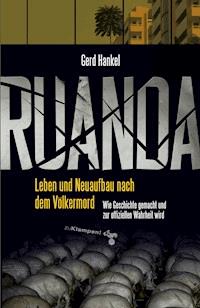31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hamburger Edition HIS
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Kann es internationale Gerechtigkeit geben? Wer bestimmt, was Unrecht ist? Seit der Neuzeit gibt es Versuche, auf Unrecht zu reagieren, das weit entfernt stattfindet und doch vor der eigenen Haustür Folgen zeitigt. Diplomatie, Interventionen mit oder ohne Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, Entscheidungen und Urteile nationaler und internationaler (Straf-)Gerichtshöfe stellen Bemühungen dar, Unrecht »von internationalem Belang« zu bekämpfen. Die politischen und öffentlichen Erwartungen sind groß. Da es auf internationaler Ebene kein Gewaltmonopol gibt, hängt die Durchsetzungskraft internationaler Gerichtsbarkeit vom Willen der Staaten ab. Konventionen machen Menschenrechte verbindlich, humanitäres Völkerrecht regelt das in bewaffneten Konflikten zu beachtende Recht. Mit dem wachsenden Schutz des Individuums erhöhte sich auch die Zahl der Mechanismen, die Pflichtverletzungen von Staaten verhindern und sanktionieren sollen. Und doch gibt es Widersprüchlichkeiten und Relativierungen, die angesichts des fernen Unrechts und Leids unerträglich scheinen. Gerd Hankels Buch zeigt, wie lang der Weg ist, um zum Ideal eines Weltgewissens zu gelangen und es so auszustatten, dass es sich regt. Vieles ist bereits errungen, doch weil Gerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit oft nahe beieinanderliegen, steht das Erreichte auf tönernen Füßen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Ähnliche
Gerd Hankel
Fernes Unrecht Fremdes Leid
Von der Durchsetzbarkeit internationalen Rechts
Hamburger Edition
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Verlag des Hamburger Instituts für SozialforschungMittelweg 36
20148 Hamburg
www.hamburger-edition.de
© der E-Book-Ausgabe 2024 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-432-9
© der deutschen Ausgabe 2024 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-395-7
Umschlaggestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
Inhalt
Abkürzungen
Einleitung
I Der »internationale Belang« und das »Gewissen der Menschheit«
Was »fernes Unrecht« ausmacht. Moralische Überzeugungen verdichten sich zu Recht
Wann »fernes Unrecht« zu uns spricht. Voraussetzungen eines moralisch begründeten Rechtsempfindens
Was einen zivilisatorischen Versuch ausmacht und von einem zivilisatorischen Fortschritt unterscheidet
II Reaktionsformen auf »fernes Unrecht«. Zwischen diplomatischen Sanktionen, Indifferenz und Opportunismus, militärischen Interventionen und Straftribunalen
Diplomatische Sanktionen, Indifferenz und Opportunismus
Militärische Interventionen als vermeintliche Lösungen
Straftribunale: Eine Vision wird Wirklichkeit
Was als Zwischenbilanz gesagt werden kann
III Über die Bedeutung von Sprache, Wörtern und Begriffen bei der Erfassung von Unrecht und einige Folgerungen daraus, die für Rechtsprechung und Lehre zu beachten wären
IV Die Notwendigkeit glaubhafter Antworten und ihre Kriterien
Die Objektivität des Gerichts
Die tatsächliche Völkerrechtsfreundlichkeit beteiligter Staaten
Der historische Kontext in Verfahren mit Völkerstrafrechtsbezug
Die beschleunigte Durchführung der Verfahren
Die Wahrung der Rechte von Angeklagten und Opfern
Abschließende Bemerkungen
V Welche Perspektiven es gibt, wann mit dem Eintritt welcher Perspektive zu rechnen ist und welche Folgerungen daraus zu ziehen sind
Die beiden gegensätzlichen Pole
Zwischenlösungen und ihre Wahrscheinlichkeit
Neue Anforderungen an Legitimation und Legalität
VI Schluss
Literatur
Zum Autor
Abkürzungen
AI Amnesty International
AJLS African Journal of Legal Studies
ASEAN Association of South East Asian Nations
AU Afrikanische Union
BGBl. Bundesgesetzblatt
BIP Bruttoinlandsprodukt
bpb Bundeszentrale für politische Bildung
DW Deutsche Welle
ECCC Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
EJIL European Journal of International Law
EMRK Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
EU Europäische Union
FDLR Forces de Libération du Rwanda
HRW Human Rights Watch
ICISS International Commission on Intervention and State Sovereignty
IGH Internationaler Gerichtshof
IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz
ILC International Law Commission
IStGH Internationaler Strafgerichtshof
JStGH Jugoslawien-Strafgerichtshof
NGO Non-Governmental Organization (Nichtregierungsorganisation / NRO)
OLG Oberlandesgericht
RDF Rwanda Defense Force
RPF Rwandan Patriotic Front (Ruandische Patriotische Front)
R2P Responsibility to Protect
RGBl. Reichsgesetzblatt
RStGH Ruanda-Strafgerichtshof
SR Sicherheitsrat
StGB Strafgesetzbuch
StPO Strafprozessordnung
UN United Nations
VStGB Völkerstrafgesetzbuch
ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
Einleitung
Die Szene ist bekannt: Goethes Faust, der Tragödie erster Teil. Es ist Ostern. Menschen gehen spazieren, außerhalb der Stadt und in einer Landschaft, die Lebensfreude weckt. Einer von ihnen, ein »Bürger«, sagt:
»Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen,
Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei,
Wenn hinten, weit, in der Türkei,
Die Völker aufeinanderschlagen,
Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus
Und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten;
Dann kehrt man abends froh nach Haus,
Und segnet Fried und Friedenszeiten.«
Ein anderer »Bürger« pflichtet bei:
»Herr Nachbar, ja! so lass ich’s auch geschehn:
Sie mögen sich die Köpfe spalten,
Mag alles durcheinander gehn;
Doch nur zu Hause bleib’s beim alten.«1
Ein wohliger Schauder erfasst beide »Bürger«, wenn sie an das kriegerische Geschehen in der Ferne denken. Von einem Erschrecken, dass dort himmelschreiendes Unrecht begangen wird, keine Spur. Mit Hochgefühl genießen sie den Kontrast ihrer sonn- oder feiertäglichen Behaglichkeit zur weit entfernten Gewalt. Für den Bettler, der sich kurz zuvor noch an sie gewendet hat (»Beliebt es euch, mich anzuschauen, / Und seht und mildert meine Not!«),2 haben sie keinen Blick. Sie sind ganz Teil ihrer bürgerlichen Welt, in der Kämpfe und Kriege in der Türkei für die gehobene Stimmung zu Hause sorgen und zugleich den Wunsch nach Kontinuität in der eigenen friedlichen und geschützten Existenz befördern.
Als »delightful horror« bezeichnete im 18. Jahrhundert Edmund Burke das Phänomen, das Schmerz und Schrecken bei denen auslöst, die ein sicheres Leben leben und aus der Entfernung auf etwas schauen, das in großem Gegensatz zur eigenen Lebenssituation steht.3 Naturkatastrophen oder eben menschengemachte Katastrophen wie Krieg oder Unglücksfälle, wenn nur weit genug entfernt, bewegen das Gemüt, weil sie aus der Perspektive des Betrachters einen überaus angenehmen (»Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen […]«) Kontrast zu einem Leben, das seinen ruhigen Bahnen folgt, bilden. Fremdes Leid als Stimulans.
Wie anders klingen da die Worte, die nach dem 24. Februar 2022 und dem 7. Oktober 2023 zu hören waren. Von ungläubigem Staunen bis hin zur Bestürzung über den eklatanten Völkerrechtsbruch reichten die Reaktionen, als die russische Armee auf Befehl Wladimir Putins die Ukraine überfiel. Blankes Entsetzen dann, als die Hamas Israel angriff, gefolgt von heftiger, anklagender Kritik an der israelischen Kriegführung im Gazastreifen.
Anders klangen bereits die Worte, die UN-Generalsekretär Ban Ki-moon im September 2016, wenige Monate vor dem Ende seiner Amtszeit, an die Adresse der kriegstreibenden Kräfte in Syrien richtete, wo seit 2011 der bis dahin auf sinistre Weise bekannteste Krieg geführt wurde. Er warf ihnen vor, »Blut an den Händen« zu haben. Von einflussreichen Mächten im Hintergrund werde die Kriegsmaschinerie geölt, den Preis zahle die Zivilbevölkerung, verraten von einer Regierung, der kein Preis zu hoch sei für den Machterhalt.4 Die große Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten teilte diese Ansicht. Wenig später verabschiedete die UN-Generalversammlung eine Resolution, in der sie die Schaffung einer internationalen, unparteiischen und unabhängigen Stelle beschloss, um die in Syrien seit 2011 begangenen Völkerrechtsverbrechen zu dokumentieren und deren strafrechtliche Ahndung zu ermöglichen. Alle Staaten, Konfliktparteien und Zivilgesellschaften wurden aufgefordert, mit dieser baldmöglichst einzurichtenden Stelle zusammenzuarbeiten.5 Inzwischen ist sie eingerichtet worden und sammelt Beweise. Kaum noch zu zählen sind die Stellen, die, künftige Strafverfahren im Blick, Beweise für Kriegsverbrechen in der Ukraine sammeln. Ebenfalls zahlreich sind die Staaten und NGOs, die Beweise für Völkerrechtsverbrechen in Israel und im Gazastreifen suchen. Fremdes Leid als Appell.
Natürlich sollte man sich davor hüten, die Botschaft, die aus dieser Form der Intervention spricht, zu entschieden ins Positive zu wenden. Bereits Ban Ki-moon stieß auf Widerspruch. Der nachdrücklichste kam vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, der nach der Eroberung Aleppos im Dezember 2016, die eine Ruinenstadt hinterließ, bemerkte: »Das war die größte, ich will das betonen, damit es alle hören, das war die größte humanitäre internationale Rettungsaktion der Neuzeit.«6 Und auch bei der Verabschiedung der UN-Resolution, obwohl mit großer Mehrheit erfolgt, gab es Enthaltungen und Gegenstimmen, insgesamt 67. Beides gab es auch bei den Resolutionen, die den russischen Angriffskrieg und dessen Folgen zum Inhalt hatten. Von breiter Zustimmung ausgehend mehrte sich die Zahl der Enthaltungen und Gegenstimmen, je konkreter die angedrohten Rechtsfolgen wurden. Als die Russische Föderation zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet werden sollte, stimmten am 14. November 2022 nur noch 94 Staaten zu (von 193), 73 enthielten sich, 14 stimmten dagegen, 12 Staatenvertreter waren gar nicht zur Abstimmung erschienen.7 Völlig uneinheitlich ist das Bild, wenn über den Angriff vom 7. Oktober 2023 und den Krieg im Gazastreifen abgestimmt wird. Mit klaren Worten wird Israels Recht auf Selbstverteidigung bestätigt, die Taten der Hamas werden beiläufig oder gar nicht erwähnt, und auch Israels augenscheinliche Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht werden hinter diplomatischen Formulierungen zum Verschwinden gebracht. Wenden wir uns dann noch der unpersönlichen internationalen Ebene und ihren weiteren Abstufungen zu und hin zu den Menschen und ihren Meinungsbildern, ist mit großer Gewissheit anzunehmen, dass in allen Weltgegenden die den zwei »Bürgern« vergleichbare Einstellung anzutreffen ist, also fremdes Leid auf Gleichgültigkeit oder Abwehr stößt und das Gefühl eigenen Wohlergehens allem anderen vorangestellt wird.
Trotzdem ist heute etwas Grundlegendes anders als zu Goethes Zeiten: Heute gibt es eine Verrechtlichung internationaler Beziehungen, und es existieren vor allem Institutionen, zu deren Aufgaben die Wahrung des Friedens und der internationalen Sicherheit gehört. Die UNO und ihre Unterorganisationen wären hier zunächst zu nennen, gefolgt von den verschiedenen internationalen Gerichtshöfen, Strafgerichtshöfen und den nationalen Gerichten, die ihre Zuständigkeit zur Ahndung von Völkerrechtsverbrechen aus dem Universalitätsprinzip (oder Weltrechtsprinzip) beziehen. Unrecht, in großem Maßstab und / oder mit staatlicher Beteiligung begangen, soll nicht mehr länger Schicksal, unvermeidbarer Teil des Weltgeschehens sein, sondern ein Übel, das den Namen Verbrechen trägt und wie im innerstaatlichen Bereich die Bestrafung des Täters nach sich zieht. Der einzelne Mensch, der Opfer dieses Verbrechens wird, soll nicht länger der machtgestützten Willkür ausgeliefert bleiben, die internationale Gemeinschaft sieht es vielmehr als ihre Aufgabe, sich seiner anzunehmen, sie solidarisiert sich gewissermaßen mit ihm und versucht über ihr politisches und justizielles Eingreifen außerdem, weitere Opfer zu verhindern. Begründet wird das Engagement der internationalen Gemeinschaft damit, dass verbrecherisches Geschehen schlimmsten Ausmaßes die Gemeinschaft »als Ganzes« betreffe, mithin von »internationalem Belang« sei und »das Gewissen der Menschheit«8 daher fordere, dass diese nicht gleichgültig bleiben dürfe. Mit anderen Worten, der Appell soll wahrgenommen werden und zur Handlung drängen.
Ist das immer noch zu positiv beschrieben? Soll hier eine zutiefst widersprüchliche Realität aus dem Wunsch heraus weichgezeichnet werden, einen zivilisatorischen Fortschritt erkennen zu können? Ist es dann nicht vermessen und sogar gefährlich, weitverbreitete Betroffenheit über Unrecht in eine Gewissensfrage für die Menschheit münden zu lassen, die nur durch energisches Handeln adäquat beantwortet werden kann? Argumente dieser Art, die Skepsis rechtfertigen sollen, sind gewöhnlich, wenn eine realistische Sichtweise eingefordert wird, leicht zu finden, was ihnen jedoch nichts von ihrem Gewicht nimmt. Diejenigen, die sie anführen, verweisen auf: den Syrienkrieg und die sich in seinem Verlauf manifestierende internationale Unfähigkeit, den Krieg und damit die von allen Seiten des Konflikts betriebene verbrecherische Eskalation zu beenden; den Krieg in der Ukraine, der die überholt geglaubte Verachtung für das Völkerrecht wieder auf die Tagesordnung der internationalen Politik gesetzt hat; den Angriff auf Israel und den anschließenden Krieg im Gazastreifen, die das Völkerstrafrecht zum Spielball politischer Interessen zu machen drohen und internationale Gegensätzlichkeit verstärken; das Gewicht ökonomischer Zwänge, das Politik im Kollisionsfall zum Erfüllungsgehilfen macht; den, gerne mit dem Hinweis auf den »Gesprächsfaden, der nicht abreißen dürfe«, oder »die Politikfähigkeit, die erhalten bleiben müsse«, verbrämten Opportunismus liberaler Staaten gegenüber notorischen Menschenrechtsverletzern, mit dem Erstere gegen eigene, vertraglich bekräftigte Prinzipien verstoßen; die Unwilligkeit von immer noch gut einem Drittel der 193 Staaten der Erde, unter ihnen Großmächte wie China, Russland oder die USA, sich dem Projekt einer ständigen internationalen Strafgerichtsbarkeit anzuschließen; die wachsende Unzufriedenheit kleinerer und schwächerer Staaten mit der Tätigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs, die darin ein in erster Linie gegen sie gerichtetes Instrument sehen.
Aber auch Argumente gegen eine Relativierung des inzwischen erreichten internationalen Standards von Betroffenheit und darauf gründender internationaler Intervention sind leicht zu finden: Die relative Kürze der Zeit, in der der aktuelle Standard erreicht worden ist, lässt eine Dynamik erkennen, die einen Sog entfaltet hat und sich dadurch weiter belebte. Immerhin haben vom Juli 1998 an ca. zwei Drittel der Staaten (124, Stand April 2024) den Gedanken einer auch für sie zuständigen internationalen Strafgerichtsbarkeit akzeptiert. Ein Internationaler Strafgerichtshof (IStGH) existiert, er ist aktiv und zu einem Bezugspunkt in der internationalen Politik geworden. Viele der Völkerrechtsverbrechen, die seine materielle, gegen Einzelpersonen gerichtete Strafkompetenz ausmachen, sind in multilateralen Verträgen enthalten. Diese Verträge gelten darüber hinaus auch in weiten Teilen gewohnheitsrechtlich und beinhalten sogar zwingendes, von allen Staaten zu beachtendes Recht. Darauf hat in mehreren Entscheidungen der für Staaten zuständige Internationale Gerichtshof (IGH) hingewiesen.
Doch nicht nur nationale und internationale (Straf)Gerichte äußern sich, auch die Staaten selbst haben verschiedene Verfahren geschaffen, die diesem Recht in abgestimmter und handlungsorientierter Kommunikation untereinander zur Beachtung verhelfen sollen. So will die Schutzverantwortung (responsibility to protect) Staaten oder die Staatengemeinschaft in die Pflicht nehmen, um das Versinken eines Staates in Chaos und Gewalt zu verhindern. Das Weltrechtsprinzip ermächtigt Staaten, ein Völkerrechtsverbrechen unabhängig vom Tatort und der Staatsangehörigkeit von Tätern und Opfern zu ahnden. Schließlich zeigen noch die Einsetzung von Wahrheits- und Versöhnungskommissionen und ihre durchweg positive Reputation, dass massive Verbrechen von der internationalen Staatengemeinschaft und den hinter ihr stehenden Menschen nicht reaktionslos hingenommen werden.
Wie also ist das Bild, das sich uns beim Umgang mit Unrecht bietet? Hell und strahlend ist es sicher nicht, zumal sich Wichtiges wie die Schutzverantwortung noch im sehr unsicheren Stadium der Absicht und auf ebenso unsicherem (normativem) Boden befindet. Aber dunkel und baldiges definitives Scheitern verkündend ist das Bild auch nicht. Es ist widersprüchlich, sehr sogar, und in dieser großen Widersprüchlichkeit ist offen, in welche Richtung die weitere Entwicklung verlaufen wird. Der Optimismus, der die Welt Anfang der 1990er Jahre erfasst hatte, ist verflogen. Eine neue Weltordnung, getragen von den Prinzipien und Vertragswerken des Völkerrechts, hat es nicht gegeben. Statt zusammenzuwachsen, driften die Staaten auseinander, seit dem 24. Februar 2022 und dem 7. Oktober 2023 mit größer werdender Geschwindigkeit. Machtpolitischer Egoismus und ein möglichst uneingeschränktes Verständnis staatlicher Souveränität sind allem Anschein nach das Gebot der Stunde, Gemeinschaftswerte stehen im Verdacht des Missbrauchs. Die Globalisierung, die die Staaten der Welt einander näher brachte, beschränkte sich augenscheinlich auf den ökonomischen Sektor, jedenfalls führte sie nicht zu einer nachhaltigen Annäherung zwischen den Staaten oder zu einer Stärkung des Rechts. Die Millenniumserklärung der Staats- und Regierungschefs aus dem Jahr 2005, in der diese einleitend versichern: »Wir bekräftigen unseren Glauben an die Vereinten Nationen und unser Bekenntnis zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts, die unverzichtbare Grundlagen einer friedlicheren, wohlhabenderen und gerechteren Welt sind, und bekunden erneut unsere Entschlossenheit, ihre strikte Achtung zu fördern«, wirkt heute wie eine traurige Reminiszenz an eine lang vergangene Zeit, von der darin ebenfalls angekündigten Schaffung einer demokratischeren Welt durch »Entwicklung, Frieden und kollektive Sicherheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit und Stärkung der Vereinten Nationen«9 ganz zu schweigen. Aber selbst wenn in Rechnung gestellt wird, dass die Formulierung des Ergebnisdokuments der Feierlichkeit des Augenblicks (Gründung der UNO vor sechzig Jahren) geschuldet war, ein Ausweis naiv-politischer Träumerei war und ist das Dokument gleichwohl nicht. Man wollte, was man damals sagte, und hielt es für erreichbar, in kleinen Schritten und wechselseitiger Kooperation. Allerdings dürften Vorverständnis und Erwartungen stark differiert haben. Es kann als ausgeschlossen gelten, dass ein ähnliches Dokument im aktuell vorherrschenden Klima des multipolaren Misstrauens und offener Aggression verabschiedet werden würde.
Was bedeutet das für die Zukunft? Wären wir gerade Zeugen einer Zeitenwende, müsste die Prognose auf einen fortdauernden Zustand des nationalen Egoismus und gewaltgeneigter Machtpolitik verweisen.10 Aber ob wir solche Zeugen sind, ist trotz klarer Indikatoren nicht einfach zu sagen. Unübersehbar ist, dass wir einen Rückfall in die Zeit erleben, in der das Völkerrecht, die UNO und ihre Charta lediglich einen dehnbaren Rahmen bildeten. Wie lange der Rückfall anhalten wird? Das ist schwer abzuschätzen. Denn immer gibt es auch Chancen, durch einen kleinen Anstoß den Lauf des Geschehens zu verändern. Und diese Chancen sind nicht kontingenter Art. Es sind vielmehr solche, die sich aus der Alternative ergeben, trotz wenig ermutigender Zeitläufte die andere, ursprünglich Zuversicht begründende Entwicklung stärker zu machen. Nicht in Form eines Plädoyers für eine bloße Fortsetzung dieser Entwicklung, sondern in einer konstruktiv-kritischen Sichtung dessen, was in besonderer Weise für eine Hoffnung begründende Phase im ausgehenden 20. Jahrhundert stand. Als 1998 in Rom das Statut für einen ständigen internationalen Strafgerichtshof angenommen wurde (120 Delegierte stimmten dafür, 7 dagegen, 21 enthielten sich), »[fielen] die sonst so kühlen Konferenzdiplomaten […] in Euphorie und umarmten einander«, viele römische Bürgerinnen und Bürger liefen auf dem Rathausmarkt zusammen, »um bei der Schlußzeremonie der gelungenen Konferenz zu applaudieren«.11 Als Zeichen eines weltweiten Umdenkens apostrophiert, hielt die selbst kühne Optimisten überraschende Zustimmung zum geplanten Weltstrafgerichtshof an. Bereits im Frühjahr 2002 war die erforderliche Zahl von 60 Ratifikationen überschritten, der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) konnte seine Arbeit aufnehmen.
Es war absehbar, dass diese Arbeit nicht leicht werden würde. Der Weg von einem komplexen Sachverhalt zu einem Urteil ohnehin nicht, daneben aber auch die Auseinandersetzung mit Staaten, die dem Vorhaben einer internationalen Strafgerichtsbarkeit ablehnend bis feindselig gegenüberstanden. Kurz bevor der IStGH Wirklichkeit wurde, hatten die USA die Unterzeichnung des Statuts von Rom rückgängig gemacht.12 Von einer »utopischen Dummheit« der Europäer war die Rede. Staaten, die mit dem Gerichtshof kooperieren wollten, wurden Sanktionen angedroht, und nicht ohne Häme wurde darauf verwiesen, dass zwei Drittel der Menschheit dem Gerichtshof gewiss fernbleiben würden.13 In der Tat sollten sich in den kommenden Jahren auch China, Indien und Russland nicht dem Gerichtshof anschließen.
Ernüchterung ist auch bei denen eingekehrt, die sich zu den Befürwortern der Idee von einer internationalen Strafgerichtsbarkeit zählen. Oder sagen wir besser, ein Realitätssinn hat sich eingestellt, der nicht länger den Weg für das Ziel nimmt und den moralischen Impetus, der das Unternehmen begleitet, vor selbstreferenziellen Entgleisungen bewahrt. Ein Anfang ist gemacht, mehr nicht, und dieser Anfang ist zudem zerbrechlich. Manchmal wird sogar von einem absehbaren Ende des IStGH geunkt. Freisprüche gegen jede Evidenz und Erwartung – und darum umso spektakulärer – würfen unweigerlich Fragen nach der Qualität der Gerichtsarbeit und der Abhängigkeit des Gerichts von der politischen Agenda einflussreicher Staaten auf.14 Und die angestrebten Anklagen von Wladimir Putin und vielen anderen möglichen Tätern im Ukrainekrieg schüfen große Erwartungen, deren Erfüllbarkeit noch in den Sternen stünde.15 Die israelische Justiz wird die Straftaten der Hamas aburteilen. Ob es darüber hinaus Strafverfahren vor dem IStGH oder anderen Gerichten wegen Völkerrechtsverbrechen der Hamas oder Israels geben wird, ist nach derzeitigem Stand (Mai 2024) ebenfalls alles andere als ausgemacht. Selbst bei einer Anklage wird der Gegenwind sehr stark sein.
Als Autor der vorliegenden Untersuchung bin ich, darauf weise ich gerne noch einmal hin,16 von dem Gedanken der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit einer internationalen Strafgerichtsbarkeit überzeugt. Eine jahrelange Tätigkeit in Ost- und Zentralafrika, namentlich in Ruanda, Burundi und der Demokratischen Republik Kongo, und viele Besuche in anderen Regionen der Welt, in denen massive Gewalt seit Jahren zu Hause war und ist, hat mich immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen eine international hergestellte Gerechtigkeit als letzte Hoffnung erschien. Lange war diese Hoffnung ein aus Verzweiflung geborenes Synonym für Resignation, heute ist sie Ausdruck einer Möglichkeit, die Wirklichkeit werden kann. Das ist eben der Unterschied: Wenn Verbrechen, systematisch und in großer Intensität begangen, nicht unter dem Schutzschild staatlicher Souveränität zum Verschwinden gebracht werden und sich auch nicht im internationalen Beziehungsgeflecht auflösen, sondern vor den Augen nationaler und internationaler Öffentlichkeiten verhandelt werden können, dann ist das eine gänzlich andere Sachlage. Und diese Sachlage ist im Ergebnis das, was, kurz gesagt, als ein zivilisatorischer Fortschritt zu bezeichnen ist. Regeln, zum Wohle der Menschheit formuliert, kommen zur Anwendung, nicht grenzenlose Macht und Willkür.
Allerdings hat der Zukunftsoptimismus auch seine Tücken. Die größte und bereits angesprochene besteht derzeit darin, dass die Gegenkräfte sehr stark sind. In ihnen fließen diverse Interessen zusammen, die grundsätzlich eine übergeordnete justizielle Strafinstanz ablehnen. Hinzu kommen widersprüchliches Verhalten oder schlichtweg Fehler seitens ihrer Befürworter, die die Gegenseite argumentativ stärker machen. Zuletzt gibt es noch offene Fragen, die auf den Kern des gesamten Vorhabens zielen. Was bedeutet zivilisatorischer Fortschritt überhaupt? Wer definiert ihn und mit welchem Verständnis oder Vorverständnis? Wie muss das zu ahnende Unrecht sein, damit es in den Fokus nationaler oder internationaler Strafjustiz gerät? Oder, genauer gefragt: Wann wird das Unrecht zu einem Unrecht, das die räumliche Distanz überspringt und das Gewissen der Menschheit berührt, also auch der Menschen, die weit entfernt vom Tatort leben? Welche Anforderungen sind an die jeweiligen Formen der Strafjustiz zu stellen, um zu verhindern, dass die Ahndung des Unrechts bestehende Gräben vertieft oder neue Gräben aufreißt? Ist es überhaupt sinnvoll und realistisch, derartige Anforderungen zu formulieren, oder ist es nicht vernünftiger, die Untiefen des Staatsunrechts vermeiden zu wollen? Damit zusammenhängend dann die weitere Überlegung nach der Art der Gerechtigkeit, die durch die Justiz gesucht werden soll. Das englische und französische »justice« hat eine weitere Semantik als das deutsche Wort »Gerechtigkeit«. Es kann auch das Recht bedeuten, das angewendet werden soll, sowie die Justiz als Instanz, deren vertrauenswürdige Existenz eingefordert wird. Wird es mit Gerechtigkeit gleichgesetzt, beinhaltet es wie im Deutschen auch einen Appell, eine tat- und schuldadäquate Strafe zu verhängen und nicht die Augen vor Taten zu verschließen, die von gleicher Art und Schwere, aber bislang ungeahndet geblieben sind. Unter welchen Umständen dürfen aber diese Taten ungeahndet bleiben? Wie steht es in diesem Fall um den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz und der Gleichbehandlung gleicher Taten? Inwiefern und mit welchen möglichen Folgen berührt ein selektives Vorgehen den Kernbestand des Völkerstrafrechts?
Fragen über Fragen und eine Problemdichte, die es vorderhand angeraten erscheinen lässt, den hier angesprochenen zivilisatorischen Fortschritt mit Zurückhaltung als einen solchen zu bezeichnen. Noch fehlen wichtige Elemente, um das Bild von einem zivilisatorischen Fortschritt zu vervollständigen. Und weil zudem trotz aller ermutigenden Voraussetzungen auch ein Scheitern nicht auszuschließen ist, wird deshalb im Folgenden von der Idee der internationalen Strafgerichtsbarkeit als einer noch im Stadium eines »zivilisatorischen Versuchs« befindlichen ausgegangen. Mitgedacht werden muss dabei selbstverständlich die bereits vorgestellte Annahme, dass »fernes Unrecht« und »fremdes Leid« zu nahem Unrecht und Leid geworden sind, dass die Haltung, schwere und systematisch begangene Verbrechen andernorts seien auf diesen nämlichen Ort beschränkt, keine Gültigkeit mehr hat. In den Worten der Appeals Chamber des Jugoslawien-Strafgerichtshofs (JStGH):
»Universally Condemned Offences are a matter of concern to the international community as a whole. There is a legitimate expectation that those accused of these crimes will be brought to justice swiftly. Accountability for these crimes is a necessary condition to the achievement of international justice, which plays a critical role in the reconciliation and rebuilding based on the rule of law of countries and societies torn apart by international and internecine conflicts.«17
Den weiteren Verlauf der Untersuchung geben die genannten Einwände, Bedenken und Fragen vor. Was mit den Wendungen von Verbrechen, die von »internationalem Belang« sind, mit solchen, die die Menschheit »als ganze« betreffen oder das »Gewissen der Menschheit« berühren, gemeint ist, soll im ersten Kapitel dargestellt werden. In Urteilen internationaler Gerichtshöfe und auch nationaler Gerichte, die nach dem Weltrechtsprinzip zuständig sind, sind diese Wendungen regelmäßig zu lesen, durchweg in einem Duktus, der das Behauptete als allgemein bekannt voraussetzt.
Bekannt sind Verweise auf das Gewissen der Menschheit oder die Menschheit selbst in der Tat, wenn auch nicht immer in derselben Terminologie. So werden in den Haager Konventionen von 1899 und 1907, den ersten umfassenden internationalen Regelungen über verbotene und gebotene Mittel und Methoden der Kriegführung, in den jeweiligen Präambeln die »Gesetze der Menschlichkeit« und die »Forderungen des öffentlichen Gewissens« zum Maßstab für die Bewertung rechtlich nicht erfasster Sachverhalte erklärt.18 Das Statut des Nürnberger Militärtribunals fasst die strafbaren Handlungen in Art. 6 (c) unter der Tatbezeichnung »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« (crimes against humanity) zusammen, was Hannah Arendt im Epilog ihres Buchs »Eichmann in Jerusalem« zu der spöttischen Bemerkung verleitete, es handle sich, da humanity im Deutschen mit »Menschlichkeit« und nicht mit »Menschheit« übersetzt und somit den Nazis lediglich ein Mangel an Menschlichkeit bescheinigt worden sei, um »das Understatement des Jahrhunderts«.19 In der Anklageschrift des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses spricht Robert Jackson mal von der »menschliche[n] Zivilisation«, mal von der »Vernunft der Menschheit«, die die Bestrafung der NS-Täter verlangten, da deren Taten »kein Heim in der Welt unberührt« gelassen habe.20 Und im Urteil des Militärgerichtshofs findet sich der Satz: »Kriegsgefangene wurden mißhandelt, gefoltert und ermordet, nicht nur unter Mißachtung der anerkannten Regeln des Völkerrechts, sondern unter vollständiger Außerachtlassung der elementarsten Vorschriften der Menschlichkeit.« Von den 24 Angeklagten verurteilte es sechzehn wegen der Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit.21 Aber welches Verständnis von Menschlichkeit oder Menschheit stand dahinter? Wie ließ es sich begründen? Mit welchen Folgen?
Die Vorstellung, dass in der Ferne Geschehenes in die Nähe rückt und es über den ersten Affekt einen Nachhall hervorruft, der präsent bleibt, setzt voraus, dass das Geschehene eine bestimmte Eigenschaft haben muss. Die Verletzung eines Normempfindens muss so massiv sein, dass sie Tausende von Kilometern überbrückt und zu einer Erfahrung der Nähe wird. Sie darf nicht kulturell begrenzt oder politisch unsichtbar zu machen sein, sondern sie ist und bleibt im Weltmaßstab vorhanden und fordert eine Reaktion. Diese Reaktion oder, genauer, der Zeitpunkt ihres Einsetzens und ihre Stärke, ist ein komplexer Vorgang, der von Faktoren wie der Verlässlichkeit von Informationen und der Bereitschaft, diese zur Kenntnis zu nehmen, beeinflusst wird. Das zweite Kapitel wird sich darum mit verschiedenen Reaktionsformen auf »fernes Unrecht« beschäftigen. Ob Indifferenz, Intervention (die militärische eingeschlossen) oder die Forderung nach strafrechtlicher Sanktion die Reaktion ist, immer liegen ihr Wertungen zugrunde, die aus der Wahrnehmungsintensität des fernen Unrechts hervorgehen. Das zeigen die zur Verdeutlichung gewählten Beispiele aus dem Gewaltgeschehen seit Beginn der 1990er Jahre. Diese Beispiele zeigen aber auch, wie Entscheidungen von vermeintlichen oder tatsächlichen Sachzwängen und von Opportunitätsgesichtspunkten beeinflusst werden, was wiederum zu der Überlegung führt, ob der »internationale Belang« nach derartigen Kriterien gewichtet werden darf. Ein Menschheitsverbrechen geschehen zu lassen, sei es aus Unwissenheit, Fahrlässigkeit oder mit Absicht, und es danach im Namen der Menschheit zu ahnden, schafft nicht nur ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die Gefahr besteht, das Versäumte oder Unterlassene mit Eifer korrigieren zu wollen. Der Vorwurf der Parteilichkeit, vor Eintritt des Geschehens von »internationalem Belang« vielleicht nur sporadisch und aus Kalkül geäußert, stünde dann manifest im Raum.
Formal wäre in diesem Fall das justizielle Handeln gleichwohl legal. Rechtsnormen würden angewendet und individuelle Schuld festgestellt werden. Allerdings wäre die möglichst große Anerkennung des Verfahrens damit keineswegs gegeben. Legitimität und (völker) strafrechtliches Handeln könnten zueinander in Widerspruch stehen. Was das bedeuten kann, soll im dritten Kapitel untersucht werden. In diesem Zusammenhang wird sich erweisen, dass zwischen Berichterstattung, öffentlicher Meinung und staatlichem Verhalten die Sprache als Transportmittel für Informationen von großer Bedeutung ist. Was wie ein Gemeinplatz klingt, zeigt sich in seiner ganzen problematischen Dimension, wenn das Verbrechen des Genozids das fragliche Unrecht ist. Oft als das »Verbrechen aller Verbrechen« bezeichnet, fordert es Eindeutigkeit, wo es nicht immer Eindeutigkeit gibt. Eine Variante dieser Eindeutigkeit ist die unbedingte politisch-moralische Zustimmung zu den Anliegen der Opfer und die ebenso unbedingte Verurteilung der Täter. Graubereiche zuzulassen fällt schwer, mit der Konsequenz, dass die versuchte Ahndung dieses Verbrechens sehr umstritten ist und eine Polarisierung zeitigt, wie sie bei der justiziellen Aufarbeitung von Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht festzustellen ist.
Im vierten Kapitel fließen die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse ein in die Aufstellung von sechs Kriterien, die Bedingung dafür sind, dass die Ahndung fernen Unrechts zu einem glaubhaften Unternehmen werden kann. Ein Versuch wird nur dann ein zivilisatorischer Fortschritt sein, wenn er, erstens, von dem Streben nach Objektivität geprägt ist, wenn er, zweitens, den historischen Hintergründen einen angemessenen Stellenwert zuweist, drittens muss er Ausdruck eines widerspruchsfreien Handelns der hinter dem Gericht stehenden Staaten sein, viertens soll eine überlange Verfahrensdauer vermieden werden, und fünftens sowie sechstens sind die Rechte des Täters und des Opfers zu wahren. Dass die Rechte von Tätern und Opfern nicht an der Spitze der Kriterienliste stehen, mag verwundern, erklärt sich jedoch durch die Besonderheit der Verfahren, die international gewollt werden. Bei ihnen sind Aspekte zu berücksichtigen, die in nationalen Verfahren keine oder keine größere Rolle spielen. Wenn dort die Rechte des Täters oder des Opfers zuvörderst zu beachten sind, zwingt der erweiterte makrokriminelle Kontext zu einer anderen Gewichtung, ohne dass im Gegenzug die Täter- und Opferrechte vernachlässigt werden dürfen. Wird diese Gewichtung hingegen nicht ausreichend im Verfahren berücksichtigt, droht es seinen eigentlichen Sinn und Zweck zu verfehlen. Unumstritten ist diese Auffassung nicht. Aber die besseren Gründe sprechen für sie, wie ich zeigen werde.
Allerdings: Wie auch immer man sich in diesem Punkt positioniert – mit dem Ausgang des zivilisatorischen Versuchs, Unrecht an fernen Orten der Welt nicht mehr hinnehmen zu wollen, wird immer zugleich entschieden, für wie glaubhaft er gehalten wird. Der Versuch kann scheitern oder Erfolg haben. Dass das Projekt bereits praktiziert wird, es also »in der Welt ist«, schließt nicht aus, dass es aus ihr wieder verschwindet und nur eine sprachliche Hülle und wehmütige Erinnerung bleiben. Es kommt darauf an, wie die Wechselbeziehung zwischen der normativen und der faktischen Seite dieses zivilisatorischen Versuchs gestaltet wird. Im fünften Kapitel geht es daher um die Frage, welcher Sinn und Auftrag rechtsmoralischen Normen unter den Bedingungen des Völkerstrafrechts zu entnehmen ist oder, anders gefragt, was mögliche Perspektiven der weiteren Entwicklung und die Voraussetzungen ihres Eintritts sind. Die Antworten münden in empiriegestützte Empfehlungen, die sich als kritisch konstruktiv im Sinne des zivilisatorischen Versuchs der Ahndung des fernen und idealerweise doch so nahen Unrechts verstehen.
1 Zitiert nach Goethe, Faust. Der Tragödie erster Teil, S. 27 (V. 860 – 871).
2 Ebenda (V. 854 – 855).
3 Vgl. Bliefernetz, Delightful Horror.
4 Die Bemerkung Ban Ki-moons findet sich in dem Artikel »Obama warnt vor Spaltung der Welt«, FAZ 21.9.2016; vgl. auch https://press.un.org/en/2016/sc12526.doc.htm [3. 6. 2024].
5 Vgl. den Hinweis auf https://www.hrw.org/news/2016/12/21/syria-un-general-assembly-adopts-resolution-war-crimes-investigations [3. 6. 2024].
6 Vgl. http://www.wiwo.de/politik/ausland/wladimir-putin-aleppos-eroberung-war-die-groesste-rettungsaktion-der-neuzeit/19173616.html [3. 6. 2024].
7 Vgl. https://news.un.org/en/story/2022/11/1130587 [3. 6. 2024].
8 So in der Präambel zum Vertrag von Rom (1998) zur Begründung eines ständigen internationalen Strafgerichtshofs und in dessen Art. 1, vgl. http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm [3. 6. 2024].
9 Zum Weltgipfel 2005 vgl. https://www.un.org/depts/german/gv-60/band1/ar60001.pdf [3. 6. 2024].
10 So z. B. mit großer Entschiedenheit Masala, Weltunordnung, S. 18 – 65.
11 Simonitsch, »Welt des Rechts«.
12 Nach Art. 125 Abs. 1 und 2 des Statuts war die Unterzeichnung des Statuts der erste Schritt der Anerkennung. Verbindlich wurde die Anerkennung dadurch, dass der Unterzeichnerstaat das Statut nach seinen innerstaatlichen Regeln ratifizierte, annahm oder genehmigte.
13 Simonitsch, »Welt des Rechts«; Ostermann, »Im Namen der Freiheit«.
14 Vgl. Maupas, »La CPI survivra-t-elle au fiasco du procès Gbagbo?«.
15 Vgl. die Hinweise bei Hankel, Putin vor Gericht?, S. 91 – 122, 126 f.
16 Ebenda, S. 91.
17 IT-94-AR73 (Nikolić), Decision on Interlocutory Appeal Concerning Legality of Arrest (2003), Abs. 25 (https://www.icty.org/x/cases/dragan_nikolic/acdec/en/030605.pdf [3. 6. 2024]).
18 RGBl. 1901, S. 423 und RGBl. 1910, S. 107.
19 Arendt, Eichmann in Jerusalem, S. 324 (Hervorhebung im Original).
20 Internationaler Militärgerichtshof Nürnberg, Der Nürnberger Prozess, Bd. 2, S. 115.
21 Internationaler Militärgerichtshof Nürnberg, Der Nürnberger Prozess, Bd. 1, S. 254, 314 – 386.
I Der »internationale Belang« und das »Gewissen der Menschheit«
Am 15. März 1921 wurde Talaat Pascha, der ehemalige Innenminister und Großwesir des Osmanischen Reichs, auf der Berliner Hardenbergstraße, Ecke Fasanenstraße, erschossen. Täter war Soghomon Tehlirjan, ein 25jähriger Armenier.1
Während seiner Amtszeit als Innenminister (1915 – 1917) befahl Talaat Pascha, zur angeblichen Vermeidung landesverräterischer Kollaboration mit dem russischen Feind, die Ermordung oder die Deportation von hauptsächlich in Anatolien lebenden Armeniern und Armenierinnen. Er setzte dazu bevorzugt jungtürkische Milizen ein, die seiner politischen Bewegung angehörten. Außerdem sorgte er dafür, dass auch die Deportationsanordnungen letztlich als Aufforderung zur Vernichtung zu verstehen waren. Im Sommer 1916, nachdem Talaat Pascha bereits ein Jahr zuvor triumphierend bemerkt hatte, »[d]ie armenische Frage existiert nicht mehr«, hatten ca. 1,1 Millionen Armenierinnen und Armenier ihr Leben verloren.2 Sie waren verhungert, verdurstet, einzeln oder in Massen zu Tode gebracht worden. Augenzeugen berichteten: »In Musch waren die Straßen mit Körpern von Armeniern besät.« »Sobald ein Armenier sich vor die Tür wagte, wurde er getötet. Selbst alte Männer, Blinde und Invaliden wurden nicht geschont.« »Die Männer, die noch lebendig eingefangen wurden, […] wurden gleich außerhalb der Stadt erschossen. Die Frauen wurden mit den Kindern nach den nächsten Dörfern gebracht, zu Hunderten in Häuser getan und verbrannt. Andere wurden in den Fluss geworfen.«3
Jetzt war Talaat Pascha tot. Der Schütze war verhaftet worden und wartete auf seinen Prozess. Die Trauerfeier für den Getöteten fand am 19. März in Berlin statt. Anwesend waren auch die ehemaligen Außenminister Richard von Kühlmann und Arthur Zimmermann. Einige Militärs, die während des Weltkriegs auf türkischer Seite gedient hatten, waren ebenfalls erschienen. Das Auswärtige Amt ließ einen Kranz niederlegen mit der Widmung: »Einem großen Staatsmann und treuen Freund.«4
Der Prozess gegen Soghomon Tehlirjan begann am 2. Juni vor dem Landgericht Berlin-Moabit. Politischer Druck bewirkte, dass die Prozessdauer auf zwei Tage beschränkt worden war. Das Auswärtige Amt, tatkräftig daran beteiligt, Talaat Pascha und anderen Organisatoren der Massaker an den Armenierinnen und Armeniern im November 1918 die Flucht nach Deutschland zu ermöglichen, wollte vermeiden, dass »die ganze Frage der aus dem Kriege bereits unliebsam bekannten Armeniergreuel« in der Verhandlung zur Sprache kam. Ebenso war ausdrücklich nicht gewünscht, dass »im Laufe des Prozesses eingehender auf die allgemeine politische Rolle Talaat Paschas und seiner Stellung zu Deutschland eingegangen würde«.5
Das Landgericht sprach den Angeklagten Tehlirjan frei. Die Geschworenen waren einstimmig zu dem Entschluss gekommen, dass Tehlirjan schuldlos an der Tat sei. Das »Nein« des Obmanns der Geschworenen auf die Frage des Gerichts nach der Schuld des Angeklagten entsprach voll und ganz den Erwartungen der Verteidigung, die, gestützt auf ein medizinisches Gutachten über die epileptische Erkrankung Tehlirjans, seine eingeschränkte Willensfreiheit zur Tatzeit geltend gemacht hatte. Fragen blieben gleichwohl, denn die offensichtlich vorsätzliche Tatbegehung Tehlirjans ließ nicht auf eine Störung seiner Willensfreiheit schließen. Insofern war es wohl ein überaus nützlicher Hinweis an die Adresse der Jury, als ihr der Verteidiger in seinem Plädoyer zurief: »Welche Jury der ganzen Welt würde Wilhelm Tell verurteilt haben, weil er den Landvogt niedergeschossen hat?«6 Ein Kommentar in der New York Times brachte es auf den Punkt: »Obwohl die Verteidigung von Tehlirjan auf zeitweilige Unzurechnungsfähigkeit plädierte, war seine wirkliche Verteidigung die entsetzliche Vergangenheit von Talaat Pascha, wodurch der Freispruch des Armeniers von der Anklage des Mords in deutscher Sicht zum Todesurteil für den Türken wurde.«7
Es war eine merkwürdige Situation. Die offizielle Politik in Deutschland wollte die »unliebsam bekannten Armeniergreuel« unter den Teppich kehren, man sieht förmlich den schmallippigen Mund oder die verhalten beschwichtigende Handbewegung aus dem Kreis der Akteure vor sich. Teile der öffentlichen Meinung wollten das Gegenteil, ein Gerichtsverfahren als Tribunal über die Verbrechen der jungtürkischen Bewegung an den Armeniern und Armenierinnen. Am Ende gab es eine Art Unentschieden. Der schnelle Freispruch verhinderte eine Beweisaufnahme zum Verbrechenskontext, der Freispruch an sich rechtfertigte den Vorwurf systematisch begangener Verbrechen durch das Osmanische Reich und seinen Organen.
Hinter dem Unentschieden verbarg sich jedoch etwas, das neu war: ein Ereignis, das nicht lediglich als Irrläufer der Politik, sondern als Unrecht wahrgenommen wurde und das über die Grenzen eines Staates hinaus nachhaltig für Betroffenheit sorgte, weil es sich wegen der zivilen Opfer und ihrer Zahl eben nicht in die herkömmliche Bezeichnung »Kriegsverbrechen« einordnen ließ. Im Friedenvertrag von Sèvres, dem Friedensvertrag mit der Türkei als dem Nachfolgestaat des Osmanischen Reichs, hatten die alliierten Siegerstaaten Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan in Artikel 230 gefordert, die Verantwortlichen für die Massaker an den Armeniern8 auszuliefern, damit sie außerhalb der Türkei vor einem internationalen Gericht abgeurteilt werden könnten. Der Vertrag, den die Türkei am 10. August 1920 unterschrieben hatte, trat jedoch nicht in Kraft. Politischmilitärische Machtkämpfe in der Türkei und ausländische Ratlosigkeit verhinderten es.9 International waren damit die Anklagen ad acta gelegt (der spätere Friedensvertrag von Lausanne enthielt keine Bestrafungsregelung mehr), aus der Welt waren die Verbrechen allerdings nicht. Das Wissen um sie verfolgte die Täter bis nach Deutschland, wo sie Unterschlupf gefunden hatten. Das Unrecht des Völkermords war plötzlich ganz nah und verlangte eine Antwort. Die Antwort, die das Berliner Landgericht gab, war unvollständig, aber sie war nichtsdestoweniger Teil einer Stimmung, die die »juristische Überzeugung einer wohlbegründeten Gerechtigkeit« in den Gerichtssaal bringen wollte und der es aus diesem Anlass nicht übertrieben schien, die Notwendigkeit der »Erkenntnis des Wesens des Rechts und der Aufgaben der Menschheit und ihrer Zusammenhänge« zu bemühen.10
Über die Grenzen des Nationalstaats hinaus schaute auch Robert M. W. Kempner, ein Jurastudent, der das Verfahren verfolgt hatte. Sechzig Jahre später sollte er, der in zwei Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen stellvertretender Chefankläger war, im Rückblick schreiben: »Rechtspolitisch war dieser Prozess von besonderer Bedeutung, weil zum ersten Mal in der Geschichte der Grundsatz zur Anerkennung kam, dass grobe Menschenrechtsverletzungen, insbesondere Völkermord, begangen durch eine Regierung, durchaus von fremden Staaten bekämpft werden können und keine unzulässige Einmischung in innere Angelegenheiten eines anderen Staates bedeuten.«11
Wenn auch davon auszugehen ist, dass Kempners Erinnerung stark von seinen Nürnberger Erfahrungen geprägt war und er zum Berliner Verfahren eine Traditionslinie legen wollte, die so nicht bestand (die Souveränitätsbeschränkung bei Völkerrechtsverbrechen gab es 1921 nicht, auch der Völkermordbegriff war juristisch noch nicht eingeführt), zuzustimmen ist ihm und den Stimmen aus der Verteidigung in einem Punkt, der wichtig ist, weil er eine Zäsur markiert. In einem Strafverfahren vor einem Gericht, das weit entfernt vom Tatort zusammengetreten ist, ist ein Unrecht nicht nur zum eigentlichen Verfahrensgegenstand geworden, sondern hat auch auf subtile Weise eine Ahndung erfahren. Dass die Ahndung in ihrer Form Widerspruch verdient – schließlich war ein mutmaßlicher Mord mit nicht ganz zweifelsfreien gutachterlichen Mitteln zum Verschwinden gebracht worden –, ändert nichts daran, dass die Tat hinter der Tat im Gerichtssaal präsent war. Diese Tat war zudem keine gewöhnliche Tat. Der Täter hatte sie als Organ eines Staates und unter Einsatz von dessen Machtmitteln begangen und sie in eine Dimension getrieben, die im Namen der Menschheit den Ruf nach Gerechtigkeit laut werden ließ.
Dieser Ruf fiel in eine Zeit, in der er nicht neu, aber anders war. Während des Ersten Weltkriegs war immer wieder – und im Zusammenhang mit der sich rasant steigernden Kriegsgewalt in immer kürzeren Abständen – die Menschheit als Anklägerin angerufen worden. Das Erschrecken über die Folgen der neuartigen industrialisierten Kriegführung war groß. Zwar wird der Versuch, die jeweils eigene Kriegführung als nur reaktiv darzustellen, bei den Klagen über den Tabubruch durch den Kriegsgegner gewiss auch ein naheliegendes Motiv gewesen sein. Dennoch war, verglichen mit früheren Kriegen, die Feststellung eines Gewaltüberschusses, der Grundwerten der Menschheit widersprach, ein neues Phänomen. In vielen Kontexten trat es im Ersten Weltkrieg zutage, doch nirgendwo so klar wie bei dem Massenmord an den Armenierinnen und Armeniern.
Nimmt man dieses Phänomen als Ausgangspunkt für eine Rück- und eine Vorschau, versteht man die Bestürzung über den Absturz der Zivilisation zwischen 1914 und 1918 und besonders 1915 / 16 also als einen Wendepunkt in dem hier skizzierten Sinne, ergeben sich daraus zwei grundsätzliche Fragen, nämlich die nach der Definition von Unrecht, das an entfernten Orten begangen wird, und die nach der Botschaft, die Akte dieses Unrechts aussenden und die darüber entscheiden, wie nahe sie an uns heranrücken. Mit anderen Worten, erklärungsbedürftig ist das Zusammenspiel von Moral, Recht und Gesetz.
Was »fernes Unrecht« ausmacht. Moralische Überzeugungen verdichten sich zu Recht
Fern ist das Gegenteil von nah, und Unrecht ist das Gegenteil von Recht. Das ist eine Feststellung, die banal ist, doch in unserem Zusammenhang weitreichende Folgen hat. Beginnt man mit der Wortbedeutung, sind »nah« und »fern« zunächst geografisch zu verstehen. Das bedarf keiner Erläuterung. Sodann sind beide Begriff auch emotional zu verstehen. »Nah« kommt uns ein Ereignis, das uns anspricht, nicht gleichgültig lässt und eine Reaktion herausfordert. Es tritt ein in unsere persönliche Sphäre und wird Teil unseres Lebens. Dieser Teil kann vorübergehend präsent sein, er kann aber auch das Leben vollständig verändern, ihm seinen Stempel aufdrücken. Demgegenüber ist ein Ereignis »fern«, wenn es uns nicht berührt oder wenn es nur kurzzeitig für uns präsent ist. Es ist Gegenstand von Gesprächen, löst auch Emotionen aus, wird aber bald wieder vom Alltagsgeschehen verdrängt oder vergessen.
Welcher Art ist das, was uns nahe kommt oder fern bleibt? Und wer ist überhaupt uns? Bevor darauf eine Antwort gegeben werden kann, wäre zuerst zu erläutern, was im vorliegenden Kontext mit den Begriffen »Recht« und »Unrecht« gemeint ist. Für den Begriff des Rechts genügen wenige Sätze. In Gegensatz gebracht zum Begriff des Unrechts bezeichnet er etwas Erlaubtes oder normativ Erwartbares. Am Beispiel der Rechtsordnung, die in Deutschland wie in vielen anderen Ländern als Freiheitsordnung verstanden wird, heißt das, dass die äußere Freiheit eines jeden Menschen der Grundbaustein der Rechtsordnung ist. Immanuel Kant formulierte den Grundsatz folgendermaßen: »[H]andle äußerlich so, daß der freie Gebrauch deiner Willkür mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetze bestehen könne.«12 Eine rechtliche Begrenzung der Freiheit ist erst dann nötig, wenn die Freiheitsausübung des einen die anderer beeinträchtigt. Dazu hält das Recht Sanktionen oder Strafen vor, die durch die Freiheitsrechte aller legitimiert werden und deren Zwangscharakter sie von den Appellen der Moral unterscheiden.13 Das insofern rechtlich normativ Gebotene ist eine staatsrechtliche Errungenschaft, eine historisch bedeutsame Leistung, jedoch unspektakulär im täglichen Leben, wo es in allen Bereichen (Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Kultur, Sport) zu finden ist. Seine Beachtung ist Voraussetzung für das menschliche Zusammenleben. Das Bemühen, Rechtsnormen vorbildlich zu erfüllen, mag auf der Ebene individueller Beziehungen kurzfristig für freudige Zustimmung oder Erstaunen sorgen, sinnvoller ist es allerdings bei einem mit entsprechender Macht ausgestattetem Verband (Staat, Körperschaft). Erfüllt dieser Verband das rechtlich Gebotene in besonderer Weise, über das Mögliche und unbedingt Erwartbare hinaus, wird das Verhalten dadurch auch nicht spektakulär, zumindest nicht für eine längere Zeit. Nutznießer und Betrachter einer rechtlichen Übererfüllung gewöhnen sich an den Zustand, er gehört zur Lebensnormalität. Bewohnerinnen und Bewohner Norwegens leben nicht dauerhaft in einem affektiven Sondermodus, weil ihr Staat schon seit Jahren in weltweit einzigartiger Weise Daseinsvorsorge betreibt,14 ebenso wenig wie Menschen in liberal-demokratischen Staaten sich täglich erneut des Grundrechts- und Menschenrechtsstandards in ihrem jeweiligen Staat erfreuen, der so weit über dem völkerrechtlich vereinbarten Minimum liegt.15 Beides ist einfach da. Fern ist es nicht, nah sehr wohl, doch nicht als Ergebnis eines affektgeladenen Prozesses.
Demgegenüber ist das rechtlich Verbotene und trotzdem Geschehene, das seine Botschaft sendet, von anderer Natur. Je nach Schwere des Normverstoßes ist die affektive Dimension größer und länger existent. Für ein Ereignis, das in der Nähe eines Menschen stattfindet, versteht sich das von selbst. Eine Tat, die geltendes Recht verletzt und ein krimineller Akt ist, wird auf ihn gewöhnlich eine gravierendere Wirkung haben als eine Wohltat, die er über das ihm rechtlich Zustehende erfährt. Vergessenseffekte treten weit eher bei positiven als bei negativen Emotionen auf.16 Und je größer die Rechtsverletzung, desto nachhaltiger ist die Wirkung. Psychotraumatologische Erkenntnisse sind hier eindeutig, soweit es sich um unmittelbare Verbrechensopfer handelt. Bei mittelbar Betroffenen, z. B. Angehörigen von Opfern, ist der Befund hingegen weit weniger eindeutig. Wo es zu dem Phänomen der trans- oder intergenerationalen Weitergabe von Traumata kommt, kann sich bei den betroffenen Angehörigen eine enorme emotionale Belastung entwickeln. Wo dies nicht geschieht, ist der Grad an Betroffenheit bedeutend niedriger, in vielen Fällen vergleichbar mit der Betroffenheit Dritter, die beispielsweise aus Zufall in einem lokalen Näheverhältnis zum Verbrechensopfer stehen.17 Das Unrecht ist präsent, es bewegt emotional, aber es beherrscht nicht das Leben. Es ist Teil dieses Lebens, und als solcher kann es auch eine Erinnerung sein, die sich manchmal einstellt, eine tiefe Gefühlsregung bewirkt und alsbald wieder von den alltäglichen Begebenheiten des Lebens überlagert wird. Eine Wir-Erfahrung aus der Perspektive Dritter bleibt es dennoch, denn die sozial-intuitive moralische Einordnung, von der der Neurowissenschaftler Robert Sapolsky spricht, ist in der Nähe begründet. Sie setzt ein starkes implizites Signal frei, dass der vom Unrecht betroffene Mensch zu uns gehört.18 Demgegenüber ist es ein weiter Weg, bis dieses Signal bei einem Unrecht, von dem aus der Ferne erfahren wird, ausgelöst wird.19 Von einem solchen Geschehen zu erfahren, führt dazu, dass die durch unmittelbare Anschauung, mittelbare Zeugenschaft oder direkte Betroffenheit freigesetzten Emotionen abgelöst werden durch Gefühle, die von einer achselzuckenden Registrierung des Geschehens, einer Betroffenheit qua bloßer Zugehörigkeit zur Menschheit also, über Mitgefühl bis hin zu einer Empörung reichen, die nach adäquaten Reaktionen ruft. Ein kognitiver Prozess mit einer Vielzahl von Zwischenstufen findet statt, bis schließlich die Wir-Intuition erreicht ist.20 Darüber, wie dieser Prozess der Distanzüberwindung verläuft, welches die individuellen Reaktionen sind, entscheidet die Vorstellungskraft des Einzelnen. Es gehe darum, so der Soziologe Luc Boltanski, dass die Person fern des Unrechts sich eine Vorstellung davon macht, wie der vom Akt des Unrechts Betroffene fühlt.21
Diese Einsicht ist keineswegs neu. Boltanski selbst verweist auf den schottischen Aufklärer Adam Smith, Henning Ritter lässt in seinem Essay über »Nahes und fernes Unglück« gleich eine ganz Reihe Aufklärer zu Wort kommen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, ob sich eines Tages eine den ganzen Globus umfassende Moral der Einfühlung durchgesetzt haben wird.22 Ihre Zuversicht oder ihre Skepsis gründete auf der Vernunft beziehungsweise Unvernunft des Menschen und ihren jeweiligen Folgen: Fortschritt, der stattfinde, trotz Unterbrechungen und Rückschlägen; oder Stillstand und sogar, verglichen mit den sich immer wieder eröffnenden Möglichkeiten, Rückschritt. So zitiert Ritter die Bemerkung Jean-Jacques Rousseaus: »Die Menschlichkeit ist ein Knoten, den Bürger von Paris mit dem von Peking zu verbinden«, und bei Paul-Henri Thiry d’Holbach lesen wir: »Die Bauern, die Handwerker, die Künstler haben keinen Moralunterricht genommen, aber wenn sie nur ein wenig nachdenken, sind sie, ohne es zu wissen, die Schüler Ciceros. Der indische Färber, der tatarische Hirt, der englische Matrose wissen, was gerecht ist und was ungerecht.«23 Für die Gegenmeinung lässt er Voltaire auftreten, der sagte: »Allem Anschein nach verdampft das Gefühl der Menschlichkeit und wird schwächer, indem es sich über die Erde ausdehnt und es ist uns nicht gegeben, von den Unglücksfällen bei den Tataren oder in Japan ebenso berührt zu werden wie von dem, was einem europäischen Volk zustößt.«24
Die Terminologie ist noch uneinheitlich. Unglück, Unglücksfälle gehen zusammen mit Menschlichkeit oder Moral oder mit Attributen wie gerecht und ungerecht. Aber ein Unglück ist nicht unbedingt ein Verbrechen, es muss nicht menschengemacht sein, sondern ihm kann eine schicksalhafte Verkettung von Umständen zugrunde liegen und ist, wird es dann Unrecht genannt, eine Anklage gegen die Wechselfälle des Lebens oder Ausdruck eines Übels, weil es unverdient erfahren wurde.25 Unrecht in Verbindung mit einem Verbrechen ist etwas anderes. Es setzt einen massiven Verstoß gegen moralische Kategorien voraus und, um nicht als »überdehnte Hausmoral«, die die Bürger von Paris und Peking zu »Flurnachbarn« mache,26 abqualifiziert zu werden, zugleich gegen geltendes Recht. Die Existenz dieses Rechts verstärkt zum einen das in einem Rechtskreis gemeinsame Empfinden, dass das, was geschehen ist, nicht hätte geschehen dürfen. Zum andern macht es, wenn es ein Recht ist, das den Menschen über Staatsgrenzen hinaus und interkulturell aufgrund ihres Menschseins zusteht, das Empfinden zu einem weltumspannenden. Fremdes Leid mindert das eigene Wohlbefinden in der Welt.27 Die moralische Empörung verbindet sich mit dem Wissen darum, dass das Geschehene im Wortsinne Unrecht ist.
Der Weg dorthin würde weit sein, daran dürfte keiner der Aufklärer gezweifelt haben. Erst müssten, so der italienische Strafrechtsreformer Cesare Beccaria, »die Despotien in die Tiefen Asiens zurückgedrängt sein«, bis dahin bleibe fernes Unrecht fern und nahes nah. Noch einmal Beccaria: »Manche glauben, daß eine grausame Tat, die in Konstantinopel begangen wird, in Paris bestraft werden könne, und zwar aus dem abstrakten Grund, daß, wer die Menschheit beleidigt, es verdient die ganze Menschheit zum Feinde zu haben und überall verabscheut zu werden, als wären die Richter die Rächer der Empfindsamkeit der Menschen und nicht vielmehr der Verträge, durch die sie miteinander verbunden sind. Der Ort der Strafe ist der Ort des Verbrechens, weil allein dort und nicht anderswo die Menschen dazu gezwungen sind, gegen einen einzelnen vorzugehen, um der Gefährdung der Allgemeinheit vorzubeugen.«28
Es ist in der geschichts- und rechtswissenschaftlichen Literatur, in denen humanitär-völkerrechtliche Entwicklungen nachgezeichnet werden, weitgehend Konsens, dass das 19. Jahrhundert einen sich in seinem Verlauf zunehmend konkretisierenden Wendepunkt darstellt.29 Die vielen Gewaltakte, die aus der Menschheitsgeschichte bekannt waren und den (Rechts)Philosophen der Aufklärung hoffnungsvoll oder desillusionierend vor Augen standen,30 stießen, da mit kleineren oder größeren Abweichungen und Zuspitzungen bis in die damalige Aktualität begangen (der Siebenjährige Krieg von 1756 – 1763 mit seinen Massakern an Unterlegenen und wehrlosen Zivilistinnen und Zivilisten kann als Beispiel gelten), auf eine Empörung, die konkrete Maßnahmen einforderte. Auf diese Weise verfestigte sich Moral, oft immer noch von der (nationalen) Perspektive des Betrachters abhängig, zu schriftlich fixierten Vereinbarungen zur Begrenzung von Leid, die nach dem Willen der Unterzeichner transnationale Rechtskraft haben sollten.
Die ersten vertraglichen Versuche zur Begrenzung von menschlichem Leid
Die erste Etappe in der staatenübergreifenden Herausbildung eines »humanitären Gewissens« begann mit dem Kampf gegen den transatlantischen Sklavenhandel, von dem der US-Jurist Henry Wheaton 1836 in der Erstausgabe seiner Elements of International Law schrieb: »The African slave trade, once considered not only a lawful, but desirable branch of commerce, a participation in which was made the object of wars, negotiations, and treaties between different European states, is now denounced as an odious crime by the almost universal consent of nations.«31 Wheaton folgerte die nahezu universelle Zustimmung zum Verbot des Sklavenhandels aus nationalen Verbotsgesetzen und aus entsprechenden internationalen Abkommen, die mit der Erklärung der Wiener Konferenz zum Sklavenhandel begonnen und sich in mehreren zwischenstaatlichen Verträgen fortgesetzt hatten. Das dahinter stehende Verbrechen, das Wheaton in seinem Völkerrechtsbuch noch mit dem pragmatisch aufrüttelnden Attribut »odious« (abscheulich) versehen hatte, prangerte er 1842 in zwei Aufsätzen als ein »crime against humanity« an, das von der internationalen öffentlichen Meinung und allen zivilisierten sowie christlichen Mächten verurteilt würde. Zum ersten Mal war damit, wie Fabian Klose in seiner Studie zum Humanitarismus hervorhebt, ein Begriff genannt worden, der künftig ein Verbrechen charakterisieren sollte, das die Menschheit in ihrem Selbstverständnis trifft und zu einer Reaktion herausfordert.32
Der weitere Weg dorthin führte bald weg von den Sklaventransporten in die Neue Welt, deren Grauen Europa nur äußerst indirekt betraf. Wie die Hauptkriegsschauplätze des Siebenjährigen Kriegs waren es Kriege in Europa selbst, die unter Beteiligung europäischer Großmächte unmittelbare Auswirkung auf das »humanitäre Gewissen« des europäischen Teils der Menschheit hatten beziehungsweise allgemein auf die Menschen dort wirkten, wo technischer Fortschritt die Konstruktion von Waffen mit immer größeren Tötungskapazitäten ermöglichte. Die Fähigkeit zur medizinischen Versorgung der Opfer – und als solche galten nur die Soldaten der beteiligten Armeen und nicht die Menschen der Zivilbevölkerung – hinkte demgegenüber deutlich hinterher. Das Sterben nach der Schlacht war ein Massenphänomen, Begleiterscheinung eines Krieges, die mit Schicksal, nicht jedoch mit Unrecht in Verbindung gebracht wurde. Ein wichtiger Schritt in dem Versuch, dieses Schicksal zu mildern, war 1851 die Einführung der Injektionsspritze, mit der Opiate als Schmerzmittel verabreicht werden konnten.33 Er beflügelte den weiteren Schritt, in dem zunehmende medizinische Kenntnisse und das Wissen um Hygienestandards auf persönliches Engagement trafen. Florence Nightingale organisierte Hilfe für verletzte Soldaten im Krimkrieg und sensibilisierte die britische Öffentlichkeit für die Notwendigkeit einer militärischen Verletztenversorgung. Clara Barton engagierte sich in gleicher Weise im amerikanischen Bürgerkrieg und gründete überdies das Amerikanische Rote Kreuz, womit sie eine Initiative aufgriff, für die wie kein zweiter der Name Henry Dunant steht. Nachdem Dunant im Juni 1859 Zeuge der Schlacht von Solferino geworden war, an deren Ende nach nur wenigen Tagen fast 40 000 Tote, Sterbende, Verstümmelte auf dem Schlachtfeld lagen, über- und nebeneinander, von den Überlebenden verlassen und der lokalen Bevölkerung ausgeplündert oder ignoriert, beschloss er, nicht nur selbst helfend einzugreifen und andere zum Eingreifen zu bewegen, sondern sich für die Gründung einer internationalen Gesellschaft einzusetzen, deren Aufgabe in der Hilfe für Kriegsopfer bestehen sollte. »Die Humanität und die Zivilisation verlangen gebieterisch nach dem hier angedeuteten Werke«, schrieb Dunant in der Erinnerung an Solferino.34
1863 trat in Genf eine Arbeitsgruppe zusammen, aus der das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hervorgehen sollte. Bereits ein Jahr später beschlossen 16 Staaten auf einer Konferenz in Genf die Konvention zur Verbesserung des Loses der Verwundeten der Heere im Felde (Erste Genfer Konvention). Neutralität der Feldlazarette, ein neutraler Status auch für alle Personen, die berufsmäßig mit der Pflege und medizinischen Versorgung verwundeter Soldaten befasst sind sowie der Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten, die Verwundeten gleich welcher Nationalität Hilfe leisten, waren die wichtigsten Vereinbarungen, die die Staaten in diesem nur aus zehn Artikeln bestehenden Vertrag trafen.35 Er sei »einer der edelsten Errungenschaften der fortschreitenden Humanität«, lobte der Schweizer Völkerrechtler Johann Caspar Bluntschli den Vertrag in seiner Darstellung des Völkerrechts der »civilisirten Staten«.36
Ausdrücklich vom Fortschritt der Zivilisation und von den Gesetzen der Humanität, die mit schrankenlos entfesselter Kriegsgewalt unvereinbar seien, sprach die St. Petersburger Erklärung von 1868.37 Zum ersten Mal in der Rechts- und Militärgeschichte legten in ihr die europäischen Vertragsstaaten fest, dass unnötiges Leiden im Krieg vermieden werden soll. Explosive Projektile mit einem Gewicht von unter 400 Gramm sollten nicht mehr verwendet werden dürfen. Anlass der russischen Initiative, die der Erklärung zugrunde lag, war die Erfindung von Geschossen, die beim Auftreffen auf weiche Oberflächen explodierten. Anders als die herkömmlichen Artilleriegeschosse wie zum Beispiel Granaten oder Schrapnells konnten sie einfacher und schneller verschossen werden und waren von verheerender Wirkung beim Kontakt mit menschlichen Körpern. Ziel des Krieges sei es, so die Erklärung, den Feind zu schwächen, ihn kampfunfähig zu machen, nicht ihm darüber hinaus Leid zuzufügen. Weil dies mit der neuen Erfindung russischer Militärtechnik unweigerlich verbunden sei, müsse ihr Einsatz vertraglich unterbunden werden.38 Noch einmal Bluntschli: »Das Völkerrecht verbindet auch die Kriegsparteien während des Krieges als Glieder der Menschheit und beschränkt dieselben in der Anwendung der zulässigen Gewaltmittel.«39
Die Ernüchterung kam im deutsch-französischen Krieg 1870 / 71. Vor allem die Bestimmungen der Genfer Konvention wurden massiv missachtet. Der erste Präsident des IKRK, Gustave Moynier, schlug darauf hin 1872 die Schaffung eines internationalen Gerichtshofs vor, vor dem sich Staaten verantworten sollten. Rein moralische Sanktionen reichten nicht aus, so die Folgerung Moyniers, die Beachtung des von den Vertragsstaaten für verbindlich erachteten Rechts müsse strafrechtlich erzwungen werden.40
Innerhalb nicht einmal eines Jahrzehnts hatte sich Erstaunliches getan. Der Soldat war als mögliches Opfer in Erscheinung getreten. Hier mögen kalte Nützlichkeitserwägungen mit Blick auf die Verwertbarkeit des ausgebildeten und ausgerüsteten Soldaten die Wahrnehmung bestimmt haben. »Unnötiges Sterben« war ein Kostenfaktor. Dass nun aber auch der Soldat der Gegenseite als mögliches Opfer galt, weist auf mehr als eine nüchtern-militärische Betrachtungsweise hin. Der getötete oder verwundete Soldat erfuhr eine Individualisierung, er trat auf als Mensch, obschon er sein Leben und seinen Körper für ein über seine Person hinausreichendes Anliegen hingegeben hatte.41
Frei von einem instrumentellen Verständnis war diese Umdeutung indes auch nicht. Der Grundsatz der Reziprozität braucht für seine Beachtung nicht unbedingt die Einsicht in den Wert menschlichen Lebens, ein Handlungsdruck infolge der Zustimmungsbereitschaft anderer Vertragsparteien reicht aus. Dennoch muss es eine anfängliche Idee gegeben haben, der eine geänderte Vorstellung von dem, was Soldaten zuzumuten ist, zugrunde lag. Und sie muss zwangsläufig Teil der größeren Vorstellung sein, die im sich neu manifestierenden »humanitären Gewissens« fußt. Vom Soldaten als Opfer war es dann nur ein kleiner Schritt zum Zivilisten als Opfer. Vorausgesetzt, er gehörte, wie der Soldat, der eigenen, westlichen Zivilisation an. An deren Überlegenheit ließ, stellvertretend für die herrschende Meinung, der russische Völkerrechtler Friedrich Fromhold Martens 1883 in seinem Buch Völkerrecht. Das internationale Recht der civilisierten Nationen keinen Zweifel, sodass »in Betreff der Türkei, China’s, Japan’s und anderer asiatischer Staaten die Einmischung der Kulturstaaten principiel« rechtmäßig sei, »sobald die christliche Bevölkerung jener Länder barbarischen Verfolgungen und Schlächtereien ausgesetzt ist. Solchenfalls rechtfertigt sich die Intervention durch die Gemeinsamkeit der religiösen Interessen und die Gebote der Humanität [,] d. h. die Principien des natürlichen Rechts, welche im Allgemeinen der Beziehung der cultivirten Nationen zu ungesitteten normiren.«42
Es war vor allem das angebliche osmanische »Barbarisierungsprojekt«,43 das europäische Großmächte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im griechischen Unabhängigkeitskampf intervenieren ließ, gefolgt von Interventionen während der so genannten Großen Balkankrise in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Interveniert wurde selbstredend militärisch. In der östlichen, vermeintlich unzivilisierten Peripherie Europas waren die Grundprinzipien des Naturrechts, ganz zu schweigen von einem naturrechtlich beeinflussten positiven Recht, abwesend. Man übte praktische Nothilfe, der eigene zivilisatorische Standard ging mit der moralischen und rechtlichen Befugnis einher, den in der Ferne an Leib und Leben Bedrängten zu Hilfe zu kommen. Untereinander, bei annähernd gleichem zivilisatorischem Standard, galt indes das europäische Völkerrecht. Und das jeweilige nationale Strafrecht war davon scharf getrennt. Da es ein Strafrecht unter Zivilisierten war, war an eine Bestrafung wegen Kriegsverbrechen nicht gedacht. Das galt auch für den unter eine andere Hoheitsgewalt geratenen Soldaten, der als Organ seines Heimatstaates gesehen wurde und darum vor Verfolgung wegen vorausgegangener Kriegshandlungen gleich welcher Art zu schützen war.
Weitergehende rechtliche Ambitionen stießen sich an der politischen Realität. Wenn das 1873 gegründete Institut de Droit International hoffnungsfroh behauptete, das Völkerrecht zum »rechtlichen Gewissen der zivilisierten Welt« weiterentwickeln zu wollen und wenn das 1880 vom selben Institut veröffentlichte »Manual of the Laws of War« den Schutzbereich des Rechts auch auf die unbeteiligte Zivilbevölkerung ausdehnte, die Anwendung des Strafrechts als Sanktionsmittel über die Staatsgrenzen hinaus, wie es das »Manual« selbst vorsah,44 entsprach nicht den Interessen der Staaten und wurde von diesen abgelehnt. Der noch weitergehende Vorschlag Moyniers, die gemeinsame Rechtsgrundlage auch zur Grundlage einer gemeinsamen Strafinstanz zu machen, geriet nicht einmal in das Stadium einer ernsthafteren Diskussion. Die Verfügung über die eigene Souveränität war für die Staaten eine völkerrechtliche Selbstverständlichkeit. Kooperation ja, aber unter genauer Kontrolle der Preisgabe staatlicher Gewalt. Zweihundert zwischenstaatliche Dispute waren von Schiedsgerichten zwischen 1815 und 1900 geregelt worden. Sie betrafen Grenzstreitigkeiten, Beschlagnahmung von Schiffen oder die Auslegung von Verträgen, kurzum Dinge, deren Lösung im Interesse aller Beteiligten lag.45 Die Schiedsgerichtsbarkeit war der bei jeweiliger Gelegenheit institutionalisierte Zusammenschluss von Staatenvertretern, um ein Problem einvernehmlich einer belastbaren rechtlichen Lösung zuzuführen. So gesehen können die humanitären Völkerrechtsverträge aus dieser Zeit als die konzeptualisierte Absicht der Staaten begriffen werden, in der Extremsituation des Krieges das Leid der Menschen zu verringern, ebenfalls im wechselseitigen Interesse, aber unter strikter Wahrung staatlicher Souveränitätsrechte.
Vergegenwärtigen wir uns die wichtigen Friedenskonferenzen und Friedensschlüsse, die es von Beginn der Neuzeit bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts hinein gab, so spricht aus ihnen der Wunsch oder das Bedürfnis von Staaten, sich zur Beendigung eines Krieges und zur Vermeidung eines neuen Konflikts friedlich zu arrangieren. Völkerrechtsverträge dieser Art waren kein neues Phänomen.46 Blicken wir auf die Völkerrechtsverträge zur Regelung des Kriegsrechts, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgeschlossen oder entworfen wurden, können wir das jedoch sehr wohl sagen, auch wenn deren Anzahl gering war und ein Menschenbild verriet, das zwischen »Zivilisierten« und »Wilden« unterschied. Es mag in diesem Kontext widersprüchlich anmuten (zumal gegenüber »Unzivilisierten« der Einsatz militärischer Gewalt zulässig war – natürlich ohne die zivilisierten Völkern vorbehaltenen humanitären Beschränkungen), die Entwicklung in die Nähe eines zivilisatorischen Fortschritts rücken zu wollen, und doch war sie genau das. Beginnend mit der Anschauung großen Leids und der unmittelbaren Betroffenheit Einzelner, gefolgt von der Weitergabe dieser Betroffenheit an Dritte, die ein hinreichendes Vorstellungsvermögen besaßen, sich in das Ausmaß des Leids hineinzufühlen, war ein Projekt realisiert worden, das sich die Minderung dieses Leids zum Ziel gesetzt hatte. Da der Krieg selbst nicht als Unrecht galt, sondern als Teil der Politik, sollten Vorkehrungen getroffen werden, um künftig ein Überschreiten der erlaubten Grenzen des Krieges zu verhindern. Mit der Ratifikation der Verträge und ihre Übernahme in das jeweils nationale Recht gelangte das individuell erfahrene Leid aus der Sphäre der Erfahrungswelt des Individuums heraus und wurde zusätzlich zum moralischen auch zu einem rechtlichen Unrecht. Es war jetzt Angelegenheit einer größeren Gruppe, eines Kollektivs mit gemeinsamen Zielen. An die Stelle betroffener Einzelner traten die Staaten als Parteien des völkerrechtlichen Vertrags. Werte, deren Beachtung im Unrechtsgeschehen von Einzelnen eingefordert wird, waren zu gemeinsamen gemacht worden.47 Nah und fern verschmolzen und eine allererste Annäherung an einen Zustand war erfolgt, in dem, in den Worten Immanuel Kants, »die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird«.48
Die Verursachung von menschlichem Leid wird zu einem Völkerrechtsverbrechen und eröffnet die Möglichkeit strafrechtlicher Verfolgung
Zu einer nächsten Annäherung sollte es einige Jahrzehnte später kommen, als 1907 auf der Zweiten Haager Friedenskonferenz das »Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs« beschlossen wurde. Artikel 3 des Abkommens besagt: »Die Kriegspartei, welche die Bestimmungen der bezeichneten Ordnung [Haager Landkriegsordnung, G. H.] verletzen sollte, ist gegebenen Falles zum Schadensersatze verpflichtet. Sie ist für alle Handlungen verantwortlich, die von den zu ihrer bewaffneten Macht gehörenden Personen begangen werden.«49 »Handlungen« waren hier zu verstehen als rechtswidrige Taten, die, wenn sie in Anbetracht des Schutzbereichs der Landkriegsordnung eine gewisse Schwere hatten, ein Kriegsverbrechen sein konnten. Wobei hier sogleich einschränkend zu bemerken ist, das der Begriff des Kriegsverbrechens seinerzeit in der westlichen Staatenwelt mit großer Zurückhaltung verwendet wurde. Nicht nur hatte er im Selbstverständnis zivilisierter Staaten keinen Platz, man scheute auch den Handlungsdruck, den er im Gefolge einer sich empörenden öffentlichen Meinung entstehen lassen könnte. Man zog es vor, von »schweren Verstößen« oder Ähnlichem zu sprechen, für die der verantwortliche Staat Schadensersatz leisten sollte.50 Da es über diese keinen Richter gab (par in parem non habet iurisdictionem), kam das Strafrecht als Sanktionsmittel, das die Schadensersatzleistung ausgelöst hätte, nicht in Betracht.
Während über das Unrecht zwischenstaatlich begangener Kriegsrechtsverstöße mithin zumindest schon auf der diplomatischen Ebene verhandelt werden konnte, blieb diese Möglichkeit versperrt, sobald es um Taten ging, die von einem Staat an der eigenen, auf seinem Hoheitsgebiet lebenden Bevölkerung oder an der in seinem Machtbereich befindlichen Bevölkerung begangen wurden. Massenmord bis hin zur versuchten Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen oder systematische Vertreibung blieben Taten, die über die Grenzen des betreffenden Staates hinaus Empörung hervorriefen, in der konkreten Reaktion aber unterschiedliche Folgen hatten. Mal intervenierten Staaten militärisch