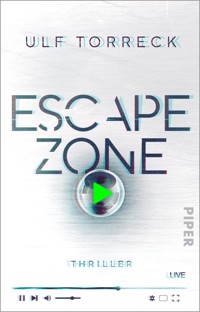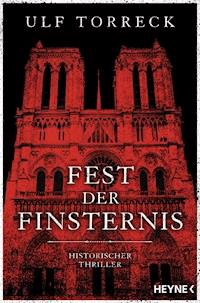
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Paris im September 1805. Der intrigante Polizeiminister Joseph Fouché regiert die Stadt mit eiserner Hand. Doch die Bewohner der Weltmetropole sind ergriffen von Angst. In finsteren Gassen werden die Leichen blutjunger Mädchen gefunden, die Brutalität der Morde ist beispiellos. Der für seinen Jagdinstinkt berühmte Polizist Louis Marais arbeitet wie besessen an dem Fall. Marais weiß, dass es ein Monster braucht, um ein Monster zu jagen. Er greift auf die Hilfe eines alten Bekannten zurück, der hinter den Mauern des Irrenhauses von Charenton sein Leben fristet. Doch damit führt Marais den Alptraum erst zu seiner wahren Größe …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 806
Ähnliche
ULF TORRECK
FEST
DER
FINSTERNIS
Historischer Thriller
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 03/2017
Copyright © 2016 by Ulf Torreck
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Michael Meller Agency GmbH, München
Redaktion: Heiko Arntz
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung von © shutterstock/Marcin Krzyzak
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-19054-5V002
www.heyne.de
Nichts, wovon auf den folgenden Seiten die Rede sein wird,
ist wahr. Mit Ausnahme derjenigen Gedanken,
Ereignisse und Dinge, die ich frei erfunden habe
»Er hat die Finsternis der Latrinen ertragen, weil in der Scheiße nach Mitternacht sich manchmal die Sterne spiegelten.«
Durs Grünbein
»Die verfallenen Altäre sind von Dämonen bewohnt.«
Ernst Jünger
»Der Mensch ist ein schönes, böses Tier.«
Donatien-Alphonse-François, Marquis de Sade
ERSTES BUCH
Die Mühlen Gottes
1
DANSE MACABRE
Im August 1805 herrschte die Pest bereits den dritten Monat über Brest. Leise wie ein Dieb in der Nacht war sie aus einer der Gossen aufgestiegen und hatte die Stadt und ihre Bewohner innerhalb weniger Tage in ihren Bann geschlagen. Seither lagen die Straßen und Plätze tagein, tagaus verlassen da. In Rinnsteinen und auf Trottoirs häufte sich der Unrat. Ein Festmahl für Ratten, Krähen, Raben und Möwen. Ein dumpf drückender Gestank machte den Menschen das Atmen schwer. Selbst der Himmel schien niedriger über den Dächern zu hängen, seit die Seuche ihre Herrschaft über die Stadt angetreten hatte. Brest schien dem Willen und der Macht seiner Bewohner entzogen und vollständig dem Tod ausgeliefert. Jenem wahren Herrn der Welt, in dessen Schuld jeder von uns vom ersten bis zum letzten Atemzug steht. Seit Mitternacht fiel kalter Nieselregen, der mit dem steifen Wind vom Meer her in die Stadt wehte und wenigstens einen Teil des Leichengestanks vertrieb.
In einem Bürgerhaus beim Marktplatz trafen sich an diesem Morgen Louis Marais, der Polizeichef und amtierende Präfekt von Brest, und der Marinearzt Docteur Couton. Seit dem Ausbruch der Seuche war Marais jeden Morgen um dieselbe Zeit von seinem Büro in der Präfektur zum Haus des Marinearztes gegangen, um die Anzahl der Toten zu erfahren und sich mit ihm über die Lage in der Stadt zu beraten.
Marais war ein großer, schlanker Mann mit einem kantigen Gesicht und dünnen Lippen. Seine schmale, leicht gebogene Nase vermittelte den Eindruck von Selbstsicherheit und Strenge. Obwohl er hier in Brest ein mächtiger Mann war, bevorzugte er einfache, schlichte Kleider. Er war kein besonders umgänglicher Mann. Falls er seit seiner überstürzten Versetzung hierher nach Brest in der Stadt so etwas wie einen Vertrauten gewonnen hatte, dann war das der Doktor Couton. Leutselig, mollig und stets geradeheraus dem Leben zugewandt, bot der Marinearzt schon äußerlich ein auffallendes Gegenbild zu dem sehnigen Marais.
Obwohl Coutons Opferzahlen heute Morgen zum dritten Mal in Folge erfreulich niedrig ausfielen und Marais eigentlich Grund zur Freude hätte haben sollen, blieb seine Mine angespannt.
Couton, der Marais’ Miene zu deuten wusste, trat zu dem mächtigen alten Bauernschrank, holte zwei Gläser heraus, füllte sie mit einem guten Schluck Rum und reichte eines davon an Marais.
»Sie müssen endlich etwas gegen den Spuk des Abbé Maurice unternehmen!«, forderte er den Präfekten auf.
Nachdem die Kirchen und Kapellen mit dem Ausbruch der Seuche über Wochen hin verwaist gewesen waren, hatte Abbé Maurice, der Priester der Fischerkirche von Saint-Petrus, begonnen, seine Runden durch die verlassenen Straßen der Stadt zu machen. Eine Handglocke schwingend, rief er die Menschen in ihren verrammelten Häusern zu Gebet und Buße auf.Seine einsamen Aufrufe zeigten schon bald Wirkung. Bereits am zweiten Tag schloss sich ihm ein erstes verlorenes Häuflein Gläubiger an.
Dies hatte Coutons Missfallen erregt. Denn in Zeiten der Seuche stellten Menschenansammlungen eine Gefahr dar. Und obwohl der Doktor immer wieder darauf hinwies, ignorierte Marais die Warnung. Immerhin hatte der Abbé sich seit Ausbruch der Pest aufopfernd um seine Schäfchen gekümmert. Unermüdlich war er dem Doktor und dessen Gehilfen zur Hand gegangen. Und solange das Häuflein, das dem Abbé durch die Gassen folgte, nicht allzu sehr anwuchs, war Marais der Ansicht, dass man ihn gewähren lassen solle. Couton schalt ihn daraufhin einen sentimentalen Narren.
Waren dem Abbé zunächst vor allem Leute aus den Fischerkaten und Seemannshäusern am Hafen gefolgt, so gewann er nach und nach auch Anhänger unter den Bewohnern der besseren Viertel. Aber immer noch hatte sich Marais gescheut, dem Treiben ein Ende zu bereiten.
Eines Abends war Couton zornig in Marais’ Büro gestürmt, um ihm klarzumachen, dass es nun wahrlich genug sei. Der letzten Prozession des Abbé waren fast fünfzig Menschen gefolgt. »Wenn darunter auch nur einer gewesen ist, der die Seuche noch nicht hatte – bei dieser verdammten Prozession hat er sie sich ganz gewiss an den Hals geholt«, rief er. »Und es wird schlimmer werden, Marais! Gestern soll der verrückte Narr verkündet haben, dass man nun endlich den Satan aus der Stadt zu treiben hätte. Wenn es irgendetwas gibt, woran man in diesen Zeiten in Brest glauben will, dann ist es Satan. Es ist nur noch eine Frage von Tagen, vielleicht nur von Stunden, bis Sie den Aufruhr am Hals haben, den wir beide so sehr fürchten!«
Marais hatte es bisher vermieden, sich mit eigenen Augen ein Bild von den Umzügen des Abbé zu machen. An jenem Nachmittag ging er endlich zur Rue de Siam, um sich die Prozession anzusehen.
Gekleidet in seine schwarze Soutane, mit der Rechten die Glocke schwingend und in der Linken ein einfaches Holzkreuz himmelwärts reckend, führte der Priester an diesem Tag um die hundert Männer, Frauen und Kinder zum Hafen und den Fluss hinunter, bis zu seiner Fischerkirche Saint-Petrus.
Wenn diese Leute so sehr um Gottes Hilfe flehten, dachte Marais dabei, wie konnte er ihnen dabei im Weg stehen? Zumal die Lage in der Stadt tatsächlich gespannt war und es womöglich nur einer einzigen Fehlentscheidung bedurfte, um die Volksseele vollends zum Kochen zu bringen. Dieser eine Fehler, fürchtete Marais, könnte in dem Verbot der Prozessionen bestehen, das Couton verlangte.
Trotz Coutons Drängen war der Zug der Gläubigen daher weiterhin unbehelligt geblieben. Marais’ einziges Zugeständnis bestand darin, dass er überall in der Stadt Plakate anschlagen ließ, die vor den Gefahren von Ansammlungen in den Zeiten der Pest warnten.
Die Seuche hatte auch von dem so leutseligen und fröhlichen Doktor ihren Tribut gefordert. Er war blasser geworden, wirkte übernächtigt und fahrig.
»Wenn der Rückgang der Toten ruchbar wird, schreibt man es nicht Ihrer Umsicht oder meinen Bemühungen zu«, erklärte er, »sondern diesem verrückten Priester und dessen Gebeten.« Und, so erläuterte Marais, dass man, bevor die Seuche endgültig auslief, stets einen solchen Rückgang der Opferzahlen beobachtete, der die Menschen dazu verleitete, ihre Vorsicht fahren zu lassen, was wiederum dazu führte, dass alles noch viel schlimmer wurde als zuvor.
Marais hatte strikte Order erteilt, kein Wort über die Gesamtzahl der Toten verlauten zu lassen, dennoch hatte sich die Nachricht vom ersten Abflauen der Seuche wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitet und führte eben jene Situation herbei, vor der Couton so eindringlich gewarnt hatte.
Eine große Gruppe von Anhängern des Abbés hatte sich zu allem Überfluss seit gut einer Woche zusammen mit dem Priester im Inneren der Kirche von Saint-Petrus eingeschlossen, um dort solange gemeinsam zu beten, bis Gott endgültig den Fluch der Pest von der Stadt nahm. Sogar noch größer als die Gruppe in der Kirche war jene Menschenmenge, die sich vor dem Kirchenportal versammelte, um wiederum den Menschen im Innern mit ihren Gebeten beizustehen. Es hatte vier Tage gedauert, bis die letzten Stimmen in der Kirche verstummten.
An diesem regnerischen Morgen nun war endgültig klar, dass in der Kirche nur noch Leichen zu finden sein konnten.
»Sie müssen dem Spuk ein Ende bereiten, Marais. Die Toten können nicht länger in der Kirche bleiben!«, forderte Couton und stellt mit einem lauten Knall sein leeres Glas ab.
Auch Marais leerte sein Glas und nickte ihm zu.
»Machen Sie sich bereit, Doktor! Ich habe für neun Uhr einen Zug Soldaten zur Kirche beordert. Ich erwarte Sie dort«, sagte er, nahm seinen Dreispitz und verließ das Haus des Arztes.
Pünktlich um neun Uhr befahl Marais einem Zug Marinesoldaten, eine starke Ankerkette am Kirchenportal von Saint-Petrus zu befestigen, anschließend spannte man drei Pferde davor und riss so das Portal aus den Angeln.
Couton hatte zuvor darauf bestanden, dass jeder der Soldaten Handschuhe trug und sich ein in Essig getränktes Tuch vors Gesicht band. Eine Vorkehrung, deren Notwendigkeit sich als Segen erwies. Im Innern von Saint-Petrus herrschte ein infernalischer Gestank.
Dem Trupp Soldaten bot sich ein grauenhafter Anblick. Wie groteske Puppen, ausgezehrt und steif, lagen die Toten auf dem Boden der Kirche. Viele von ihnen waren am Ende zusammengekrochen. In geisterhaft bleichen Haufen hatten sie sich ineinander verschlungen. Ihre Gesichter waren bizarre lederne Masken, Augen und Münder standen offen. Hitze und Gestank hatte Schwärme von Fliegen, Ratten und Maden angelockt, die in leeren Augenhöhlen, Mündern und Ohren wimmelten. Ein Karneval des Todes, gefeiert von Maden, Kakerlaken, Ratten, Spinnen und Fliegen.
Der Kirchenboden war von einem schlüpfrig schimmernden Belag überzogen – gebildet aus Fäkalien und geronnenem Blut. Ratten tummelten sich darauf, die auch schon von den reglosen Leibern gekostet hatten, und auf den klebrigen Bodenplatten waren Abertausende Fliegen verendet. Das prächtig leuchtende Grün ihrer vertrockneten Leiber wirkte auf Couton und die Marinesoldaten wie Hohn. So einige unter den Soldaten schauten ängstlich zur Statue des Heilands hinauf und bekreuzigten sich.
Die Blicke des Doktors blieben lange auf zwei Frauen haften, die ihre Kleinkinder im Arm hielten, als hätten sie bis zum Schluss gehofft, sie allein durch jene Geste vor dem unausweichlichen Ende bewahren zu können.
Und Marais?
Er war zwar als Erster – noch vor seinen Männern und dem Doktor – ins Kircheninnere eingedrungen, hielt seinen Blick jedoch all die Zeit niedergeschlagen und hatte seither noch kein Wort von sich gegeben.
Es war eine furchtbare Arbeit, die ineinander verkrallten Leichname voneinander zu lösen und draußen auf die herbeigerufenen Karren zu verladen. Obwohl Soldaten während ungeliebter Tätigkeiten gewöhnlich dazu neigten, ihre Handgriffe mit Flüchen und derben Witzen zu begleiten, fiel an jenem Tag in Saint-Petrus außer einigen gemurmelten Stoßgebeten kaum ein Wort.
Während die Marinesoldaten die ersten Toten aus der Kirche schleppten, befahl Marais den Männern plötzlich mit kratziger Stimme, ihre Arbeit zu unterbrechen. Ohne weitere Erklärung stieg er zur Empore hinauf und sah von dort aus eine Zeitlang schweigend auf den mit Leichnamen bedeckten Kirchenboden hinab, bis er den Männern schließlich durch ein knappes Handzeichen befahl, weiterzumachen.
Auch nach fünf Jahren, die er hier in Brest hauptsächlich mit Verwaltungsangelegenheiten verbrachte, hatte Marais nichts von dem geschulten Auge und kühl kalkulierenden Verstand des begabten Polizisten verloren, der er einst in Paris gewesen war. Und etwas an Lage und Anordnung der Leichen war ihm ins Auge gefallen.
Weshalb waren die Leichname in drei deutlich voneinander getrennten Gruppen angeordnet, fragte er sich. Sicher, es entsprach menschlichem Verhalten, sich in der höchsten Not aneinander zu drängen, um in der Berührung mit dem Nachbarn Schutz und Trost zu suchen. Doch weshalb hatten sich hier drei Gruppen gebildet – nicht eine einzige, oder womöglich ja auch zwei? Sondern drei? Von denen eine im Übrigen deutlich kleiner war als die beiden anderen.
Erst nachdem er sich von der Empore aus einen Überblick über den gesamten Kirchenraum verschafft hatte, gelangte Marais zu einer Erklärung.
Kurz vor dem Ende mussten einige der im Kircheninneren gefangenen Menschen versucht haben, zu fliehen. Aber sie waren von den anderen mit allen Mitteln daran gehindert worden, das verrammelte Kirchenportal aufzubrechen, um nach draußen zu gelangen. Dies musste die größte Gruppe, jene nächst dem Kirchenportal, gewesen sein. Eine zweite, nur etwas kleinere Gruppe, die sich kaum zehn Schritte von ihnen entfernt befand, war die ihrer Gegner. Und die zehn oder zwölf Gestalten, welche sich in einem Halbkreis um den Abbé Maurice zum Sterben niedergelegt hatten, bildeten die der Anführer.
Steif und mit vorgerecktem Kinn verharrte Marais auf der Empore. Seine Augen wirkten stumpf und seine Finger hatten sich um die glatte Brüstung gekrallt.
Der Anblick des stocksteif hinter der Brüstung stehenden Marais erzeugte in Couton maßlosen Zorn. Der Doktor war mit seinen Sanitätern und Freiwilligen seit dem Ausbruch der Seuche Tag für Tag unterwegs gewesen, um den Kranken Linderung zu verschaffen. Er war angespannt, erschöpft und übernächtigt. Für ihn hatte Marais die Schweinerei hier in Saint-Petrus im Grunde ebenso zu verantworten wie der wahnsinnige Abbé Maurice.
Je länger Couton zu Marais hinaufsah, umso größer wurde sein Zorn. Zumal Couton sicher war, dass Marais’ scheinbar so überhebliche Gelassenheit zwangsläufig auch die Moral der Männer beschädigen musste. Denn die fieberten geradezu nach einer kleinen Geste des Anstands und Mitgefühls vonseiten ihres Präfekten. Doch Marais hatte sich dort oben in Mantel und Hut wie ein böser dunkler Engel hinter der Empore aufgebaut.
Couton ließ alles stehen und liegen, und stürmte durch die Kirchenbänke hindurch zur Empore, um Marais zur Rede zu stellen. Der Zorn des Doktors verrauchte jedoch, sobald Marais ihm auf der Empore still das Gesicht zuwandte und für einen Augenblick sein in Essig getränktes Tuch herabstreifte.
Marais’ Wangen glänzten feucht. Nicht vor Schweiß, sondern von Tränen, die ihm ungehindert aus den Augen rannen.
Die Finger des Präfekten hatten sich dabei so fest um den Handlauf der Brüstung gekrallt, dass sie vor Anspannung beinah so unnatürlich weiß und dünn wirkten, wie die all jener Toten da unten am Kirchenboden.
Plötzlich peinlich berührt, wandte sich Couton wortlos wieder ab und lief zur Treppe zurück.
Weder der Doktor noch die Marinesoldaten konnten ahnen, dass Marais dort oben Zwiesprache mit seinem Gott hielt, während ihm Tränen des Zorns über die Wangen liefen. Tränen des Zorns über seine eigene Feigheit und Tränen des Zorns über den Abbé Maurice, der jeden Anstand und jedes Mitgefühl verriet, als er seine Gefährten daran hinderte, dieser irdischen Hölle zu entkommen.
Es dauerte bis zum Abend Saint-Petrus von den Leichnamen zu räumen. Zum Ende waren die Männer erschöpft wie nie. Zur körperlichen Erschöpfung gesellte sich die geistige. Marais ließ ihnen Sonderrationen an Wein und Rum austeilen. Zugleich wies er auf den letzten Karren, auf dem sich inzwischen auch der Leichnam des Abbé Maurice befand. »Dass mir keiner auf die Idee kommt, ihn etwa gesondert zu bestatten! Er kommtins Massengrab zu allen anderen!«, befahl er. Den Marinesoldaten war anzusehen, wie unangenehm ihnen der Befehl war, einen Priester in einem Massengrab zu verscharren.
Zurück in seinem schmucklosen Büro in der Präfektur, ging Marais das Briefeschreiben schwerer als sonst von der Hand. Obwohl er Nacht für Nacht in einem Brief an seine Frau Nadine die Ereignisse in der Stadt zusammenfasste, hatte er selbst seit über einem Monat nichts mehr von seiner Familie gehört. Nadine lebte mit ihrem Sohn Paul in einem Örtchen außerhalb der Stadt. Marais hielt sie dort für sicher vor der Seuche. Seine Briefe an sie bewahrte er verschnürt mit einem roten Band in einer Schublade seines Schreibtischs auf. Und genauso würde Nadine es mit ihren Briefen an ihn halten, so hatten sie es abgesprochen, als Marais sie vor dem Quarantänebefehl zuletzt gesehen hatte. Er hätte es nicht für opportun gehalten, darauf zu bestehen, dass man mit der täglichen Lebensmittellieferung, auch die Briefe seiner Frau in die Stadt brachte. Die Pest wütete zwar auch außerhalb der Stadtmauern, hatte dort aber nicht so fest Tritt fassen können wie innerhalb Brests.
Sechs Tage nach den Ereignissen in Saint-Petrus empfing Couton Marais besonders gut gelaunt zu ihrer morgendlichen Besprechung. Gewöhnlich bat er ihn dazu in sein Wohnzimmer, in dem es stets angenehm nach frischem Tee duftete, der inzwischen eine Seltenheit in Frankreich geworden war. »Letzte Nacht gab es nur einen Toten, Louis. Ein Fischer mit Lungenentzündung. Ich denke, es ist für dieses Mal überstanden.«
Sie einigten sich darauf, dass man – nur um wirklich sicher zu gehen – noch zwei weitere Tage warten sollte, bevor Marais die Quarantäne über Brest endlich aufheben ließ.
Auf diese Nachricht hin strömten die Menschen aus ihren Häusern und nahmen die Plätze, Gassen und Straßen ihrer Stadt so rasch und reibungslos wieder in ihren Besitz, dass es Marais beinah wie ein Wunder vorkam. Die Fröhlichkeit der Leute dort unten auf dem Platz kam ihm schäbig vor. Ihm war, als trampelten sie auf den Gebeinen der Toten herum. Andererseits entsprach aber genau dies nun einmal dem Lauf der Welt.
Marais zog den Packen Briefe hervor und schob ihn in eine Kuriertasche. Er rief nach seinem Burschen Sergeant Strass und befahl ihm, zwei gute Pferde aufzusatteln.
Der Titel Bursche war irreführend, denn Sergeant Strass war ein Mann, der die Blüte seiner Jahre längst hinter sich hatte. Er war kräftig und untersetzt, das Haar grau und unordentlich, und er war seinem Herrn seit Jahr und Tag treu ergeben.
Strass schob zwei geladene Pistolen in die Satteltaschen. Außerdem hatte er zwei blanke Säbel dabei. Schon zu gewöhnlichen Zeiten trieb sich allerhand Gelichter auf den Straßen Frankreichs herum. Jetzt jedoch mochte nur Gott allein wissen, wie viele Strauchdiebe, Totschläger und Verzweifelte sich während der Quarantäne um die Stadt angesammelt haben mochten.
Marais hatte seine Familie von Anfang an nicht in Brest haben wollen, das ihm mit seinen Sträflingen im Marinegefängnis, den Soldaten, betrunkenen Seeleuten, Händlern und rauen Fischern nicht als der rechte Ort für eine Frau und ein kleines Kind erschienen war. So hatte er keine Zeit verloren, gleich nach seiner Versetzung jenes Haus in der kleinen Ortschaft etwas außerhalb der Stadt zu erwerben, wo sein Sohn in Frieden zwischen Weiden, Feldern, Sand und Meer aufwachsen würde.
Doch bereits nach wenigen Minuten Reitzeit hörten Marais und Strass von einem Bauern, dass vor einiger Zeit in der Gegend um Marais’ Haus ein begrenztes Aufflackern der Seuche zu verzeichnen gewesen war. Ihr Ritt durch flache windgepeitschte Wiesen und Felder zog sich für Marais scheinbar endlos hin. Obwohl er in Wahrheit kaum mehr als eine Stunde dauerte.
Als Marais sein Haus verlassen und dessen Türen verrammelt vorfand, ritten sie zum Pfarrhaus des kleinen Sprengels direkt an der Küste, zu dem das Haus zählte. Dort erfuhren sie von dem alten Gemeindepriester, was geschehen war.
»Ihre Frau und Ihr Sohn, Monsieur le Préfet, waren die letzten Toten. Wir glaubten es schon überstanden zu haben. Es waren ja auch nur fünf, die sich die Pest aus unserem Dorf geholt hat. Doch als es begann, bestand Madame Marais darauf, dass man Sie nicht benachrichtigt. Es gebe in Brest Wichtigeres, worum Sie sich zu sorgen hätten, sagte sie.«
Strass empfand Marais’ äußerliche Ruhe angesichts der Schreckensnachricht des Gemeindepriesters beinah als unerträglich. Der Pfarrer begleitete Marais auf den Friedhof, der etwas abseits von der aus grauem Stein errichteten Kirche auf der Kuppe eines Hügels lag. Windflüchter und ein paar halb verwitterte Engelsstatuen bildeten seinen einzigen Schmuck. Viele Gräber waren uralt und ihre Steine schon vor Jahrzehnten so tief in die Erde eingesunken, dass sie unter dem harten Gras kaum noch auszumachen waren.
Marais schickte den Priester mit einer herrischen Geste zurück und blieb mit gesenktem Haupt und dem Hut in der Hand lange bei dem Fleckchen Erde stehen, das als letzte Ruhestätte seiner kleinen Familie diente.
Strass konnte nur erahnen, was in dem Präfekten vorgehen mochte. Haderte er mit seinem Gott? Das wäre nur zu verständlich gewesen. Strass sah, wie Marais den Hut wieder aufsetzte, und als er das Friedhofstor erreichte, hätte ein zufälliger Beobachter in seiner Haltung keine Spur mehr von der Last seines Schmerzes bemerkt.
»Wohin, Monsieur?«, fragte Strass.
»Zum Haus.«
Marais trieb sein Pferd unbarmherzig an. Strass folgte ihm in einigem Abstand.
Das zweistöckige Haus war ein massives Gebäude, errichtet aus demselben grauen Stein wie die Kirche, die umliegenden Höfe und der Dorfladen. Es lag am Rande des Ortes und verfügte über gute Glasfenster, eine feste Tür aus dickem Buchenholz und war umgeben von einem sorgsam gepflegten Garten, der sicherlich der ganze Stolz von Madame Marais gewesen war.
Marais sprang von seinem Pferd und band es an einen Ring in der niedrigen Steinmauer, die den Vorgarten vom Rest des Grundstücks trennte. Er befahl Strass zu warten, presste sich sein Taschentuch vor Nase und Mund und betrat das Haus.
Strass hörte, dass Marais drinnen die Treppe hinaufging, und sah dann, wie er nach und nach alle Fenster im Haus schloss und sogar die Fensterläden verriegelte, als bereitete er das Haus auf einen bevorstehenden Sturm vor.
»Dein Feuerzeug!«, forderte Marais Strass auf, nachdem er wieder zu ihm getreten war. Der Sergeant kramte in seinen Taschen und brachte Stahl und Stein zum Vorschein.
Marais öffnete die Kuriertasche, nahm die Briefe an Nadine und ging mit dem Bündel und Strass’ Feuerzeug wieder ins Haus. Als Marais wenige Minuten später wieder aus dem Haus trat, quoll bereits Rauch unter dessen Tür hervor.
Als einige Dorfbewohner aufgeschreckt von dem Geruch des Feuers mit Wassereimern zu Hilfe eilen wollten, befahl Strass ihnen barsch zu verschwinden.
Zwei Stunden oder länger stand Marais in seinem dunkelblauen Mantel mit dem schwarzen Dreispitz auf dem Kopf und dem hellen Tuch vorm Gesicht regungslos zwischen dem brennenden Haus und der Scheune. Ein paarmal war es Strass, als hätte er ihn irgendetwas rufen hören. Doch das Feuer prasselte so laut, dass er sich auch geirrt haben konnte.
Strass verstand nur zu gut, was seinen Herrn antrieb. Er war der Sohn eines wandernden Scherenschleifers und aufgewachsen unter Hausierern, Gauklern, Bettlern und Taschendieben, wie sie die Märkte der Kleinstädte unsicher machten. Ganz gewöhnliche Leute mochten ihre Häuser nach dem Tod ihrer Liebsten ausräuchern, tünchen und umgestalten. Das fahrende Volk jedoch nahm auf dieselbe Weise Abschied von seinen Toten, wie Marais dies tat: Indem die Menschen deren Wagen mit all ihrer Habe darin verbrannten und so die Seelen ihrer Toten freisetzten.
In Brest erzählte man sich, Marais stamme aus einer Beamtenfamilie in der Auvergne. Doch Strass begriff: Marais musste wie er selbst unter fahrendem Volk auf der Straße aufgewachsen sein. Vielleicht war er gar ein gitan, ein Zigeuner. Doch da er Marais stets für dessen unbestechlichen Gerechtigkeitssinn geschätzt hatte, sandte er für ihn ein stilles Gebet zum Himmel. Es war das Gebet eines alten Soldaten: »Herr, mein Gott, vergib ihm seine Schuld. Du musst. Denn Du hast ihn so geschaffen, wie er ist.«
Auf dem Marktplatz und in den Straßen der Hafenstadt herrschte ein fröhliches Treiben, als die beiden Männer vor der Präfektur von ihren Pferden absaßen. Man feierte ausgelassen die neu gewonnene Freiheit mit Wein, Musik und Tanz.Gegen elf Uhr nachts sollte sogar ein Feuerwerk das Volksfest krönen. Die Stimmnung hatte etwas von einem unverhofften Karneval.
Marais nahm von dem Trubel jedoch kaum etwas wahr. Er war in seinem Büro und ordnete seine Akten. Sein Nachfolger würde seine Angelegenheiten in einem vorbildlichen Zustand vorfinden. Marais’ Entschluss stand fest: Er würde sich, sobald alle Akten geordnet waren, eine Kugel in den Kopf jagen.
Nie hätte er gedacht, dass er einmal an Gottes Güte und unermesslichen Gnade zweifeln würde. Wenn man bedachte, wo einst seine Wiege gestanden hatte und wie weit er es schließlich gebracht hatte, so war nachvollziehbar, dass er sich all die Jahre für einen von Gott Begünstigten gehalten hatte. Nicht einmal seine erzwungene Versetzung aus Paris hierher nach Brest hatte etwas an seiner Überzeugung, ein Glückskind zu sein, ändern können. Obwohl die ersten Monate hart gewesen waren, war es ihm gelungen, sich gut in dem neuen Leben einzurichten. Er hatte Nadine an seiner Seite gehabt, die ihm stets eine Stütze gewesen war.
Nun war all dies zunichtegemacht worden.
Er war selbst schuld gewesen. Er hätte auf Couton hören sollen und niemals zulassen dürfen, dass dieser wahnsinnige Priester sich mit seiner Gefolgschaft in Saint-Petrus verbarrikadierte. Ein wenig mehr Entschlusskraft und Schneid, und er hätte das Schlimmste verhindern können.
Doch er hatte nichts unternommen.
Und zu all dem kam der Tod seiner Familie. Während er an ihrem Grab stand, dem Priester zuhörte, der ihn mit seinen seltsam ausgelaugten Worten zu trösten versuchte, raste Marais gegen seinen Gott, der diese Katastrophe zugelassen hatte. Denn lag nicht alle Macht bei Gott? Und war er daher für seine Versäumnisse nicht ebenso zu verdammen, wie Marais für die seinen? Womöglich ja sogar mehr noch als der schwache Mensch Louis Marais? Doch während er später sein Haus brennen sah, begriff er, dass er nicht Gott allein verantwortlich für sein Unglück machen durfte. Nein, sein Entschluss stand fest.
Das Furchtbarste an seinem Vorhaben, sich selbst ein Ende zu setzen, war, dass er damit auch jedes Versprechen auf ein Wiedersehen mit seiner Frau und seinem Sohn verspielte, die er in diesem Augenblick sicher und glücklich in Gottes Paradies wusste. Denn Suizid war eine Todsünde und würde Marais in die Hölle verdammen.
Doch was war ein Leben allein und mit dem Wissen, dass er diese Leute in Saint-Petrus ihrem Tod ausgeliefert hatte, obwohl es in seiner Macht gestanden hätte, sie davor zu bewahren? Verdammt zum ewigen Fegefeuer war er durch seine Versäumnisse als Präfekt ohnehin. Diese Welt war ihm seit Nadines und Pauls Tod Hölle genug. Besser jetzt und hier durch eigene Hand ein rasches Ende machen, als in dieser leeren und furchtbaren Welt weiter zu existieren, bis er eines Tages auf natürlichem Wege in Gottes Hölle gelangte.
In einem polierten Ebenholzkasten auf dem Aktenschrank lagen zwei gut geölte Duellpistolen, die er von seinem Vorgänger in der Präfektur übernommen hatte. Marais hob den Kasten herunter, legte ihn vor sich auf den Tisch und öffnete ihn. Zusammen mit den beiden Waffen lagen auch Putzstock, Pulverbeutel, Zündblättchen und eine Handvoll Bleikugeln in dem Kasten. Er prüfte nacheinander beide Pistolen auf ihre Funktionstüchtigkeit und entschied sich für jene, die ihm um einen Hauch besser ausbalanciert erschien. Dann roch er misstrauisch an dem Schießpulver und zerrieb ein wenig davon zwischen Daumen und Zeigefinger. Es war staubtrocken und gut angemischt. Zuletzt suchte er die Kugel aus. Er griff nach dem Militärdolch, der ihm als Brieföffner diente, und schnitt zwei tiefe Kerben in das weiche Blei der Kugel ein.
Für Marais war es eine Frage von Anstand und Würde, gerade in diesem letzten Akt auf Erden nicht zu versagen. Er war ein Mann, der mit Schusswaffen umzugehen wusste. Eine gekerbte Kugel würde beim Eindringen in seinen Schädel in Splitter zerspringen, die ihm sein Hirn zu Brei zermahlen würden.
Marais lud die Waffe, legte sie dann wieder auf den Schreibtisch, trat ans Fenster und sah einen Moment dem ausgelassenen Treiben auf dem Marktplatz zu. Er wunderte sich über das offensichtliche Zutrauen in die Welt und in die Zukunft, das die Leute dort unten so kurz nach der Katastrophe beflügelte. In seinem eigenen Herzen fand er dafür keinen Platz mehr.
Er ging wieder zum Schreibtisch, ergriff die Waffe, trat zwei Schritte in die Mitte des Raumes, setzte den Lauf der Pistole an den Kopf und schloss die Augen.
Was war das schon? Die Krümmung seines Fingers, dann – Dunkelheit. Ein einziger kurzer Moment.
Er versuchte es.
Nichts.
Er war unfähig, seinen Finger zu krümmen.
Verblüfft über sich selbst setzte er die Waffe ab, betrachtete sie verlegen und setzte sie erneut an den Kopf.
Doch wieder wollte es ihm nicht gelingen.
Erschöpft ließ Marais sich auf den Stuhl sinken. Er war schweißgebadet. Ganz offensichtlich war er außerstande, einen Schlussstrich zu ziehen. Zu dem Versagen als Präfekt und Beschützer seiner Familie kam nun noch die Erkenntnis, ein Feigling zu sein.
Draußen, am Nachthimmel, explodierten die ersten bunten Sterne des Feuerwerks.
Marais erhob sich und holte eine Flasche Cognac aus dem Aktenschrank, stellte ein Glas dazu, das er zuvor mit seinem Hemdzipfel vom Staub befreite, und schenkte sich einen kräftigen Schluck ein.
Wie vielen Menschen war es wohl ähnlich ergangen, fragte er sich. Selbstmord war eine Angelegenheit, die sich im Verborgenen abspielte. Die Welt erfuhr vom Ergebnis. Doch niemals hörte man etwas darüber, wie oft dieser oder jener sich die Schlinge wieder vom Hals streifte, wie oft er die Waffe wieder absetzte oder wie viele verzweifelte Schwimmzüge einer noch vollführte, bevor er sich schließlich widerstandslos den Fluten überließ.
Marais trank den Cognac in zwei gierigen Schlucken und füllte das Glas erneut. Eine tiefe Ruhe durchströmte ihn. Ein drittes Glas Cognac – ebenso hastig hinuntergeschüttet wie die beiden zuvor.
Draußen explodierten immer noch bunte Bälle und strahlende Sterne, die dann wirbelnd aus dem klaren Nachthimmel wieder zur Erde herabstürzten.
Jetzt galt es.
Er dachte darüber nach, es hier am Schreibtisch zu tun. Doch würde das die Dossiers und Aktenstücke, die er darauf geordnet hatte, mit seinem Blut besudeln. Was ihm als unzulässig und würdelos erschien. Also griff er nach der Duellpistole, löste sich vom Schreibtisch und trat wieder in die Mitte des Raumes.
Er setzte den Lauf an den Kopf, atmete tief durch und schloss die Augen.
Doch wieder gelang es ihm nicht, seinen Finger dazu zu bringen, den Abzug durchzuziehen. Für eine Schrecksekunde wähnte er sich in einer Hölle, die zynischerweise der Welt glich, die er gerade so verzweifelt zu verlassen versuchte.
Aber er war am Leben und erneut gescheitert.
Wie sehr er sich doch nach der Dunkelheit sehnte. Wie sehr er sich vor sich selbst ekelte.
Verzweifelt sank er auf den Stuhl.
Marais hätte nicht zu sagen vermocht, wie lange er so dagesessen hatte. Es musste bereits Mitternacht gewesen sein, als es plötzlich an der Tür klopfte und Strass hereintrat.
»Ein Bote aus Paris, Monsieur. Er sagt, er müsse seine Antwort gleich haben.«
Strass legte die Depesche, die der Bote gebracht hatte, auf Marais’ Schreibtisch, wandte sich um und verließ das Zimmer. Marais sah ihm nach. Dann wandte er sich der Depesche zu. Bei dem Siegel darauf handelte es sich um das des Polizeiministers. Außerdem war Dringend darauf vermerkt und zweimal unterstrichen worden.
Fast fünfzehn Jahre lang war Marais Polizeiagent in Paris gewesen. In dieser Zeit hatte er seine größten Erfolge gefeiert und es zum wohl berühmtesten Polizisten in Frankreich gebracht. Trotzdem hatte Monsieur le MinistreJoseph Fouché ihn vor fünf Jahren, zwei Monaten und zwölf Tagen mithilfe einer raffinierten Intrige seines Postens enthoben und hierher nach Brest verbannt.
Mit einer einzigen Ausnahme hatte Marais keinen Mann je so tief verachtet wie den Polizeiminister Fouché. Marais hatte seinen Beruf immer als eine Art Spiel begriffen. Wenn man so wollte, war der Beruf des Polizisten eine Variante der Jagd. Aber zur Jagd – wie zum Spiel – gehörte es, dass man sich nach einer Niederlage als guter Verlierer gab. Fouché jedoch war dazu nicht fähig gewesen. Für ihn bedeutete jede Niederlage eine persönliche Demütigung, die es auszuwetzen galt – und zwar um jeden Preis.
Marais wog die Depesche in der Hand. Ich könnte sie verbrennen und den Boten ohne Antwort zurückschicken, dachte er.
Letztlich siegte sein Pflichtbewusstsein. Dies war ein amtliches Dokument, und es war an ihn persönlich gerichtet. Er war schließlich immer noch Beamter.
Marais erbrach das Siegel.
Monsieur,
dringende Ermittlungen erfordern Ihre unverzügliche Rückkehr. Ernennung zum Commissaire du Police Judiciaire hiermit erfolgt. Einsatzort: Sicherheitsbüro Paris, Rue Sainte-Anne.
Joseph Fouché, Paris
Ungläubig begriff Marais, dass Fouché ihm seinen alten Posten anbot. Natürlich bedeutete der Posten eines Commissaire, gemessen an seiner Stellung hier in Brest, einen gewissen Abstieg. Aber es bedeutete auch, dass die Dinge in Paris schlimm stehen mussten, wenn der alte Fuchs über seinen Schatten sprang und sich ausgerechnet an Louis Marais wandte.
Marais hatte ein Talent dafür, Morde aufzuklären. Das wusste Fouché besser als jeder andere im Ministerium. Daher lag die Vermutung nahe, dass es ein Mord war, der den Minister dazu bewog, nach ihm zu rufen.
Was nun, fragte sich Marais, sollte er wirklich nach Paris zurückkehren?
Noch vor wenigen Augenblicken wollte er seinem Leben ein Ende setzen, doch er hatte es nicht vermocht. Und jetzt rief dieses verhasste Leben nach ihm, als wäre nichts geschehen. Marais fragte sich mit bitterer Ironie, wer ihn hier in Gestalt dieser Depesche in Versuchung führte – Gott, der Herr, oder jener alte kahlköpfige Betrüger, den man gemeinhin Satan nannte?
Letztlich, sagte er sich, war es gleich. Was hatte er schon zu verlieren? Nichts.
Er erhob sich, trat zur Tür.
»Strass! Ein Pferd! Meinen Mantel! Einen Koffer für die Papiere!«, rief er.
Die Tür öffnete sich, und Strass steckte seinen Kopf durch den Spalt.
»Monsieur le Préfet?«
Marais war bereits aufgestanden und trug unter dem Arm den Ebenholzkasten mit den beiden Pistolen.
»Worauf wartest du? Hast du mich nicht verstanden? Beweg dich!«
Strass’ eilige Schritte verklangen im Flur.
Als an diesem Morgen die Sonne aufging, stattete Marais Couton einen kurzen Abschiedsbesuch ab. Bevor er das Haus des Doktors verließ, legte er den Ebenholzkasten mit den beiden Duellpistolen auf dessen Schreibtisch ab. »Bewahren Sie das für mich auf, Couton. Womöglich werde ich eines Tages danach schicken lassen.«
2
DER GEHEIME GARTEN
Der Mann hielt einen stumpfen Spiegel in der Hand und trug ein Damenkorsett über einem weißen Nachthemd. Er stand auf einer zwei Meter hohen Bühne. Die Frau neben ihm hatte einen angemalten Bart und ihr wirres graues Haar unter einen verrosteten Gardistenhelm gestopft. Ihr faltiger Hals ragte aus einem schimmernden Brustharnisch, und ihre schwarzen Männerhosen waren in der Taille so weit, dass sie mit einem Strick gehalten werden mussten. Zwischen beiden schlug ein mongoloider Zwerg ohne erkennbaren Rhythmus auf eine Trommel ein, die so groß war, dass er fast vollständig hinter ihr verschwand.
Anlass dieser Versammlung war eine Theaterprobe im Hauptsaal des Asyls von Charenton. Regisseur, Dramaturg, Intendant und Kostümbildner des Stückes war ein Adeliger namens Donatien Alphonse François, Marquis de Sade, und das Stück, welches man probte, Molières Don Juan.
Seit einigen Jahren galten de Sades Theateraufführungen in Charenton unter den Reichen und Schönen von Paris als der letzte Schrei.
De Sade war dreiundsechzig Jahre alt und hatte selbst seine zweitbesten Jahre längst hinter sich. Er war von mittlerer Statur. Das Gesicht mit der großen, leicht gebogenen Nase war fleischig, die Lippen elegant geschwungen, jedoch recht schmal. Eindrucksvoll waren seine blauen Augen. De Sade galt in seiner Jugend als schöner Mann. Inzwischen war er dick geworden, Rheuma und Gicht plagten ihn, und er zog beim Gehen sein rechtes Bein etwas nach.
Er hatte vor der Bühne in einem abgewetzten Sessel Platz genommen und genoss sichtlich den skurrilen Anblick, der sich ihm bot. Sein ausgeblichener Brokatrock mit den Seidenaufschlägen war nach einer längst vergangenen Mode geschneidert, seine Stiefel zerkratzt und die Sohlen löchrig, die Perücke auf seinem Kopf voller Löcher, und der Edelstein in dem vermeintlich kostbaren Ring an seiner rechten Hand war in Wahrheit nur ein Stück farbiges Glas.
Monsieur le Marquis war Abkömmling eines Geschlechts, das seit Jahrhunderten zum Hochadel Frankreichs zählte, und doch hatte er mehr als die Hälfte seines Lebens in Festungen, Gefängnissen oder Irrenanstalten verbracht. In einem Dokument der kaiserlichen Staatskanzlei begründete man seine Einweisung nach Charenton damit, dass er – wie seine obszönen Romane unmissverständlich zeigten – an »ausschweifender Demenz« leide, die seine Unterbringung in einer Irrenanstalt nicht nur rechtfertige, sondern dringend erfordere. Allerdings flüsterte man auch, dass der wahre Grund für seine Einweisung eine Schmähschrift gegen Kaiser Napoléon Bonaparte darstellte. Dass de Sade die Urheberschaft daran stets empört von sich wies, zählte nicht.
Neben de Sade nahm in einem zweiten Sessel gerade ein verwachsener Buckliger Platz. Er war nicht größer als ein Knabe, nannte sich Abbé Coulmier, war der Direktor des Asyls von Charenton und unterstützte de Sades Theaterinszenierungen bedingungslos, da er sie für eine geeignete Form der Therapie hielt.
Der Abbé blickte de Sade in einer Mischung aus Amüsement und Neugier an. »Ich bin ja einer Meinung mit Ihnen, mein Freund: Einen stummen, glatzköpfigen Debilen hat vor Ihnen bestimmt noch keiner als Don Juan besetzt. Obwohl man sich natürlich fragt, wie Sie einen Stummen dazu bewegen wollen, seinen Text zu sprechen. Eine Pantomime ist das Stück ja nun nicht.«
»Sprechen soll er ja auch gar nicht, Coulmier. Seinen Part wird der junge Lataque hinter der Bühne deklamieren.«
Der junge Lataque verfügte über einen geradezu göttlichen Körper war aber völlig in sich selbst versunken und besaß die Fähigkeit, ganze Bücher auswendig zu lernen, die er dann mit ausdrucksloser Stimme und ohne den geringsten Fehler wiederzugeben pflegte.
De Sade zauberte einen appetitlichen Apfel aus seiner Rocktasche und hielt ihn Coulmier vors Gesicht. »Mein Theater ist wie dieser Apfel. Man soll es schmecken und riechen, berühren und fühlen können. Und vor ihm erschrecken …«
De Sade brach den Apfel entzwei. Dessen Inneres war faulig braun und wimmelte von weißlichen Würmern.
Coulmier nahm die beiden Apfelhälften in die Hand und betrachtete die Maden. »Ich verstehe. Alle Schönheit ist grausam«, sagte er, warf den Apfel angewidert zu Boden und zertrat ihn unter seinem Stiefelabsatz.
»Genau, Coulmier. Sie als buckliger Zwerg sollten diese Erkenntnis ganz besonders zu schätzen wissen«, sagte de Sade.
Nicht alle Insassen von Charenton waren tatsächlich krank. Einigen bot das Asyl einfach eine bequeme Flucht vor der Realität. In anderen Fällen hatte man unliebsame Familienmitglieder mit stillschweigendem Einverständnis der Behörden hierher abgeschoben. Oft genug geschah das, um sich deren Vermögen unter den Nagel zu reißen. Eine weitere Kategorie bildeten Insassen wie de Sade, die aufgrund von mehr oder weniger undurchsichtigen Intrigen hier gelandet waren. Die meisten dieser Leute hatten sich nach und nach mit ihrer Situation abgefunden und versuchten das Beste aus ihrer Lage zu machen. Eine weitere Gruppe der ständigen Bewohner des Asyls bildeten die Angehörigen von Insassen, die sich – aus Zuneigung oder Pflichtgefühl – entschlossen hatten, ihr Leben zusammen mit ihren Lieben hinter Mauern zu fristen. So war auch de Sades Geliebte, Madame Constance Quesnet, vor zwei Jahren zu ihm hierher nach Charenton gezogen.
Coulmier warf dem Marquis einen melancholischen Blick zu. Er war fasziniert von de Sades Phantasie, seiner Willenskraft und Energie. Und er beneidete ihn heimlich um dessen Erinnerungen an Ausschweifungen und Laster, zu denen es ihm selbst sein Leben lang an Mut, Vermögen und gutem Aussehen gefehlt hatte.
Auf der Bühne begann der Zwerg erneut wild zu trommeln. De Sade hatte ihn schon mehrfach ermahnt, nicht so einen Lärm zu veranstalten, aber vergebens.
Unvermittelt brachen die Trommelschläge ab. Der debile Stumme warf seinen Handspiegel zu Boden, und den dünnen Lippen der Frau im Harnisch entrang sich ein erstauntes Quieken. Doktor Royer-Collard – Anstaltsarzt und erbitterter Gegner der Theateraufführungen in Charenton – hatte den Saal betreten. Er klatschte mehrmals in die Hände. »Manou, Lorraine, Stanislaw – Zeit fürs Bad!«
Er wandte sich um, zum Zeichen, dass er keine Widerworte duldete.
»Idiot!«, zischte Coulmier, während er der Dame im Harnisch, dem Zwerg und dem stummen Glatzkopf mit einer Geste zu verstehen gab, dass die Probe für heute beendet sei.
Während die Schauspieler von der Bühne stiegen, zückte de Sade ein Schnupftabaksdöschen und zog geräuschvoll schniefend eine Portion des gelblichen Pulvers von seinem Handballen in die Nasenlöcher, woraufhin er sich mit dem Rockärmel Rotz und Tabakreste vom Gesicht wischte. Gewöhnlich hätte Royer-Collard es nicht gewagt eine Probe zu unterbrechen, solange der Abbé sich im Saal aufhielt. Der Doktor war bereits bei der Tür, als er sich noch einmal zu Coulmier und de Sade umwandte.
»Ach übrigens, Bürger de Sade, da warten zwei Polizisten in Ihren Räumen. Sie haben eine Order vom Präfekten dabei.«
De Sade stieß einen Fluch aus. Sicher waren die Polizisten gekommen, um in seinen Kammern nach verbotenen Schriften und pornographischen Büchern zu suchen, wie sie das in regelmäßigen Abständen zu tun pflegten.
Als sich der Marquis steif erhob, fühlte er sich alt und müde. Er nickte Coulmier zum Abschied zu und machte sich auf, um zu sehen, ob er die Polizeiagenten bei ihrer Arbeit wenigstens ein bisschen behindern konnte. Zu jedem anderen Zeitpunkt hätte Constance das für ihn übernommen, doch befand die sich auf Besuch bei Verwandten auf dem Land.
Zu de Sades Verwunderung waren die beiden Polizisten an diesem Nachmittag nicht gekommen, um seine Habseligkeiten zu durchwühlen, sondern forderten ihn zu einem Ausflug nach Paris auf.
Die Kutsche wartete bereits im Hof.
Dass de Sade im Inneren der Kutsche von Jean-Marie Beaume, dem Polizeipräfekten von Paris, erwartet wurde, bedeutete allerdings mehr als nur eine Überraschung für den alternden Marquis. Das, so meinte er, konnte eigentlich nur in einer Bosheit enden – und zwar auf seine Kosten.
De Sade und Beaume tauschten ein paar nichtssagende Höflichkeiten aus, die kaum darüber hinwegtäuschen konnten, wie tief die gegenseitige Abneigung zwischen dem Polizeipräfekten und dem alten Libertin war. Zumal Beaume sich nicht dazu hinreißen ließ, de Sade Auskunft über Zweck und Ziel ihrer unerwarteten Ausfahrt zu geben. Beaume bestand sogar darauf, die Vorhänge zuzuziehen. »Immer noch jene alte Geschichte, de Sade?«, lächelte er. »Dabei sollte man doch meinen, das alles sei inzwischen lang genug her.«
De Sade wandte sich demonstrativ dem verhängten Kutschfenster zu.
»Nicht mir sollten Sie Vorwürfe machen, sondern Jean-Jacques Henri, oder meinetwegen auch Marais«, versuchte Beaume halbherzig, erneut eine Konversation in Gang zu bringen.
De Sade schwieg weiterhin. Trotzdem hatte Beaume ganz richtig vermutet, wenn er die üble Laune seines Passagiers auf »jene alte Geschichte« bezog. Damals hatten der frühere Polizeipräfekt von Paris Jean-Jacques Henri, Beaume und ein gewisser Louis Marais de Sade das Blaue vom Himmel versprochen, wenn er ihnen bei der Aufklärung einer spektakulären Mordserie half. De Sade war überzeugt, dass die beiden Polizisten ihm seinerzeit den entscheidenden Hinweis zur Lösung des Rätsels verdankten. Marais wurde durch die Verhaftung des Mörders und Kannibalen Lasalle in ganz Frankreich berühmt. Jean-Jacques Henri wurde zum Helden und Beaume befördert. Nur de Sade bekam nichts. Keines der Versprechen die Marais und der Polizeipräfekt ihm gegenüber gemacht hatten, wurde eingehalten.
Nun saß de Sade so viele Jahre später also erneut Jean-Marie Beaume gegenüber. Der Präfekt hatte sich kaum verändert. Immer noch hatte er etwas von einem jungenhaften Draufgänger an sich, das ihm jetzt umso besser zu stehen schien.
De Sade fragte sich, ob man ihn womöglich nur deswegen aus Charenton holte, um ihn irgendwo in einer dunklen Gasse einem Meuchelmörder auszuliefern. Womöglich reichte es dem Kaiser und dessen Polizeiminister ja nicht mehr, ihn einzusperren. Jean-Marie Beaume wäre auch nicht der erste Polizist, der sich für einen Mord einspannen ließe. Ihn dafür anzuheuern, stellte sogar einen besonders schlauen Schachzug dar. Wer wäre schließlich besser geeignet, einen Mord zu vertuschen, als der Polizeipräfekt von Paris?
Hoffentlich, dachte de Sade, würde es wenigstens schnell gehen. Beaume erschien ihm nicht wie ein Mann, der seine Freude daran hätte, bei einem Meuchelmord besonders grausam vorzugehen. Nein, er zählte zu der Sorte, die es schnell und schlagkräftig mochten. Ein einziger Augenblick grellen Schmerzes und alles war vorüber. Falls es so kam, fragte er sich, wäre das dann wirklich so furchtbar? Immerhin ginge er so mit einem Knalleffekt von der großen Bühne der Welt ab.
Die Kutsche hielt.
»Man erwartet Sie, Monsieur«, sagte Beaume und öffnete de Sade lächelnd den Schlag.
De Sade blickte den Präfekten fragend an, dann zog er seinen Bauch ein und stieg aus der Kutsche. Er fand sich im dunklen Hof eines Pariser Stadtpalais wieder, das sich in jedem der älteren Viertel der Stadt befinden konnte. Es war drei Stockwerke hoch und seine Fassade schmucklos schlicht. Eine Reihe alter Bäume säumte die Auffahrt. Kein Licht drang aus Türen oder Fernstern des Palais.
De Sade blickte sich nach Beaume um, der ihn mit einer Geste beschied, zur Tür zu gehen. »Klopfet an, so wird Euch aufgetan, wie es in der Schrift heißt«, lächelte der Polizeipräfekt.
Ein verlassenes Stadtpalais war ein guter Ort für einen Meuchelmord. Es konnte Tage dauern, bevor man hier seine Leiche fand. Doch de Sade wusste auch, was er seinem Stand und seinem Ruf schuldig war. Zweimal war er im Siebenjährigen Krieg als Offizier für Tapferkeit vor dem Feind ausgezeichnet worden. Er war ein Marquis von Frankreich, seine Ahnenlinie reichte weiter zurück als die der meisten Könige. Ein Mann wie er trat dem Tod nicht mit gesenktem Haupt entgegen. So ging – nein stolzierte – Monsieur le Marquis scheinbar gleichmütig der Eingangstür entgegen, ohne sich große Hoffnungen zu machen, dahinter auf irgendetwas anderes als den Tod zu treffen.
Sowie er die schwere Tür erreichte, wurde diese auch schon wie von Zauberhand geöffnet. In dem schmalen Spalt erschien eine runzlige Hand, die eine Lampe mit einer dünnen Kerze darin in die Höhe hielt.
»Arthur?«, rief de Sade erstaunt aus. Alles hätte er hier zu sehen erwartet, jedoch nicht dieses runzlige Gesicht mit der breiten Narbe auf der rechten Wange. Eine Narbe, die de Sade selbst dort hinterlassen hatte. Wie lange war das her? Fünfunddreißig Jahre? Eher wohl vierzig.
De Sades Herz raste. Wenn Arthur ihn erwartete, fragte er sich, war dann etwa auch sein Herr, der Comte Solignac d’Orsey, nicht weit?
De Sade verwarf den Gedanken. Der Comte musste längst tot sein. Er war bereits in den besten Mannesjahren gewesen, als de Sade ihn vor fast vierzig Jahren kennenlernte, und müsste daher heute beinahe hundert sein. Und kein Mann, der solch ausschweifenden Vergnügungen frönte wie es der Comte getan hatte, erreichte je ein solches Alter.
»Mitleid ist ein Schimpfwort für mich«, hatte der Comte damals gesagt, an jenem glorreichen Wintermorgen, als der blutjunge Marquis de Sade, besiegelt durch einen langen Kuss, dessen Schüler, Geliebter, Komplize und Kumpan wurde. Und was für ein gelehriger, eifriger und schöner Schüler Monsieur le Marquis doch gewesen war! Umso furchtbarer für ihn die Sommernacht, in der de Sades Zuneigung und Bewunderung in Verachtung und Hass umschlug, weil sein Herr und Meister, Lehrer und Geliebter, ihn ohne ein Wort der Erklärung zugunsten eines neuen, jüngeren Geliebten fallen ließ.
Der Comte war nicht der erste Libertin gewesen, mit dem de Sade in Kontakt gekommen war. Sein Onkel, Jacques-François de Sade, galt als der berühmteste Libertin und Freidenker seiner Zeit und hatte keine Gelegenheit versäumt, seinem jungen Neffen seine ganz eigenen Lebensansichten zu vermitteln. De Sade, enttäuscht von seiner kühlen Mutter und dem exzentrischen Vater, hatte die Zuneigung des Onkels dankbar erwidert. De Sades Onkel mochte zwar die in ihm vorhandenen Anlagen zum Provokateur und Libertin erkannt und geweckt haben, doch nachdem er jene Keime zu zarten Sprösslingen herangezogen hatte, brachte der Comte sie schließlich erst wirklich zum Erblühen.
Während de Sade später Jahrzehnte in Gefängnissen, Festungen und Irrenanstalten verbrachte, hatte der Comte in aller Stille einen Kreis ergebener Gefolgsleute um sich versammelt, die ihm bedingungslos folgten und seine Ansichten darüber, was ein wahrer Libertin sei, niemals in Zweifel zogen. Als die ersten Romane und Novellen des jungen de Sade erschienen, war es dieser geheime Zirkel, der seine Schriften und Ideen erbitterter verdammte als selbst der prüdeste Zensor. Für den Kreis des Comte hatten Libertins eine verschworene Elite zu bleiben, die jegliche Vorlieben und Leidenschaften ihres Zirkels eifersüchtig hütete und sich tunlichst der Öffentlichkeit fernhielt. Aber de Sade hatte dieses Gesetz gebrochen. Und obwohl de Sade sicher war, dass der Comte Solignac d’Orsey selbst längst tot und begraben sein musste, war er sich zugleich klar darüber, dass dessen verschworener Kreis nach wie vor sehr lebendig war.
Während de Sade noch in diese Gedanken vertieft war, glitt ein verächtliches Lächeln über seine Lippen.
Ja, dachte er, hier und jetzt von der Hand seinesgleichen ermordet zu werden, bildete den passenden Schlussakkord für sein Leben.
Diese Narren hofften, ihn endgültig zu besiegen, freute er sich, dabei würden sie mit ihrem Meuchelmord nichts weiter erreichen, als seinem Namen und seinen Werken zu neuem Glanz zu verhelfen
Denn nichts ging über einen rätselhaften Tod, um das Werk eines Schriftstellers und Philosophen wahrhaft unsterblich zu machen.
»Kommen Sie, Monsieur!«, bat Arthur mit brüchiger Stimme und wies mit der Hand in die Halle des Palais.
De Sade trat ein.
Arthur hob seine Lampe.
Ihr Licht fiel auf Wände und Decke der prächtigen Halle des Palais. Monsieur le Marquis stockte der Atem, als er dort auf das wunderbarste Kunstwerk blickte, das er je zu Gesicht bekommen hatte.
Denn Wände und Decken der Halle waren mit Fresken bemalt und von Stuckfiguren gesäumt, die sich gegenseitig wundervoll ergänzten. Was sie darstellten, war die Hölle. Doch es war eine überaus denkwürdige Hölle, in der die armen Sünder statt von Dämonen gepeinigt zu werden, in einer Art riesigen Amphitheater zusammenkamen, auf dessen Bänken man nach Herzenslust miteinander diskutierte, trank, weinte, lachte oder in den merkwürdigsten Stellungen kopulierte. Jede der Figuren dort wurde als selbstbewusstes Individuum gezeigt, das stolz und trotzig, ja zuweilen gar fröhlich seine Verdammnis durchlebte.
Im Zentrum des Deckenfreskos war Luzifer persönlich zu sehen. Dieser Luzifer war ein ganz gewöhnlicher Jedermann, und wie er so auf seinem schlichten Thron saß, hätte er ein Pariser Kleinbürger sein können, der an irgendeinem Lokaltisch darüber nachsann, ob er besser Kaffee oder Schokolade ordern solle.
»Sie haben nur wenig Zeit!«
De Sade zwang den alten Dienstboten, ihm in die Augen zu sehen. »Wofür Arthur?«, fragte er.
»Als ob Sie das nicht besser als jeder andere wüssten, Monsieur. Beeilen Sie sich! Es geht zu Ende mit ihm!«, antwortete Arthur.
Während er hinter ihm die Treppe hinaufstieg, erfasste den Marquis wieder dieselbe längst vergessen geglaubte Erregung, die ihn auch damals schon jedes Mal ergriff, sobald er im Begriff gestanden hatte, dem Comte gegenüberzutreten. Man sagte zwar, Hass nutze sich mit der Zeit ab wie ein zu oft gebrauchtes Werkzeug. De Sades Hass und Verachtung auf Solignac d’Orsey hatte sich in all den Jahren jedoch nicht abgenutzt.
Im Gegenteil.
Zwei hohe Flügeltüren gingen von der Galerie am Ende der Freitreppe ab, doch nur hinter einer davon – der linken – schimmerte etwas Licht auf die Galerie. De Sade glaubte das böse Fauchen großer Katzen hören zu können.
»Er ist da drin. Gehen Sie … rasch …«, drängte Arthur, öffnete die Tür einen Spalt und winkte de Sade ungeduldig, endlich einzutreten.
Nach der Düsternis der Halle blendete de Sade das Licht in dem weitläufigen Saal. Für einen Moment kehrte seine Furcht zurück. War dieses grelle Licht das Letzte, was er sah, bevor irgendein stechender Schmerz ihn traf und er für immer in Dunkelheit fiel?
De Sade kniff unwillkürlich die Augen zusammen.
Hinter ihm fiel die Tür ins Schloss.
Irgendetwas berührte zärtlich de Sades Wange. Ein seltsames Streicheln, flatterhaft unbeständig und so sanft – nahezu unfühlbar. Das konnte nicht der Tod sein. De Sade schlug blinzelnd die Augen auf.
Er sah einen Schmetterling, erdfarben mit gelben, roten und blauen Flecken. Sein Flug wirkte so schwerelos, als tanzte er in der Luft. Er flog so nah und ungerührt um de Sades Gesicht, als hätte er keinen Grund, Menschen zu fürchten.
De Sade verabscheute Schmetterlinge. Panisch wedelte er mit den Händen, um ihn zu vertreiben.
Der Saal musste das gesamte mittlere Stockwerk des Palais einnehmen. Beleuchtet wurde er durch eigenwillig geformte Kandelaber, die statt Kerzen gläserne Kolben trugen, in denen sich eine fluoreszierende Flüssigkeit befand – eine Vorrichtung, von der de Sade in den Schriften längst vergessener Alchimisten gelesen hatte. Der Boden war aus Steinfliesen und bedeckt von einer dicken Schicht schwarzen feuchten Humus, aus dem fremdartige Farne, Palmen, Büsche und Blüten wuchsen.
Andere Pflanzen waren dagegen in große Kübel gepflanzt. Zwischen ihren Wedeln, Ästen und Blättern flatterten und summten weitere Insekten umher. Manche so winzig wie Eintagsfliegen, andere so groß und bunt wie der Schmetterling, den de Sade eben ängstlich vertrieben hatte. Auch fanden sich überall zwischen Blättern und Ästen kunstvoll gesponnene Netze großer, glänzender Spinnen. Zwischen den Pflanzen und Kübeln blitzten zudem kunstvolle Volieren hervor, in denen sich exotische Vögel tummelten. Obwohl die meisten der Volieren verschlossen waren, flatterten doch einige ihrer Bewohner frei im Saal umher.
In der gegenüberliegenden Ecke saßen zwei große, getigerte Katzen. Fauchend und zähnefletschend waren sie damit beschäftigt, einen bunten Vogel in Fetzen zu reißen. Einzig ihr Fauchen und Kratzen war dabei zu hören. Denn obwohl der Saal voller Vögel war, schien keiner von ihnen irgendeinen Laut von sich zu geben. Zwischen all den Pflanzen schlängelten sich Pfade tiefer ins Innere des Saales hinein. De Sade schreckte zwar unwillkürlich davor zurück, ihnen zu folgen. Andererseits war es völlig sinnlos, noch länger schweigend hier herumzustehen. So folgte er zögernd dem breiteren der Pfade weiter in den großen, unübersichtlichen Saal hinein.
Obwohl seine Beklemmung mit jedem Schritt weiter wuchs, war er auch fasziniert von dem, was er da sah. So überwältigend und verstörend war es. Denn von Zeit zu Zeit stieß er bei seiner Wanderung auf lebensgroße Puppen und Automaten, die zwischen den Pflanzen, den Volieren und Kandelabern aufgestellt waren und ihm noch seltener und exotischer vorkamen als tropische Schmetterlinge im kalten Herbst von Paris. Da gab es Gliederpuppen aus Metall und Gips, aber auch solche aus Porzellan und festem Stoff und andere, die wie Marionetten an Fäden von der hohen Decke hingen.
Vor allem die übergroßen Marionetten vermittelten den Eindruck von grotesken Monstrositäten, deren starre Gesichter und geisterhafte Gliedmaßen nur darauf zu warten schienen, von einer verborgenen Faust zu künstlichem Leben erweckt zu werden. Beängstigender sogar noch als die Marionetten fand de Sade indes eine Reihe feingliedriger Automaten, deren meisterliche Gestaltung aus feinstem Porzellan, dünnem Goldblech, glattem Leder und kostbarster Seide täuschend echt die Illusion von Lebendigkeit erweckte.
Erst nach einiger Zeit wurde ihm bewusst, dass sich unter all den Marionetten, Puppen und Automaten keine einzige befand, die einer Frau nachgebildet war.
Dieser Saal war ein einziger Traum. Seine bloße Existenz bildete ein Veto gegen die Macht der Wirklichkeit eines Zeitalters, für das die unermesslichen Möglichkeiten menschlicher Träume sich allzu oft einzig in der Zweckmäßigkeit von Feldgeschützen erschöpften. De Sade selbst hatte einst von einem Ort wie diesem geträumt. Aber nichts hier war echt, sondern fügte sich in ein striktes Korsett aus Regeln, Mustern und unbarmherziger menschlicher Logik. Der Comte hatte sich in seinem Zaubersaal zu einem allmächtigen Gott aufgespielt. Doch es gab nun einmal keine Götter. Hinter den Kulissen dieses Ortes musste eine Heerschar von Gärtnern, Handwerkern und Bediensteten damit beschäftigt sein, dafür zu sorgen, dass die exotisch gespenstische Fassade gewahrt blieb.
De Sade entdeckte den Comte. Er saß in einem Stuhl aus schwarzem Metall und dunkelrotem Holz, an dessen Seiten zwei riesige Räder angebracht waren. Die Anordnung ihrer Drahtspeichen hatte etwas von Spinnennetzen.
De Sades ehemals stolzer und schöner Geliebter war zu einer winzigen Kreatur geschrumpft, deren Atem so leicht ging, dass er kaum noch wahrzunehmen war, und dessen geisterhaft lange und knotige Finger regungslos auf den Armlehnen seines Stuhls lagen.
Aus dicken königsblauen Decken ragte ein dürrer brauner Hals hervor. Den Kopf bedeckte ein Turban aus leuchtend rotem Tuch. Das Gesicht des Comte war völlig haarlos. Selbst Augenbrauen und Wimpern waren ihm ausgefallen, und jenes träge Öffnen und Schließen der hauchdünnen Augenlider hatte etwas von der Wachsamkeit eines lauernden Reptils.
Die grauen, blutleeren Augen des Comte blickten de Sade geradeheraus an. Dies war der Blick eines Monsters vom Gipfel seiner Macht hinab auf eine Welt, von der es wusste, dass sie ihm zu Füßen lag. De Sade begriff, dass an diesem Ort, der die bedeutendste Sammlung mechanischer Wunderwerke in Paris beherbergte, keine einzige Uhr zu finden war. Aber auch keiner der Vögel hier hatte gesungen. De Sade erschien dies nur folgerichtig: Vögel, die sangen, flogen irgendwann davon. Und das Ticken von Uhren erinnerte an den unaufhaltsamen Fluss der Zeit. Doch weder die Freiheit noch die Zeit hätten in diese künstliche Welt des Comte gepasst. Beide musste er als Bedrohungen seiner Stellung als allumfassender Herrscher in diesem Labyrinth aus gefährlicher Schönheit ansehen.
Wie schäbig er doch war, erkannte de Sade plötzlich, ein Heuchler und Ignorant bis zum Schluss. Sie sprachen nicht miteinander. Für Worte war das Vergnügen des Comte, de Sade wiederzusehen, offensichtlich zu groß, und saß de Sades Hass auf ihn zu tief.
Die Versuchung, sich zu rächen, und das uralte Scheusal jetzt und hier umzubringen, wurde in de Sade plötzlich übermächtig. Den Comte nur um ein paar Stunden – ja nur um eine einzige Minute früher – vom Angesicht der Welt zu wischen, als es das Alter, das unaufhaltsam an ihm fraß, sowieso getan hätte, hätte selbst nach all den Jahren seinen Triumph über ihn bedeutet. Es brauchte auch gar nicht viel dazu. Alles was er zu tun hätte, wäre, einen Zipfel der Decke so lange auf Mund und Nase des Comte zu pressen, bis dieser erstickte. Ein Kinderspiel.
Dennoch ließ de Sade den Greis im Rollstuhl unbehelligt.
Paradoxerweise war sein Hass auf ihn zu tief verwurzelt und zu leidenschaftlich, als dass er in einem schlichten Mord hätte enden können.
Zumal sich der Alte womöglich gar nichts sehnlicher wünschte, als von seinem ehemaligen Schüler und Geliebten umgebracht zu werden. Und dem alten Scheusal mit diesem Mord auch noch einen Gefallen zu tun, war nun wirklich das Letzte, was de Sade sich wünschen konnte.
Die Blicke der beiden trafen sich.
Kein Zweifel, dass der Alte genau wusste, welche Gedanken gerade in de Sades Hirn umgingen.
Etwas veränderte sich in seinem Gesicht. Vielleicht war es ein überhebliches Lächeln, das da um die federstrichdünnen Lippen des Uralten spielte.
Der Comte bedeutete de Sade mit mühsamen Gesten seiner Spinnenhände, seinen Rollstuhl umzudrehen und etwas näher auf ein Kruzifix zuzuschieben, das hinter ihm an der Wand hing. Es war kein gewöhnliches Kruzifix. Und selbstverständlich hatte sich der Alte auch nicht in den letzten Stunden seines Lebens plötzlich Gott zugewandt.
Leid, Schmerz und tiefste Qual, die aus der Christusfigur sprachen, wirkten so unerhört delikat und lebendig, wie de Sade es noch nirgendwo zuvor gesehen hatte.
Was den Comte zu diesem Heiland zog, war der Ausdruck tiefsten Leidens, den er verströmte. Diese Christusfigur diente dem Comte zu demselben Zweck, dem die obszönen Kupferstiche kopulierender Paare und aufreizender Brüste den jungen Männern dienten, wenn sie sich heimlich des Nachts unter ihren Decken selbst befriedigten. Der Comte mochte ein furchtbarer Heuchler sein, aber er war immerhin ein Heuchler, dessen innerster Kern niemals von Zweifeln oder Mitleid angefochten worden war.
Ein letztes Mal sahen sich die beiden Männer in die Augen und erkannten darin jeder für sich, was sie sich einst gegenseitig gewesen waren.
De Sade wandte sich ab und machte sich auf den Weg zurück.
Als er irgendwann auf die beiden getigerten Katzen stieß, schimmerten Blut und bunte Vogelfedern in ihrem Fell. Sie fauchten ihn böse und verzogen an.
Wie schön sie doch waren, dachte er.
Erst als ihn bei der hohen Tür zur Galerie erneut einige Schmetterlinge umschwirrten, beschleunigte er seine Schritte und scheuchte sie schließlich von neuer Panik und Angst erfüllt kopflos davon.
Der klebrig süße Blütenduft war bei der Tür wieder stärker geworden. Ihm drehte sich darüber der Magen um, er stolperte auf die Galerie hinaus und schlug die hohe, zweiflügelige Tür heftig hinter sich zu.
Das Geräusch der zufallenden Tür wurde, vielfach verstärkt, als Echo von Wänden und Deckengewölbe zurückgeworfen.
Schwer atmend verharrte de Sade auf der Galerie. Wie ein Geist tauchte Arthur neben ihm mit seiner Lampe auf. De Sade erschrak, presste sich enger gegen die glatte Wand, seine Hand fuhr zu seinem Gürtel herab, wo früher einmal ein Degen befestigt zu sein pflegte.
»Monsieur le Comte erwartet nicht, dass Sie an seinem Begräbnis teilnehmen«, bemerkte Arthur trocken. Er leuchtete de Sade mit der Lampe ins Gesicht, sodass dem nichts anderes übrig blieb, als sich abzuwenden und seine Augen zu schließen.
»So pass doch auf, Mann!«, fuhr de Sade ihn giftig an.
Arthur senkte die Lampe und griff dann in seinen Rock, um einen versiegelten Umschlag aus schwerem Papier hervorzuziehen.
De Sade erkannte das Siegel des Comte darauf.
»Monsieur le Comte besteht darauf, Ihnen dies auszuhändigen. Dieser Umschlag enthält seine Hinterlassenschaft an Sie.«
Arthur reichte de Sade den Umschlag.
De Sade zögerte nicht, den Umschlag entgegenzunehmen. So enthusiastisch er in seinen Schriften und Briefen die Revolution und die Veränderungen, die sie mit sich brachte, begrüßt hatte, hielt er trotzdem immer noch sehr auf die klassische Etikette des Ancien Régime. Und den Umschlag zurückzuweisen, hätte eine unverzeihliche Verletzung jener Etikette dargestellt.
De Sade konnte nur raten, was sich in dem Umschlag verbarg. Doch er nahm sich fest vor, ihn zu verbrennen, sobald er in Charenton zurück war. Keine Etikette konnte ihn zwingen, das Erbe des Comte auch tatsächlich anzutreten. Denn es konnte sich dabei um gar nichts anderes handeln als etwas gefährlich Böses.
Das Asyl lag in tiefer Dunkelheit, als Beaumes Kutsche in den Hof einrollte. Die beiden Männer gaben sich zum Abschied nicht die Hand. Beaume hatte zwar wirklich jeden Trick und Kniff angewandt, um de Sade Einzelheiten über sein Zusammentreffen mit dem Comte zu entlocken, aber de Sade war seinen Fragen hartnäckig ausgewichen.
Es war kalt zwischen den dicken alten Mauern des Asyls. De Sade rieb sich die Hände und schlug den zerschlissenen Brokatrock enger um sich. Er vermisste seine Geliebte Constance.