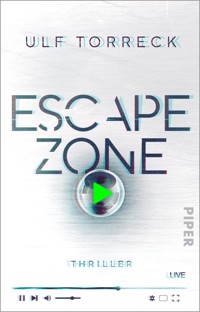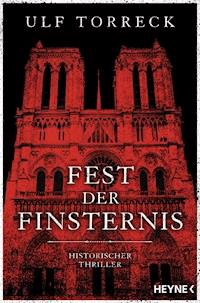1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Paris 1797: Ein unheimlicher Mörder geht in der Metropole um und zieht eine Spur des Schreckens. Der legendäre Inspecteur Louis Marais steht vor dem schwierigsten Auftrag seiner Laufbahn. Gerüchte um Schwarze Messe und Magie umwehen die Verbrechen. Was davon ist Wahrheit? Bei einem denkwürdigen Diner trifft Marais auf den Skandalautor Marquis de Sade. Für ihn beginnt eine Reise in die Abgründe des Menschen …
Erleben Sie dir Vorgeschichte zu Ulf Torrecks großem historischem Thriller »Fest der Finsternis«!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
DAS BUCH
Paris 1797: Ein unheimlicher Mörder geht in der Metropole um und zieht eine Spur des Schreckens. Der legendäre Inspecteur Louis Marais steht vor dem schwierigsten Auftrag seiner Laufbahn. Gerüchte um Schwarze Messen und Magie umwehen die Verbrechen. Was davon ist Wahrheit? Bei einem denkwürdigen Diner trifft Marais auf den Skandalautor Marquis de Sade. Für Marais beginnt eine Reise in die Abgründe des Menschen …
Exklusiv als eBook Only: Die Vorgeschichte zum historischen Thriller »Fest der Finsternis« von Ulf Torreck
Mit einer Leseprobe aus »Fest der Finsternis«
DER AUTOR
Ulf Torreck, geboren 1972 in Leipzig, arbeitete bereits früh als Rausschmeißer und Barmann und später als Journalist und Filmkritiker. Nach längeren Aufenthalten in Südostasien, Frankreich, Irland und Großbritannien begann er, Novellen und Romane zu schreiben. Für »Das Fest der Finsternis« recherchierte Torreck mehrere Jahre lang und befasste sich intensiv mit den dunklen Seiten des Menschen.
ULF TORRECK
VOR DER
FINSTERNIS
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Garten der Liebe
In den Garten der Liebe trat ich,
um zu sehen, was ich nie zuvor geschaut:
eine Kapelle, wo auf dem Grün ich
als Kind einst spielte, war erbaut.
Und die Tore waren verschlossen,
und »Du sollst nicht« stand über der Pforte;
so wandte ich mich zum Garten der Liebe
und suchte nach Blumen an jenem Orte.
Statt Blüten fand ich Gräber dort
Blumen und Blüten – vergangen.
Und da schritten Priester in Scharen, in schwarzen Talaren,
Die banden mit Gebeten und Dornen mein Glück und Verlangen.
William Blake: Songs of Innocence and Experience (1794)
Nichts, wovon auf den folgenden Seiten die Rede sein wird, ist wahr. Mit Ausnahme derjenigen Gedanken, Ereignisse und Dinge, die ich frei erfunden habe.
Prolog
Rot und Blau
Juni 1796
Inspektor Marais sah zu, wie Nicolas Bonnechance seine Hunde mit den Händen und Füßen der beiden toten Männer fütterte. Die Hunde hießen Rouge und Bleu – Rot und Blau – und sprangen aufgeregt um die Beine ihres Herrn, nachdem er den Toten mit zwei Säbelschlägen Hände und Füße abgetrennt hatte. Dabei spritzte etwas hellrotes Blut auf sein verschwitztes Hemd, einige Tropfen landeten in seinem Gesicht.
Bonnechance war ein Kopfgeldjäger, dessen Dienste die Pariser Polizei hin und wieder in Anspruch nahm, wenn es galt, besonders gefährliche Verbrecher zu stellen und unschädlich zu machen. Er war ein schlanker Schwarzer, der den Frauen gefiel und von dem es hieß, dass er einst aus Afrika nach Saint Domingue verschleppt worden war, von wo aus er den Weg hierher nach Paris fand und mit einer Zucht exotischer Bluthunde begonnen hatte, die er inzwischen in ganz Frankreich verkaufte.
Die beiden Deserteure, deren Hände und Füße Bonnechance gerade an seine Bluthunde verfütterte, waren bis an die Zähne bewaffnet gewesen, als sie sich nach einer langen, verzweifelten Hetzjagd auf dem alten Friedhof am Rande von Montmartre verbargen. Vor etwa einer Woche waren sie von ihrem Regiment in der Bretagne geflohen und hatten auf ihrem Weg nach Paris eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Für ein paar Bissen Brot töteten sie eine vierköpfige Familie in der Nähe von Rouen. Der Familie folgte ein Gastwirt an der Straße nach Bezancourt. In dem winzigen Nest La Chapelle schlugen sie einem fahrenden Händler den Kopf ab und spießten ihn auf einen Eichenast, bevor sie sich mit dessen Wagen und Pferden davonmachten.
Der alte Friedhof von Montmartre, auf dem ihre Flucht schließlich endete, bestand aus einem von Büschen, Eschen und einigen uralten Kastanien überwucherten Kirchhof, der von einer verfallenen Mauer geschützt wurde. Die Kirche darin war schon vor Jahren verfallen. Ihre Ruine nutzten die guten Bürger des kleinen Ortes als Steinbruch für den Bau ihrer Häuser.
Die Deserteure wussten, was sie erwartete, sollten sie lebend gefasst werden, und sie waren kampferprobte Grenadiere, die mit ihren Säbeln, Pistolen, Messern und Knüppeln umzugehen wussten. Ganz gewöhnliche Polizeiagenten stellten keine echten Gegner für sie dar. Inspektor Marais und seine zwei Dutzend Männer des Sonderkommandos hatten die beiden Deserteure vier Tage und Nächte durch ganz Paris gehetzt, bis es ihnen gelang, sie hier auf dem alten Friedhof in die Enge zu treiben. Einer der Polizeiagenten war bei dem Versuch, die beiden Männer am Marktplatz von Saint-Germain zu stellen, bereits getötet worden. Weder Inspektor Marais noch Jean-Jacques Henri, der Polizeipräfekt von Paris, wollte noch mehr Männer riskieren, um die Deserteure unschädlich zu machen. Also hatte der Präfekt nach Bonnechance geschickt. Als der den Friedhof erreichte, war es nach neun Uhr abends und fast dunkel. Er hatte seine Bluthunde dabei, ein zweischneidiges Messer und eine Peitsche, aber keine Schusswaffen, und ging ganz allein mit den Hunden auf den Friedhof, während Henris Polizeiagenten das Gelände sicherten.
Gegen Morgen kehrte Bonnechance zurück. Er hatte eine Fleischwunde am Bein, und seine Hunde wirkten zerzaust, aber er hatte die Deserteure zur Strecke gebracht. Einen der beiden erwischten die Hunde. Doch der andere ging wohl allein auf Bonnechances Konto, denn sowie Marais einen Blick auf den Toten warf, wurde ihm klar, dass der mit einer Peitsche totgeprügelt worden sein musste. Marais ahnte, dass ihn die verzweifelten Schreie der beiden Männer, die aus dem Gestrüpp des alten Friedhofs gedrungen waren, noch sehr lange verfolgen würden.
Marais wandte sich von dem Anblick der schmatzenden Hunde ab. Er war ein großer, fast schon dürrer Mann mit einem kantigen Gesicht und dünnen Lippen. Seine schmale, leicht gebogene Nase vermittelte den Eindruck von Selbstsicherheit und Strenge. Obwohl er Polizeiinspektor war und damit ein mächtiger Mann in Paris, bevorzugte Marais einfache, schlichte Kleider. Seine Herkunft lag völlig im Dunkeln. Er war bekannt dafür, dass er mit den vier Wurfmessern, die er immer bei sich trug, besser und schneller traf als ein Jahrmarktsgaukler, und einst, während seiner Zeit in der Armee, einige Tapferkeitsauszeichnungen kassiert hatte. Davon abgesehen wusste man, dass er nicht korrupt war, aber dennoch rasch Karriere gemacht hatte und diese schließlich damit krönen konnte, dass ihm Präfekt Jean-Jacques Henri eine eigene Abteilung in der Rue Sainte-Anne zugestand, die sich ausschließlich mit den schwersten Straftaten und gefährlichsten Verbrechern in Paris befasste.
Marais trat zu Jean-Jacques Henri, der es wie er selbst nicht lange ertragen hatte, den Hunden dabei zuzusehen, wie sie sich hungrig über die Hände und Füße hermachten. Die letzten Tage und Nächte waren ungewöhnlich heiß gewesen. Jeder Schritt, den man auf den ausgefahrenen Wegen und Straßen von Paris tat, wirbelte kleine Wolken gelblich-grauen Staub auf, und die etwa zwei Dutzend Polizeiagenten, die die beiden Deserteure bis hierher getrieben hatten, schwitzen furchtbar in ihren dunklen Wollmänteln und Dreispitzhüten. Marais hatte aus einem Gasthaus ein Fass Wein requirieren lassen, dazu Näpfe und Gläser besorgt und den Wein, mit frischem Wasser verdünnt, an seine Männer verteilen lassen. Zwei Stühle und ein alter, stabiler Tisch dienten Marais und dem Präfekten als Kommandostand. Jean-Jacques Henri hatte zwei Gläser Wein eingeschenkt, sobald Marais zu ihm herantrat.
Der Präfekt wies auf Bonnechances gierig schmatzende Hunde. »Man hätte dafür sorgen sollen, dass die Männer das nicht zu sehen bekommen, Monsieur le Inspecteur!«
Marais stimmte seinem Vorgesetzten zu. Es war wirklich nicht gut für die Moral der Männer, zusehen zu müssen, wie sich die Hunde an menschlichem Fleisch gütlich taten.
Jean-Jacques Henri war Ende fünfzig, durchschnittlich groß, und sein schmales Gesicht mit dem breiten Mund durchzogen tiefe Falten. Wegen seiner breiten und scharf gebogenen Nase und dem breiten Mund war er ein gefundenes Fressen für die Karikaturisten der Journale von Paris.
Kein Mensch konnte sich erklären, was die beiden Grenadiere zu solch abscheulichen Grausamkeiten trieb. Doch Marais hatte selbst einst in der Armee gedient. Krieg war ein furchtbares Geschäft, und nicht jede Wunde, die man dabei davontrug, war äußerlich. Manche Soldaten erreichten nach einigen Jahren einen Punkt, an dem sie einfach überschnappten und blindlings auf alles und jeden in ihrer Umgebung losgingen. Geschah dies während eines Gefechts, behängte man sie danach gern mit Tapferkeitsorden und nannte sie Helden. Hatten sie das Pech, jenen seelischen Bruchpunkt außerhalb des Schlachtfelds zu erleben, liefen sie Gefahr, so zu enden wie die beiden Männer hier – ohne Hände und Füße tot im Straßenstaub irgendeines unbedeutenden Vororts.
Bonnechance pfiff endlich seine Hunde zurück, die nur widerwillig ihr Mahl im Stich ließen, um seinem Befehl zu folgen. Ein Trupp Polizeiagenten trat zögerlich und voller Ekel heran, ergriff die Leichen und warf sie auf einen Gemüsekarren.
»Meine Honorarnote lasse ich Ihnen zukommen, Monsieur le Préfet!«, sagte Bonnechance, deutete eine Verbeugung an und ging dann, die Hunde an seiner Seite, auf die schmale, frühmorgendlich stille Straße zu.
»Er ist ein verdammtes Ungeheuer, Marais!«, flüsterte Jean-Jacques Henri.
Einer der Polizeiagenten, ein recht junger Mann namens Bellot, trat zu Marais und dem Präfekten und schaute sie schüchtern an.
»Reden Sie schon, Mann!«, forderte Henri ihn unwirsch auf.
»Es ist nur, Monsieur le Préfet, weil ich … eigentlich die Männer auch …«, begann Bellot und spuckte auf den Boden. »… wir uns fragen, weshalb Bonnechance seine Bluthunde mit den Händen und Füßen gefüttert hat. Und wir fragen uns, ob das auch so rechtens sein kann. Weil der Schwarze ist doch ’n verfluchter Heide, und was immer die Deserteure … Also was immer die auch getan haben, jetzt sind sie ja tot, und die waren immerhin Christenmenschen. Kann doch nicht richtig sein, die von dem Heiden an seine verdammten Hundemonster verfüttern zu lassen, oder?«
Jean-Jacques Henri zupfte einige Male pikiert an seinen makellosen Hemdmanschetten herum. Er wollte die Frage nicht beantworten, doch Marais war ebenso wenig erpicht darauf, dies zu erläutern.
»Man sagt, sie mit Menschenfleisch zu füttern, hält die Hunde scharf«, erklärte Marais schließlich ungewohnt leise.
Bellot wandte sich ab und ging mit gesenktem Kopf auf seine Kameraden zu, die in einer dichten Traube zusammenstanden und ihn neugierig erwarteten. Marais war es, als hätte er ihn murmeln hören: »Er ist trotzdem ein verdammtes Monster!«
Monsieur le Inspecteur hätte dem gar nicht widersprechen wollen. Aber er wusste eben auch, dass es für ehrenwerte Männer wie den Präfekten sehr praktisch war, über ein Monster wie Bonnechance zu verfügen.
Und wäre Marais in diesem Moment vorbehaltlos ehrlich zu sich selbst gewesen, hätte er sich eingestanden, dass von all den Männern, mit denen er in seinem Leben gerauft, gekämpft, getrunken oder an deren Seite er sich gefürchtet hatte, keiner ihm je solch irrationale Angst einjagte wie Nicolas Bonnechance.
ERSTES BUCH
Nachtmahr I
1
Man fand die erste Leiche am Morgen des 12. Mai 1797 in einer Gegend von Paris, die vor allem von einfachen Handwerkern und kleinen Geschäftsleuten bewohnt war. Es war ein Glück, dass man sie an einem Werktag fand, denn werktags waren schon sehr früh eine Menge Leute unterwegs, um ihren Geschäften nachzugehen, sodass weder die frei laufenden Schweine noch die Hunde, Katzen oder Hühner lange genug Gelegenheit gehabt hätten, sich an dem Leichnam zu schaffen zu machen. Die Leiche war die eines jungen Mannes.
Als man Inspekteur Louis Marais und den Polizeiarzt Gevrol hinzuholte, umstand längst eine dichte Traube Neugieriger den Toten. Der Boden um den Leichnam war von frisch Erbrochenem übersät und von Dutzenden Füßen zu zähem Brei zertreten.
Marais hatte vier Polizeiagenten dabei, die er mit Gesten, Blicken und leisen Pfiffen dirigierte. Wie gut dressierte Hunde folgten sie ihm aufs Wort. Sie trugen dunkle Mäntel, Stiefel und Hüte, und brauchten nur wenige Minuten, um die unmittelbare Umgebung der Leiche von den Neugierigen zu räumen.
Polizeiarzt Gevrol ließ sich neben der Leiche auf die Knie nieder und begann, sie zu untersuchen.
Marais wartete geduldig ab, bis der Doktor sich eine erste Meinung gebildet hatte. Er erwartete keine große Überraschung von Gevrols Untersuchung. Jeder, der Augen im Kopf hatte, konnte sehen, dass dem jungen Mann die Kehle durchgeschnitten worden war. Sein Gesicht, sein helles Haar, Brust und Kragen seines Hemdes und Mantels waren von Blut durchtränkt. Doch seine Augen waren geschlossen.
Dieser Mord, dachte Marais, war zweifellos das Ergebnis eines Streits zwischen Betrunkenen. Vielleicht war es dabei um Geld gegangen. Vielleicht auch um eine Frau.
Gevrol wischte sich die Hände an einem Taschentuch ab und sah zu Marais auf.
»Monsieur?«
»Ja …«
»Schauen Sie …«
Gevrol faltete das ehemals weiße Hemd des Toten über dessen Brust zur Seite. Die Brust des jungen Mannes war geöffnet worden.
»Sein Herz fehlt«, sagte Gevrol.
»Sein Herz fehlt?«, erwiderte Marais.
Der Doktor nickte.
Die Obduktion, die Gevrol am späten Vormittag unternahm, bestätigte, dass dem jungen Mann die Kehle durchtrennt und anschließend die Brust geöffnet und das Herz entfernt worden war. Außer seinem Herzen fehlte dem Toten nichts. Selbst seine Börse war noch vorhanden gewesen, als man seine Kleidung im Hôtel-Dieu untersuchte.
Marais hatte Gevrol bei der Obduktion hospitiert und war anschließend zu Jean-Jacques Henris Haus gefahren. Henri war zwar zunächst ungehalten über die Störung – in letzter Zeit fühlte der Präfekt sich nicht wohl, weil ihn ein hartnäckiger trockener Husten plagte. Sowie ihm Marais die spärlichen Fakten des Falls darlegte, kam auch Monsieur le Préfet zu dem Schluss, dass Schwierigkeiten zu erwarten waren. »Das ist Ihr Fall, Marais. Nehmen Sie sich so viele Männer, wie Sie für nötig erachten, und halten Sie mich auf dem Laufenden!«
2
Eine volle Woche verging, und Marais sah ein, dass er immer noch ganz am Anfang seiner Ermittlungen stand. Hinzu kam, dass die Journaille inzwischen Wind von dem Fall bekommen hatte. Marais war klar, dass eine Leiche ohne Herz ein gefundenes Fressen für die Pressemeute war, die diesen Fall leicht zu einer gefährlichen Affäre aufbauschen könnte, mit der dieser oder jener sein ganz eigenes Süppchen zu kochen versuchte. Denn während in Österreich und Italien gerade der junge korsische General Napoléon Bonaparte von Sieg zu Sieg eilte, herrschte in Paris eine Bande aus korrupten ehemaligen Revolutionären und skrupellosen Emporkömmlingen, der es nur mühsam gelang, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Und vielleicht genügte ja schon ein einziger rätselhafter Mord, den man an die große Glocke hängte, um diese Ruhe zu zerstören und die Stadt erneut in Chaos und Anarchie zu stürzen.
Bisher hatten Marais und der Präfekt den Fall zwar aus den Schlagzeilen heraushalten können, aber Marais war sicher, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis irgendeiner der Schreiberlinge einen Hinweis erhielt und eins und eins zusammenzählte. Sollte dies geschehen, würde in Paris der Teufel los sein. Der Druck auf ihn und den Präfekten, endlich einen Schuldigen zu liefern, verstärkte sich dann um ein Vielfaches.
Was Marais bisher herausgefunden hatte, war erbärmlich wenig. Zwar gelang es ihm rasch, das Opfer als einen gewissen Pascal Mole, einen Handwerksgesellen und Sohn eines recht gut situierten Schneidermeisters aus der Rue Duclaire, zu identifizieren. Die Freude darüber war jedoch nur von kurzer Dauer, denn Eltern, Geschwister und Freunde des Ermordeten zeichneten das Bild eines strebsamen und ernsten jungen Mannes, der weder übermäßig trank noch den Frauen hinterherjagte oder sich mit zwielichtigen Freunden umgab. Es schien einfach kein Motiv für diesen Mord zu geben. Erst recht konnte Marais sich bisher nicht erklären, weshalb sein Mörder dem jungen Monsieur Mole das Herz aus der Brust schnitt, obwohl dies mit ziemlichem zusätzlichem Aufwand verbunden war und mit beachtlichem Blutvergießen einherging. Hände, Arme und Kleidung des Mörders mussten daher voller Blut gewesen sein, sobald er fertig geworden war. All das stellte für den Mörder ein Risiko dar, das Marais völlig überflüssig erschien. Der ganz gewöhnliche Mord in Paris war eine ziemlich triste Angelegenheit und in aller Regel stets rational erklärbar. Für den Fall Pascal Mole galt das bislang jedoch keineswegs. Es kam schon vor, dass ein Pariser Verbrecher während der Abrechnung mit der Konkurrenz um einiges weiterging, als den Gegner einfach nur zu töten. Aber selbst dann begnügte man sich gewöhnlich damit, dem Besiegten Zunge oder Gemächt abzutrennen. Nie jedoch war in den Pariser Polizeiakten ein Fall verzeichnet worden, bei dem man dem Opfer das Herz aus der Brust geschnitten hätte.
Außerdem fehlte es beim jungen Pascal Mole an irgendeiner Verbindung zu den für solche Untaten in Frage kommenden Kreisen. Dass es ausgerechnet sein Herz gewesen war, das sein Mörder dem jungen Monsieur Mole stahl, konnte unmöglich Zufall sein. Aber wer sollte ein Interesse am Herzen dieses Jungen gehabt haben? Die einzige Antwort, die Marais auf diese Frage einfiel, war, dass man es Mole aus symbolischen Gründen aus der Brust geschnitten hatte, als Zeichen oder Warnung. Aber, so fragte sich Marais, wer sollte der Empfänger dieser Nachricht sein? Und weshalb hatte man sie ihm gerade mit Hilfe des jungen Mole übermittelt?
Bevor er ins Bett ging, kniete Marais nieder, um ein Gebet zu sprechen, das ihn etwas aufzumuntern vermochte. Über dem Tischchen neben seinem Bett hing die Zeichnung einer hübschen, selbstbewusst lächelnden Frau. Ihr Name war Nadine Nast. Sie war Marais’ Verlobte. Anfang dreißig und berüchtigt für ihre Schlagfertigkeit, war sie beinahe schon zu einem Leben als alte Jungfer verdammt gewesen, als Marais sie auf einem Polizeiball traf. Er selbst war auch keine überragende Partie und zuweilen immer noch erstaunt darüber, dass sich Nadine für seine eher ungelenken Annäherungsversuche offen gezeigt hatte.
Marais’ Träume in jener Nacht führten ihn durch düstere labyrinthische Flure, in denen er vergeblich nach irgendeinem Weg zurück ins Licht suchte. Am Ende eines dieser von flackernden Lampen beleuchteten Korridore erwartete ihn der nackte Präfekt, der ihm aus unnatürlich großen Augen entgegensah, während ihm Blut aus Mund und Nase lief. Vor seinen dürren, übergroßen Füßen lag die Leiche einer Frau, deren Brustkorb geöffnet war und um deren pumpendes, herausgetrenntes Herz sich geifernd und knurrend Bonnechances Bluthunde stritten.
Mit einem unterdrückten Schrei erwachte Marais in seinem dunklen Zimmer.
3
Zwei weitere furchtbar quälend ereignislose Tage vergingen, bis man Marais erneut zu einem Mord rief. Bei dem Opfer handelte es sich um eine junge Witwe namens Charlotte Moreau.
Gleich nach seiner Ankunft am Tatort, einem gutbürgerlichen Haus am Rande von Saint-Quentin, ließ Marais einen Sicherheitskordon errichten, um Schaulustige und eifrige Schreiberlinge der Journale fernzuhalten, die sich in engen Trauben mit lang gereckten Hälsen und geweiteten Augen in der Straße vorm Haus versammelt hatten.
Selbst Doktor Gevrol hatte Schwierigkeiten, vorgelassen zu werden, als er einige Zeit darauf ebenfalls eintraf.
Madame Moreau, Witwe eines Textilhändlers, lag mit durchtrennter Kehle in einem grünen Seidenkleid am Boden ihres recht konventionell eingerichteten Salons, auf dessen Tisch sich eine Kanne längst erkalteter Schokolade nebst zweier benutzter Tassen befanden.
Madames Haar war geordnet und ihre Hände waren sorgsam an ihrer Seite abgelegt. Über ihren Körper war ein Stück weißes Betttuch gebreitet, das ihn bis über ihre Scham hinab und bis zum Halsansatz hinauf bedeckte. Es war ebenso von Blut durchtränkt wie der dicke Teppich auf dem Salonboden.
Das grüne Kleid, die blasse Haut der Toten und jenes angetrocknete Blutrot auf dem Weiß des Lakens ergaben einen beißenden Farbkontrast, den Marais für lange Zeit nicht mehr vergessen konnte.
Gevrol entfernte das Betttuch – darunter kam zum Vorschein, was jeder der Polizeiagenten hier im Haus längst geahnt und befürchtet hatte: ein tiefer, blutiger Einschnitt zwischen den Brüsten der Toten.
»Oh, merde …«, flüsterte einer der Polizeiagenten in dem Moment, als Gevrol seine Hand durch den Schlitz in die Brust der Toten schob. Gevrol zog die Hand zurück und schüttelte langsam den Kopf.
»Kein Herz, Marais.«
Gevrols und Marais’ Blicke verhakten sich einen Moment ineinander, dann schlug Gevrol die Augen nieder.
Marais’ Blicke wanderten von dem Doktor und der armen Madame Moreau zum Tisch. Vorsichtig trat er dann an der Leiche vorbei und unterzog Tassen, Tellerchen und Kanne einer genauen Untersuchung.
Sergeant Dupont und der Rest der Männer beobachteten ihn gespannt dabei. Marais hielt eine der beiden Tassen etwas länger in seiner Hand. Schließlich stellte Marais sie vorsichtig wieder ab. Zornig blickte er von Mann zu Mann, bellte einige Anweisungen und verließ das Haus.
»Was sollte denn das?«, erkundigte sich eingeschüchtert einer der jüngeren Polizeiagenten bei Doktor Gevrol. Der versetzte ihm eine Kopfnuss und wies dann auf jene Tasse, die Marais länger in Händen gehalten hatte. Auf dem feinen, glänzenden Porzellan waren verwischte Flecken zu erkennen – heller als die kräftige, fast schwarze Schokolade sie erzeugen konnte, die Madame in den Tassen serviert hatte.
»Sehen Sie das nicht, Sie Kretin? Da ist Blut an der Tasse!«, rief der Doktor. Nicht nur ihm schauderte wohl bei dem Gedanken, dass der Mörder nach vollbrachter Tat in einem von Madame Moreaus Sesseln gesessen und in aller Ruhe seine Schokolade ausgetrunken hatte.
»Kein Wort über irgendetwas hier drin zu den verdammten Geiern da draußen, kapiert?«, befahl der Sergeant, der zusammen mit Marais zum Tatort geeilt war, seinen Männern.
4
Nur knapp eine Stunde nach seiner Inspektion des Tatortsbetrat Marais das Büro seines Präfekten, um ihn über den neuen Fall zu informieren.
»Und Sie sind sicher, Marais: dieselbe Handschrift?«, bohrte Henri noch einmal nach, sobald Marais mit seinem knappen Rapport zum Ende gekommen war.
»Kein Zweifel. Ich habe vorsorglich Depeschen in alle übrigen Departements gesandt. Möglich, dass dort irgendeiner schon etwas Ähnliches auf dem Tisch hatte. Vielleicht kam der Mörder ja aus der Provinz nach Paris. Gevrol behauptet, dass er sehr gut weiß, was er tut. Dieser Schnitt in die Kehle war in beiden Fällen sauber und gerade. Ebenso wie diejenigen, mit denen er die Herzen entfernte.«
Unschlüssig wiegte Henri den Kopf. »Ein Schlachter also? Oder ein Feldscher?«
»Möglich. Ich brauche mehr Männer, Monsieur le Préfet. Ich will, dass sie ganz Saint-Quentin nach möglichen Zeugen abklappern. Und jeder von ihnen muss lesen und schreiben können. Ich brauche Berichte von jeder Befragung, die sie vornehmen.«
Jean-Jacques Henri griff nach Papier und Feder und erstellte den entsprechenden Befehl. Er reichte ihn Marais. »Finden Sie dieses Ungeheuer, Inspektor!«
Marais faltete den Befehl und schob ihn in seine Rocktasche.
Weitere drei Tage vergingen, in denen Marais jeden verfügbaren und auch nur halbwegs geeigneten Mann nach Saint-Quentin zur Zeugenbefragung aussandte. Zweimal täglich, jeweils gegen Mittag und vor Dienstschluss, sammelte er die Berichte der Männer ein und verbrachte anschließend die halbe Nacht damit, sie auszuwerten.
Am fünften Tag nach dem Auffinden der Leiche der Witwe Moreau erschien er erneut in Jean-Jacques Henris Büro, um Bericht zu erstatten.
»Die Männer haben jeden verhört, der irgendwie in Verbindung mit dieser Moreau stand. Ihre Familie, die Nachbarn, sogar den Kaminfeger, ihren Bäcker und den Jungen, der ihr manchmal die Einkäufe besorgte. Sie haben auch die unmittelbare und weitere Nachbarschaft der Witwe durchforstet und jeden befragt, den sie dort antrafen. In vielen Fällen taten sie das sogar mehrmals. Dasselbe Vorgehen habe ich in der Umgebung des Tatorts im Fall Pascal Mole angeordnet. Ergebnis: nichts. Keiner hat etwas gesehen. Keiner hat etwas gehört. Die Witwe Moreau lebte allein. Sie hatte genügend Geld, und am Sonntag nach der Messe traf sie sich regelmäßig mit drei Freundinnen auf eine Tasse Schokolade in ihrem Salon. Weder hatte sie Schulden, noch trieb sie sich mit Männern herum. Es scheint außerdem auch keinerlei Verbindung zwischen ihr und Pascal Mole zu bestehen. Alles, was wir in unserer ersten Befragung über ihn ermitteln konnten, haben alle weiteren nur noch einmal bestätigt. Er lebte allein, er war fleißig, strebsam und schüchtern.«
Henri ließ Marais’ Worte schweigend auf sich wirken.
»Mit anderen Worten – Sie sind am Ende Ihrer Weisheit angekommen?«