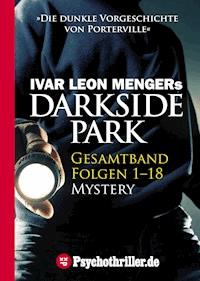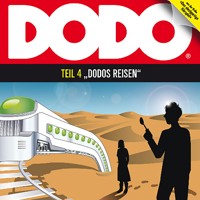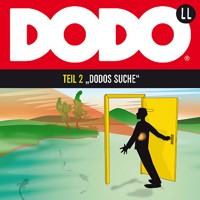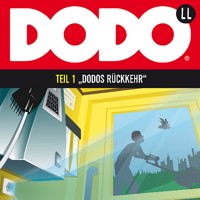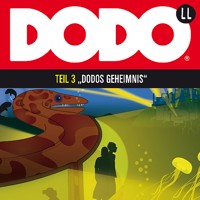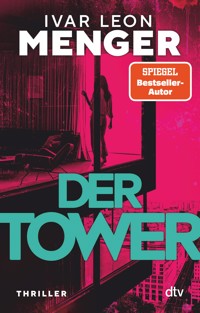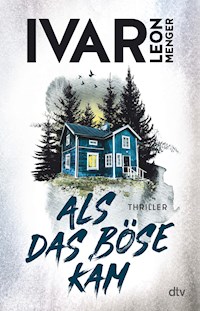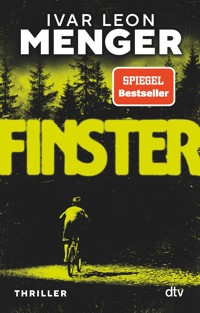
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Dorf der Verlorenen Mai 1986. Ein 13-jähriger Junge verschwindet spurlos vom Jahrmarkt in Katzenbrunn. Das passiert nicht zum ersten Mal. Seit Jahren werden in dem kleinen Dorf im Odenwald immer wieder Kinder als vermisst gemeldet. Hans J. Stahl, Kriminalkommissar a. D., beschließt daraufhin, die Ermittlungen an den seither ungelösten Fällen wieder aufzunehmen und auf eigene Faust weiterzuführen. Er kehrt zurück nach Katzenbrunn, das vor allem für seine psychiatrische Klinik bekannt ist. Dabei stößt er auf verstörende Geheimnisse. Während er den wenigen Spuren nachgeht, verschwindet ein weiterer Junge. Stahl läuft die Zeit davon. »Ivar Leon Mengers dritter Thriller – und zum dritten Mal schlaflose Nächte für mich. Der Kerl ist wirklich eine Bereicherung für den deutschen Thrillermarkt.« Romy Hausmann »Dieser Thriller verführt dich. Wunderbar leicht kommt er daher, dann packt er dich, macht dir Angst und raubt dir den Schlaf.« Bernhard Aichner
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Mai 1986. Ein dreizehnjähriger Junge verschwindet spurlos vom Jahrmarkt in Katzenbrunn. Das passiert nicht zum ersten Mal. Seit Jahren werden in dem kleinen Dorf im Odenwald immer wieder Jugendliche als vermisst gemeldet. Hans J. Stahl, Kriminalkommissar a. D., beschließt daraufhin, seine Ermittlungen an den seither ungelösten Fällen wieder aufzunehmen und auf eigene Faust weiterzuführen. Er kehrt zurück nach Katzenbrunn, das vor allem für seine psychiatrische Klinik bekannt ist. Dabei stößt er auf verstörende Geheimnisse. Während er den wenigen Spuren nachgeht, verschwindet ein weiterer Junge. Stahl läuft die Zeit davon.
Von Ivar Leon Menger sind bei dtv außerdem erschienen:
Als das Böse kam
Angst
Ivar Leon Menger
Finster
Thriller
Gewidmet meiner Mutter Hanni,
ohne die dieser Roman niemals möglich gewesen wäre.
Danke für deinen jahrelangen Glauben in mich
und deine liebevolle Unterstützung.
Gewidmet meiner viel zu früh verstorbenen Lektorin
Judith Mandt
(1981 – 2024)
KATZENBRUNN
1. Mai 1986
Nikolaus Kämmerer
Es riecht nach gebrannten Mandeln, fettigen Pommes, Zuckerwatte, verschüttetem Bier, Bratwurst und dem Blut zweier Trunkenbolde, die sich vor dem Autoscooter um eine Frau streiten.
Nikolaus macht einen großen Bogen um die Prügelei, umklammert den Brustbeutel um seinen Hals. Sein Vater hat ihm fünf Mark für den Jahrmarkt gegeben. Denn wie jedes Jahr am Ersten Mai ist Katzenbrunner Waldkerb auf dem Festplatz. Und wie jedes Jahr bringen die Buden und Fahrgeschäfte für zwei Tage Leben in das ansonsten trostlose Kaff im Odenwald.
Hätte der Dreizehnjährige allerdings gewusst, dass der diesjährige Jahrmarkt das Letzte ist, was er jemals erleben wird, wäre er sicherlich mit in die Geisterbahn gegangen. Um dem Mädchen zu beweisen, dass er keine Angst hat.
Doch so steht er starr davor und reibt sich unbemerkt die Hände an seiner kniekurzen Stonewashed-Jeans trocken.
»Komm schon, Niko!«, ruft Bianca, das rothaarige Mädchen mit den Sommersprossen aus seiner Klasse, und streckt ihm die Hand hin. Ihr hellblaues Sommerkleid weht im Abendwind. Wie gern würde er ihre Finger ergreifen und sich im Waggon neben sie setzen, ganz dicht, ihre nackten Beine würden sich im Dunkeln berühren.
Er könnte sich zu Bianca hinüberbeugen und …
»Lass den Spinner doch!«, grölt Schnitzel und ergreift Biancas Arm. »Wer nicht will, der hat schon, oder?«
Die anderen Freunde lachen.
Schnitzel ist schon sechzehn und heißt so, weil er nur Schnitzel isst. Immer muss er vor der Gruppe beweisen, wie stark er ist. Nikolaus hat Angst vor ihm. Und vor seinen »Witzen«, wie der Jugendliche seine Quälereien selbst gerne nennt. Heute zum Beispiel hat er Nikolaus’ Fahrrad tief im Wald versteckt, während die anderen ihn festgehalten haben. Doch Nikolaus hat sich nicht die Blöße gegeben, danach zu suchen. Das wird er erst tun, bevor sie wieder nach Hause nach Kolmbach fahren. Vielleicht hat Schnitzel irgendwann Mitleid und wird ihm das Versteck verraten.
Er sieht Bianca und den drei Jungen hinterher, wartet, bis sie sich an der Kasse Karten gekauft haben und den weit aufgerissenen Kiefer des Totenkopfs betreten. Sie teilen sich einen Waggon, der mit Spinnenweben verziert ist. Zwei sitzen vorne, Schnitzel mit Bianca hinten.
Natürlich spielt Schnitzel den Macker, legt betont lässig den Arm um Biancas Schultern und grinst. Nikolaus schaut weg. Etwas sticht in seiner Brust. Der Waggon ruckelt und wird in die Geisterbahn hineingezogen.
Nun steht Nikolaus allein da, greift in die Tüte mit den gebrannten Mandeln. Lustlos steckt er sich eine Handvoll in den Mund und sieht sich um. Die meisten Gäste sind mindestens über fünfzig oder sechzig Jahre alt, sitzen schweigend auf Holzbänken und trinken Bier. Vereinzelt laufen Halbstarke in Lederkluft über den Platz, Motorradhelme unter den Arm geklemmt. Zum Glück irrt keiner der Bekloppten frei herum, für die Katzenbrunn so berühmt ist.
Sein Blick fällt auf die Schießbude. Auf die Reihen bunter Plastikblumen, auf die Kuscheltiere und Gummianhänger. Plötzlich kommt ihm eine Idee. Er könnte für Bianca eine Rose schießen.
Von seinem letzten Geld kauft er zehn Schuss für zwei Mark fünfzig und hofft, dass es reichen wird. Die Budenbesitzerin lädt das Luftdruckgewehr mit Bleikugeln und überreicht es ihm.
Nikolaus legt den Arm auf und zielt. Das weiße Plastikröhrchen, in dem eine Rose steckt, hat er fest im Blick. Er drückt ab. Und schießt daneben.
»Das wird schon …«, sagt eine Frau neben ihm und lächelt fast mütterlich. In ihrem Arm hält sie einen leicht beschwipsten Mann, der als Gewinn einen kleinen Schlüsselanhänger von der Budenbesitzerin überreicht bekommt.
Es ist eine lachende Erbsenschote.
Nikolaus wischt sich über die Stirn und lädt nach, legt wieder an. Dieses Mal trifft er. Einmal, zweimal. Zielen. Dreimal, viermal. Weißes Plastik zerspringt, und Plastikblumen fallen zu Boden. Konzentriert lädt er nach und schießt und schießt. Auch fünf, sechs, sieben und neun treffen das Röhrchen. Vor ihm liegt ein Strauß bunter Plastikblumen. Bianca wird Augen machen.
»Glückwunsch, du bist ja wirklich ein Meisterschütze!«, ertönt eine hohe Fistelstimme neben seinem rechten Ohr. Es ist nicht die Frau von eben, sondern ein Mann mit Vollbart. Er trägt eine Brille, einen schwarzen Ledermantel und hat eine kleine Narbe über dem Auge.
»Danke«, sagt Nikolaus und blickt sich irritiert um. Das Pärchen mit dem Erbsen-Anhänger ist verschwunden.
Er legt das Gewehr ab.
»Unglaublich, wie ein echter Polizist«, sagt der Mann und hält ihm eine Tüte Popcorn hin. »Willst du? Lecker süüüß.«
»Ähm, nein, danke«, entgegnet Nikolaus freundlich, nimmt den Strauß Rosen an sich, dreht sich um und verschwindet auf den Rummelplatz.
Überall blinken bunte Glühbirnen, aus den Lautsprecherboxen dröhnt Take on me und Live is Life. Nikolaus summt zufrieden mit, drückt sich an knutschenden Pärchen vorbei, »na-na-nana-na«, die überlebensgroße Mumienfigur der Geisterbahn kann er schon von Weitem erkennen.
Ein Regentropfen fällt ihm auf die Stirn. Nikolaus blickt in den wolkenverhangenen Himmel. Warum muss es schon wieder regnen? Den ganzen Tag hatten sich Sonnenschein und Gewitterschauer abgewechselt. Nikolaus geht schneller.
Plötzlich hält ihn jemand am Arm fest.
»Hey, warte mal!«, sagt die hohe Stimme, die Nikolaus augenblicklich wiedererkennt. Es ist der Mann vom Schießstand. Nikolaus wird zurückgehalten, der Griff ist eisern. »Du hast wirklich prima Turnschuhe.«
Nikolaus blickt irritiert an sich herunter. Seine neuen Adidas sind vom Matsch des Festplatzes verschmiert. »Bitte entschuldigen Sie, aber ich muss jetzt weiter. Meine Freunde warten dort drüben auf mich.«
»Nein, lauf nicht weg, mein Junge. Ich möchte dir etwas zeigen, das dir sehr gefallen wird. Etwas, das du dir in deinen kühnsten Träumen nicht ausmalen kannst. So etwas gibt es nur in Katzenbrunn.«
»Danke, aber ich habe kein Interesse …«, sagt er, obwohl irgendetwas seine Neugier weckt. Trotzdem schrillen alle Alarmglocken.
Der Mann deutet auf seinen Rosenstrauß. »Lass mich raten, die sind bestimmt für deine Herzensdame, nicht wahr?«
Nikolaus schweigt, dann nickt er schüchtern.
Der Mann grinst. »Dachte ich’s mir doch. Ein so süüüßer Junge wie du wird bestimmt viele Freunde haben. Bist du mit dem Fahrrad hier?«
»Wieso?«
»Es ist gar nicht weit entfernt«, sagt der Mann und deutet an der Kasse des Autoscooters vorbei. »Es ist gleich dahinten, im Waldstück.«
Nikolaus will sich losreißen. Von dem Mann geht eine unheimliche Stimmung aus, die man schwer beschreiben kann.
»Lassen Sie mich los!«, sagt er nun bestimmt, als der Mann plötzlich seinen schwarzen Ledermantel aufknöpft. Der Junge hält den Atem an. Dieser Irre wird darunter doch nicht nackt sein?
Doch es kommt schlimmer, als er dachte.
Eingeschüchtert folgt Nikolaus Kämmerer dem Mann in den dunklen Wald. Ohne Widerworte, ohne Gegenwehr.
Über ihm öffnet sich der Himmel.
Radioaktiver Regen, den der Ostwind mit sich bringt.
Seine Freunde werden ihn niemals wiedersehen.
ZWEI MONATE SPÄTER
Juli 1986
Oskar
Unser Dorf hat achtzehneinhalb Häuser. Dazu eine Bushaltestelle ohne Überdachung, eine Kapelle mit Friedhof, eine Metzgerei, das zugenagelte Fotofachgeschäft, einen Automaten für Kaugummis und daneben den für Mamas Zigaretten. Und weiter oben, am Ortsausgang, sind die leer stehende Trinkhalle, die Schreinerei und Bestattungen Wenner, Bauernhof G. Müller, der Landgasthof und das Einkaufslädchen. Und einmal im Jahr haben wir den Jahrmarkt hier, auf dem Festplatz.
Doch das berühmteste Gebäude in unserem Ort ist die Villa. Mit ihren dunklen Fenstern, den verzierten Säulen und dem Sicherheitszaun. Der Bau liegt gleich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ich nenne ihn den Schwarzen Palast.
Dort drüben verschwinden sie nämlich.
Alle, nacheinander.
Ich weiß das. Weil ich es beobachte, mit meinem Fernglas. Von meinem Kinderzimmer aus. Wer dort hineingebracht wird, kommt nie wieder raus. Bis auf das eine Mal, als tatsächlich ein Mann flüchten konnte. Mama hat den Zeitungsartikel sogar ausgeschnitten. Sie sagt, unser Dorf war berühmt. In ganz Katzenbrunn hat man den Verrückten gesucht. Tagelang war Polizei und Blaulicht, überall waren Suchhunde. Sogar in unserem Wald, der das Dorf von allen Seiten wie eine Würgeschlange umschließt. Katzenbrunn, ja, so heißt der Ort, in dem ich mit meiner Mama lebe.
Vater Fritz ist schon lange tot.
Unser halbes Haus, weil es von einem Schwerlaster kaputt gefahren wurde, verkümmert direkt an der Landstraße. Mama will nicht, dass die andere Hälfte wiederaufgebaut wird. Sie sagt, der Baulärm störe sie. Doch ich weiß, es liegt am Geld. Sie hat alles versoffen, was die Versicherung ihr gegeben hat.
Seit Jahren fahren hier kaum noch Autos. Aber der Schulbus hält vor unserer Tür. Von meinem Zimmer aus kann ich alles sehen.
Eine Klinik für kopfkranke Menschen, sagt Mama. Doch ich weiß, dass es eine Psychiatrie ist. Steht nämlich gut leserlich auf dem Metallschild, auf dem meterhohen Zaun:
Odenwald Klinik Waldfrieden
Zutritt nur nach Absprache!
Bisher habe ich mich an die Warnung gehalten. Denn ich möchte nicht, dass Mama wegen mir Ärger bekommt. Kinder habe ich dort drüben nie gesehen. Auch nicht zu Besuch.
Es ist Sommer 1986, Schulferien. Ich könnte mit dem Bus nach Lindenfels fahren und ins Freibad gehen. Doch ich habe keinen Freund, der mich begleiten könnte. Wobei, alleine ist sowieso besser.
Bei uns in Katzenbrunn leben nur steinalte Menschen, die nach Schimmelkäse stinken. Ich sitze meist in meinem Zimmer und starre auf die leere Straße, hinüber zur Klinik, während ich mich frage, was man anstellen muss, um dort zu landen.
Wie kaputt man im Kopf sein muss.
Manchmal denke ich darüber nach, mir mit dem Hammer auf den Schädel zu schlagen. Nur um auf der anderen Seite der Lindwurmstraße wohnen zu dürfen. Weit weg von Mama. Sie hat sich verändert, seit Vater Fritz gestorben ist. Besonders mir gegenüber. Sie redet kaum. Die Dusche im ersten Stock hat sie seit Monaten nicht mehr aufgesucht. Dafür dusche ich zweimal täglich. Morgens und abends, vor dem Zähneputzen. Reinlichkeit ist eine Tugend, Oskar, hat Vater Fritz immer gesagt. Nachdem er seine Biere ausgetrunken und zu Mama ins Schlafzimmer gegangen war. Dann hörte ich die Türen knallen. Ich habe mich nie nach oben getraut. Bis zu dem Tag, als er die Treppe herunterstolperte und es ruhig im Haus wurde. Mama sagt, es war ein Unfall. Und die Polizei sagt das auch.
Doch ich weiß es besser.
Ich darf nur mit niemanden darüber sprechen.
Hans J. Stahl
Hans Jörg Stahl, zweiundsiebzig Jahre alt, Kriminalhauptkommissar a.D., bedankt sich bei der Wirtin für das Kännchen Filterkaffee, greift zu seinem Gehstock und verlässt den Landgasthof. Im Schneckentempo humpelt er die geschwungene Hauptstraße hinunter. Es ist warm. Über ihm zwitschern die Vögel. Lindwurmstraße – sehr passend, denkt er und lässt den Blick über die Baumallee und die verrußten Fachwerkfassaden gleiten. Das Dorf Katzenbrunn hatte sich kaum verändert, als schlummerte es noch immer in einem Dornröschenschlaf. An manchen Stellen war der Ort nur noch dunkler geworden.
Ex-Kommissar Stahl bleibt vor der Metzgerei stehen und blickt auf das fotokopierte Suchplakat am Laternenmast. Das Papier des schwarz-weißen Drucks ist vom radioaktiven Sommerregen ausgewaschen wie eine alte Jeans.
Er hatte es immer geahnt. Und nicht nur das, er hatte sie alle gewarnt. Die Kolleginnen und Kollegen, den Bürgermeister, die Gemeinde. Doch niemand wollte es hören. Nun ist es wieder passiert, zehn Jahre später.
Der Greifer ist zurück.
Erneut ist ein Junge verschwunden. So wie 1969, 1973, 1975 und 1976. Dieses Mal auf der Katzenbrunner Waldkerb, vor zwei Monaten, kurz nach dem Tschernobyl-Unglück.
Damals, bei den ersten Suchaktionen, war Stahl noch im Dienst und als Kriminalkommissar für das Gebiet Lindenfels verantwortlich. Jetzt ist er pensioniert und macht Urlaub in diesem schrulligen Dorf. Das hat er zumindest seiner Nachbarin erzählt, die sich um die Kakteen auf der Fensterbank und um seine Katzen Lili Marleen und Caesar kümmert.
Er streicht ein letztes Mal über das Suchplakat, dann geht er weiter die menschenleere Straße hinunter. Die Vorhänge der umhergewürfelten Häuser sind zugezogen, als wären sie nicht bewohnt. Vielleicht wird er dahinter beobachtet. Aus dem Dunkeln, von neugierigen alten Augen.
Stahl erreicht das halbe Fachwerkhaus, das an der steilsten Kurve der Landstraße liegt. Es wurde nach einem Lastwagenunfall nicht wiederaufgebaut. Er blickt an der verschmutzten Fassade nach oben und erkennt eine Bewegung am Fenster. Das Haus scheint überraschenderweise bewohnt zu sein. Der Vorhang im ersten Stock bewegt sich. Stahl legt die Hand an die Stirn und kneift die Augen zusammen. Der vergilbte Stoff ist mit bunten Traktoren bedruckt, wahrscheinlich ein Kinderzimmer.
Er blickt auf das Klingelschild: Gerlach. Einen kurzen Moment überlegt er, ob er klingeln und die Bewohner vor dem freilaufenden Serientäter warnen sollte, doch er weiß es besser. Stahl hatte es auf die harte Tour lernen müssen, damals. Die Verschwiegenheit, die Kälte, die ihm im Dorf entgegengebracht wurde. Der gesamte Ort hatte sich gegen ihn verschworen. Als er hier ermittelte, vor zehn Jahren.
Vielleicht wohnt dort oben gar kein Kind mehr, das beschützt werden muss, beruhigt sich Stahl und dreht sich zur anderen Straßenseite um. Er blickt auf die imposante Villa der psychiatrischen Klinik im Wald mit ihrem baumhohen Säulengang. Einer der größten Arbeitgeber im Umkreis. Unvorstellbar, dass in Katzenbrunn noch Familien mit Kindern leben könnten. Nicht nach den schrecklichen Erlebnissen der letzten Jahre. Wer danach nicht weggezogen war, hatte den Ernst der Lage nicht erkannt oder kein Geld.
Stahl blickt nach links und rechts, schwingt den Gehstock nach vorne, zieht ein Bein nach und überquert die schmale Landstraße. Er kann sich Zeit lassen. Seit er vor fünfzehn Minuten den Landgasthof verlassen hat, ist kein Fahrzeug an ihm vorbeigekommen. Auch kein Motorrad, Postauto oder ein Ortsfremder, der sich verfahren hat. Ganz so, als gäbe es diesen Ort auf keiner Landkarte.
Stahl betritt den Bürgersteig. Vor ihm erhebt sich die gepflegte Grünanlage der Klinik Waldfrieden, die von einem meterhohen Zaun beschützt wird. Er greift in die Innentasche seines grauen Jacketts, zieht das silberne Zigarettenetui hervor und zündet sich eine an.
Augenblicklich steigen die Erinnerungen in ihm auf.
Es war ein verregneter Herbsttag 1976, kurz vor seiner Pensionierung. Der dreizehnjährige Stefan Kreitzer aus Schlierbach war verschwunden. Nur sein Fahrrad wurde gefunden, ganz in der Nähe des Klinikparks von Katzenbrunn. Die Mutter hatte ihn angefleht, den Jungen zu finden. Stahl hatte ihr in einem schwachen Moment versprochen, den Sohn nach Hause zu bringen. Bis dahin hatte er noch nie ein solches Versprechen abgegeben, aber sein damaliges Bauchgefühl sagte ihm, dass der Täter auf dem Klinikgelände zu suchen sei, da man dort das Rad gefunden hatte. Außerdem konnte er nicht mit einem ungelösten Fall in Rente gehen, das ließ sein Ehrgeiz nicht zu. Trotzdem blieb es höchst unprofessionell, der Mutter Hoffnungen zu machen.
Er musste den Greifer schnappen.
Also war Stahl mit seinem Audi 80 aufgebrochen und zurück nach Katzenbrunn gefahren. Seit mehreren Tagen logierte er im Landgasthof Zur Krone. Im Waldstück, kurz nach Lindenfels, geriet sein Wagen ins Schlingern und kam von der nassen Fahrbahn ab. Der Audi knallte gegen einen Baum.
Als Stahl wenig später im Krankenhaus aufwachte, war sein halber Körper eingegipst. Er konnte nicht mehr zu Ende ermitteln. Seine Pensionierung trat ein, und sein Nachfolger Kommissar Kleist war nun für den Fall zuständig. Kleist ließ ganz Katzenbrunn auf den Kopf stellen. Auch den Klinikleiter hatte er befragt, ohne Erfolg.
Stahl riet ihm, einen Durchsuchungsbeschluss für Waldfrieden zu besorgen, doch Kleist wollte nichts davon wissen, die Beweise würden dafür nicht ausreichen.
Die Mutter von Stefan Kreitzer starb, einen Tag bevor Stahl aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Sie hatte sich auf die Bahngleise gestellt.
Die Ärzte im Krankenhaus sagten ihm, dass Stahl bald genesen sei. Doch es sollte anders kommen. Seit zehn Jahren plagen ihn Schmerzen. Angeblich alles nur psychosomatisch. Aber was wussten die schon?
Stahl pustet Rauch aus. Unser Täter versteckt sich da drin, in dieser Villa – egal, was alle behaupten, denkt er.
Doch dieses Mal wird er ihn fassen.
Er hatte es versprochen.
Wirtin Geli
Sie räumt das Kännchen vom Frühstückstisch ab, an dem ihr wortkarger Gast den Filterkaffee geschlürft hat. Im Aschenbecher liegen fünf Zigarettenstummel. Wirtin Gerlinde Elmenreich, achtundsechzig, von allen im Ort nur liebevoll Geli genannt, schmunzelt. Auch wenn der siebzigjährige Herr vorgegeben hat, nur für einen Kurzurlaub nach Katzenbrunn gekommen zu sein – sie weiß es besser. Der Mann ist ehemaliger Polizist.
Schon vor zehn Jahren war ihr der Schönling aufgefallen. Bevor er seinen Autounfall hatte. In seinem schicken Anzug mit Fischgrätmuster, den ordentlich frisierten Haaren, dem markanten, wettergegerbten Gesicht. Der Ex-Kommissar teilte sich nicht nur den Vornamen mit Hansjörg Felmy, dem berühmten deutschen Schauspieler, sondern auch dessen charismatisches Äußeres.
Geli war noch keine Witwe gewesen, als Stahl das erste Mal in ihrem Landgasthof logierte. Das war 1976. Trotzdem hatte sie schon damals ein Auge auf den Kommissar geworfen. Und bis auf den Gehstock hatte Hans Jörg Stahl über die Jahre nichts von seiner Attraktivität eingebüßt.
Sie wischt mit dem Lappen über den Eichentisch und sieht aus dem Fenster. Von hier oben hat Geli eine gute Aussicht über Katzenbrunn. Überhaupt hat Geli das Dorftreiben immer im Blick. Als Wirtin lernt man eben nicht nur die Eigenheiten der Einheimischen kennen, sondern auch Reisende gut einzuschätzen.
In der Ferne, am anderen Ende des Ortes, liegen Kapelle und Friedhof. Von der Sonnenterrasse des Landgasthofs aus kann sie sogar das Grab ihres Ehemanns Josef erkennen. Die betongraue Granitplatte, die sie für ihn ausgesucht hat. Endlich weiß sie genau, wo er liegt.
Zum ersten Mal ist es nicht das Bett einer anderen Frau.
Hätte sich Geli damals einen Ruck gegeben und den Kommissar angesprochen, vielleicht hätte sich ihr Leben verändert. Doch damals kam für sie keine Trennung mehr infrage. Was wäre aus dem Landgasthof geworden? Undenkbar! Also lebte sie mit Josefs Liebschaften und zog sich immer mehr zurück.
Erst nach seinem plötzlichen Tod durch einen Herzinfarkt vor vier Jahren blühte Geli wieder auf. Langsam zwar, wie eine verkümmerte Zimmerpflanze, die man wieder aufpäppelte, aber über die Monate hinweg gewann sie immer mehr Kraft und Selbstvertrauen. Und auch der Landgasthof begann wieder zu florieren. Es kamen mehr Gäste in die Krone als je zuvor. Geli wusste nicht, woran es lag, aber sie nahm den Umstand als Geschenk an.
Das Sahnehäubchen war allerdings Hans Jörg Stahl gewesen. Sie hätte niemals gedacht, den schnittigen Kommissar wiederzusehen, geschweige denn, dass er unter ihrem Dach schlief.
Dieses Glück hat sie nur dem armen verschwundenen Jungen aus Kolmbach zu verdanken, denkt sie. Und auch: Hoffentlich bleibt er noch etwas länger verschollen.
Augenblicklich steigt ihr Schamesröte in die Wangen. Wie kann sie nur so egoistisch sein und so etwas Grausames denken? Zur Bestrafung zwickt sie sich in den Oberarm. Doch es nützt nichts, ein zartes Lächeln huscht über ihre Lippen. Hans Jörg Stahl hat das Zimmer für eine Woche in ihrem Gasthof gebucht. Eine ganze Woche. Genug Zeit, um ihn näher kennenzulernen.
Sie blickt in den braunen Glasaschenbecher hinein, den Stahl während des Frühstücks benutzt hat. Greift vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger zwischen die Asche und zieht einen Zigarettenstummel heraus. B&H steht auf der kleinen Banderole. Die edle Marke führt sie nicht in ihrem Gasthof. Nur Ernte 23, HB, Roth-Händle, Lord und Marlboro. Anderes wird von ihren Stammgästen nicht verlangt. Geli ist sich zu hundert Prozent sicher, dass sie die britische Marke noch nirgends in Katzenbrunn gesehen hat, seit die Trinkhalle geschlossen wurde. Selbst in Manfred Horns Einkaufslädchen nicht. Und der verkauft viele verschiedene Marken, sogar Zigarillos und Zigarren.
Sie läuft zur Rezeption, greift zum Telefon und bestellt beim Großhändler per Expresslieferung zwei Stangen Benson & Hedges.
Oskar
Ich beobachte den alten rauchenden Herrn mit Gehstock, der unter meinem Fenster steht und den Schwarzen Palast beschattet, noch einen kurzen Moment, dann ziehe ich den Vorhang zu und schlüpfe aus meinem Kinderzimmer.
Im Flur riecht es nach Kartoffelsuppe von gestern. Ich steige die schmalen Treppenstufen nach oben, streiche mit den Fingern über unsere Familienfotos an der Wand und klopfe an Mamas Tür.
Sie wälzt sich auf der Matratze, die Sprungfedern quietschen. Ich öffne die Tür einen Spaltbreit. Ein Schwall ranziges Körperfett mit süßlichem Harngeruch frisst sich mir in die Nase. Ich atme durch den Mund, flüstere in den abgedunkelten Raum hinein: »Ich werde rüber in den Wald gehen, Mama. Bin bald wieder zurück!«
Sie schiebt sich die Schlafmaske von den Augen, rollt sich zur Seite. Dabei stößt sie die leere Wodkaflasche um, die auf dem Nachttisch steht, und ein dumpfer Aufschlag auf dem grünen Teppichboden ist zu hören.
Das Glas zerbricht nicht.
»Schon wieder?«, nuschelt sie.
»Es ist schönes Wetter«, erkläre ich.
»Nein. Ich … ich finde das nicht gut, Oskar«, sagt sie und zieht die Nase hoch. »Du weißt, dass es zurzeit im Wald besonders gefährlich ist. Die in den Fernsehnachrichten haben gesagt, dass die Ostwinde …«
»Ich werde nichts anfassen oder essen.«
»Diese verdammte Strahlung«, sagt sie und fingert nach den Kopfschmerztabletten. »Aber versprich mir, auf keinen Fall aus der Quelle zu trinken, ja?«
»Natürlich nicht«, sage ich schnell, obwohl es nichts Besseres gibt, als das Gesicht unter eiskaltes Quellwasser zu halten. Besonders im Juli. »Mach dir keine Sorgen, Mama.«
Sie setzt sich schwerfällig im Bett auf. Thront wie eine glänzende Unke auf der Matratze. Sie hat das Schlafanzugoberteil aus Satinstoff falsch geknöpft, ihr halber Busen hängt heraus.
Sie hustet aus den Tiefen ihrer Lunge. »Und halte dich von den verdammten Kindern fern!«
Ich schüttle demonstrativ den Kopf, um sie zu beruhigen. Als wäre radioaktive Strahlung ansteckend. »Ich treffe mich mit niemandem, Mama. Versprochen.«
Wie auch? Katzenbrunn ist kein Kinderdorf. Sondern ein Friedhof mit drei Dutzend lebenden Toten. Da richtet selbst radioaktiver Regen keinen Schaden mehr an.
Deshalb bin ich oft draußen. Ich habe mir sogar eine Schutzhütte drüben im Wald gebaut. Also nicht wirklich selbst gebaut, sie stand schon lange vor mir dort. Ich habe den Ort nur etwas umgestaltet. Mit Postern von Falco, Madonna und Nena. Mit Spielzeug, Süßigkeiten. Und natürlich ein paar Kerzen, falls es dunkel wird.
Niemand weiß von meiner geheimen Hütte, die gut versteckt zwischen den Bäumen liegt. Bis auf den fremden Mann vielleicht, der dort letzte Woche hinter den Bäumen herumgeschlichen ist. Ein langhaariger rotblonder vielleicht dreißigjähriger Brillenträger mit dünnem Oberlippenbart, dessen Wangenknochen wie spitze Hähnchenflügel aus der Haut stachen. Der Mann trug eine schwarze Lederweste, darunter ein dunkelblaues Jeanshemd und eine kastanienfarbene Cordhose.
Er sah auf jeden Fall nicht wie ein Förster aus.
»Haben sie den vermissten Jungen denn schon gefunden?«, nuschelt Mama und drückt eine Tablette aus der Blisterpackung.
»Hm?«
»Den vom Suchplakat.«
»Weiß nicht.«
»Du musst vorsichtig sein, Oskar«, sagt sie und schluckt die Pille ohne Wasser. »Ich kann nicht immer auf dich aufpassen.« Sie greift in die Zigarettenschachtel und fummelt eine letzte Zigarette heraus, zündet sie an. »Schatz, kannst du für mich neue Kippen holen?«
Ihr Kopf schwankt in einer Nebelwolke.
»Natürlich, Mama.«
»Geld liegt auf der Kommode.«
Ich drücke die Tür weiter auf und gehe auf Zehenspitzen auf das verdunkelte Fenster zu, greife nach dem Portemonnaie und kippe das Sprossenfenster. Frischer Sommerwind zieht in die Dachkammer hinein.
»Willst du mich umbringen?«, schnauzt sie.
Sofort schließe ich das Fenster wieder und husche aus dem Zimmer.
Als ich auf die Straße trete, ist der rauchende Mann nirgends mehr zu sehen. Ich blicke mich nach allen Seiten um. Vielleicht hat ihn der Schwarze Palast verschluckt? Bei dem Gedanken muss ich grinsen.
Ich stecke die Hände in die Hosentaschen und schlendere den Berg hoch, Richtung Ortsausgang. Zu den Automaten.
Vor dem staubigen Schaufenster von Foto Strick bleibe ich stehen. Ich blicke durch die Ritze des Holzverschlags. Dort liegt er noch, der neue Videorecorder von Grundig. Niemand hat ihn gestohlen. Ein silberner Zauberkasten, so winzig klein wie drei nebeneinandergestellte Schuhkartons. Damit kann man Filme aus dem Fernseher aufzeichnen, erklärte mir Herr Strick. An ein Wunder allerdings grenzt das funkelnde Elektronikgerät daneben. Ein sogenannter Mini-Camcorder von Sony im Video-8-Format. Diese Filmkamera wird mit Batterie betrieben und kann ganz leicht überallhin mitgenommen werden. Wie eine gewöhnliche Fotokamera, nur mit Bewegtbild. Den fertigen Film muss man nicht mehr zum Entwickeln in den Fotoladen bringen, sondern kann die Filmkamera direkt an den Fernseher anschließen, um sich alles anzusehen. Das Geschäft hat sowieso seit Monaten geschlossen, seit sich Herr Strick einen Strick genommen hat (kein Witz).
Irgendwann werde ich auch einen Camcorder besitzen.
Ich werfe vier Münzen in den Automaten und ziehe eine Schachtel Marlboro.
Günther Kulka
Der zentnerschwere Mann mit der Wildschweinnase starrt ihn minutenlang an. Ohne ein Wort zu sagen. Günther Kulka beginnt zu frieren. Das Klimagerät läuft auf Hochtouren. Blauer Zigarettenrauch schwebt wie ein Geisterschiff über sie hinweg. Ihn beschleicht das Gefühl, der Marktleiter hypnotisiere ihn oder könne auf sonderbare Weise sein Gehirn auslesen. Seine Augen beginnen hinter den dicken Brillengläsern zu tränen.
Kulka zwingt sich, nicht zu zwinkern.
Der Marktleiter des Einkaufslädchens Kolonialwaren Horn schlägt die Bewerbungsmappe zu. Scheinbar ist er zufrieden mit dem, was er gesehen hat. Die Prozedur scheint jedoch nicht zu Ende zu sein, Kulka wird weiterhin gemustert, von oben bis unten. Er streicht sich die Finger an der braunen Cordhose trocken. Vielleicht hätte er sich die schulterlangen Haare doch zusammenbinden sollen. Und sich einen Anzug leihen, statt in Lederweste und Jeanshemd im Dorfladen aufzutauchen.
Marktleiter Manfred Horn beugt sich schwerfällig nach vorne, hustet erneut Rauch aus. Dann dreht er sich auf seinem Bürostuhl zur Seite und klopft mit der Pranke gegen die dunkle Glasscheibe, die über dem Bürotisch in die Wand eingefasst ist. »Hier von meinem Büro aus kann ich alles sehen. Jede Kundin, jeden Kunden.« Er zieht wieder an seiner HB-Zigarette. »Und natürlich auch jeden Mitarbeiter.«
Kulka wirft einen Blick durch die Scheibe, hinunter auf die gefüllten Einkaufsregale. Hauptsächlich Konservendosen, Ravioli und Erbsensuppe. Er hätte nicht gedacht, dass sich hinter dem schmalen Spiegel tatsächlich das stickige Büro des Marktleiters versteckt. Er war hier schließlich in einem Odenwälder Kuhkaff, nicht auf der Reeperbahn.
»Kann man sich auf Sie verlassen?«
Günther Kulka nickt eifrig mit dem Kopf. »Können Sie, ja.«
»Schön, schön«, brummt Marktleiter Horn und lehnt sich wieder in seinem Bürostuhl zurück. Der Kippenstummel klemmt in seinem Mundwinkel. »Also? Warum Katzenbrunn?«
Der junge Mann rutscht auf dem Stuhl herum. Auf diese Frage hatte er sich vorbereitet, doch irgendwie will ihm die Lüge nicht über die Lippen kommen. Deshalb bleibt er stumm.
»Haben Sie etwa was ausgefressen, Junge?«
»Nein, nein, nein!«, stammelt Kulka, vielleicht etwas zu hastig. Er holt kurz Luft, sammelt sich. »Ich … ich mag Katzenbrunn. Die Gegend ist wirklich schön. Und ruhig, so mitten im Wald gelegen.«
»Hier leben nur Gestörte. Was soll daran schön sein?«, entgegnet der Marktleiter trocken, ohne eine Miene zu verziehen, und saugt an seiner Zigarette.
Sollte das ein Scherz sein? Oder eine Fangfrage?
Günther Kulka wippt mit dem Oberkörper, denkt nach. Dann versteht er. »Ach, Sie meinen wegen der Irrenanstalt? Ja, ja, ich weiß.« Er lacht. »Die habe ich am Ortseingang gesehen. Nein, die stört mich nicht. Überhaupt nicht.«
»Soso, stört Sie nicht …«, wiederholt Manfred Horn und runzelt die Stirn, notiert etwas in seinen Unterlagen. »Wissen Sie eigentlich, warum unser hübscher Ort Katzenbrunn heißt?«
Irritiert schüttelt Kulka den Kopf.
Sein Gegenüber schmunzelt. Und verzichtet auf eine Antwort. Stattdessen deutet er auf die Bewerbungsmappe, die vor ihnen auf dem Resopaltisch liegt. »Wie ich in Ihrem Lebenslauf gesehen habe, sind Sie die letzten Monate mehrfach umgezogen? Von Würzburg nach Hamburg, St. Pauli, dann weiter nach Salzgitter in Niedersachen und jetzt zu uns nach Katzenbrunn?« Der Marktleiter grinst herausfordernd. »Also immer kreuz und quer durch die Republik. Sie sind wohl auf der Flucht, was?« Er hustet. »Terrorist? RAF?«
»Ähm, was? Nein, natürlich nicht …«, erklärt Kulka schnell und streicht sich über den flaumigen Oberlippenbart. »Aber eine Art Rebellion, also ein Neuanfang, ist es schon.« Er greift in seine Brusttasche und zieht eine Packung Marlboro heraus, steckt sich ebenfalls eine an. Seine Finger zittern. »Meine Frau hat Pharmazie studiert, zumindest ein paar Semester, unten in Würzburg. Ihre Eltern wollten das.« Kulka zieht an der Kippe. »Wir sind abgehauen. Ein bisschen Deutschland erkunden.« Jetzt war der richtige Zeitpunkt für seine Lüge gekommen, dachte er und fuhr fort: »Und dann hat mir ein Freund aus Lindenfels von dieser leer stehenden Trinkhalle in Katzenbrunn erzählt, direkt an der Lindwurmstraße, wo ein neuer Pächter gesucht wird.«
»Die Trinkhalle? Aha … Ihre Frau will die also jetzt betreiben?«
»So haben wir es zumindest geplant.« Günther Kulka beginnt zu strahlen. Er ist stolz auf seine Frau Gisela, die ihm zuliebe alles zurückgelassen hat. Sogar den Kontakt zu ihren nervigen Eltern. »Schließlich wollen wir auch bald Kinder haben.«
»Mhm, interessant …«, sagt der Marktleiter nachdenklich und drückt die Kippe im Aschenbecher aus. Es wirkt, als würde er mit seinem dicken Daumen einen Käfer zerdrücken. »Das bedeutet also, Ihre Frau wird mir und meinem Laden bald Konkurrenz machen?«
»Ähm, wie bitte?«
»Das hätten Sie mir vorher sagen müssen.«
»Aber …?« Sein Mund ist so trocken wie der Kreideschwamm aus seiner Schulzeit. »Was … was meinen Sie damit?«
»Tja, Herr Kulka. Es tut mir leid. Aber Geschäft ist Geschäft«, sagt Marktleiter Horn und deutet auf die Bürotür. »Unter diesen Umständen kann ich Sie leider nicht einstellen.«
Hans J. Stahl
Die Haustür öffnet sich erst nach dem dritten Klingeln. Eine dürre Mittfünfzigerin, weißblond, sichtbar gefärbt, mit türkisfarbener Blumenschürze, taucht im Türrahmen auf, lehnt sich gegen die Milchglaswand des Windfangs. Bevor Ex-Kommissar Stahl sich vorstellen kann, hebt sie die Hand und deutet ihm an zu schweigen. Hinter ihr im Flur bellt ein Hund. Von der Stimmlage schätzt Stahl das Tier auf einen Deutschen Schäferhund.
»Hasso, still!« Und dann: »Ich kaufe nichts an der Tür.«
»Ich ebenfalls nicht«, entgegnet Stahl freundlich und zieht seinen Personalausweis hervor. »Aus Prinzip.« Die Bewegung, die er jahrzehntelang, ohne nachzudenken, ausgeübt hatte, war ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Auch wenn er keine offizielle Dienstmarke mehr vorzeigen kann, es gebührt dem Respekt, sich seinem Gegenüber ordentlich vorzustellen. »Bitte entschuldigen Sie die Störung, Frau Bergmann. Mein Name ist Hans Jörg Stahl. Wie das Eisen. Ich bin pensionierter Kriminalkommissar, und ich hätte nur eine kurze Frage an Sie.«
»Polizei? Na, dann schießen Sie mal los«, sagt sie und verschränkt die Arme vor der Brust. Ihre Fingernägel leuchten signalrot. »Nein, Moment, lassen Sie mich raten. Es geht um den Jungen von der Waldkerb, richtig?«
»Hm, ganz recht.« Stahl lächelt. Sein Instinkt hatte ihn zum richtigen Haus geführt. »Sein Name ist Nikolaus Kämmerer. Wie ich gehört habe, wurde sein Kinderrad hier ganz in der Nähe gefunden. Im Wald, wieder nur wenige Hundert Meter hinter der psychiatrischen Klinik.«
Ihre Miene verfinstert sich.
Er bemerkt es.
Also spricht Stahl weiter: »So wie damals. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Jahr 1976, Frau Bergmann? Wir gehen davon aus, dass der damalige Täter, die Zeitungen nannten ihn den Greifer, heute um die vierzig Jahre alt sein könnte. Schon vor zehn Jahren war ein Junge in Katzenbrunn …«
Weiter kommt er nicht.
»Ich hätte es wissen müssen!« Sie fuchtelt wild mit den Händen, spuckt Luft aus. »Unsere Klinik! Natürlich! Wie immer – wie immer ist unsere Einrichtung an allem schuld!«
»Entschuldigen Sie, das habe ich …«
»Die Polizei glaubt also immer noch, dass ein Patient für das alles verantwortlich ist? Der Greifer – ein Irrer, der sich Kinder holt und tötet?« Frau Bergmann baut sich wie ein gefüllter Heliumballon vor ihm auf. Sie ist kurz vorm Platzen. »Dann beantworten Sie mir eins: Warum hat man noch nie eine Leiche gefunden, he? Noch keine einzige!«
Stahl schweigt.
»Katzenbrunn ist kein Mörderdorf, Herr Kommissar! Hier leben nur friedfertige Menschen. Verlassen Sie unsere Gemeinde und finden Sie lieber die vermissten Jungen!«
Sie knallt ihm die Tür vor der Nase zu. Ein Windzug weht ihm die letzten lichten Haare ins Gesicht.
Stahl richtet seinen Scheitel. Für heute ist er fertig.
Mehr wird er von Schwester Annegret Bergmann nicht erfahren. Womöglich hat die Psychiatrieleitung allen Angestellten eingeimpft, über die Vermisstenfälle zu schweigen. Ihr gutes Recht, um den Ruf der Klinik zu schützen.
Er wendet sich ab und humpelt über den sauber gerechten Kiesweg weiter zum Jägerzaun. Ein schief gewachsener Kirschbaum steht im gepflegten Vorgarten, darunter auf dem gemähten Rasen, in einer Linie aufgereiht, ein Dutzend Gartenzwerge. Stahl schielt über seine Schulter hinweg zum Küchenfenster, dann stößt er mit dem Gehstock einen der Gartenzwerge um und verlässt das Grundstück.
Schugge
Seine Nase läuft. Er wischt sie sich mit dem Jackenärmel sauber. Schnieft trotzdem. Schugge hat sich vom Wald her an das ehemalige Fotogeschäft geschlichen. An die Rückseite des Ladens, dabei ist er wie ein Feldhase von Busch zu Baum gehüpft. Niemand hat ihn gesehen.
Schugge versteckt sich hinter einem Container. Ja, gutes Kind, sagt die Stimme in seinem Kopf.Überall wächst Löwenzahn zwischen den Betonplatten empor. Sie leuchten wie kleine gelbe Briefkästen.
Keiner kümmert sich um das Geschäft von Wolfgang Strick. Seit er sich totgemacht hat. Schugge weiß, dass nun niemand mehr in den Fotoladen geht. Bald ist es sein Zuhause, sein eigenes Heim.Dort wird er schlafen. Und niemand wird es wissen. Er kann dort ganz allein sein. Er nimmt den Schraubendreher aus der Jackentasche und schiebt ihn in das Türschloss. Rührt im Loch herum, wie ein Klistier zur Darmreinigung, gutes Kind. Klappt nicht. Schugge guckt sich um. Die Container, die der Lastwagen gebracht hat, sind voll mit Regalen, Leuchtstoffröhren und Stühlen. Gefüllt mit grauen, dicken Mülltüten.
Schugge wird traurig. Warum haben sie auch den Fotoladen totgemacht?, flüstert die Stimme. Verbittert steckt er den Schraubendreher in den Spalt zwischen Tür und Rahmen. Und er drückt. Ganz fest, rutscht ab. Die Hintertür will nicht aufgehen. Zwei Häuser weiter bellt Hasso. Der Schäferhund von Bergmann. Er hasst diese Frau.
Böse Frau. Hund, still!
Schugge sieht das Fenster neben der Tür. Es hat eine Glasscheibe. Sie ist staubig. Glas kann man kaputt machen.
Aber keinen Lärm machen, nicht.
Er läuft zurück zum Container und zieht einen Holzstuhl heraus. Wickelt die Jacke um das Stuhlbein. Schugge holt aus und schlägt das Fenster ein. Glas fällt zu Boden. Hasso bellt lauter. Schugge dreht sich im Kreis und macht: »Schschschsch! Nein, nein! … Hasso still!« Es nützt nichts. Der Schäferhund bellt weiter. Er ist viel zu weit weg.
Aufgebracht stellt Schugge den Stuhl unter das Fenster und klettert durch das zerbrochene Glas ins Innere. Er schneidet sich den Arm auf. Und das Gesicht. Es blutet. Aua, aua. Er fällt auf eine Kloschüssel. Der linke Arm schmerzt. Er richtet sich auf, blickt in den runden Badezimmerspiegel. Da drin ist er zu sehen. Er,der große Schugge. Eigentlich Meschugge, die Einwohner von Katzenbrunn haben ihm diesen Spitznamen gegeben. Nachdem er in den Dorfbrunnen gestiegen ist, um dort Katzenjungen zu suchen. Sie haben alle gelacht.
An den Namen, den ihm seine Mutter zur Geburt gegeben hat, kann sich Schugge nicht erinnern. Aber Meschugge gefällt ihm. Und Schugge auch. Auf seiner blutigen Wange sprießen Barthaare, unterschiedlich lang. Die Lippen sind geschwungen, die Zähne fast weg. Die Augen sind so blau wie der Himmel im Mai. Haare mit der Schere geschnitten. Hat Schugge selbst gemacht, gutes Kind, sagt die Stimme in seinem Kopf. Er grinst sein Ebenbild an, dann streicht er über das kalte Glas.
Oh, Schugge, sie werden dich nicht finden. Nein, nein, nein, niemals. Du gehst nicht mehr zurück. Er drückt die Toilettentür auf und betritt den alten Fotoladen. Die Schaufenster sind mit Holzbrettern vernagelt, durch schmale Schlitze fällt Sonnenlicht in das leer stehende Geschäft. In der Auslage liegen noch verstaubte Geräte. Er lauscht. Jemand zieht am Automaten Zigaretten. Schugge sieht die Gestalt durch die Schlitze, verharrt für einen Moment im Dämmerlicht. Dann setzt er einen Fuß vor den anderen. Das Glas knirscht unter seinen Schuhen. Es riecht nach Verdünner und Rattenkot. Schugge spitzt die Ohren.
Er ist allein. Noch.
Oskar
Der weiße Lieferwagen fällt mir sofort auf. Er parkt unter der Linde am Straßenrand. Gleich gegenüber von unserem Einkaufslädchen. Ich habe das fremde Fahrzeug schon einmal gesehen, ganz sicher, oben am Landgasthof. Ich blinzle, versuche, das Kennzeichen zu erkennen. SZ-GK59-…? Der Besitzer ist nicht von hier, zumindest nicht aus dem Odenwald. Doch ich bin zu weit entfernt, um die Buchstaben richtig zu entziffern.
Ich weiß nicht, warum, aber der leicht verbeulte Lieferwagen weckt mein Interesse. Es verirren sich selten Menschen in unser Dorf. Vielleicht werden unserem Marktleiter neue Lebensmittel gebracht? Eine neue Sorte Eiscreme oder Schokolade? Der Lieferwagen hat jedoch keine Werbebeklebung an den Seiten.
Ich gehe ein paar Schritte weiter. Im Führerhaus sitzt niemand, das kann ich aus der Entfernung erkennen. Ich streiche mir die Haare aus der Stirn. Bevor ich Mama die Marlboros nach Hause bringe, könnte ich mich an den Lieferwagen anschleichen und in den Laderaum lunzen. Falls der Wagen überhaupt hinten Fenster hat.
Ich stecke Mamas Zigarettenpackung in die Hosentasche und drehe mich nach allen Seiten um. Außer der uralten Strick, die wie jeden Mittag auf der Parkbank am Katzenbrunnen sitzt und sich dabei stundenlang die Haare kämmt, ist niemand auf dem Bürgersteig zu sehen.
Ich schleiche über die Straße auf das geparkte Fahrzeug zu.
Augenblicklich beginne ich zu pfeifen. Nicht weil es zu meinem Plan gehört, besonders unauffällig zu sein. Sondern weil ich nervös bin. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Es ist ein Lied aus meiner Kindheit. Der Sänger heißt Freddy Quinn. Vater Fritz hat es gesungen, wenn er mich mit dem Ledergürtel bestraft hat.
Der Schatten des Baumes fällt über mein Gesicht, sofort wird es kühler. Pfeifend gehe ich zur Beifahrertür und schiele in die leere Fahrerkabine hinein.
Dort liegt ein Päckchen Zigaretten. Ich erkenne das rote Markenzeichen von Mamas Marlboros, ein Paar Gummistiefel (wofür braucht man die im Sommer?), eine Bild-Zeitung mit Datum von heute, ein angebrochenes Päckchen Pfefferminzkaugummis, einen Armeerucksack, einen zerfledderten Juliette-Liebesroman, eine leere Flasche Schmucker-Bier und ein …
»Hey, was soll das?«
Eine Hand legt sich auf meine Schulter.
Ich wirble erschrocken herum und blicke in das Gesicht eines langhaarigen Mannes mit Brille. Es ist der Fremde mit der Weste, den ich im Wald gesehen habe. Ich habe ihn sofort wiedererkannt. Er stinkt wie eine Räucherforelle, nach kaltem Zigarettenrauch.
Panisch reiße ich mich von ihm los und renne davon. Ich höre noch, wie die Seitentür des Lieferwagens aufgeschoben wird, dann biege ich hinter Schreinerei und Bestattungen Wenner in den kleinen Sandweg ein, der in den Wald führt. Und renne. Renne und drehe mich nicht um.
Ich hoffe, dass er mich nicht verfolgt. Fluchend springe ich immer tiefer in den dunklen Wald hinein, meine Beine tragen mich durch das Unterholz. Über mir flattern schwarze Vögel in den Ästen. Dann taucht sie endlich vor mir auf. Meine Schutzhütte, versteckt zwischen den Kiefern auf giftgrünem Moosboden. Ich bleibe stehen, stütze mich auf meinen Oberschenkeln ab und verlangsame meine Atmung. Nachdem meine Lunge zu brennen aufgehört hat, laufe ich hinter die Holzhütte. Unter einem markierten Stein befindet sich der Schlüssel, den ich dort versteckt habe.
Die Tür quietscht, als ich sie aufsperre. Als ich den vertrauten, modrigen Geruch rieche, fühle ich mich sicher. Ich taste mich zum Regal und greife nach den Streichhölzern, zünde zwei Kerzen an. Nena strahlt von ihrem Plakat herab. Ich puste das Streichholz aus und setze mich im Schneidersitz auf eines der orangefarbenen Gartenstuhlkissen, die ich aus unserem Keller stibitzt habe. Mama wird es nicht bemerken. Seit Vater Fritz’ Tod war sie nicht mehr in unserem Garten. Wenn ich nicht jeden Samstag den Rasen mähen würde, würden wir in einem Urwald leben.
Ich überlege, ob ich mir einen Schokoriegel oder ein paar Treets gönnen sollte, aber ich darf meinen Vorrat nicht aufbrauchen. Vielleicht finde ich irgendwann wieder einen Freund, den ich zu mir einlade.
Plötzlich überkommt mich Traurigkeit. Ich fühle mich alleine. Schwermütig ziehe ich die Beine an meine Brust, umklammere sie mit den Armen und starre auf die Kellerklappe vor mir, wippe mit dem Oberkörper vor und zurück. Schaukle mich selbst. So, wie es Mama gemacht hat, als ich noch klein war.
Dann, langsam, beginne ich mich zu beruhigen.
Hans J. Stahl
Die Glocke der Kapelle läutet. Ex-Kommissar Stahl blickt auf seine russische Pilotenuhr am Handgelenk. Zwölf Uhr. Vielleicht sollte er dem Pfarrer einen Besuch abstatten. Geistliche sind schließlich wie Frisöre, haben ihre Ohren überall. Kennen jedes Geheimnis ihrer Gemeinde, sei es noch so schmutzig.
Lärmend quält sich ein Traktor die geschwungene Lindwurmstraße hinauf. Auf dem Fahrersitz hockt ein schlaksiger junger Mann mit Vollbart. Das muss Georg Müller sein, denkt Stahl, nickt ihm freundlich zu, erhebt den Gehstock. Der junge Bauer bemerkt den Gruß, starrt jedoch weiterhin regungslos auf die Fahrbahn vor sich.
»Seltsamer Kauz«, murmelt Stahl und betritt den kleinen Friedhof am Ortseingang. Von irgendwo krächzt ein Kolkrabe. Der ehemalige Kommissar blickt sich in der Parkanlage um. Vereinzelte Bäume und Büsche, verschachtelte Kieswege, fast labyrinthartig. Eine Trauerweide streckt ihre dürren Arme über den Weg.
Er humpelt weiter.
Denkt nach.
Die Grabsteine von Katzenbrunn bieten überraschenderweise nicht viel Abwechslung bei der Namensgebung. Stahl registriert nur elf unterschiedliche Nachnamen: Müller, Bergmann, Gerlach, Kaffenberger, Bongartz, Wenner, Strick, Lautenschläger, Wenzel, Richter und Horn.
Hier scheint alles in der Familie zu bleiben.
Er stützt sich auf seinen Gehstock und schlurft auf die Kapelle zu. Die Flügeltüren stehen weit offen.
Schwester Bergmann
Sie hatte erst gar nicht abgewartet, bis der alte Krüppel ihr Grundstück verlassen hat, sondern war sofort in den Flur gestürzt, zu ihrem Telefon.
Aufgeregt lässt sich Annegret Bergmann auf ihren neuen Telefonplatz fallen, den ihr Mann von einer Vertreterkonferenz aus Michelstadt mitgebracht hat. Es ist ein wunderbares Stück, aus geschnitztem Holz, dunkelbraun lackiert, der gepolsterte Sitz wurde mit grünem Samt bezogen. An der rechten Seite hat das Möbelstück eine geschwungene Verlängerung, auf der nicht nur das cremefarbene Telefon Platz findet, sondern auch ihr Adressbüchlein mit Goldschnitt.
Hastig blättert sie zu dem Buchstaben D für Doktor, Dr. Krumbiegl. Sie findet seine Nummer, greift nach dem Werbekugelschreiber von Imkerei Bienenglück und dreht damit die Wählscheibe. Fast hätte sie vor Aufregung ihren Zeigefinger benutzt. Kaum auszudenken, wenn der lackierte Fingernagel eingerissen wäre.