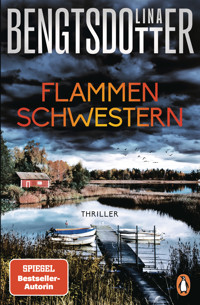
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Ort voller Geheimnisse, zwei verschwundene Frauen und ein gefährliches Spiel mit dem Feuer
Als Kinder waren Katja und Vega unzertrennlich. Katja wuchs in einer zerrütteten Familie auf und Vegas Mutter ist viel zu früh verstorben. Die beiden Mädchen waren jedoch stets füreinander da, bis ein schicksalhafter Tag die beiden Freundinnen mit aller Wucht auseinandergerissen hat. Viele Jahre später erhält Vega einen verzweifelten Anruf von Katja, der sie zwingt, in das kleine Dorf ihrer Jugend zurückzukehren. Doch bei ihrer Ankunft fehlt von Katja jede Spur. Sofort kommt die Erinnerung an Katjas Tante zurück, die als Teenager vor mehr als dreißig Jahren verschwand. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Schicksalen? Vega muss Katja finden, bevor es zu spät ist – oder das dunkle Geheimnis, dass sie seit so vielen Jahren hütet, wird ihr Leben für immer zerstören.
Nach Abschluss der erfolgreichen Serie um die Ermittlerin Charlie Lager meldet sich Lina Bengtsdotter mit einem hochatmosphärischen Thriller zurück, den man nicht aus der Hand legen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Lina Bengtsdotter wuchs in der schwedischen Kleinstadt Gullspång auf, die sie zum Setting ihrer beliebten Thriller-Serie um die Ermittlerin Charlie Lager machte, mit der sie auch in Deutschland die Bestsellerliste stürmte. Lina Bengtsdotter lebt in Stockholm.
Lina Bengtsdotter in der Presse:
»Der dunkle Humor, die fesselnden Charaktere und der grandiose Schreibstil sorgen dafür, dass Lina Bengtsdotters Romane immer wieder begeistern.« Camilla Läckberg
»Lina Bengtsdotter vereint alle Zutaten eines perfekten Schwedenkrimis.« Kölner Express über Löwenzahnkind
»Wie in einer nebligen Nacht mit ihren Schatten zeigt uns dieser Thriller alles … erst auf den zweiten Blick.« Dagens Nyheter über Hagebuttenblut
»Spannender Thriller, nicht nur für Schwedenkrimi-Fans. Ein äußerst vielschichtiger Roman, bei dem die Spannung konstant hoch bleibt.« hr2-»Büchertipp« über Löwenzahnkind
Außerdem von Lina Bengtsdotter lieferbar:
Löwenzahnkind
Hagenbuttenblut
Mohnblumentod
www.penguin-verlag.de
Lina Bengtsdotter
FLAMMENSCHWESTERN
Thriller
Aus dem Schwedischen von Sabine Thiele
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Lågorna bei Forum, Stockholm.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 der Originalausgabe by Lina Bengtsdotter
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Maike Dörries
Umschlaggestaltung: bürosüd, München
Umschlagabbildungen: www.buerosued.de
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28641-5V002
www.penguin-verlag.de
1
Wir gehen den Schotterweg entlang. Katja trägt das rote Kleid ihrer Tante und ich einen hellblauen Rock mit passend hellblauer Strickjacke aus demselben Schrank.
Ich sage zu Katja, dass wir vielleicht besser umkehren sollten, dass die ganze Idee der helle Wahnsinn ist. Doch Katja geht einfach weiter, und ich … folge ihr, schaffe es nicht, umzukehren.
Als wir zu der alten Eiche kommen, wo der Schotterweg zu einem Trampelpfad im Gras wird, beginnt Katja zu singen.
Den Blick lass ich schweifen,
Zu lieblichem Vogelgesang.
Sie lacht und nimmt meine Hand, und meine schwache Stimme vermischt sich mit ihrer starken, klaren.
Da seh ich ein bildhübsches Mädchen,
Und ein Gedanke streift mich, flüchtig.
Wie ein fremdartiges Wesen, ein allsehendes Auge, das über uns schwebt, gehe ich schwankend mit ihr zum Haus. Bin das wirklich ich, die da unten in den Kleidern eines verschwundenen Mädchens herumstolpert? Bin das ich, die Katja hochhelfen will, als sie stürzt, und dann selbst falle? Sind das wir, die da herumkriechen, wieder aufstehen und weitergehen, während wir Lieder aus einer anderen Zeit singen?
Und dann sind wir da. Die dunklen Fenster des Hauses, der durchdringende Geruch der Fliederbüsche, die Rufe der nachtaktiven Vögel. Ein Rasenmäher steht am Gartenrand, wo der Wald anfängt, daneben ein Benzinkanister. Es wirkt wie von einem Regisseur in dieser merkwürdigen Szenerie platziert, in der ich sowohl Zuschauerin als auch Protagonistin bin.
Katja schraubt den schwarzen Verschluss ab, Katja schüttet eine Benzinspur bis zum Haus und spritzt den Rest an die Wand neben der Haustür. Katja macht das alles, doch ich halte sie nicht auf. Erst als sie ihr Feuerzeug hochhält, sage ich, dass er vielleicht noch da drin ist. Nein, nein, erwidert Katja. Er ist wieder in Stockholm. Ich habe ihn heute am Bahnhof gesehen. Dann bückt sie sich und entzündet die Benzinspur, und ich halte sie nicht auf.
Wie eine zischende Schlange winden sich die Flammen zum Haus. So schnell, denke ich noch, da lecken sie schon an der Fassade. Und dann verfärbt sich der Himmel und beleuchtet Katjas Gesicht. Sie schreit mir etwas zu, doch über das Prasseln der Flammen höre ich sie nicht. Da zerrt sie an meinem Arm und brüllt, dass wir weglaufen müssen, verdammt noch mal, wir müssen weglaufen, sonst sterben wir.
Willst du sterben?
Ich schüttele den Kopf, doch meine Beine rühren sich nicht vom Fleck, und ich denke, dass ich vielleicht ein Tier bin, ein Pferd, das lieber in der Geborgenheit des Stalls verbrennt, als draußen zu überleben.
Katja lässt mich los und verschwindet im Wald. Sie will nicht sterben.
2
Sachen, die in meinem Schrank im alten Mühlenhaus in Mossen ganz hinten liegen:
Ein verbogener Silberanhänger in Form einer Leier, eine weiße Baumwollunterhose, steif von getrocknetem Sperma, eine schriftliche Begründung, warum Vega Johansson für ihre Kurzgeschichte den ersten Preis in einem Schreibwettbewerb zum Thema Todsünden gewonnen hat, vier zerknüllte Kurzgeschichten, korrigiert von Atle Berggren – Ausrufezeichen, Fragezeichen und Anmerkungen, wo die Leser noch mehr Informationen brauchen –, eine braune Bibel mit herausgerissenen Seiten. Und dann das Foto von uns. Arm in Arm blinzeln wir in die Sonne. Aufgenommen im Mai 2008, nur wenige Wochen, bevor es geschah.
3
Dreieinhalb Stunden dauert die Zugfahrt von Stockholm nach Silverbro. Länger als der Flug von London nach Stockholm. Eigentlich wollte ich schlafen, doch die Nackenstütze störte mich, und wenn ich die Augen schloss, fuhren meine Gedanken Karussell. Ich sah Katja vor mir, sah sie blass und rauchend auf ihrem Bett im Stentorpsgården, hörte Jacks tröstendes Flüstern: Alles wird gut, Katja.
Als ich die Augen fester schloss, sah ich die Flammen, die den Himmel erhellten, Katjas aufgeregtes Gesicht, ich hörte die Rufe und spürte den Rauch in den Lungen.
Ich trank einen Schluck starken Kaffee aus dem Bordbistro und dachte an das vorletzte Gespräch, das ich mit Katja geführt hatte. Ein Jahr hatte ich schon in London gewohnt, als sie anrief und mir erzählte, sie sei schwanger. Im fünften Monat hatte sie es erst erfahren, und wenn sie es früher gewusst hätte, hätte sie abgetrieben, aber jetzt war es zu spät. »Stell dir vor«, sagte sie, »jetzt ist es mir genauso ergangen wie dir. Ist das nicht krank, dass uns beiden dasselbe passiert?«
»Wer ist der Vater?«, fragte ich.
»Keine Ahnung, irgendein Trottel aus der Stadt.«
»Himmel, Katja.«
Sie tat verwundert. Sprach sie denn auf einmal mit der Jungfrau Maria? Seit wann hatte ich solche Vorurteile? War ich jetzt etwa hochnäsig geworden, nachdem ich mir den reichen Typen geangelt hatte?
»Frans«, sagte ich. »Er heißt Frans, und ich habe keine Vorurteile, ich dachte nur, dass du vielleicht weißt, wer der Vater ist.«
»Die sehen doch alle gleich aus«, meinte Katja. »Man kann sie unmöglich auseinanderhalten.« Dann fuhr sie ernster fort: »Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Vega.«
»Das wird schon. Pass einfach auf dich auf, dann wird alles gut.«
»Ich passe aber nicht auf mich auf, das weißt du doch.«
»Du könntest dich ändern?«
»Kann man das? Kann man sich einfach so ändern?«
»Wenn man den Willen hat, die Stärke …« Ich wollte noch irgendetwas Aufmunterndes zum Thema Willen sagen, doch mir fiel nichts ein. Mir fehlte er ja auch.
»Kommst du heim, wenn das Kind da ist?«, fragte Katja.
»Ja, mache ich.«
»Versprochen?«
Ich versprach es, wohlwissend, dass ich das Versprechen nicht einhalten würde.
»Vielleicht werden sie ja Freunde«, sagte Katja. »Unsere armen ungewollten Kinder. Glaubst du nicht?«
Ich sagte, doch, das glaubte ich, dann fragte ich, wie es Jack gehe.
»Er war verdammt traurig«, antwortete Katja. »Wegen dem, was du getan hast.«
Ich sagte, ich sei nur umgezogen und hätte keine Todsünde begangen. Dann fiel mir auf, dass ich vielleicht genau das getan hatte.
»Hast du ihn getröstet?«, konnte ich mir nicht verkneifen zu fragen.
»Du bist einfach verschwunden«, sagte Katja. »Ich muss dir gar nichts erzählen.«
»Interessiert mich ja nur.«
»Du hättest bleiben sollen.«
»Ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht bleiben. Wegen der Schuldgefühle«, fügte ich hinzu, als es still im Hörer blieb.
»Aber wir wussten es doch nicht«, meinte Katja schließlich. »Es ist einfach passiert. Es war … Schicksal.«
»Ich glaube nicht an das Schicksal.«
»Und den Zufall?«
»Eher an den freien Willen«, erwiderte ich, auch wenn ich daran eigentlich genauso wenig glaubte.
»Es war nicht unsere Schuld«, sagte Katja lauter.
»Doch, das war es«, antwortete ich. »Alles war unsere Schuld.«
Danach, neun Jahre Funkstille. Bis vorgestern. Frans’ Businesspartner war mit seiner Frau zu einem frühen Abendessen zu Gast, und mitten in einem endlosen Gespräch über den Wohnungsmarkt, Dividenden und Exits klingelte mein Handy. Ich entschuldigte mich und ging in die Küche, während ich mich meldete.
»Silver?«, sagte Katja verwaschen. »Bin ich da bei Silver?«
Sie hatte eine neue Nummer, und ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, ihre Stimme zu hören. Sie versetzte mich zurück in eine andere Zeit, an einen anderen Ort, und meine Hände kribbelten.
»Katja?«, fragte ich. »Bist du das? Ist alles in Ordnung?«
»Nein.« Dann begann sie zu weinen.
Ich fragte, was passiert sei, und während Katja Luft holte, sah ich den Regentropfen hinterher, die an der Fensterscheibe hinunterrannen, und kämpfte gegen den Impuls an, aufzulegen und einfach zum Lammsteak und den teuren Weinen zurückzukehren, weit weg von den Abgründen, die ich früher einmal durchlebt und selbst verursacht hatte.
»Es sind Dinge ans Licht gekommen«, sagte Katja.
»Was?« Die Wände schienen sich auf mich zuzubewegen. »Was ist ans Licht gekommen?«
»Es ist alles ganz anders. Nichts ist, wie ich es geglaubt habe.«
»Was?«
»Darüber kann ich nicht am Telefon sprechen. Du musst heimkommen. Alles ist wieder da. Ich kann nicht länger schweigen. Die Schuldgefühle … Ich kann nicht mehr.«
»Du hast doch nicht etwa mit jemandem geredet?«, fragte ich und dachte an das Versprechen, das wir uns damals gegeben hatten. Dass alles, was in jener Nacht geschehen war, mit uns sterben sollte. »Vergiss nicht, wir haben es einander geschworen.«
»Vergiss nicht, dass du mich im Stich gelassen hast«, sagte Katja und murmelte etwas Unverständliches.
»Erzähl doch einfach, was passiert ist«, sagte ich, weil ich nicht über die Schuld reden wollte. Mir war schwindelig.
»Komm einfach nur heim«, gab Katja zurück. Dann brach die Verbindung ab, und niemand meldete sich, als ich zurückrief.
Ich schickte ihr eine Nachricht, dass ich einen Flug buchen würde und sie bitte nichts Unüberlegtes tun sollte.
Die Antwort kam sofort: Beeil dich!
Ich weiß nicht, wie lange ich mit dem Handy in der Hand in der Küche stand und an all die Dinge dachte, die ich die letzten zehn Jahre hatte vergessen wollen. Alle sinnlosen Strategien, die ich entwickelt hatte, um das Schreckliche zu verdrängen: Ich hatte mich in den Unterarm gekniffen, war bis zur Erschöpfung gejoggt, hatte heiße Bäder genommen. Eine Weile hatte es funktioniert, doch jetzt stand ich wieder mitten im Sturm und dachte an Atles Worte über Schuld. Dass man nur schwer messen konnte, wo sie anfing und wo sie aufhörte.
Sie hört nicht auf, dachte ich. Nie.
Eine junge Frau mit einem schlafenden Säugling im Arm setzte sich auf den Platz gegenüber. Ich war so in Gedanken versunken gewesen, dass ich gar nicht gemerkt hatte, wie der Zug gehalten und Fahrgäste aus- und eingestiegen waren. Das Baby wachte auf und wimmerte leise. Die Frau lächelte entschuldigend, als sie ihre Bluse aufknöpfte und das Baby an die Brust legte. Es sah so natürlich aus. Als Valter klein war, dachte ich oft, dass manche Frauen besser für das Muttersein gerüstet zu sein schienen, und jetzt spürte ich wieder die Sorge, ich könnte nicht dazugehören.
Ich nahm das Manuskript, das ich vor ein paar Tagen in der Bibliothek ausgedruckt hatte, aus meiner Tasche. Es wäre einfacher gewesen, das in Frans’ Büro zu erledigen, aber ich hatte keine Lust auf die steif lächelnden, viel zu stark parfümierten Frauen am Empfang. Ich wollte dort nicht wie der letzte Trottel auftauchen und mich fragen, was sie von den Dummheiten wussten, die Frans anstellte, wenn er angeblich nicht zu sprechen war.
Ich musterte den Titel, Flammen. Darunter lagen vierundfünfzig Seiten voller Hoffnung, Selbsthass und Größenwahn.
War es gut?
Keine Ahnung.
Flammen
Wo fängt man an? Im großen Stil vielleicht, mitten in der Handlung, mit den Lügen und den Leben, die zu Ende gingen. Oder eher etwas zurückgenommener, mit dem besonderen Ort, an dem ich aufgewachsen bin, meinem hochgewachsenen Vater John und der wunderschönen Cecilia, meiner Mutter.
Jemand hat mir mal gesagt: Alle Geschichten können interessant oder uninteressant sein, es kommt immer auf den Erzähler an, Vega. Vergiss das nicht.
Wenn ich eine Erzählerin bin, ist es möglicherweise gar nicht so wichtig, wo ich anfange. Und wenn ich keine Erzählerin bin, ist es sowieso unwichtig.
Ich wurde am 1. Mai 1990 geboren, zwei Wochen zu früh und auf dem Badezimmerboden in unserem Haus. Papa brachte mich auf die Welt und behauptete danach, vom ersten Moment an gewusst zu haben, dass ich ein besonderes Kind war: Du hast schon geschrien, bevor du richtig aus dem Mutterleib gekommen warst. Wirklich wahr. So etwas habe ich zuvor noch nie erlebt.
Allerdings war Papa kein Geburtshelfer, sondern Vorarbeiter im Sägewerk Silverbro, der Mann, den man zuerst anrief, wenn etwas kaputtging. John Silver reparierte alles.
Eigentlich wohnten wir nicht in Silverbro, sondern in Mossen, sechs Kilometer außerhalb. Zwei einsame Höfe standen dort nebeneinander, Kvarnen und Stentorpsgården, inmitten von Weideland und einem Moor. Man sagte, das Moor habe keinen Grund, doch laut meiner Großmutter war das nur dummes Geschwätz. Natürlich hat es einen Grund, sagte sie, wenn ich mir ausmalte, wie ich den Halt verlieren und immer weiter einsinken würde, alles hat irgendwo ein Ende.
Ich weiß nicht, warum mich lebensgefährliche Dinge immer so anzogen. Sie schienen förmlich nach mir zu rufen. Komm!, schrien sie, komm näher, näher, nur ein bisschen noch. Ich balancierte auf rutschigen Felskanten, streckte die Finger zur elektrischen Säge aus, wenn Papa Holz zerkleinerte, und ging auf die dünne Eisdecke des Flusses.
Großmutter fand, dass Mama mich nicht streng genug erzog. Cecilia sollte besser auf mich aufpassen und mich warnen, was Mädchen zustoßen konnte, die so wild herumrannten wie ich.
Denk an Sofia, flüsterte sie manchmal. Vergiss nicht Sofia.
Und Mama sagte, dass niemand Sofia vergessen würde, dass ihr Name und ihre Geschichte immer ein Teil von Silverbro sein würden, aber dass sie deshalb meine Welt nicht kleiner machen würde.
Ein paar Kilometer von unserem Hof entfernt, in entgegengesetzter Richtung zum Ort, erstreckte sich der Storskogen. Ein alter Nadelwald, so dicht, dass die Sonnenstrahlen den Boden kaum erreichten. In manchen Teilen wuchsen plötzlich Laubbäume und wucherte Unterholz, das Terrain wurde hinterhältig sumpfig und unwegsam. Man raunte, dass sich dort schon Menschen verirrt und nicht wieder nach draußen gefunden hätten, man munkelte von Seelen, die in windstillen Nächten schrien, und dass man sich nicht von Elfen und Waldnymphen verzaubern lassen durfte. Diese Geschichten erzählte man sich in Silverbro, als ich klein war, und als ich groß genug war, um alles zu hinterfragen, tat ich es trotzdem nicht. Ich war ein Mädchen, das gern an Sagen und Märchen glaubte.
Dort also wohnten wir, zwischen Steinmauern, Wald und Mooren, die Familie Silver. Nicht viele wussten, dass wir eigentlich Johansson hießen. Papas Spitzname John Silver, den er als Kind bekam (wegen seiner weißen Haarsträhne an der linken Schläfe), wurde auch zu meinem und dem meiner Mutter. Cecilia und Vega Silver.
Unser Haus hieß Kvarnen, das alte Mühlenhaus, das schon seit Generationen im Besitz von Papas Familie war. Es war windschief und schlecht isoliert, und abends war es nie richtig still. Es klang, als wäre jemand auf der Treppe oder auf dem Dachboden. Papa, der Holzexperte, erklärte, dass Holz lebendiges Material war und es deshalb überall knackte und knarzte.
In unserem Haus ging immer etwas kaputt, Leisten lösten sich von der Wand, Türen klemmten, der alte Heizkessel gab den Geist auf. Ich wünschte mir oft, wir würden in der Stadt wohnen, in so einem eingeschossigen Haus, in dem es warm und alles ganz und einfach war, doch Mama sagte, unser Haus habe eine Seele, und die sei wichtiger als Bequemlichkeit. Großmutter rümpfte über so etwas die Nase. Häuser waren bequem oder unbequem, eine Seele hatten sie aber nicht.
Doch egal, ob mit oder ohne Seele, das Haus schien Großmutter trotzdem fest im Griff zu haben, denn sie weigerte sich, den Hof zu verlassen. Nach Großvaters Tod hatte sie ihn an Mama und Papa verkauft, sich aber frech in der alten Angestelltenwohnung auf dem Grundstück eingenistet. Da saß sie dann und trauerte dem Leben hinterher, das man ihr genommen hatte.
In dem anderen Außengebäude hatte Mama ihr Atelier, in dem all die Bilder standen, die niemand kaufen wollte. Der Schuppen hatte eine eigene Toilette, und Mama brachte dort oft Menschen unter, die ein bisschen den Halt verloren hatten, wie sie sagte. Frauen, die ihre Männer verlassen hatten, Anhalter ohne Ziel, Väter, die ihre Familien versoffen hatten. Mama war die Trösterin, die zuhörte und verstand. Sie sorgte für Wein, Essen und Zigaretten und sagte, dass man durchhalten, atmen und die Stunden vergehen lassen müsse. Doch das war alles vor meiner Geburt, danach war auf dem Hof kein Platz mehr für andere traurige Seelen als Mamas.
Sie ist aus dem falschen Holz geschnitzt, sagte Großmutter oft abends zu Papa, wenn Mama draußen im Atelier war.
Papa antwortete immer, dass Cecilia aus dem besten Holz geschnitzt sei und dass er sie liebe.
Natürlich, Liebe und das alles sei ja durchaus schön, meinte Großmutter, aber mit Menschen wie Cecilia, mit solchen … Künstlerseelen … nehme es nie ein gutes Ende. Das spürte sie genau. Das würde kein glückliches Ende nehmen.
Wir können nur hoffen, sagte Großmutter, wir können wirklich nur hoffen, dass das Mädchen nicht genauso wird.
Ich verstand nicht, was so schlimm daran wäre, wie Mama zu werden, denn so wie sie wollte ich immer sein. Mama konnte malen, Geschichten erzählen und entspannt mit fremden Menschen reden. Doch da hatte ich ihre andere Seite noch nicht gesehen, bis ich sie weinend auf dem Boden im Atelier fand, bis Papa sie mitten in der Nacht in der Stadt abholen musste, wo sie in Unterwäsche herumirrte, bis sie mit mir Ausflüge an seltsame Orte unternahm, bis sie in einem fünfzehn Quadratmeter großen Zimmer in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung landete.
Wenn Papa bei der Arbeit war und Mama malte, war ich oft bei Großmutter. Ich saß bei ihr an dem großen Webstuhl und sah zu, wie aus alten Fetzen Teppiche wurden, begleitet von einem regelmäßigen Klopfen, bei dem meine Gedanken abschweiften. So verbrachte ich die meisten Tage, bevor ich in die Schule kam, in meiner eigenen Welt mit Fantasiefreunden, sprechenden Tieren und mystischen Wesen. Doch als Mama für Freunde, die nur ich sehen konnte, den Tisch deckte und sie ins Bett brachte und sich geduldig meine endlosen Geschichten anhörte, wurde Großmutter schon skeptischer.
Bleib bei der Wirklichkeit, sagte sie, wenn ich ihr meine Geschichten erzählte, die Wirklichkeit ist schwer genug, da muss man nicht auch noch etwas erfinden.
Mama fand es lustig, dass Großmutter, die Märchen und Geschichten so kritisch gegenüberstand, gläubig war. Cecilia war Atheistin, konnte aber trotzdem lange Zitate und Stammbäume aus der Bibel aufsagen. Jakob und seine Söhne, Abschnitte aus den Korintherbriefen, dem Buch der Psalmen und dem Johannesevangelium. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein.
Warum wusste Cecilia so viel darüber, wenn sie nicht an Gott glaubte?
Sie sagte, dass Märchen nicht wahr sein müssten, damit man an sie glauben könne.
Großmutter sagte, wenn man nicht an Gott, unseren Herrn glaube, dann werde man auch nicht mit dem ewigen Leben belohnt.
Doch Mama wollte gar nicht ewig leben. Für sie klang das wie ein Albtraum, aus dem man nicht aufwachen konnte. Da könnte Astrid doch wohl zustimmen – es wäre schrecklich, niemals zur Ruhe zu kommen, oder?
Ich selbst wusste nicht, was schlimmer wäre – ewig tot zu sein oder für immer zu leben.
Als ich sechs Jahre alt wurde, bekam ich von Großmutter eine Bibel. Bei den dünnen Seiten und den winzigen Buchstaben dachte ich, dass das Buch ein Leben lang reichte, und das werde es auch, sagte Großmutter, denn es sei das Buch des Lebens, und solange ich nur das läse, werde alles gut werden. Doch Großmutter irrte sich.
Ich wäre ein sehr einsames Kind gewesen, wenn das Schicksal mich nicht mit Jack Linder bekannt gemacht hätte. Jack, dieser mutige, musikalische Junge, der sich genauso gern Gefahren aussetzte wie ich. Wir sprangen zwischen den scharfkantigen Farmwerkzeugen im verlassenen Nachbarhof herum, wetteiferten darum, wer sich am weitesten vorwagte in das sumpfige Moor und erzählten uns Gruselgeschichten von abgebrochenen Fingernägeln unter Sargdeckeln und lebenden Toten. Ich liebte die Furcht in Jacks Blick, wenn ich ihm von den schrecklichen Dingen erzählte, die früher in Silverbro passiert waren, und die Geschichten noch ausschmückte. In Silos verschwundene Männer, falsch gefällte Bäume, die Menschen erschlugen, und die traurigste Geschichte von allen, die von Sofia Lo, dem Mädchen, das einmal auf dem Nachbarhof gewohnt hatte, dem Stentorpsgården. An einem Sommerabend hatte man sie noch im Pub gesehen, danach war sie spurlos verschwunden. Das war einige Jahre vor Jacks und meiner Geburt gewesen, doch wir hatten so oft davon gehört, dass wir das Gefühl hatten, dabei gewesen zu sein. Als wären wir selbst an der groß angelegten Suche beteiligt gewesen, im Wald und in den verlassenen Scheunen, als hätten wir mit den anderen ihren Namen gerufen.
Sofias Verschwinden hatte ihre Familie zerstört. Ihre Mutter zog zurück in den Norden, ihre Schwester verließ mit ihrem Freund den Ort. Ihr Vater, Holger Lo, bis dahin zuverlässiger Schichtleiter im Sägewerk, landete schon bald auf der Säuferbank im Ort. Der Stentorpsgården gehörte immer noch der Familie Lo, doch niemand kümmerte sich darum, und mit jedem Jahr blich die Fassade immer mehr aus, Dachziegel fielen zu Boden, und der Schotterweg wucherte zu.
Jack und ich kletterten oft über die Mauer, gingen durch den verwilderten Garten und sahen durch die schmutzigen Fenster. Die Möbel waren mit weißen Laken abgedeckt, und die große Uhr im Wohnzimmer war auf Viertel nach elf stehen geblieben. Wenn wir eine Weile dort standen, sah ich irgendwann Sofia vor mir, wie sie im Sonnenlicht vor dem Kamin tanzte, wie sie mit ihrer Schwester über etwas lachte. Und dann, wie sie sich einfach in Luft auflöste. Jack konnte sich keine so deutlichen Bilder ausmalen, weshalb ich ihm zu helfen versuchte. Sie schließt die Augen, dreht sich, streckt die Arme in die Höhe.
Wenn ich an meine frühe Kindheit zurückdenke, ist Jack fast immer dabei. Jack mit seiner Gitarre in seinem Zimmer, Jacks Gesicht, wenn er meinen Geschichten lauscht, Jack, der nach meiner Hand greift, wenn ich so tue, als würde ich im Moor einsinken. Wir zwei in der Laube hinter dem Himbeerfeld. Mama, die so tut, als wären wir feine Herrschaften, und sie würde uns bedienen. Und dann in dem Abgrund nach Cecilia: Jack, der neben mir sitzt, als ich stumm im Bett liege und an die Decke starre.
Die ersten Jahre waren wir ganz für uns: Jack, ich, die Lieder und Geschichten. Doch im Sommer vor der siebten Klasse ließ sich Kristina Rainen scheiden, nahm ihre Kinder mit und kehrte auf den Stentorpsgården zurück. Und alles wurde anders.
4
Ich legte das Manuskript in den Schoß und überlegte, was Atle dazu gesagt hätte.
Wo ist die eigene Stimme?, hätte er sicher gefragt. Wo sind der Mut, die Dunkelheit, die Tiefe?
Er hätte gesagt, dass ich mich zu sehr mit der Chronologie und Naturbeschreibungen aufhielt, dass ich an den Orten verweilte, die ich als Kind geliebt hatte. Das Himbeerfeld, der Malerschuppen, das Moor. Natürlich war das schön, aber ich wollte doch sicher mehr?
Ja, da war noch mehr, was ich erzählen wollte, doch ich kreiste darum, kam dem Kern der Geschichte nicht näher. Nach den vielen Seiten hatte ich die Dunkelheit kaum berührt. Ich hatte Mama erwähnt, ihre nächtlichen Ausflüge und Irrfahrten, doch ich hatte nichts von dem Ereignis im Schuppen erzählt, und auch nicht von der Nacht, in der alles zu Ende ging.
Nicht nachdenken, schreiben, hörte ich Atles Stimme in meinem Kopf, halt dich an die schriftstellerische Freiheit.
Aber das, was wir getan haben … Wenn es eines Tages veröffentlicht wird, werden es alle wissen.
Menschen und Orten kannst du andere Namen geben, du kannst unter Pseudonym schreiben, Hauptsache, du bekommst die Geschichte aus dir heraus.
Das ist keine Geschichte. Sondern die Wahrheit!
Keine Erzählung ist wahr, Vega. Das ist die einzige Wahrheit.
Ich blätterte weiter in meinem Manuskript, überflog die Stelle, als Jack und ich Katja und Danny kennenlernten. Wie wir uns freuten, dass sie Zwillinge waren und wir alle in dieselbe Klasse gehen würden. Dann: ausführliche Beschreibungen vom Stentorpsgården und seiner Verwandlung, von Kristinas Alkoholeskapaden und Samuels ständigem Hämmern in der Scheunenwohnung.
Samuel … In letzter Zeit hatte ich ein paar Anläufe gemacht, über das älteste der Rainen-Geschwister zu schreiben. Er war schon erwachsen, als die Familie nach Silverbro zurückzog. Ich hatte versucht, seinen Raubtierblick zu beschreiben, das ausdruckslose Gesicht und das Unbehagen, das er vom ersten Moment an in mir ausgelöst hatte. Stattdessen hatte ich unzusammenhängend von seinem alten BMW erzählt, seinen ständig bellenden, wolfsartigen Hunden und seiner gruseligen Angewohnheit, wie aus dem Nichts aufzutauchen. Danach weigerten sich meine Finger zu tippen, und ich konnte nur noch in die Luft starren und schließlich mit einer anderen Szene weitermachen.
Der nächste Halt war die Kleinstadt, in die Papa gezogen war, nachdem er nicht allein auf unserem Hof wohnen bleiben wollte. John Silver in seiner traurigen Zweizimmerwohnung, in der er immer so unbeschäftigt und fehl am Platz wirkte, in der es nichts zu reparieren gab, niemanden zu trösten. Er, der Großmutter versprochen hatte, sein Elternhaus niemals zu verkaufen, hatte genau das getan, ein Jahr nachdem ich nach London gezogen war. Großmutter hätte Einspruch erhoben, doch zu dem Zeitpunkt lag sie schon mit ihrem Mann und dessen Eltern im Familiengrab auf dem Friedhof von Silverbro.
Papa zog wegen der Stille um. Die hielt er nicht aus. Er ertrug die Vorstellung nicht, als Einsiedler im Wald zu sterben. Doch in der Stadt war er viel einsamer, inmitten von Menschen, die er nicht kannte.
Ich wählte Katjas Nummer auf meinem Handy. Seit ihrem Anruf in London hatten wir keinen Kontakt mehr gehabt. Sie antwortete nicht auf meine SMS, in der ich ihr schrieb, dass ich einen Flug gebucht hatte. Als ich anrief, wurde ich sofort zur Mailbox weitergeleitet. So wie jetzt auch. Hier ist Katja, ich kann gerade nicht ans Telefon gehen. Nachrichten höre ich keine ab, schreibt eine SMS.
Auch wenn sie keine Nachrichten abhörte, hinterließ ich ihr trotzdem eine. »Katja«, sagte ich. »Melde dich. Ich bin bald zu Hause. Bitte red mit niemandem und tu nichts Unüberlegtes.«
Nachdem ich aufgelegt hatte, las ich noch einmal alle SMS, die ich ihr in den letzten Tagen geschickt hatte. In denen ich immer verzweifelter gefleht hatte, sie möge sich zusammenreißen, nichts sagen und mit dem, was auch immer sie tun wolle, warten, bis wir miteinander gesprochen hätten.
Vielleicht war es schon zu spät. Ich stellte mir vor, wie Katja im Pub an der Bar saß und laut verkündete, sie müsse etwas loswerden.
Ob die Leute Verständnis für uns hätten? Das Rechtssystem? Nein, das glaubte ich nicht. Könnte Papa noch mehr Trauer in seinem Leben ertragen? Und Valter, was würde mit ihm passieren?
Ich wollte zum Essen bei Papa bleiben und dann mit dem nächsten Zug zwei Stunden später nach Silverbro weiterfahren.
John Silver stand auf dem Bahnsteig, mit den Händen in den Taschen. Als er mich sah, strahlte er und nahm mir rasch den Rollkoffer ab. Wie war die Reise? Wie ging es Valter? Frans? Hatte ich Hunger? Er hatte Smörgåstårta für uns gemacht.
»Nur für uns zwei?«
»Ja. Die schmeckt uns doch so gut«, sagte Papa. Er lächelte, doch ich sah die Trauer in seinen Augen. Mama hatte die Torte aus Brot, Lachs, Krabben, Frischkäse und Dill auch geliebt.
Wir gingen über das Kopfsteinpflaster des Marktplatzes. Ich sah an den Häusern hinauf, zu dem kleinen Einkaufszentrum Kupolen, der rosafarbenen Fassade des Stadthotels, in das Katja und ich uns geschummelt hatten, obwohl wir noch zu jung gewesen waren. Bei jedem Besuch bei Papa beschlich mich immer wieder das eigenartige Gefühl, dass das nicht mehr dieselbe Stadt war. Sie schien kleiner geworden zu sein, sich verändert zu haben.
Die Wohnung roch nach Putzmittel. Ich hängte meine Jacke auf und stellte die Schuhe neben Papas zwei Paar. Papa ging in die Küche, ich sollte mich so lange ins Wohnzimmer setzen, wir würden dort essen, da war es gemütlicher. Und nein, er wollte keine Hilfe, ich sollte mich einfach ausruhen.
An den Wohnzimmerwänden hingen Mamas Bilder. Sie waren an die Deckenhöhe in der Mühle angepasst und zu groß für die kleine Wohnung, doch als ich Papa darauf aufmerksam gemacht hatte, meinte er nur, dass ihm die Proportionen ganz egal seien. Er wollte die Bilder einfach immer um sich haben, sie machten ihn glücklich.
Aber das waren keine glücklichen Bilder, die Mama hinterlassen hatte. Ich sah auf die finsteren, angsterfüllten Gesichter, die aus dem Farbchaos auf der eingerahmten Leinwand hervortraten. Der Gedanke, dass Papa sie immer um sich hatte, war deprimierend.
Die ganze Wohnung war quasi ein Mausoleum für Mama. Überall hingen und standen Fotos von ihr, Papa und mir. Ich, mager und mit dunklen Augen zwischen meinen Eltern, die sich verliebt ansahen. Auf Papas Nachttisch stand das Hochzeitsfoto, auf dem Mama barfuß ihr Brautkleid trug, das sie aus einer alten Gardine genäht hatte. Die dunklen Haare hingen ihr offen über den Rücken, und sie sah ihren großen blonden Mann an. Hinter ihnen waren ein gelbes Rapsfeld und der große Wald hinter dem Moor zu sehen. Es war ein schönes Bild, aber ich verstand nicht, wie Papa es aushielt, es ständig um sich zu haben.
An einer Schranktür lehnte seine Gitarre. Ich sah ihn vor mir, wie er früher auf dem Hof darauf gespielt hatte, hörte ihn von Cecilia singen, die sein Herz gebrochen hatte und shaked his confidence daily, und Mama, die lachte und ihn bat, noch mehr zu spielen. Spiel noch etwas für mich, John, egal was.
Und John spielte das Lied vom alten Fredrik Åkare und dem jungen Fräulein Cecilia Lind.
So sah ich die beiden oft vor mir, John und Cecilia auf einer belaubten Tanzfläche, eng aneinandergeschmiegt. Papa hatte den Arm um ihre Taille gelegt.
Doch Mama hatte als kleines Mädchen nicht von einem Mann und einer Familie geträumt. Cecilia wollte allein und frei durchs Leben gehen und sich nur der Kunst widmen. Als Teenager träumte sie von einer kleinen Dachbodenwohnung in Europa. Manchmal nahm sie mich in Gedanken dorthin mit, zu knarzenden Treppen, zugigen Zimmern, Farben, Leben, Musik, Menschen, die kamen und gingen, Gespräche über die Welt und die Kunst, Zigaretten mit Mundstücken, Wein. Doch das Leben hatte sie in eine andere Richtung geführt. Sie war in Silverbro geblieben, einem Ort, den sie in ihren düsteren Stunden als Gegend beschrieb, in dem Mädchen verschwanden und Träume starben.
John liebte Cecilia, aber liebte Cecilia ihn genauso sehr?
Manchen Menschen reicht es, zu lieben, anderen, geliebt zu werden, sagte Mama einmal, als ich sie danach gefragt hatte. Und wenn du dir einen Mann suchst, entscheide dich für einen, der dich so liebt wie Papa mich. Versprich mir das, Vega.
Und die Versprechensbrecherin versprach es.
5
Flammen
Einige Wochen nach dem Einzug der Familie Rainen lud Katja uns zu ihnen ein. Die Diele war ein einziges Durcheinander aus Schuhen, Jacken und Pullovern, und es roch beißend nach Katzenklo, Alkohol und Tabak. Auf der Arbeitsfläche in der Küche stapelten sich schmutzige Töpfe und Teller mit Essensresten.
»Arbeitet eure Mutter?«, fragte Jack.
Danny bedeutete ihm zu schweigen und zog eine angelehnte Tür ins Schloss, die von der Küche abging. »Sie schläft«, sagte er. »Sie hat keine Arbeit, also abgesehen von den Tarotkarten, aber sie hat hier ja noch nicht so viele Kunden.«
»Warum schläft sie mitten am Tag?«, fragte Jack.
Ich sah ihn an und wünschte, ich wäre auch ein Mensch, der es komisch fand, dass ich in eine Familie hineingeboren worden war, in der beide Eltern einen normalen Tagesrhythmus hatten und sich ordentlich benahmen.
»Weil sie nachts trinkt«, erklärte Katja. »Davon wird man müde.«
Es war spannend, durch die Räume zu gehen, die ich bisher nur von außen gesehen hatte. Die weißen Laken über den Möbeln waren entfernt, und das traurige Gefühl, das ich beim Blick durch die Fenster immer gehabt hatte, war jetzt nicht mehr so stark, seit echte Menschen im Haus wohnten. Trotzdem war er noch zu spüren, dieser Schmerz, die Erinnerung an ein Mädchen, ein Rätsel, das nie gelöst worden war.
Wir waren bei einer kleinen Diele mit einer steilen Treppe angekommen. An der Wand hingen Familienfotos in unterschiedlichen Rahmen und Größen. Da stand der junge Holger mit den Armen um seine Frau und vor ihnen die beiden Töchter in identischen Blusen und Röcken. Das nächste Bild war draußen auf dem Hof aufgenommen worden, ein lächelndes Mädchen in kurzem Kleid mit weißen Kniestrümpfen saß auf der Mauer.
»Das ist meine Tante«, sagte Katja, als ich es betrachtete. »Die Fotos hängen seit … damals hier.« Dann deutete sie auf ein anderes Bild von einer deutlich älteren Sofia, das nach ihrem Verschwinden in den Zeitungen abgedruckt worden war. Sofia lächelnd in einem roten Kleid, mit dazu passender Tasche, zusammen mit einem gleichaltrigen Mädchen.
»Das ist Camilla«, erklärte Katja. »Ihre beste Freundin. Man hat sie für die Zeitung weggeschnitten.«
Ich kannte Sofias beste Freundin. Sie grüßte Papa und mich immer laut und fröhlich, war immer etwas zerzaust. Die Frau hatte überhaupt keine Ähnlichkeit mit ihrem jüngeren Ich.
»Das ist so traurig«, sagte ich. »Das mit Sofia. Dass sie einfach verschwunden ist.«
Katja sagte, noch trauriger sei, nicht zu wissen, was geschehen sei.
Die Gitarre, die an der Wand lehnte, war das Erste, was Jack kommentierte, als wir in Dannys karg möbliertes Zimmer kamen.
»Spielst du?«, fragte er.
»Ich versuche es«, antwortete Danny.
»Warum hast du das nicht gesagt?«, wollte Jack wissen.
»Vielleicht, weil er nicht besonders gut ist«, meinte Katja trocken. »Hey, stimmt doch«, sagte sie, als Danny ihr einen bösen Blick zuwarf. »Deine Finger sind total steif, und unmusikalisch bist du auch.«
Danny entgegnete, das sei totaler Mist. Er hatte doch gerade erst angefangen zu spielen, wie sollte er da schon gut sein?
»Jack könnte dir ja vielleicht helfen«, sagte Katja. »Vega sagt, dass du ziemlich gut bist.«
Jack antwortete, dass man nicht zu sehr auf mich hören solle, aber dass er Danny gern bei den Grundlagen helfen würde. Er hatte die Gitarre in die Hand genommen, einen Akkord angeschlagen und unzufrieden bemerkt, dass sie leicht verstimmt war. Nachdem er eine Weile an den Stimmschrauben gedreht hatte, gab er Danny die Gitarre.
»Jack, spiel du doch was«, sagte Katja ungeduldig, nachdem Danny erst mühsam die Finger auf den Bund gelegt und dann eine Weile vor sich hin geklimpert hatte. Sie hatte nicht übertrieben, er war wirklich nicht besonders musikalisch.
Was sie hören wollten, fragte Jack und nahm die Gitarre von Danny entgegen.
»Such du was aus«, meinte Katja.
Jack sah zu mir und spielte das Intro von Nothing Else Matters von Metallica. Das Lied hatte er mir beizubringen versucht, doch ich war leider genauso untalentiert wie Danny.
Dann begann Katja zu singen. Sie sang vom Abstand zwischen Herzen, dem Leben, das unseres war, und wie egal es war, was die Leute sagten, taten, wussten.
Die Welt schien stillzustehen. Mein ganzer Körper reagierte auf ihre klare, volle Stimme. Jack schien genauso verzaubert zu sein.
»Du kannst echt singen«, sagte er, als das Lied zu Ende war. »Ich meine … du solltest daraus was machen.«
»Danke«, erwiderte Katja. »Du bist auch nicht schlecht.«
Wir gingen in Katjas Zimmer, das neben Dannys lag.
»Eigentlich wollte ich das Zimmer auf der anderen Flurseite«, meinte Katja. »Aber das war Sofias, deshalb hat Mama es mir nicht erlaubt. Ich verstehe nicht so ganz, warum, aber …«
»Und ich verstehe nicht, warum du nicht mit dem hier zufrieden sein kannst«, fiel Danny ihr ins Wort.
»Das andere ist schöner. Aber Mama will nicht, dass irgendetwas darin verändert wird. Sie glaubt, dass Sofia eines Tages nach Hause kommt.«
»Das wird nicht passieren«, sagte Danny.
Und dann diskutierten sie, warum das Zimmer für Kristina so heilig war.
»Vielleicht will sie nicht daran erinnert werden«, sagte ich und dachte daran, wie schwer es mir selbst fiel, in den Schuppen zu gehen. Die Leere, die Mama hinterlassen hatte, schnürte mir die Kehle zu.
»Es spielt keine Rolle, wo sie ist«, meinte Katja. »Ob sie die Augen zumacht oder hinschaut. Das hat nichts mit dem Zimmer zu tun. Sie wird trotzdem daran erinnert. Sie wird ihre Schwester immer vermissen.«
Als ich an jenem Abend nach Hause kam, bat ich Großmutter, mir von Sofia Lo zu erzählen, und nein, nicht nur von ihrem Verschwinden. Ich wollte wissen, wie sie gewesen war.
»Soweit ich mich erinnere«, sagte Großmutter, »war sie anders.«
Ich fragte, was sie damit meine, weil ich ja wusste, dass für Großmutter das meiste »anders« war.
»Um sie herum gab es oft Streit und Ärger«, erklärte Großmutter. »Und ich weiß, dass Holger und seine Frau sich Sorgen gemacht haben …«
»Weswegen?«
»Weil sie so hinter den Männern her war«, antwortete Großmutter. »Sie war selbst noch ein Kind, aber bei manchen erwacht das Interesse früh. Und man sieht ja, was aus ihr geworden ist. Den Tod hat es ihr eingebracht. Die meisten Mädchen in dem Alter würden sich wohl nicht von einem fremden Mann weglocken lassen.«
»Woher weißt du, dass sie das getan hat?«
Das wusste Großmutter nicht, aber sie glaubte es.
»Kann es nicht jemand von hier gewesen sein?«
»Natürlich. Ich wüsste nur nicht, wer. Aber sie hatte auch einen merkwürdigen Freund, der nicht von hier war und der dann passenderweise auch verschwand. Viele hielten ihn für den Täter.«
Ich fragte sie, wie der Freund heiße.
Großmutter antwortete, er heiße Nils, den Nachnamen habe sie vergessen. In jenem Sommer habe er bei Milch-Arvid und dessen Frau gewohnt. Die beiden hatten ja selbst keine Kinder und nahmen oft in den Ferien Problemkinder auf, und ausgerechnet dieser komische Junge war mit Sofia herumgezogen.
»Inwiefern war er komisch?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Großmutter. »Er wirkte einfach seltsam. Wo willst du hin?«, fragte sie, als ich vom Küchentisch aufstand.
»Auf den Dachboden.«
»Das Essen ist bald fertig.«
»Ruf mich, wenn es so weit ist.«
»Dann lass die Tür offen, damit du mich hörst.«
Ich holte meinen Laptop und ging hinauf auf den Dachboden. Mama hatte mal gesagt, dass man unbedingt einen eigenen Raum brauchte, wenn man etwas erschaffen wollte. Leider war mein Zimmer nicht dafür geeignet, weil Großmutter jeden Moment hereinplatzen und die Magie zerstören konnte. Doch auf den Dachboden ging sie selten, weil sie Dunkelheit, Mäuse und Staub hasste.
Ich setzte mich an den Tisch vor dem kleinen, von Spinnweben überzogenen Fenster, klappte den Laptop auf und begann, die Geschichte zu schreiben, die mich schon lange beschäftigte. Die Geschichte von Sofia Lo, dem Mädchen, das verschwunden war.
6
Papa trug die große Smörgåstorte auf einem Tablett ins Wohnzimmer und fragte, was ich trinken wolle.
»Hast du Wein?«
»Ja, aber nur roten.«
»Das passt gut.« Ich schnitt mir ein Stück von der Torte ab und aß einen großen Bissen, wobei ich genießerisch die Augen schloss. Nicht nur der Geschmack war himmlisch, sondern alles, was damit verbunden war: Feste, Feiertage und schöne Stunden gemeinsam mit einer Familie, die früher einmal glücklich gewesen war.
»Ich habe mich ein bisschen gewundert, als du erzählt hast, dass du nach Silverbro fährst«, sagte Papa. »Ich meine … du bist ja nicht einmal nach Großmutters Tod nach Hause gekommen.«
»Weil es mir nicht gut ging«, antwortete ich. Das stimmte, kurz nach Valters Geburt war es mir wirklich nicht gut gegangen, und da hatte ich auf gar keinen Fall zurück nach Silverbro fahren wollen.
»Aber jetzt willst du dich mit Katja treffen?«
Ich nickte.
»Ich dachte, ihr hättet keinen Kontakt mehr.«
»Seit dem Gymnasium nicht mehr, nein.«
»Was ist damals eigentlich passiert?«, fragte Papa. »Das habe ich nie verstanden.«
»Wir haben uns auseinanderentwickelt«, meinte ich ausweichend. Das war eine Lüge. Katja und ich hatten uns nicht auseinanderentwickelt, wir waren auseinandergerissen worden, und zwar nicht, weil unser Leben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelte. Wir selbst hatten den Graben zwischen uns geschaffen, zumindest wenn man an so etwas wie den freien Willen glaubte.
»Vor ein paar Monaten habe ich sie zufällig getroffen«, erzählte Papa. »Hier in der Stadt.«
»Wie ging es ihr?«
»Ganz gut. Sie schien ihr Leben in Ordnung bringen zu wollen. Ihre Tochter war auch dabei.«
»Stella?«
»Ja, Stella. Sie wollten neue Kleider für eine Feier kaufen.«
Ich dachte an Katjas Anruf, wie aufgewühlt und betrunken sie da gewesen war. Weit entfernt von einer Mutter, die mit ihrem Kind in die Stadt fuhr, um neue Sachen für eine Feier zu kaufen.
»Als sie mich angerufen hat, war sie in keiner guten Verfassung«, meinte ich.
»Nach einer guten Phase«, sagte Papa, »kommt oft wieder eine schlechte.«
Ich sah zu einem der düsteren Bilder an der Wand und dachte daran, wie oft wir es erlebt hatten. Mamas bessere Zeiten, die Hoffnung, die Zerbrechlichkeit in der Luft und dann der Rückfall, die Rückschritte, die Trauer.
Papa trank einen Schluck Wein und sagte, wie seltsam es doch sei, dass so viele schreckliche Dinge ein und derselben Familie zustoßen könnten. Von Tony hatte ich ja sicher gehört?
Ich schüttelte den Kopf, von ihm hatte ich seit Jahren nichts mehr gehört.
»Er hat Krebs«, erzählte Papa. »Hirntumor, glaube ich. Er hat nicht mehr lange. Vielleicht hat Katja ja deshalb wieder den Halt verloren.«
Ich habe keinen Vater. Es gibt keine Väter, hatte Katja immer gesagt, wenn die Sprache auf Tony Rainen kam. Ich stellte mir Tony in einem Krankenbett vor, blass und krank, doch das war schwierig.
»Katja hasst ihn«, sagte ich. »Deshalb glaube ich nicht, dass sie wegen ihm aus der Spur gerät.«
»Es kann einen genauso erschüttern«, erwiderte Papa, »wenn jemand schwer krank wird, den man hasst.«
Ich nickte, natürlich, das konnte schon sein.
»Aber jetzt erst mal Prost.« Papa hob das Glas. »Trinken wir darauf, dass du wieder zu Hause bist. Nur schade, dass Valter nicht dabei ist.«
Ich dachte an meinen Sohn und seine unschuldige Welt weit weg von Schichtarbeit, Schmerzen und Sucht, und sagte, dass jetzt nicht der beste Zeitpunkt wäre, ihm Silverbro zu zeigen, nicht, wenn es Katja so schlecht ging.
»Er hätte ja so lange bei mir bleiben können«, sagte Papa.
»Ja, aber ich bleibe vielleicht länger, und er hat ja Schule. Außerdem … muss ich allein sein. Ich brauche ein wenig Abstand.«
»Ist etwas passiert?«
»Nein, nein.« Ich dachte an die große weiße Wohnung in einer von Londons besten Gegenden, an das Leben, das ich zwar lebte, das sich aber nicht wie meins anfühlte.
Papa fragte, ob etwa mit Frans war.
»Es geht nicht immer nur um Frans«, erwiderte ich.
Papa legte das Besteck beiseite und sah mich an. Bei seinem Blick hätte ich am liebsten geweint.
»Wie geht es dir eigentlich, Vega?«
»Es ist … alles ein bisschen viel gerade.« Ich trank einen Schluck Wein. »Ich suche meinen Platz im Leben«, fuhr ich fort, »und im Moment treibe ich ziellos umher.«
»Du klingst wie deine Mutter«, sagte Papa. »Genau wie Cecilia.«
Ich bat ihn, damit aufzuhören, denn wenn mir etwas Unbehagen bereitete, dann, mit meiner Mutter verglichen zu werden. Es war egal, dass er immer wieder sagte, ich sei aus hartem Holz geschnitzt. Jedes Mal, wenn er auf eine Ähnlichkeit zwischen uns hinwies, hatte ich das Gefühl, zu zerbrechen.
Papa antwortete, dass er es doch nicht böse meinte.





























