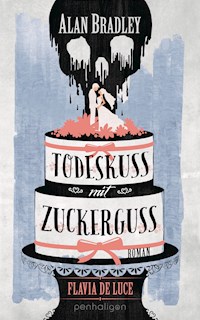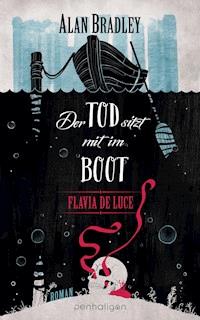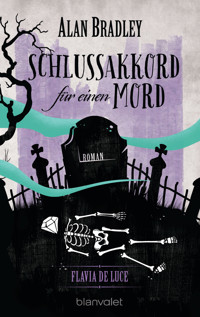9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Flavia de Luce
- Sprache: Deutsch
Wer Wednesday Addams als Ermittlerin liebt, kommt an Flavia de Luce nicht vorbei.
Für die notorisch klamme Familie de Luce tut sich eine unverhoffte Geldquelle auf: Eine Filmcrew will ihr Herrenhaus für Dreharbeiten nutzen. Die Schaulustigen strömen nach Buckshaw, um den Star des Ensembles zu sehen, die berühmte Diva Phillys Wyvern. Doch dann geschieht das Unfassbare: Eine Leiche wird gefunden – erdrosselt mit einem Filmstreifen. Zu allem Überfluss ist Buckshaw durch einen tosenden Schneesturm von der Außenwelt abgeschnitten. Der findigen Hobbydetektivin Flavia ist klar: Der Täter muss sich unter den Gästen befinden. Unverzüglich beginnt sie mit ihren Ermittlungen und gerät dabei selbst ins Visier des Mörders …
Diese außergewöhnliche All-Age-Krimireihe hat die Herzen von Lesern, Buchhändlern und Kritikern aus aller Welt im Sturm erobert!
Die »Flavia de Luce«-Reihe:
Band 1: Mord im Gurkenbeet
Band 2: Mord ist kein Kinderspiel
Band 3: Halunken, Tod und Teufel
Band 4: Vorhang auf für eine Leiche
Band 5: Schlussakkord für einen Mord
Band 6: Tote Vögel singen nicht
Band 7: Eine Leiche wirbelt Staub auf
Band 8: Mord ist nicht das letzte Wort
Band 9: Der Tod sitzt mit im Boot
Band 10: Todeskuss mit Zuckerguss
Außerdem als E-Book erhältlich:
Das Geheimnis des kupferroten Toten (»Flavia de Luce«-Short-Story)
Alle Bände sind auch einzeln lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Alan Bradley
Flavia De Luce
Vorhang auf für eine Leiche
Roman
Aus dem Englischen übersetztvon Gerald Jungund Katharina Orgaß
Penhaligon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »I Am Half-Sick of Shadows« bei Orion, an imprint of the Orion Publishing Group Ltd., London.
© 2011 by Alan Bradley
© der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Penhaligon Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Covergestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft, unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock.com (Carboxylase; DenisKrivoy; thenatchdl; KingVector) Satz: dtp im Verlag, Sabine Müller
ISBN 978-3-641-08525-4V003
www.penhaligon.de
Für Shirley
Einen Ritter, treu und ergeben, hat sie nichtDie Dame von Shalott.
Doch mit Freude webt sie immer noch,des Spiegels magische Bilder in ihr Tuch,denn oft zog durch die stillen Nächteein Leichenzug, mit Federschmuck und Lichtern,und Musik hin nach Camelot:Oder, wenn der Mond hoch am Himmel stand,zwei junge Liebende kamen, frisch getraut;da sagte die Dame von Shalott:»Ich bin die Schatten wohl schon leid.«
Alfred Tennyson: Die Dame von Shalott
1
Nasskalte Nebelranken erhoben sich vom Eis wie gepeinigte Seelen, die ihre leibliche Hülle verließen. Die kalte Luft hatte sich in einen trüben, wabernden Dunst verwandelt.
Ich sauste in dem langen Korridor auf und ab, und das Kratzen meiner silbernen Schlittschuhkufen klang wie das trostlose Geräusch, das entsteht, wenn ein Metzger hingebungsvoll seine Messer schleift. Unter der Eisschicht war das komplizierte Muster des Holzparketts noch deutlich zu erkennen, wenn auch seine Farben durch die Beugung des Lichts zugegebenermaßen ein wenig stumpf wirkten.
Die zwölf Kerzen über mir, die ich aus der Anrichtekammer gemopst und in die uralten Kronleuchter gesteckt hatte, flackerten wie irre im Luftzug, wenn ich unter ihnen entlangschoss. Auf und ab fuhr ich, hin und her und rundherum. Ich atmete die beißend kalte Luft tief ein und stieß sie als kleine silbrige Wölkchen wieder aus.
Als ich schließlich mit harschem Kratzen zum Stehen kam, spritzten kleine Eisbröckchen wie eine sich brechende Welle aus winzigen, bunten Diamanten auf.
Die Bildergalerie zu fluten war nicht besonders schwer gewesen: Man musste lediglich von der Terrasse her einen Gummischlauch durch das Fenster schlängeln und das Wasser die ganze Nacht über laufen lassen – und natürlich bedurfte es dieser erbarmungslosen Kälte, die das Land nun schon seit vierzehn Tagen in ihrem eisigen Griff hielt.
Da ohnehin nie jemand den unbeheizten Ostflügel von Buckshaw aufsuchte, würde auch niemand meine improvisierte Eisbahn entdecken; jedenfalls nicht bis zum Frühling, wenn die ganze Pracht wieder schmolz. Niemand, bis auf meine in Öl gemalten Vorfahren vielleicht, die in Reih und Glied an den Wänden hingen und mein Treiben aus ihren schweren Bilderrahmen heraus mit frostigen Blicken missbilligten.
Ich streckte ihnen die Zunge heraus, wobei ich ein unanständiges Geräusch machte, und glitt erneut in den kalten Dunst hinein, wobei ich mich wie eine Eisschnellläuferin weit vorbeugte und mit dem rechten Arm in der Luft herumfuchtelte. Meine Zöpfe flatterten wild, und die linke Hand hatte ich so lässig auf den Rücken gelegt, als befände ich mich auf einem Sonntagsspaziergang durch unsere herrliche Natur.
Wie schön wäre es doch, dachte ich, wenn jetzt ein Modefotograf wie zum Beispiel Cecil Beaton zufällig mit seiner Kamera vorbeikäme und diesen Augenblick für die Nachwelt festhielte.
»Mach einfach weiter, Mädel«, würde er sagen. »Verhalte dich ganz natürlich, als wäre ich gar nicht da.« Und schon würde ich wieder wie der Wind durch unsere endlos lange, holzgetäfelte Ahnengalerie sausen, und ab und zu würde das diskrete Knallen einer Blitzlichtbirne meine Bewegungen für die Ewigkeit konservieren.
Ein, zwei Wochen danach würde ich dann auf den Seiten von Country Life oder der Londoner Illustrierten Nachrichten erscheinen, mitten im schwungvollen Lauf, in einer entschlossenen und zugleich unfassbar anmutigen Bewegung erstarrt.
»Bezaubernd – betörend – de Luce« würde die Bildunterschrift lauten. »Elfjährige Eisläuferin ist bewegte Poesie.«
»Herr im Himmel!«, würde es Vater entfahren. »Das ist ja Flavia!«
»Ophelia! Daphne!«, würde Vater rufen, mit der Zeitschrift wie mit einer Fahne wedeln und dann noch einmal einen Blick darauf werfen, um sich zu vergewissern. »Kommt schnell her! Das ist Flavia – eure Schwester.«
Bei dem Gedanken an meine Schwestern stöhnte ich laut. Bis dahin hatte mir die Kälte nicht allzu viel ausgemacht, jetzt aber packte sie mich plötzlich mit der Wucht eines atlantischen Sturmwindes – die bittere, beißende, lähmende Kälte auf hoher See im Winter, die Kälte des Grabes.
Ich zitterte wie Espenlaub und riss die Augen auf.
Die Zeiger meines Messingweckers standen auf Viertel nach sechs.
Ich schwang die Beine aus dem Bett, tastete mit den Zehen nach den Pantoffeln und watschelte dann, eingewickelt in mein gesamtes Bettzeug – Deckbett, Steppdecke und so weiter –, wie eine bucklige, leicht übergewichtige Kakerlake zum Fenster hinüber.
Draußen war es natürlich noch dunkel. Um diese Jahreszeit würde die Sonne erst in zwei Stunden aufgehen.
Die Schlafzimmer auf Buckshaw waren groß wie Exerzierplätze, kalte, zugige Säle mit weit voneinander entfernten Wänden und finsteren Ecken, und mein Zimmer, im südlichsten Winkel des Ostflügels gelegen, war das weitläufigste und trostloseste von allen.
In der Folge eines langen, erbitterten Disputs zwischen zweien meiner Vorfahren, Antony und William de Luce, bei dem es um den Sportsgeist bei gewissen militärischen Taktiken im Krimkrieg ging, hatten sie Buckshaw in zwei Lager geteilt, deren Demarkationslinie sich mit schwarzer Farbe mitten durch die Eingangshalle zog: eine Linie, die keiner der Kontrahenten übertreten durfte. So kam es aus den verschiedensten Gründen – von denen manche ziemlich langweilig, andere ausgesprochen absurd sind – noch während der Regierungszeit von König George V. dazu, dass man andere Teile des Hauses renovierte, während der Ostflügel größtenteils unbeheizt blieb und schließlich aufgegeben wurde.
Das hervorragende Chemielabor, das für meinen Großonkel Tarquin (oder kurz »Tar«) de Luce von dessen Vater eingerichtet worden war, hatte ein vergessenes und vernachlässigtes Dasein gefristet, bis ich seine Schätze entdeckt und für mich beansprucht hatte. Mithilfe von Onkel Tars sorgfältig geführten Notizbüchern und meiner bedingungslosen Leidenschaft für die Chemie, die mir offenbar schon von Geburt an im Blut lag, hatte ich bereits beachtliche Fähigkeiten darin erworben, »die Bausteine des Universums umzugruppieren«, wie ich es immer nannte.
»Beachtliche Fähigkeiten?«, protestierte meine innere Stimme. »Nur ›beachtliche‹? Jetzt mach aber mal halblang, Flavia! Du weißt genau, dass du ein absolutes Genie bist!«
Die meisten Chemiker, ob sie es nun zugeben oder nicht, hegen in ihrem Metier ein kleines Steckenpferd, auf dem sie am liebsten herumreiten. Mein Steckenpferd sind die Gifte.
Auch wenn ich noch immer in Verzückung geraten kann, wenn ich daran denke, wie ich einmal die Schlüpfer meiner Schwester Feely kräftig currygelb gefärbt habe, indem ich sie in einer Lösung aus Bleizucker kochte und anschließend in eine weitere aus Kaliumchromat tauchte: Mir ging das Herz erst dann so richtig auf, als ich zum ersten Mal ein simples, aber recht nützliches Gift herstellte, indem ich die dicke Schicht Grünspan von dem kupfernen Schwimmer in einem unserer Toilettenspülkästen aus dem 19. Jahrhundert abkratzte.
Ich verneigte mich vor meinem Spiegelbild – und musste beim Anblick der fetten weißen »Schnecke im Schlafrock«, die sich vor mir verneigte, laut lachen.
Ich schlüpfte in meine Klamotten vom Vortag und streifte in letzter Sekunde noch eine ausgebeulte graue Strickjacke über, die ich aus der untersten Schublade von Vaters Kommode entwendet hatte. Diese unförmige Monstrosität, die mit ihren olivfarbenen und kastanienbraunen Rauten an eine verbrutzelte Klapperschlange erinnerte, hatte ihm seine Schwester, meine Tante Felicity, zum letzten Weihnachtsfest gestrickt.
»Sehr aufmerksam, Lissy«, hatte Vater gesagt und sich auf diese Weise um eine eindeutigere Lobpreisung des hässlichen Fetzens gedrückt. Als mir im August auffiel, dass er das Ding noch kein einziges Mal getragen hatte, betrachtete ich es als leichte Beute, und seitdem die kalte Witterung eingesetzt hatte, war es zu meinem Lieblingskleidungsstück avanciert.
Natürlich passte mir die Jacke nicht. Auch wenn ich die Ärmel aufkrempelte, sah ich darin aus wie ein zerzauster Affe beim Bananenpflücken. Andererseits ist, meiner Meinung nach und zumindest im Winter, die Wärme dicker Wolle dem Frieren in modischen Fähnchen jederzeit vorzuziehen.
Außerdem hatte ich mir angewöhnt, mir zu Weihnachten keine Anziehsachen zu wünschen. Warum dafür einen Wunsch verschwenden, wenn man todsicher sowieso etwas zum Anziehen geschenkt bekam?
Letztes Jahr hatte ich den Weihnachtsmann um einige dringend benötigte Laborgläser gebeten – ich hatte mir sogar die Mühe gemacht, eigens eine Liste der unterschiedlichen Kolben, Bechergläser und Reagenzgläser anzufertigen und unter mein Kopfkissen zu legen – und, siehe da –, der brave Kerl hatte tatsächlich alles besorgt!
Feely und Daffy glaubten nicht an den Weihnachtsmann, weshalb er ihnen bestimmt absichtlich so ausgesucht lausige Geschenke wie parfümierte Seife, Morgenmäntel und Pantoffeln brachte, die so aussahen und sich auch so anfühlten, als wären sie aus orientalischen Teppichen geschneidert.
Immer wieder hatten mich meine Schwestern belehrt, dass der Weihnachtsmann nur etwas für kleine Kinder sei.
»Er ist nur ein grausamer Spaß, den sich Eltern auf Kosten ihrer grässlichen Gören machen, damit sie sie mit Geschenken überhäufen können, ohne sich richtig mit ihnen befassen zu müssen«, hatte Daffy erst letztes Jahr allen Ernstes behauptet. »Er ist ein Märchen, mehr nicht, ich schwör’s. Schließlich bin ich älter als du und kenne mich mit so was aus.«
Ob ich ihr glaubte? Ich war mir nicht ganz sicher … Als ich wieder in meinem Zimmer war und darüber nachdenken konnte, ohne gleich loszuheulen, hatte ich das Problem mit meinen ausgeprägten detektivischen Fähigkeiten beleuchtet und war zu dem Schluss gekommen, dass meine Schwestern gelogen hatten. Wer sollte denn sonst meine Laborgläser gebracht haben, bitte schön?
Außer dem Weihnachtsmann kamen nur fünf Kandidaten infrage. Mein Vater, Colonel Haviland de Luce, war völlig verarmt und fiel daher aus, genauso meine Mutter Harriet, die beim Bergsteigen umgekommen war, als ich noch in den Windeln lag.
Dogger, Vaters Faktotum also das Mädchen für alles – verfügte schlicht und ergreifend nicht über die seelischen, körperlichen und auch finanziellen Mittel, um heimlich und bei Nacht großzügige Geschenke durch ein zugiges, verfallendes Landhaus zu schleppen. Dogger war im Fernen Osten Kriegsgefangener gewesen und hatte dort so Furchtbares durchgemacht, dass sein Verstand noch immer wie mit einem unsichtbaren Gummiband mit jenen Erlebnissen verbunden war – einem Band, an dem das unbarmherzige Schicksal ab und zu zerrte, und das üblicherweise immer im unpassendsten Augenblick.
»Er hat dort Ratten essen müssen!«, hatte mir Mrs Mullet einmal in der Küche erzählt. »Stell dir das mal vor – Ratten! Sie mussten sie braten!«
Da alle Angehörigen unseres Haushalts aus dem einen oder anderen Grund als Geschenkebringer disqualifiziert waren, blieb nur noch der Weihnachtsmann übrig.
Schon in einer Woche würde er wiederkommen, und um die leidige Frage ein für alle Mal zu klären, hatte ich schon seit geraumer Zeit einen Plan geschmiedet. Ich würde ihm eine Falle stellen.
Und zwar eine streng wissenschaftliche.
Wie einem jeder erfahrene Chemiker sagen kann, lässt sich Vogelleim ganz einfach herstellen, indem man die Mittelrinde der Stechpalme acht, neun Stunden lang kocht, sie für zwei Wochen unter einem Stein vergräbt, dann wieder ausbuddelt und in fließendem Flusswasser wäscht. Anschließend zermahlt man sie und lässt sie gären. Das Mittel wurde jahrhundertelang von Vogelfängern benutzt, die es auf Äste schmierten, um die Singvögel zu fangen, die sie anschließend in den Städten verkauften.
Der große Sir Francis Galton hat in seinem Buch Die Kunst des Reisens oder Nützliche Kniffe und Hinweise für unzivilisierte Länder, von dem ich ein signiertes Exemplar in einer mit wirren Unterstreichungen versehenen Gesamtausgabe seiner Werke in Onkel Tars Bibliothek entdeckt hatte, eine Methode zur Herstellung ebenjenes Klebstoffs beschrieben. Ich hatte Sir Francis’ Anweisungen buchstabengetreu befolgt, hatte im Hochsommer mehrere Armvoll Stechpalmen aus dem Eichenwäldchen im Gibbet Wood nach Hause geschleppt und die klein gebrochenen Zweige über dem Laborbunsenbrenner in einem Schmortopf gekocht, den ich mir – allerdings ohne ihr Wissen – von Mrs Mullet ausgeborgt hatte. Zum Schluss hatte ich noch ein paar selbst erfundene chemische Finessen angewandt, um das pulverisierte Harz hundertmal klebriger als im Originalrezept zu machen. Nach nunmehr einem halben Jahr Vorbereitung war meine Paste inzwischen so klebrig, dass sie einen ausgewachsenen Gorilla mitten im Lauf ausgebremst hätte, und der Weihnachtsmann – falls es ihn wirklich gab – durfte eigentlich nicht die geringste Chance haben. Falls der muntere alte Herr nicht zufällig einer Flasche Diethylether O(C2H5)2 dabeihatte, mit dem er den Vogelleim lösen konnte, würde er bis in alle Ewigkeit in unserem Kamin stecken bleiben – oder bis ich mich seiner erbarmte und ihn daraus befreite.
Der Plan war einfach genial. Wieso war noch niemand auf diese Idee gekommen?
Ein Blick durch den Vorhangspalt verriet mir, dass es in der Nacht geschneit hatte. Auch jetzt wirbelte der Nordwind noch weiße Flocken durch den Lichtschein aus der Küche im Erdgeschoss.
Wer mochte zu einer so unchristlichen Zeit schon auf den Beinen sein? Mrs Mullet kam erst später, und zwar zu Fuß von Bishop’s Lacey nach Buckshaw.
Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen!
Heute war der Tag, an dem die Eindringlinge aus London eintreffen sollten. Wie konnte ich das vergessen haben!
Vor über einem Monat – am 11. November, um genau zu sein, jenem grauen, trüben Herbsttag, an dem man in Bishop’s Lacey um die Gefallenen aus den verschiedenen Kriegen trauert – hatte uns Vater in den Salon gerufen, um uns die furchtbare Neuigkeit zu verkünden.
»Ich muss euch leider mitteilen, dass das Unvermeidliche eingetreten ist«, sagte er schließlich, nachdem er eine Viertelstunde gramvoll aus dem Fenster geschaut hatte.
»Ich brauche euch ja wohl nicht an unsere prekäre finanzielle Situation zu erinnern …«
Er hatte anscheinend vergessen, dass er uns tagtäglich – manchmal sogar zweimal innerhalb einer Stunde – an unsere schwindenden Geldreserven erinnerte. Buckshaw hatte Harriet gehört, und als sie gestorben war, ohne ein Testament zu hinterlassen (wer hatte schon damit gerechnet, dass eine so lebenslustige Person wie sie auf einem Berg im fernen Tibet ihr Ende finden würde?), hatten die Sorgen ihren Anfang genommen. Seit zehn Jahren ging Vater nun schon mit den grauen Herren der Königlichen Finanzbehörde die, wie er es nannte, »Tanzschritte des Todesmenuetts« durch.
Trotz der sich immer höher stapelnden Rechnungen auf dem Tisch in der Diele und trotz der immer häufigeren telefonischen Anfragen vulgär klingender Anrufer aus London war es Vater gelungen, sich irgendwie durchzulavieren.
Einmal hatte ich, aufgrund seiner Phobie bezüglich des »Instruments«, wie er das Telefon nannte, einen dieser Anrufe selbst entgegengenommen und auf ziemlich amüsante Weise abgeschmettert, indem ich so tat, als würde ich Englisch weder verstehen noch sprechen.
Als das Telefon kurz darauf wieder geklingelt hatte, hatte ich mir den Hörer sofort geschnappt und mit dem Finger immer wieder auf die Gabel getrommelt.
»Hallo?«, hatte ich gerufen. »Hallo? Hallo? Tut mir leid … Ich verstehe kein Wort. Ganz schlechte Verbindung. Rufen Sie nächste Woche wieder an!«
Beim dritten Klingeln hatte ich den Hörer vom Haken genommen und in die Sprechmuschel gespuckt, die prompt ein besorgniserregendes Knistern von sich gegeben hatte.
»Feuer«, hatte ich mit verstörter Stimme gesagt. »Das ganze Haus steht in Flammen! Ich muss leider auflegen. Entschuldigen Sie, aber die Feuerwehr schlägt schon die Fenster ein.«
Der Rechnungseintreiber hatte nie wieder angerufen.
»Meine Verhandlungen mit der Steuerbehörde«, hatte Vater gesagt, »haben nichts gefruchtet. Es ist aus mit uns.«
»Aber … Tante Felicity!«, protestierte Daffy. »Tante Felicity wird uns doch bestimmt …«
»Deine Tante Felicity hat weder die Mittel noch die Absicht, unsere Lage zu lindern. Ich fürchte, dass sie …«
»… über Weihnachten herkommt«, unterbrach ihn Daffy. »Du könntest sie doch fragen, wenn sie hier ist!«
»Nein.« Vater schüttelte traurig den Kopf. »Es war alles umsonst. Der Tanz ist zu Ende. Ich war gezwungen, Buckshaw …«
Ich hielt die Luft an.
Feely beugte sich vor und runzelte die Stirn. Sie kaute an einem Fingernagel, was ziemlich ungewöhnlich für eine derart eitle Person war.
Daffy schielte unter gesenkten Lidern hervor, unergründlich wie eh und je.
»… einem Filmstudio zu überlassen. Jedenfalls vorübergehend. Die Filmleute kommen in der Woche vor Weihnachten und haben freie Hand, bis sie ihre Arbeit hier beendet haben.«
»Und was wird dann aus uns?«,fragte Daffy.
»Wir dürfen hierbleiben, vorausgesetzt, wir halten uns in unseren Privaträumen auf und mischen uns nicht in die Dreharbeiten ein. Tut mir leid, aber das waren die günstigsten Bedingungen, die ich herausschlagen konnte. Im Gegenzug erhalten wir ein Honorar, mit dessen Hilfe wir uns noch eine Weile über Wasser halten können – zumindest bis zu Mariä Verkündung Ende März.«
Eigentlich hätte ich mit etwas in der Art rechnen müssen. Vor ein paar Monaten waren zwei junge Männer in Schals und Flanell aufgetaucht und hatten Buckshaw zwei ganze Tage lang aus jedem erdenklichen Winkel geknipst, von innen und von außen. Neville und Charlie hießen sie, und Vater hatte sich nur vage zu ihren Absichten geäußert. Ich hatte angenommen, es handele sich lediglich um einen weiteren Fototermin für Country Life, und nicht weiter darüber nachgedacht.
Vater war inzwischen wieder wie magisch vom Fenster angezogen worden und ließ den Blick nach draußen über sein in Schwierigkeiten steckendes Anwesen schweifen.
Feely stand auf und schlenderte wie zufällig zum Fernglas. Sie beugte sich darüber und musterte ihr Spiegelbild.
Ich ahnte, was sich in ihren Gehirnwindungen abspielte.
»Weißt du, worum es geht?«, fragte sie mit einer Stimme, die so gar nicht die ihre war. »Bei dem Film, meine ich.«
Vater drehte sich nicht um. »Vermutlich ist es eine dieser schauderhaften Landhausschmonzetten. Ich habe nicht näher nachgefragt.«
»Machen irgendwelche bekannten Schauspieler mit?«
»Ich kannte jedenfalls keinen«, sagte Vater. »Der Vermittler hat andauernd den Namen Wyvern erwähnt, aber der hat mir auch nichts gesagt.«
»Wyvern?« Daffy war sofort hellwach. »Etwa Phyllis Wyvern?«
»Stimmt, so hieß sie.«Vater klang ein kleines bisschen munterer. »Phyllis. Der Name kam mir irgendwie bekannt vor. So heißt nämlich auch die Vorsitzende der Philatelistischen Gesellschaft in Hampshire. Nur dass sie Phyllis Bramble heißt«, setzte er hinzu, »nicht Wyvern.«
»Phyllis Wyvern ist der berühmteste Filmstar der Welt«, sagte Feely völlig baff. »Der ganzen Galaxis!«
»Des ganzen Universums«, fügte Daffy völlig ernsthaft hinzu. »Die Bahnwärtertochter – da hat sie Minah Kilgore gespielt, weiß du noch? Anna aus der Steppe … Liebe und Blut … Bereit zu sterben … Der geheime Sommer. Sie sollte sogar die Scarlett O’Hara in Vom Winde verweht spielen, hat sich aber vor den Probeaufnahmen an einem Pfirsich verschluckt und brachte kein Wort heraus.«
Daffy war stets über den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Filmwelt informiert, weil sie die entsprechenden Zeitschriften im Dorfladen nach der Schnelllesemethode überflog.
»Und Phyllis Wyvern kommt zu uns nach Buckshaw?«, fragte Feely. »Phyllis Wyvern?«
Vater zuckte nur matt die Schultern und blickte wieder mit düsterer Miene aus dem Fenster.
Ich rannte die Osttreppe hinunter. Im Salon war alles dunkel. Als ich in die Küche kam, blickten Daffy und Feely mit säuerlichen Mienen von ihren Haferbreischüsseln auf.
»Ach, da bist du ja, Schatz«, sagte Mrs Mullet. »Eben grade haben wir überlegt, ob wir einen Suchtrupp nach dir losschicken sollen. Jetzt ist aber höchste Eisenbahn. Diese Filmfritzen sind bestimmt hier, ehe du ›Alec Guinness‹ sagen kannst.«
Ich schlang mein Frühstück in mich hinein (klumpiger Haferbrei und angebrannter Toast mit Zitronenaufstrich) und wollte eben wieder abhauen, als die Küchentür aufging und Dogger zusammen mit einem Schwall kalter Luft hereinkam.
»Guten Morgen, Dogger«, sagte ich. »Suchen wir heute den Baum aus?«
Seit ich denken kann, war es für meine Schwestern und mich Brauch gewesen, Dogger in der Woche vor Weihnachten in den Wald von Buckshaw zu begleiten, wo wir diesen und jenen Baum begutachteten, einen jeden hinsichtlich seiner Größe, Gestalt, Dichte und des allgemeinen Erscheinungsbildes beurteilten, ehe wir uns schließlich für den Gewinner entschieden.
Am folgenden Morgen tauchte der auserwählte Baum dann wie durch Zauberhand im Salon auf, wo er in einem Kohleneimer stand und darauf wartete, dass wir uns ihm widmeten. Mit Ausnahme von Vater verbrachten wir den Tag in einem wahren Wirbelsturm aus uraltem Lametta, silbernen und goldenen Girlanden, bunten Glaskugeln und kleinen Engeln, die Papptrompeten bliesen, und hielten uns so lange es ging damit auf, bis am späten Nachmittag das Werk leider vollbracht war.
Weil es der einzige Tag im Jahr war, an dem meine Schwestern ein bisschen weniger fies zu mir waren als sonst, freute ich mich unverhohlen darauf. Einen Tag lang – oder zumindest ein paar Stunden – waren wir ausgesucht freundlich zueinander, scherzten, und manchmal lachten wir sogar miteinander, als wären wir eine jener armen, aber fröhlichen Familien bei Charles Dickens.
Ich lächelte Dogger in froher Erwartung zu.
»Leider nicht, Miss Flavia«, antwortete Dogger. »Der Colonel hat beschlossen, dass im Haus alles so bleibt, wie es ist. So wünschen es die Filmleute.«
»Wen kümmern schon die blöden Filmleute!«, rief ich, vielleicht ein wenig zu laut. »Die können uns doch nicht einfach unser Weihnachten vermiesen!«
Aber ich las sofort in Doggers Gesicht, dass sie das sehr wohl konnten.
»Ich stelle einen kleinen Baum ins Gewächshaus«, sagte er. »In der kühlen Luft dort hält er auch viel länger.«
»Das ist nicht dasselbe!«, maulte ich.
»Stimmt«, pflichtete Dogger mir bei, »aber auf diese Weise haben wir wenigstens unser Möglichstes getan.«
Noch ehe mir eine Erwiderung einfiel, kam Vater in die Küche, musterte uns finster, als wäre er ein Bankdirektor und wir eine Bande rebellischer Kontoinhaber, denen es gelungen war, die Barrieren noch vor der Öffnungszeit zu durchbrechen.
Wir saßen eingeschüchtert und mit gesenktem Blick da, als er den British Philatelist aufschlug und sich gleichzeitig dem Bestreichen seines versengten Toasts mit fahlweißer Margarine widmete.
»Über Nacht ist schöner frischer Schnee gefallen«, sagte Mrs Mullet munter, aber an ihrem besorgten Blick in Richtung Fenster erkannte ich, dass sie nicht mit dem Herzen bei der Sache war. Wenn der Wind weiterhin so heftig blies, würde sie am späten Nachmittag, wenn ihr Tagewerk vollbracht war, durch hohe Schneewehen nach Hause waten müssen.
Falls das Wetter allzu garstig wurde, würde Vater selbstverständlich Clarence Mundy mit seinem Taxi herbestellen – aber bei diesem Sturm war es ungewiss, ob Clarence mit seinem Wagen durch die hohen Schneehaufen hindurchpflügen konnte, die sich unweigerlich zwischen den Hecken bildeten. Wir wussten alle, dass Buckshaw zurzeit nur zu Fuß zu erreichen war.
Als Harriet noch lebte, gab es einen Schlitten mit Glocken und warmen Decken. Der Schlitten stand sogar immer noch in einer dunklen Ecke in der Remise, gleich hinter Harriets Rolls-Royce Phantom II, beide Fahrzeuge ein Denkmal für ihre verstorbene Besitzerin. Die Pferde waren leider schon lange nicht mehr da. Sie waren bei einer Versteigerung nach Harriets Tod verkauft worden.
In der Ferne ertönte ein Grollen.
»Hört mal!«, sagte ich. »Was war das?«
»Der Wind«, antwortete Daffy. »Willst du den letzten Toast noch, oder kann ich den haben?«
Ich schnappte mir die Scheibe und mampfte sie auf dem Weg in die Eingangshalle trocken herunter.
2
Als ich die schwere Haustür aufzog, blies mir ein Schwall eisiger Flocken ins Gesicht. Ich schlang fröstelnd die Arme um mich und blinzelte mit zusammengekniffenen Augen in die winterliche Welt hinaus.
Im kargen Licht des frühen Morgens glich die Landschaft einem Schwarz-Weiß-Foto. Die weite Fläche des verschneiten Rasens wurde nur von den tintenschwarzen Silhouetten der kahlen, entlaubten Kastanien unterbrochen, die die kleine Allee säumten. Hier und dort neigten sich weiß bemützte Büsche unter ihrer schweren Last tief auf den Rasen hinab.
Wegen des wirbelnden Schnees konnte man nicht einmal bis zum Mulford-Tor sehen, doch etwas schien sich dort draußen zu bewegen.
Ich wischte mir die tauenden Flocken aus den Augen und schaute noch einmal hin.
Ja! Ein blasser Farbfleck erschien in der schwarz-weißen Landschaft – und jetzt noch einer! Vorneweg fuhr ein riesiger Möbelwagen, dessen kräftiges Rot immer intensiver wurde, je näher er durch den unaufhörlich fallenden Schnee auf mich zukam. In seinem Kielwasser folgte eine Reihe kleinerer Lastwagen wie eine Prozession aufgezogener Spielzeugelefanten … zwei … drei … vier … fünf … nein, sechs Stück!
Als der Möbelwagen steifgelenkig die letzte Biegung der Einfahrt nahm, konnte ich die Aufschrift deutlich lesen: Ilium Films stand da in dicken gelben und weißen Buchstaben, so gestaltet, dass die Schrift dreidimensional wirkte. Die kleineren Lastwagen waren ähnlich beschriftet und ebenfalls eindrucksvoll anzuschauen, als sie sich jetzt wie eine Herde rings um ihren Anführer scharten.
Die Tür des Möbelwagens flog auf, und ein massiger rotblonder Mann kletterte aus dem Führerstand. Er trug eine Latzhose, sein Kopf war mit einer Schiebermütze bedeckt, und um den Hals hatte er ein rotes Tuch geschlungen.
Erst als er durch den Schnee auf mich zugestapft kam, merkte ich, dass plötzlich Dogger neben mir stand.
»Mich laust der Affe«, sagte der Mann und verzog das Gesicht im kalten Wind.
Mit ungläubigem Kopfschütteln ging er auf Dogger zu und streckte ihm eine grobe, fleischige Pranke hin.
»McNulty. Ilium Films. Transportabteilung. Hansdampf in allen Gassen und Meister aller Klassen.«
Dogger schüttelte die Pranke stumm.
»Wir müssen den ganzen Zirkus hier hinters Haus bringen, raus aus diesem Nordwind. Freds Generator macht immer Mätzchen, wenn es zu kalt ist. Das verwöhnte Biest will verhätschelt werden, der Generator, wenn ich’s Ihnen sage.«
Dann ging er vor mir in die Hocke. »Wie heißt du denn, Kleine? Bestimmt Margaret Rose. Na klar … Margaret Rose. Wenn du keine Margaret Rose bist, dann weiß ich auch nicht.«
Am liebsten wäre ich sofort nach oben in mein Labor marschiert, hätte ein Glas Blausäure aus dem Regal geholt, den Typen an der Nase gepackt, ihm den Kopf in den Nacken gedrückt, ihm das Zeug in den Rachen gekippt und abgewartet.
Glücklicherweise hielt mich meine gute Erziehung davon ab.
Margaret Rose – nicht zu fassen!
»Da haben Sie voll ins Schwarze getroffen, Mr McNulty«, sagte ich und rang mir ein verblüfftes Lächeln ab. »Ich heiße wirklich Margaret Rose. Wie haben Sie das bloß erraten?«
»Tja, was das betrifft, hab ich ’nen sechsten Sinn«, antwortete er achselzuckend. »Muss an meinem irischen Blut liegen«, setzte er in übertrieben irischem Dialekt hinzu und tippte sich kess an die Mütze, als er sich erhob. Eine kleine Vorstellung, die er allem Anschein nach nicht zum ersten Mal gab.
»Na schön«, sagte er, wieder an Dogger gewandt, »die Damen und die Herrschaften dürften so gegen Mittag per Automobil hier eintreffen. Nach der langen Fahrt von London hierher sind sie garantiert hungrig wie die Wölfe, also machen Sie mal hin und sehen Sie zu, dass eimerweise Kaviar auf dem Tisch steht.«
Doggers Miene blieb ausdruckslos.
»He, war doch nur Spaß, Kumpel!«, sagte McNulty, und einen entsetzlichen Augenblick lang fürchtete ich, er würde Dogger einen kumpelhaften Rippenstoß verpassen.
»Ein Witz, kapiert? Wir haben unsere eigene Kantine dabei.«
Er zeigte mit dem Daumen über die Schulter auf einen der geduldig wartenden Lastwagen.
»Ein Witz«, sagte Dogger. »Aha. Wenn Sie so freundlich wären und Ihre Stiefel ausziehen würden, dann folgen Sie mir bitte nach drinnen …«
Als Dogger die Tür hinter ihm schloss, blieb McNulty stehen und sah sich staunend um. Besonders die beiden großen Treppenfluchten, die in den ersten Stock hinaufführten, schienen es ihm angetan zu haben.
»Mich laust der Affe!«, sagte er. »Dass man so wohnen kann!«
»Tja, es hat ganz den Anschein«, erwiderte Dogger. »Hier entlang, bitte.«
Dogger gab McNulty eine kurze Führung, zeigte ihm, ohne sich irgendwo länger aufzuhalten, das Esszimmer, das Feuerwaffenmuseum, das Rosenzimmer, das Blaue Zimmer, das Wohnzimmer … Ich trabte immer hinterher.
»Zum Salon und zum Arbeitszimmer des Colonels ist der Zutritt verboten«, erklärte Dogger, »so wie besprochen. Zur Erinnerung habe ich an die betreffenden Türgriffe eine weiße Pappscheibe gehängt, damit niemand in … in ihre Privatsphäre eindringt.«
Um ein Haar hätte er »unsere Privatsphäre« gesagt, da war ich ganz sicher.
»Ich sag’s weiter«, erwiderte McNulty. »Ist bestimmt kein Problem. Unsere Leute sind auch so eine richtig verschworene Truppe.«
Wir gingen bis zum Ostflügel und betraten die Bildergalerie. Ich rechnete halb damit, dass es dort wie in meinem Traum aussah: alles überflutet und vereist. Aber die Galerie sah aus wie seit undenklichen Zeiten: eine lange, düstere Bahnhofshalle voller finster dreinblickender Vorfahren, die sich mit nur wenigen Ausnahmen (wie Komtess Daisy, die Besucher auf Buckshaw begrüßt haben sollte, indem sie in einem silbernen chinesischen Seidenkittel auf dem Dach Flickflacks aufführte) ein für alle Mal in ein immerwährendes Schmollen zurückgezogen hatten. Ein nicht eben heiter stimmender Anblick.
»Die Benutzung der Bildergalerie wurde ebenfalls besprochen«, sagte Dogger.
»Aber keine Nagelschuhe auf dem Fußboden, wenn ich bitten darf!«, ließ sich eine Frauenstimme vernehmen. Sie gehörte Mrs Mullet.
Die Hände in die Hüften gestemmt, musterte sie McNulty mit ihrem patentierten strengen Blick und sagte dann mit etwas sanfterer Stimme: »Entschuldigen Sie bitte, Dogger, aber der Colonel muss gleich zu einem Briefmarkentreffen nach London, und bevor er geht, sollen Sie sich um das Dosenfleisch kümmern und so weiter.«
»Dosenfleisch« war das Codewort dafür, dass Vater sich Geld für den Zug und das Taxi borgen musste. Das hatte ich herausgefunden, als ich einmal an Vaters Bürotür lauschte. Ich hätte es lieber nicht gewusst.
»Selbstverständlich«, sagte Dogger. »Entschuldigen Sie mich einen Augenblick.«
Dann verschwand er auf die ihm eigene Art und Weise.
»Da müssen Sie wohl ein paar Decken oder Planen auf den Boden legen«, sagte Mrs Mullet zu McNulty. »Das ist nämlich echtes Pah-kett! Kirschholz, Mahagoni, Walnuss, Birke – und sechs verschiedene Sorten Eiche sind da drin. Da lässt man nicht einfach so eine Horde Arbeiter drübertrampeln.«
»Ich versichere Ihnen, Mrs …«
»Mullet«, half ihm Mrs Mullet. »Mit M.«
»Mrs Mullet. Ich heiße McNulty, ebenfalls mit M, nebenbei bemerkt. Patrick McNulty. Ich versichere Ihnen, dass die Mitarbeiter bei Ilium Films nach ihrer Pingeligkeit ausgewählt werden. Ich kann Ihnen sogar anvertrauen – ich weiß ja, dass Sie es nicht weitererzählen –, dass wir soeben von einem Drehort in einer königlichen Residenz kommen, und dort hat sich ein gewisser Sie-wissen-schon-wer mit keinem Sterbenswörtchen über uns beschwert.«
Mrs M fiel die Kinnlade herunter.
»Sie meinen …«
»Ganz recht«, antwortete McNulty und legte den Finger auf die Lippen. »Sie sind eine kluge Frau, Mrs Mullet, das habe ich gleich erkannt.«
Sie lächelte so fadenscheinig wie die Mona Lisa, und ich wusste, dass er ihr ihre Loyalität abgekauft hatte. Was dieser Patrick McNulty auch sonst sein mochte, der Kerl war so geschmeidig wie Rizinusöl.
Dogger kam zurück. Seine geschäftsmäßige Miene gab nichts, aber auch gar nichts preis. Ich folgte ihm und McNulty nach oben und in den Westflügel.
»Das Zimmer am Südende des Korridors ist Miss Harriets Boudoir. Dieser Raum ist streng privat und darf unter keinen Umständen betreten werden.«
Dogger sagte das so, als sei Harriet nur mal eben auf Besuch bei den Nachbarn, um an der üblichen Fuchsjagd durch Felder und Wälder teilzunehmen. Er verschwieg McNulty, dass meine Mutter schon zehn Jahre tot war und Vater ihre Gemächer wie einen Schrein hütete, in dem niemand, das glaubte er wenigstens, ihn weinen hörte.
»Verstanden«, sagte McNulty. »Alles Roger. Ich geb’s weiter.«
»Die beiden Zimmer zur Linken gehören Miss Ophelia und Miss Daphne, die sich, solange Sie mit Ihren Leuten hier sind, ein Zimmer teilen werden. Suchen Sie sich eines davon als Drehort aus, die jungen Damen begnügen sich dann mit dem anderen.«
»Nett von den beiden«, meinte McNulty. »Aber darum kümmert sich Val Lampman. Das ist unser Regisseur.«
»Alle anderen Schlafzimmer, Wohnzimmer und Salons, inklusive derjenigen an der Nordseite, können von Ihnen nach Belieben genutzt werden«, fuhr Dogger fort, ohne bei der Erwähnung von Englands gefeiertstem Filmregisseur auch nur mit der Wimper zu zucken.
Sogar ich wusste, wer Val Lampman war.
»Ich gehe jetzt besser wieder zu meinen Leuten«, sagte McNulty mit einem Blick auf seine Armbanduhr. »Wir rangieren die Lastwagen um und laden alles aus.«
»Wie Sie wünschen«, erwiderte Dogger, und es kam mir vor, als klänge eine Spur Traurigkeit in seiner Stimme mit.
Wir gingen nach unten, wobei McNulty mit den Fingern über die geschnitzten Treppenpfosten fuhr und den Kopf in den Nacken legte, um die Deckenverkleidung zu begaffen.
»Mich laust der Affe!«, murmelte er vor sich hin.
»Ihr kommt nie im Leben darauf, wer bei diesem Film Regie führt!«, sagte ich, als ich in den Salon platzte.
»Val Lampman«, antwortete Daffy gelangweilt und ohne von ihrem Buch aufzublicken. »Phyllis Wyvern arbeitet derzeit mit keinem anderen zusammen. Nicht, seit sie …«
»Seit sie was?«
»Dafür bist du noch zu jung.«
»Gar nicht! Was ist mit Boccaccio?«
Erst neulich hatte uns Daffy beim Abendessen ausgewählte Geschichten aus Boccaccios Dekameron vorgelesen.
»Das ist nur Dichtung, alles erfunden«, erwiderte sie. »Val Lampman ist das wahre Leben.«
»Wer sagt das?«, konterte ich.
»Kinowelt sagt das. Stand ganz groß auf der Titelseite.«
»Was denn?«
»Herrgott noch mal, Flavia«, sagte Daffy und legte unwillig ihr Buch weg, »du verwandelst dich allmählich in einen Papagei: ›Seit wann? Sagt wer? Was denn?‹«
Sie äffte mich grausam nach.
»Wir sollten dir beibringen, ›Wo ist das Vögelchen ?‹zu sagen oder ›Lore will einen Keks‹. Einen Käfig haben wir schon bestellt: todschicke goldene Gitterstäbe, eine Sitzstange und ein Wasserbecken, in dem du planschen kannst – auch wenn du davon wohl keinen Gebrauch machen wirst.«
»Kackgranate!«
»Abgeprallt«, sagte Daffy und hielt einen unsichtbaren Schild auf Armeslänge vor sich.
»Wieder abgeprallt«, sagte ich und ahmte ihre Geste nach.
»Ha! Deiner ist bloß aus Blech. Kackgranate durchschlägt Blech. Das weißt du.«
»Stimmt nicht!«
»Stimmt wohl!«
An diesem Punkt mischte sich Feely in unsere bis dahin ausgesprochen zivilisierte Auseinandersetzung.
»Apropos Papagei. Bevor du zur Welt gekommen bist, hatte Harriet einen wunderschönen Graupapagei. Sindbad hieß er. Ich kann mich noch genau an ihn erinnern. Er konnte das lateinische Verb amare konjugieren und Ausschnitte aus der ›Loreley‹ singen.«
»Das hast du dir bloß ausgedacht«, fuhr ich sie an.
»Oh nein. Ich erinnere mich noch genau an Sindbad«, sagte Feely lachend.
»›Ich glaube, am Ende verschlingen die Wellen Schiffer und Kahn‹«, rezitierte Daffy. »Der arme alte Sinby ist immer auf seine Sitzstange geklettert und hat die Zeilen von dort gequäkt. Urkomisch war das.«
»Und wo ist er jetzt?«, wollte ich wissen. »Papageien können schließlich über hundert Jahre alt werden.«
»Er ist weggeflogen«, sagte Daffy mit belegter Stimme. »Harriet hatte eine Decke auf der Terrasse ausgebreitet und dich mit an die frische Luft genommen. Irgendwie hast du es geschafft, das Türchen aufzumachen, und Sindbad ist weggeflogen. Weißt du das nicht mehr?«
»Stimmt überhaupt nicht!«
Feelys Blick hatte nichts Schwesterliches mehr.
»Leider doch. Später hat Harriet oft gesagt, es wäre ihr lieber gewesen, du wärst weggeflogen und Sindbad wäre dageblieben.«
Der Druck in meiner Brust wurde immer stärker, als wäre ich ein Dampfkessel.
Ich stieß ein verbotenes Wort aus und stapfte voller Rachegedanken aus dem Zimmer.
Manchmal hilft nichts anderes mehr als eine Prise gutes altes Strychnin.
Ich würde schnurstracks in meine Chemieküche gehen und etwas zusammenbrauen, nach dessen Anwendung meine gehässigen Schwestern auf den Knien um Gnade flehen würden! Ich würde ihre Eibrote mit ein paar Körnchen nux vomica würzen. Das würde sie eine ganze Woche von jeder gesitteten Gesellschaft fernhalten.
Ich war schon halb oben, als es an der Haustür klingelte.
»Zum Kuckuck noch mal!«, schimpfte ich, denn nichts verabscheute ich mehr, als unterbrochen zu werden, wenn ich gerade etwas Spannendes mit Chemikalien im Sinn hatte.
Wohl oder übel ging ich die Treppe wieder hinunter und riss wütend die Tür auf.
Draußen stand ein livrierter Chauffeur und musterte mich überheblich. Seine Aufmachung bestand aus einem schokoladenbraunen Mantel mit geflochtenen Litzen, ausgestellten Kniehosen, die in hohen hellbraunen Lederstiefeln steckten, einer Schirmmütze und einem Paar weicher brauner Lederhandschuhe, die er eine Spur zu lässig in den perfekt manikürten Händen hielt.
Er war mir auf Anhieb unsympathisch – was vermutlich auf Gegenseitigkeit beruhte.
»De Luce?«, fragte er.
Ich verzog keine Miene und wartete auf eine höflichere Anfrage.
»Miss de Luce?«
»Eben die«, antwortete ich knapp und spähte an ihm vorbei, als könnten sich noch mehr von seiner Sorte im Gebüsch versteckt halten.
Der Möbelwagen und die anderen Laster waren verschwunden. Ein Wirrwarr von Reifenspuren verriet, dass sie hinters Haus gefahren waren. Stattdessen blubberte eine schwarze Daimler-Limousine leise im wirbelnden Schnee vor sich hin. In ihrem unirdischen Glanz erinnerte sie an einen Leichenwagen.
»Kommen Sie herein und machen Sie die Tür zu«, sagte ich. »Vater ist kein großer Freund von Schneewehen in der Eingangshalle.«
»Miss Wyvern ist eingetroffen«, verkündete er daraufhin.
»Aber …«, stammelte ich. »Aber sie sollte doch erst am Nachmittag kommen …?«
Phyllis Wyvern! Meine Gedanken überschlugen sich. Jetzt, da Vater nicht hier war, sollte doch wohl nicht ich …
Selbstverständlich hatte ich Phyllis Wyvern schon auf der Leinwand gesehen, nicht nur im Gaumont, sondern auch in unserem kleinen Kino drüben in Hinley. Und einmal sogar im Gemeindesaal von St. Tankred, wo Mr Mitchell vom Fotostudio in Bishop’s Lacey Die Pfarrersfrau vorgeführt hatte – auf Bitten des Herrn Vikar und vermutlich in der Hoffnung, dass die Handlung in den Herzen der Gemeindemitglieder etwas Sympathie für seine rattengesichtige (und rattenherzige) Ehefrau Cynthia erwecken möge.
Diese Wirkung erreichte er damit natürlich nicht. Aber abgesehen davon, dass die Kopie so alt und zerkratzt und voller Laufstreifen war, dass das Bild manchmal wie ein Hampelmann auf der Leinwand hin und her hüpfte, war Phyllis Wyvern in der Rolle der mutigen und tapferen Mrs Willington einfach umwerfend gewesen. Als am Schluss das Licht anging, hatte sogar der Vorführer Tränen in den Augen, obwohl er den Streifen schon hundertmal gesehen hatte.
Cynthia Richardson dagegen war und blieb unbeliebt, und ich hatte gesehen, wie sie sich nach dem Film ganz allein über den Friedhof nach Hause schlich.
Wie aber sollte man sich von Angesicht zu Angesicht mit einer Göttin unterhalten? Was sagte man in so einem Fall?
»Ich klingle nach Dogger«, sagte ich.
»Ich kümmere mich darum, Miss Flavia«, antwortete Dogger, der schon hinter mir stand.
Ich weiß nicht, wie Dogger das macht, aber er taucht immer im richtigen Augenblick auf, wie die Figuren, die bei Kuckucksuhren pünktlich aus ihren Türchen hervorschießen.
Schon ging er auf den Daimler zu, und der Chauffeur schlidderte und rutschte eifrig vorneweg, weil er natürlich als Erster am Wagenschlag sein wollte.
Dogger gewann den Wettlauf.
»Miss Wyvern. Darf ich Sie im Namen von Colonel de Luce herzlich hier auf Buckshaw willkommen heißen? Es ist uns eine Freude, Sie bei uns zu empfangen. Der Colonel hat mich gebeten, Ihnen sein unendliches Bedauern auszurichten, dass er nicht persönlich zu Ihrer Begrüßung anwesend sein kann.«
Phyllis Wyvern nahm Doggers dargebotene Hand und stieg aus dem Wagen.
»Seien Sie bitte vorsichtig, Miss Wyvern. Es ist ziemlich glatt heute Morgen.«
Ich sah jeden ihrer Atemzüge deutlich in der kalten Luft, als sie Doggers Arm nahm und auf die Eingangstür zugeschwebt kam. Geschwebt! Man konnte es einfach nicht anders nennen. Trotz des rutschigen Fußwegs schwebte Phyllis Wyvern auf mich zu wie ein leibhaftiges Gespenst.
»Wir haben Sie nicht vor Mittag erwartet«, sagte Dogger. »Deshalb ist der Fußweg noch nicht richtig freigeschaufelt und gestreut.«
»Aber ich bitte Sie, Mr …«
»Dogger.«
»Mr Dogger, ich bin ein einfaches Mädchen aus Golders Green. Ich bin schon mal durch Schnee gegangen und traue mir diese Aufgabe auch ein weiteres Mal zu.«
»Hoppla!« Sie kicherte und tat so, als würde sie ausrutschen, dabei strahlte sie ihn an und hielt sich an seinem Arm fest.
Ich konnte nicht glauben, wie klein sie war. Sie reichte ihm kaum bis zur Brust.
Sie trug ein enges Kostüm, eine weiße Bluse und einen schwarz-gelben Liberty-Schal, und trotz des trüben Lichtes wirkte ihr Teint wie Sahne in einer Sommerküche.
»Hallo!«, sagte sie, als sie vor mir stand. »Dieses Gesicht habe ich schon einmal gesehen. Du bist Flavia de Luce, wenn ich nicht irre. Ich hatte sehr gehofft, dich hier anzutreffen.«
Ich hörte auf zu atmen, und es machte mir überhaupt nichts aus.
»Dein Foto war doch im Daily Mirror.