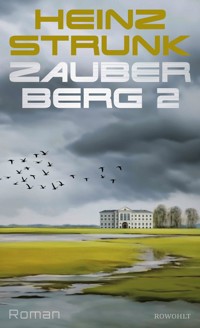Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacheles!
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie es ist, in Harburg aufzuwachsen, das weiß Heinz Strunk genau. Harburg, nicht Hamburg. Mitte der 80er ist Heinz volljährig und hat immer noch Akne, immer noch keinen Job, immer noch keinen Sex. Doch dann wird er Bläser bei Tiffanys, einer Showband, die auf den Schützenfesten zwischen Elbe und Lüneburger Heide bald zu den größten gehört. Aber auch das Musikerleben hat seine Schattenseiten: traurige Gaststars, heillose Frauengeschichten, sehr fettes Essen und Hochzeitsgesellschaften, die immer nur eins hören wollen: «An der Nordseeküste» von Klaus und Klaus. «Das Buch zählt zum Interessantesten und Lustigsten, das die deutsche Gegenwartsliteratur im Moment zu bieten hat», schrieb die Süddeutsche Zeitung seinerzeit über das Buch, mit dem Heinz Strunk zum Romancier und Bestsellerautor wurde.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 10 min
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Heinz Strunk
Fleisch ist mein Gemüse
Eine Landjugend mit Musik
Über dieses Buch
«Es tut einem ja jeder leid, der das Buch von Heinz Strunk nicht gelesen hat.» (Sven Regener)
Harburg bei Hamburg, Mitte der Achtziger. Heinz ist volljährig, hat aber immer noch Akne, immer noch keinen Job, immer noch keinen Sex und wohnt immer noch mit der Mutter im Zwergenhaus der Großeltern.
Eines Tages ein Anruf. Es meldet sich jemand, der Gurki heißt. Der Mann hat eine Tanzband namens Tiffanys, die auf den Schützenfesten zwischen Elbe und Lüneburger Heide gut im Geschäft ist und jemanden fürs Saxophon gebrauchen könnte. Heinz ergreift die Chance. Und lernt schnell, dass auch das Musikerleben seine Schattenseiten hat: traurige Gaststars, heillose Frauengeschichten, sehr fettes Essen und Hochzeitsgesellschaften, die immer nur eins hören wollen: «An der Nordseeküste» von Klaus und Klaus.
«Das Buch zählt zum Interessantesten und Lustigsten, das die deutsche Gegenwartsliteratur im Moment zu bieten hat», schrieb die Süddeutsche Zeitung seinerzeit über das Buch, mit dem Heinz Strunk zum Romancier und Bestsellerautor wurde.
Vita
Der Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk wurde 1962 in Bevensen geboren. Seit seinem ersten Roman Fleisch ist mein Gemüse hat er 14 weitere Bücher veröffentlicht. Der goldene Handschuh stand monatelang auf der Bestsellerliste; die Verfilmung durch Fatih Akin lief im Wettbewerb der Berlinale. 2016 wurde der Autor mit dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis geehrt. Seine Romane Es ist immer so schön mit dir und Ein Sommer in Niendorf waren für den Deutschen Buchpreis nominiert.
«Unter den Giganten des Komischen nach Karl Valentin beziehungsweise im letzten Halbjahrhundert erscheint mir Heinz Strunk nach Heino Jaeger, Gerhard Polt und Helge Schneider zwar der noch unbekannteste, aber keineswegs mindeste Bruder, sondern heute schon ein inter pares.» (Eckhard Henscheid)
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2024
Copyright © 2004 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg
Coverabbildung Getty Images; Marek Slusarczyk/Alamy Stock Photo
ISBN 978-3-644-02123-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1985
Im Zwergenhaus
Ich hatte Mutter versprochen, endlich unseren winzigen Rasen zu mähen, und nun mühte ich mich an diesem brüllend heißen Augustnachmittag 1985 mit den Kanten ab. Bevor ich mir die gesamte Fläche vornahm, trimmte ich immer zuerst penibel die Rasenkanten. So richtig toll wurde es nicht, aber das war nicht meine Schuld, sondern die meines verstorbenen Großvaters, der zu Lebzeiten jede handwerkliche Eigeninitiative seines Enkels mit der Bemerkung Zwei linke Hände und lauter Daumen zu ersticken pflegte. Der alte Despot hatte lieber alles selber gemacht, weil es ihm bei mir zu langsam ging. Die Spätfolgen seiner pädagogischen Konzeptlosigkeit konnte er jetzt posthum besichtigen. Es war ein Trauerspiel.
Das Blut schoss mir über der harten körperlichen Arbeit in den Kopf und weiter in jeden einzelnen meiner Pickel. Ich war dreiundzwanzig und litt seit nunmehr elf Jahren an Acne Conglobata, der schlimmsten Form dieser elenden Hauterkrankung, die unbehandelt auch NIEMALS besser wird. Pusteln mit oder ohne Eiterhaube, Mitesser und tief in der Haut verankerte Flechten bedeckten Gesicht, Nacken, Rücken und Schulter. Die Pickel wirkten irgendwie gar nicht mehr wie Pickel, sondern wie etwas viel Schlimmeres, sie wirkten wie eine unbekannte Weltraumkrankheit. Ich sah aus wie eine Versuchsperson, bei der die Tests schief gelaufen waren. Im Sommer sah es immer besonders schlimm aus, da ich mich vor Scham schon seit Jahren nicht mehr der Sonne ausgesetzt hatte und komplett ausgeblichen war. Die roten Aknehörner setzen sich auf meiner kalkweißen Haut deutlich ab und waren schon von weitem gut zu erkennen. Nach einer erfolglosen Endlosschleife im therapeutischen Bermudadreieck Vitamin-A-Säure, Breitbandantibiotika und Eigenblutbehandlung hatte ich die Akne als Schicksal angenommen und wartete einfach mal so ab. Vielleicht würde sich alles ganz plötzlich und unerwartet ändern, denn das Leben schlägt ja die tollsten Kapriolen. Bis dahin hieß es geduldig ausharren und weiterhin fleißig Rasen mähen und Hecke stutzen. Ich war gerade fertig mit den elenden Kanten, als das Telefon klingelte. Mein entfernter Bekannter Jörg.
«Kurze Frage, kurze Antwort, ich hab ’ne Anfrage fürs übernächste Wochenende, hast du da Zeit?»
«Weiß ich im Moment nicht so genau, da muss ich in meinen Kalender gucken, wart mal einen Augenblick.»
Ich blätterte ein bisschen im Telefonbuch.
«Um was geht’s denn überhaupt?»
«’ne Tanzband aus Lüneburg, Tiffanys heißen die, die brauchen für übernächstes Wochenende noch ’nen fünften Mann.»
Jörg war ein ziemlich dröger Zeitgenosse. Sein Phlegma wirkte ansteckend, und schnell verfiel ich in denselben, monotonen Sprachrhythmus.
«Ich weiß im Moment auch nicht genau, du kannst denen ja meine Nummer geben.»
«Wart mal einen Augenblick, da kommt gerade ein Kunde.»
Jörg arbeitete in einem kleinen Musikgeschäft mit dem Namen Ohrenschmaus. Viele junge Männer, die in Musikaliengeschäften arbeiten, wären eigentlich lieber richtige Musiker und begreifen solche Tätigkeiten lediglich als Interimslösung. Doch meist reicht die Begabung nicht aus, und sie bleiben in diesen Jobs stecken bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ein Schicksal, das auch Jörg drohte. Er hatte sich ausgerechnet die Bassgitarre ausgesucht, das vermutlich unspektakulärste Instrument der Welt. Jeden Abend nach der Arbeit hockte er in seinem verschwitzten Jugendzimmer (er wohnte noch zu Hause) und versuchte, Kontrolle über den störrischen Viersaiter zu erlangen. Wenn es zum Gitarristen nicht langte, dann wurde man Bassist. Bei den Girls konnte man damit natürlich nicht punkten.
«Hallo, bist du noch dran?» Jörg hatte den Kunden offenbar erfolgreich vergrault.
«Ich hab die Nummer hier. Du sollst den selber mal anrufen, der Typ heißt Gurki.»
«Was ist denn das für ein Name? Das klingt ja so wie Goofy in doof. Der heißt doch sicher auch richtig!»
«Mann, ich weiß auch nicht, wie der richtig heißt, ich soll das nur ausrichten. Ich hab jetzt auch keine Zeit. Soll ich dir die Nummer geben oder nicht? Mir ist das doch egal.»
Seine Stimme klang kraftlos und aggressiv zugleich.
«Ja, dann sag mal.»
Kaum hatte ich aufgelegt, fing ich an, albern im Flur rumzuhüpfen. Lieber Gott, danke, danke, danke! Die Nachfrage nach meiner Arbeitskraft tendierte im Allgemeinen gegen null, und Tanzmusik war schließlich besser als nix. Vor Aufregung rauchte ich erst einmal zwei Zigaretten hintereinander und wählte dann mit feuchten Händen die Telefonnummer mit der Lüneburger Vorwahl.
«Musikhaus Da Capo, Beckmann, guten Tag.»
Statt Ohrenschmaus nun also Da Capo.
«Hallo, Heinz Strunk hier. Ich ruf an wegen der Mucke, ich würde gern Gurki sprechen.»
«Der ist am Apparat.»
«Ach so. Ich hab die Nummer von Jörg vom Ohrenschmaus.»
«Schön, dass du anrufst. Also, das geht um ein Schützenfest in Moorwerder, die wollen da dieses Jahr fünf Mann haben, am liebsten mit Saxophon.»
«Ich spiel auch Flöte.»
«Super. Der Mann ist gut, das hör ich schon, hehehe.»
«Ja, hoffentlich.»
«Und, Sonnabend und Sonntag, geht das bei dir?»
«Da ist gerade was ausgefallen, und jetzt kann ich wieder», log ich.
«Alles klärchen. Sonnabend sind sieben Stunden, von acht bis drei Uhr, und sonntags nochmal fünf Stunden, von acht bis eins.»
«Normal.»
«Kennst du dich aus? Hast du schon mal Tanzmusik gemacht?»
Die Frage konnte ich bejahen. Ich hatte meine ersten Erfahrungen schon mit neunzehn in der Kapelle Holunder gesammelt. Meine vier Kollegen waren sympathisch abgehalfterte Typen um die vierzig. Jens, der Organist, Weinbrandtrinker alter Schule, hatte ein Gesicht, wie es nur hochprozentiger Alkohol im Laufe vieler Jahre zu schnitzen vermag. Er war einer der letzten reinen Organisten, d.h., er spielte keine Synthesizer und Keyboards, sondern eine wunderschöne alte Hammond B3 mit dem dazugehörigen Leslie. Geprobt wurde einmal die Woche in einem ehemaligen Luftschutzbunker. Er war wie alle Bunker auf der ganzen Welt dunkel, feucht und roch nach verlorenem, altem Krieg. Der Übungsraum lag im fünften Stock. Dort schafften wir uns Deine Spuren im Sand, Hello, Mary Lou oder auch ein Walzermedley mit den schönsten Melodien von Johann Strauß drauf. Nach Feierabend aßen wir in der Kneipe gegenüber meist noch Currywurst mit Kartoffelsalat. Stumm wie ein Fisch saß ich im Kreis meiner erwachsenen Kollegen und hielt den Mund, wie es sich für junge Leute gehört. Wir hatten fast jeden Samstag einen Job und mussten dann immer unsere tonnenschwere Anlage die engen Treppen des Bunkers nach unten und morgens um fünf oder sechs wieder nach oben wuchten. Ich hatte große Angst um meine Wirbelsäule, denn ich war ja noch im Wachstum. Hans, der Schlagzeuger, fuhr das Bandauto, einen maroden Mercedes mit Anhänger. 99 Prozent aller schrottreifen Mercedesse mit Hänger, die am Wochenende die Autobahnen blockieren, sind mit Tanzbands besetzt, die gerade auf dem Weg zur Mucke sind. Auf jeder Rückfahrt war Hans besoffen; ein Wunder, dass wir nie erwischt wurden. Bei meiner allerersten Mucke im Herbst 1981 staunte ich nicht schlecht, als plötzlich Kinder zum Bühnenrand kamen und nach Autogrammen fragten. Da brat mir doch einer nen Storch, die kennen mich gar nicht, und ich muss hier schon Autogramme geben! Ich schätzte daraufhin unseren Prominentenstatus falsch ein, denn es sollten die ersten und letzten Autogramme bleiben, die ich während meiner gesamten Tanzmusiklaufbahn geben musste. Nachdem wir ein Set mit When the Saints beendet hatten, gingen die Kollegen zum Tresen, während ich unschlüssig auf der Bühne stehen blieb. Ein dickes Mädchen kam zur Bühne getrottet, blieb direkt vor mir stehen und beobachtete mich, ohne ein Wort zu sagen. Mir fiel auch nichts ein. Das eine Auge ihrer bunten Kinderbrille war mit einem Pflaster verklebt. Es vergingen sicher zwei Minuten, dann sagte sie: «Holunder, Holunder, die Welt wird immer runder.» Sie drehte sich um und schob ab.
Das Mädchen sollte Recht behalten. Wegen irgendwelcher Zwistigkeiten löste sich Holunder ein Jahr später auf, und ich blieb erst mal ohne weitere Engagements.
Ich sagte Gurki, dass ich bereits in drei Tanzbands gespielt hätte.
«Klingt doch gut. Wir probieren das einfach mal aus. Es gibt für beide Tage sechshundert, ist das in Ordnung für dich?»
Meine Güte, sechshundert Mark, ein Geldregen!
«Ja, ist okay.» Ich bemühte mich, möglichst gleichgültig zu klingen.
«Alles klar, dann Sonnabend in einer Woche in Moorwerder auf dem Festplatz, das findest du schon. Kannst du gegen sechs Uhr da sein?»
«Äh, das ist gerade ein bisschen schwierig mit dem Hinkommen.»
«Wieso, hast du kein Auto oder was?»
Ich hatte noch nicht einmal einen Führerschein, aber das wollte ich nun wirklich nicht zugeben. Mucker ohne Auto, so was gibt’s gar nicht.
«Doch, natürlich, aber mein Lappen ist gerade weg, die haben mich mit 150 in ’ner Autobahnbaustelle geblitzt.»
Geschwindigkeitsübertretung schien mir das Beste zu sein. Ich war eben ein Mensch, der es eilig hatte. Ich hätte natürlich auch sagen können: «Ich bin bei Rot über ’ne Ampel gefahren, und da stand noch jemand. Aber ich kann nichts dafür, weil ich besoffen war.» Na ja, besser nicht.
«Pass auf, dann wirst du vor dem Soundcheck abgeholt, so gegen halb sechs.»
«Alles klar. Und wie ist es mit Klamotten?»
«Wenn du schwarze Hose, schwarze Schuhe und weißes Hemd mit Stehkragen mitbringen könntest, wär gut. Sakko und Fliege kriegst du von uns. Also dann, bis Samstag, frisch rasiert und gut gelaunt, hahaha.»
«Hahaha, ja logisch. Tschöööös.»
Es gibt Orte, die sollte man früh verlassen, wenn man noch etwas vorhat im Leben. Der Hamburger Stadtteil Harburg liegt am falschen, dem südlichen Ufer der Elbe. Das schöne, große, eigentliche Hamburg ist auf der anderen Seite. In jeder Stadt gibt es richtige, weniger richtige und falsche Bezirke, und wenn man im falschen wohnt, sollte man damit nicht hausieren gehen.
Das weithin sichtbare Wahrzeichen Harburgs sind die 1856 gegründeten Phoenix-Gummiwerke. Wo andere Städte eine Burg oder einen Dom haben, steht mitten in Harburg dieses riesige Industrieareal. Schon als Kind hat mich die Phoenix fasziniert. Sie war irgendwie unwirklich und erinnerte an Fabriken in Stummfilmen von Fritz Lang. Der Weg zum Kindergarten führte mich jeden Tag an den geheimnisvollen Gemäuern vorbei, und ich habe mich oft gefragt, was da drinnen wohl vor sich geht.
Harburg ist der langweiligste Ort der Welt, aber das ist ja auch schon wieder Quatsch, denn die Kasseler oder die Ulmer beanspruchen das zu Recht auch für ihre Städte. In den siebziger Jahren eröffnete McDonald’s in Harburg eine der ersten Filialen in Deutschland, die sich sofort zum zentralen Treffpunkt sozial auffälliger Jugendlicher entwickelte. Kinder aus normalen Verhältnissen trauten sich schon bald nicht mehr dort hin, denn zum Cheeseburger gab’s von den halbstarken Schlägerbanden gleich noch gratis eins auf die Nuss, mindestens. Dann soll angeblich irgendwo das legendäre Harburger Schloss existieren, das aber noch nie ein Mensch zu Gesicht bekommen hat.
«Sag mal, das Harburger Schloss, wo ist das denn eigentlich nun genau?»
«Weiß ich auch nicht. Aber irgendwo soll das sein.»
Weltberühmt geworden ist Harburg durch die Terroranschläge des elften September. Wer hätte das für möglich gehalten? In den Häusern, in denen ich jahrelang ein und aus gegangen war, hatten also die Top-Terroristen gewohnt! Mohammed Atta, Marwan al-Shehhi, Ramzi Binalshib und wie sie alle hießen waren in den mir bekannten Straßen einfach so herumgelaufen und hatten bei Schlecker oder Eurospar wie jeder andere auch Seife oder Butter gekauft. Die Technische Universität, Harburger Chaussee Nr. 115, Marienstraße 54 und die Wilhelmstraße 30! Hier hat der Chef Mohammed Atta, ein guter Koch, wie kolportiert wird, für sich und seine Mordbuben orientalische Spezialitäten gebrutzelt. Aber selbst diesen Ruhm musste Harburg abtreten, denn bald hieß es vereinfachend nur noch, die Terroristen hätten ihre Anschläge von Hamburg aus geplant.
In einem der Außenbezirke bewohnte ich zusammen mit meiner Mutter ein nur sechzig Quadratmeter großes Reihenhaus. Die Straßen der in den fünfziger Jahren erbauten Siedlung waren ausschließlich nach niedersächsischen Provinzkäffern benannt: Walsroder Ring, Celler Weg, Luhdorfer Stieg. Noch nicht mal Hannover war dabei! Wir wohnten im Bispinger Weg 7b. Irgendwie war alles eng und winzig. Straßen, Gärten, Häuser, ja selbst Bäume, Pflanzen und Haustiere wirkten eine Nummer kleiner als anderswo.
Auch meine Kinderfreunde Peter Barsties und Walter Scherwath waren hier kleben geblieben. Peter hatte bereits mit zwanzig geheiratet und bewohnte mit seiner Frau ein eigenes Zwergenhaus. Er und Walter waren immer noch gut miteinander befreundet; ich hingegen wurde gemieden. Es herrschte damals in der Siedlung die einhellige Meinung, aus mir würde nichts Rechtes mehr werden. Peter und Walter hatten schon längst ihre Ausbildung beendet und standen erfolgreich im Berufsleben.
Die Harburger Walter und Peter hatten eine auffällige Ähnlichkeit mit den echten Walter und Peter, den Söhnen des ewigen Oppositionsführers Dr. Helmut Kohl, der sich mit Hilfe seines Erfüllungsgehilfen Genscher nun doch noch zum Bundeskanzler hochgemobbt hatte. Wie das die ersten Jahre immer klang: Bundeskanzler Kohl! Das passte irgendwie nicht, denn eigentlich hieß der Bundeskanzler doch Schmidt, Helmut Schmidt! Allen war klar, dass Helmut Kohl nur ein Übergangskanzler sein konnte. Doch für den Moment hatte er zusammen mit Hannelore und den beiden Söhnen das Sagen.
Meine Situation war ausgesprochen verfahren. Ich war bereits nach einem Monat bei der Bundeswehr ausrangiert worden, weil ich den rüden Ton nicht vertrug. Eine Falte im Bettzeug, und sofort wurde man niedergebrüllt. Einerseits war ich ungeschickt, andererseits verstand ich vieles auch einfach nicht. Was zum Beispiel war eigentlich genau das Koppelschloss?
«SANITÄTSSOLDAT STRUNK, HÄNDE VORS KOPPELSCHLOSS!»
Nie wusste ich, was ich machen sollte, und ruderte deshalb hilflos mit den Armen. Ich war über 500 Kilometer entfernt von meiner norddeutschen Heimat in der Universitätsstadt Marburg stationiert worden. Das Straßenbild dominierten dort zwei Gruppen junger Leute: coole Studenten vornehmlich der Geisteswissenschaften, die sich rauchend und Weißwein trinkend in Cafés herumfläzten und sich über die andere Gruppe, die uncoolen Bundeswehrasis aus der Tannenbergkaserne, lustig machten. Nach Dienstschluss stürzten die durch Stiernacken und Pisspottschnitt stigmatisierten Rekruten in der Stadt aus lauter Verzweiflung schnell noch ein paar Halbe hinunter, um dann vor Erschöpfung und Angst halb wahnsinnig bereits gegen einundzwanzig Uhr in einen komatösen Schlaf zu fallen. Wir armen Sanitätssoldaten waren Menschen zweiter Klasse, Mörder in Uniform, stumpfe Prolls ohne politisches Bewusstsein. Wer nicht verweigerte, war das Letzte. Ich hatte aus Faulheit alle Fristen für die lästige Gewissensprüfung versäumt und musste mich nun ins Unvermeidliche fügen. Ein einziger Albtraum war jeden Sonntag die endlos lange Bahnfahrt vom ungefähr drei Subkontinente entfernten Harburg in die Kaserne zurück. Schrecklich, schrecklich, schrecklich, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ich war ein einziger Schweißausbruch. Im stets überfüllten Zug hockten im Gang die Soldatenzombies auf ihren unförmigen Reisetaschen und dämmerten mit toten Augen einer neuen Folterwoche entgegen. Je näher wir dem Quälcamp kamen, desto heftiger wurden meine Panikattacken. Die Tannenbergkaserne betrat ich jedes Mal als ein vor Todesangst schlotterndes Bündel Mensch, das seiner Auslöschung entgegensieht. Hier gehörte ich doch nicht hin! Obwohl ich schon nach drei Wochen vollkommen am Ende war, hielt ich noch eine vierte Woche durch, bis mir schließlich beim morgendlichen Stubenappell die Tränen über die Wangen pullerten. Anstatt mich auf der Stelle zu erschießen, schickte mich der Zugführer zum Stabsarzt, und bereits drei Tage später durfte ich mit dem Befund endogene Depression für alle Zeiten dienstuntauglich die Tannenbergkaserne verlassen.
Ich mach ein glückliches Mädchen aus dir
Tatsächlich litt ich bereits seit längerem unter Angst und Panikzuständen. Ausgelöst worden waren diese durch ein unausgegorenes Drogenexperiment mit achtzehn. Es hatte mich immer gewurmt, dass ich noch nicht einmal richtig stoned gewesen war, während sich meine damaligen Freunde mit den abenteuerlichsten Drogenerfahrungen übertrumpften. Nie konnte ich mitreden, denn die Joints schlugen bei mir einfach nicht an. In meiner Not ließ ich mich schließlich vom Drogenpapst der Schule zu einem riskanten Selbstversuch überreden: Ich löste eine große Portion Hasch in einer noch größeren Portion starken Bohnenkaffees auf und quälte mir die abscheulich schmeckende Plörre in großen Schlucken hinein. Nach ungefähr einer Stunde setzte schlagartig die Wirkung ein: Herzklopfen, Brustschmerz, Schwindel und Erstickungsanfälle. Die typischen körperlichen Symptome einer Angstpsychose. Viel schlimmer jedoch waren die sekundären Folgen: Todesängste, Furcht vor Kontrollverlust und das Gefühl, wahnsinnig zu werden. Nie wieder habe ich derartige Höllenqualen erlitten. Nachdem ich mehrere Stunden überzeugt gewesen war, endgültig den Verstand verloren zu haben, ließ die akute Wirkung in den frühen Morgenstunden nach. Doch offensichtlich war da ernsthaft etwas durcheinander geraten, denn ich wurde noch Monate später von abscheulichen Flashbacks heimgesucht. Daher meine Empfehlung: Hasch und Bohnenkaffee sollten unbedingt getrennt voneinander genossen werden!
Auch meine Mutter schlug sich seit längerem schon mit einer schweren seelischen Erkrankung herum. Bei dieser so genannten schizo-affektiven Psychose wechselten sich manische mit depressiven Phasen ab, wobei die Ausschläge im Laufe der Jahre immer heftiger wurden. Hatte die manische Phase ihren Höhepunkt erreicht, schlief Mutter oft tagelang nicht mehr, litt unter starken halluzinatorischen Wahnerlebnissen, psychomotorischen und kognitiven Störungen. In diesem sich exponenziell beschleunigenden Irrsinn brannte sie wie eine Supernova, um schließlich im unendlich verdichteten schwarzen Loch der Depression zu implodieren. Trotz kiloweise Psychopharmaka und Elektroschocks blieb sie oft monatelang im Kokon der Depression stecken. Die Psychose hatte sich im Laufe der Jahre als eigenständiges Krankheitsbild verfestigt und war inzwischen unheilbar, obwohl das natürlich niemand zugeben wollte. Erbarmungslos verrichtete sie ihr Zerstörungswerk. Achgottachgott, und jetzt ich. Alles erblich. Vom Vater die Akne und von der Mutter das Verrückte. Meiner genetischen Bestimmung würde ich nicht entrinnen können. Dabei war ich doch noch so jung. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass bis vierzig jeder durchhalten muss, dann kann er sich frei entscheiden. Aber wie sollte das gehen? Das hatte ich ja noch fast zwanzig Jahre vor mir!
Unsere Siedlung war offenbar der Humus, in dem psychische Defekte aller Art hervorragend gediehen, denn der nächste hoffnungslose Fall wohnte gleich nebenan, im Zwergenhaus zur Rechten. Rosemarie hauste dort seit dem Tod der Eltern zusammen mit ihrem Bruder Werner. Werner war das, was man landläufig grenzdebil nennt. Er hatte meines Wissens noch nie eine Freundin gehabt und sah aus, als ob man ihm über viele Jahre hinweg mit stumpfen Gegenständen unablässig auf den Kopf gehauen und seinen Schädel zusätzlich noch für mindestens zwei Jahre in einen Schraubstock gespannt hätte. Rosemarie teilte das Schicksal meiner Mutter: Seit Jahren arbeitsunfähig, vegetierte sie in ihrem Zimmer vor sich hin, rauchte filterlose Reval und hörte deutsche Schlager, insbesondere die ihres Lieblingsinterpreten Chris Roberts.
Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay, hey, für mich, ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich.
Du kannst nicht immer siebzehn sein, Liebling, das kannst du nicht, aber das Leben wird dir noch geben, was es mit siebzehn dir verspricht.
Ich mach ein glückliches Mädchen aus dir, jeden Tag und jede Nacht, was du dir wünschst, das bekommst du von mir, jeden Tag und jede Nacht. Das hättest du dir im Traum nicht gedacht, was man aus Liebe so macht, ja glaub mir, ich mach ein glückliches Mädchen aus dir, jeden Tag und jede Nacht.
Diejenigen, die dauernd die blöde Frage stellen, wer denn um Himmels willen eigentlich deutsche Schlager hört, wissen es nun endlich: Rosemarie. Regelmäßig wurde sie in die psychiatrische Klinik Hamburg-Ochsenzoll verbracht und nach ein paar Wochen wieder ungeheilt entlassen. Mit gerade mal sechsunddreißig war sie durch Psychopharmaka und Kuchen der Saison so grotesk aufgeschwemmt, dass sie das Haus nur noch verließ, um Zigaretten zu holen. Die Augen vor panischem Entsetzen geweitet, kreiselte sie ihren unförmigen Rosemariekörper zum Zigarettenautomaten und zurück.
Ich konnte mir keinen Menschen auf der ganzen Welt vorstellen, der mehr raucht als Rosemarie. Sie verbreitete eine Dunstglocke mit einem Radius von ungefähr fünf Metern, und ihre Haut war sattgelb. Im Sommer saß sie manchmal quarzend in der Hollywoodschaukel. Man konnte bei ihr dann oben von unten nur noch dadurch unterscheiden, dass oben Rauch rauskam. In ihrem Zimmer hielten es selbst Ohrenkneifer oder anderes zählebige Ungeziefer nicht lange aus. Irgendwann sah sie aus wie eine Wasserleiche, die man bei niedriger Temperatur tagelang gedünstet hat. Nachts schrie sie manchmal bei geöffnetem Fenster leise vor sich hin. Der Ekel und das Entsetzen vor der Welt und sich fanden ihren Ausdruck in diesen nicht enden wollenden, leisen Schreien. Eines Nachts wurde ich von einem Chris-Roberts-Medley geweckt. Ich mach ein glückliches Mädchen aus dir, jeden Tag und jede Nacht. Ganz entgegen ihrer Gewohnheit hatte sie die Musik sehr laut aufgedreht. Ich dachte mir nichts weiter dabei, aber am nächsten Morgen war sie tot. Sie hatte Gift geschluckt und sich zusätzlich noch die Pulsadern aufgeschnitten.
Es gab noch mindestens drei weitere Fälle schwerer psychischer Defekte in unserer Zwergensiedlung. Wahrscheinlich würde ich ewig hier wohnen bleiben, Mutter unten in der Stube und ich oben im ausgebauten Speicher, wo der Regen so gemütlich aufs Dach prasselte. In meinem süßsauren Jugendzimmer bewahrte ich immer noch die schlampig zusammengekleisterten Kriegsspielzeugmodelle von Airfix auf. Ich war jahrelang ein großer Fan des Zweiten Weltkriegs gewesen, den die Deutschen meiner Meinung nach nur verloren hatten, weil sie mit der Entwicklung ihrer Geheimwaffen nicht zügig genug vorangekommen waren. Ärgerlich!
Ich hatte gehofft, dass sich in den eineinhalb Jahren meiner Bundeswehrzeit irgendetwas ergeben würde, aber jetzt musste ich mir wohl oder übel etwas einfallen lassen. Eigentlich wollte ich ja schon die ganze Zeit Musiker sein, am besten mit eigenen Hits reich werden wie alle anderen auch, denn das schien damals pipieierleicht. Die Neue Deutsche Welle lag Mitte 83 zwar schon in den letzten Zügen, aber ich hatte die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt und träumte trotz Akne und anderer unübersehbarer Handikaps von einer Karriere im Pop-Business. Von Musik verstand ich schließlich was. Meine ganze Kindheit und Jugend über hatte ich unter der Ägide von Mutter, die selbst Musiklehrerin gewesen war, geübt, geübt und nochmals geübt. Jetzt galt es, endlich die Ernte einzufahren. Dass ich Popmusiker werden wollte, konnte ich Mutter natürlich nicht erzählen, denn sie hielt Popmusik für ausgesprochenen Quatsch. Trotz ihrer Erkrankung hatte Mutter immer noch große Macht über mich. Also tat ich harmlos.
«So, Heinz, was soll denn jetzt mit dir werden?»
«Weiß nicht. Ich dachte, Musik studieren.»
«So, dachtest du. Aber dann musst du erst mal die Aufnahmeprüfung schaffen. Und wovon willst du bis dahin leben?»
«Ach so.»
«Das ist keine Antwort. Entweder du suchst dir wie alle anderen auch einen Job, oder du musst zum Sozialamt gehen. Ich verdiene nicht genug für uns beide.»
Mein Antrag auf Sozialhilfe wurde ohne Murren bewilligt, und so stand ich die nächsten beiden Jahre unter der väterlichstrengen Obhut von Herrn Sommer, einem Mittdreißiger mit irritierend unstetem Blick.
Mein bester Freund Niels wusste zum Glück ebenso wenig wie ich, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Ein Tagedieb alter Schule. Wir trafen uns meist bei mir, tranken Bier und saßen einfach nur so rum. Wenn das Fernsehprogramm zu Ende war – damals gab es noch Sendeschluss –, hörten wir das Radionachtprogramm, bevorzugt das Südfunk-Tanzorchester Stuttgart unter der Leitung von Erwin Lehn, das uns mit heiteren, jedoch niemals banalen Klängen erfreute. Manchmal fingen wir aus heiterem Himmel hysterisch an zu lachen über das Schauspiel unserer traurigen Jugend, die da so sinnlos verstrich. Andere trampten nach Asien, hingen in Diskotheken rum oder machten sonst wie was aus ihrem Leben. Und wir? Wir waren eben Privatpersonen. Kontakte zum anderen Geschlecht gab es auch nicht. Die einzige Frau, die ich jemals halbwegs nackt gesehen hatte, war Mutter gewesen. So schien es auch weiterzugehen. Ich hatte mir von den Holunder-Ersparnissen ein winzig kleines Tonstudio angeschafft, in dem ich tage- und nächtelang Playbacks ohne klaren Verwendungszweck zusammenschraubte. Da mir lediglich eine unfassbar kompliziert zu bedienende Drum-Maschine, der analoge Synthesizer JX-3P und einer der ersten Vierspurkassettenrecorder zur Verfügung standen, klangen die Stücke alle ziemlich ähnlich. Gewisse Übereinstimmungen mit Jack Nicholson im Psychoschocker Shining, in dem er den immer gleichen Satz in seine Reiseschreibmaschine hämmert: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!, waren unverkennbar. Playbacks schrauben, trinken, Sozialamt, Mutter, Niels, Rasen mähen. Bis vierzig soll man durchhalten? Und wie wär’s mit dreißig? Ich konnte mir nicht vorstellen, unter den gegebenen Umständen auch nur dieses Alter zu erreichen. Noch acht Jahre! Wahrscheinlich würde irgendwann einfach mein Herz stehen bleiben, weil der Körper nicht mehr mitmachte.
Auch mit Mutter ging es rapide bergab. Sie aß und trank kaum noch etwas und glich immer mehr einem verschrumpelten Vogel, den seine Eltern aus dem Nest gepickt haben. Sie wollte sich zu Tode hungern. Auch nach der nächsten Zwangseinweisung ins Krankenhaus besserte sich ihr Zustand trotz härtester Medikation überhaupt nicht. Wenn ich sie besuchte, lag sie fast immer auf dem Bett und machte ihren Mund auf und zu wie ein Karpfen. Der Körper war irgendwie ganz verbogen, und in ihren Augen spiegelte sich die nackte Panik. Was kann ein Mensch eigentlich ertragen? Meine Vogelmutter ertrug es schließlich nicht mehr und sprang aus dem Fenster, hinaus in die Freiheit. Doch die Erlösung blieb ihr verwehrt. Sie durfte nicht sterben, immer noch nicht, ihr Martyrium sollte in der nach oben offenen Spirale des Leidens weitergehen. Nun würde sie erst recht für lange Zeit im Krankenhaus bleiben müssen, anschließend Rehaklinik, und dann? Hilflos wie eine Schildkröte, die man auf den Rücken gedreht hat, wartete ich darauf, dass irgendetwas passierte.
Viel Afrika und wenig Bavaria
Im Keller hatte ich noch aus Holunder-Zeiten eine schwarze Bundfaltenpluderhose, ein weißes Hemd mit Vatermörderkragen und ein Paar ausgelatschte schwarze Schuhe aufgetrieben. In welche Richtung das Programm von Tiffanys wohl ging? Wahrscheinlich die übliche Mischung aus Oldies, Evergreens, Schlagern, Volksmusik und ein paar aktuellen Titeln. Ich war den Umgang mit fremden Menschen nicht mehr gewohnt, da mich meine nunmehr zweijährige Reihenhauseremitage bereits etwas kauzig gemacht hatte. Im Spiegel überprüfte ich noch einmal mein Aussehen. Im rechten Mundwinkel hatte sich ein schmerzhafter Pickel mit gelber Haube eingenistet, der gerade seinen Zenit erreichte. Pickel am Mund nie ausdrücken, das ist gefährlich (Blutvergiftung)! Egal, sollten sie ruhig erst einmal einen Schrecken kriegen. Ich war schließlich zum Musikmachen engagiert, und davon verstand ich etwas.
Punkt halb sechs klingelte es. Vor der Tür standen zwei junge Männer: Der eine war rotblond und untersetzt, der andere sicher eins neunzig und wirkte etwas steif in den Hüften. Beide schienen ungefähr in meinem Alter zu sein. Der Kleinere, der einen ganz selbstbewussten Eindruck machte, eröffnete das Gespräch.
«Wir sollen hier den besten Saxophonisten Hamburgs abholen.»
«Ach so, ja, ich wäre dann so weit», entgegnete ich wenig schlagfertig. Ich hatte meine Instrumentenbatterie, bestehend aus Tenor-, Alt-, Sopransaxophon und der Tasche mit Flöte und Stativen, vollständig im Flur aufgepflanzt, um sie zu beeindrucken.
«Kommt das alles mit?» Der Große stotterte ein wenig.
«Ja. Ich bin übrigens Heinz.»
Der Hüftsteife hieß Norbert und war maritim bekleidet mit einem Troyer, Karottenjeans und Camel-Boots. Torsten trug ein Sweatshirt mit Mickeymaus-Aufdruck und eine ausgebeulte Bundfaltenhose. Auf der Fahrt wurde ich mit der noch jungen Bandhistorie vertraut gemacht: Tiffanys gab es in der aktuellen Besetzung erst seit drei Monaten. Gurki, der Bandleader, mit bürgerlichem Namen Gundolf Beckmann, hatte sich mit der alten Besetzung überworfen, die daraufhin geschlossen ausgestiegen war. Norbert, Torsten und der dritte, Jens, hatten vorher als Trio Lütt un Lütt Schützenfeste, Feuerwehrbälle und Hochzeiten bespielt. Auf einer dieser Veranstaltungen tauchte Talentscout Gurki auf und engagierte prompt die ganze Truppe. Lütt un Lütt wurde so vollständig von Tiffanys absorbiert.
Das Moorwerdersche Schützenfest zählte zu den Größten im Landkreis und konnte sich eine Fünf-Mann-Kapelle ohne weiteres leisten. In der Mitte des Festplatzes stand, umsäumt von allen möglichen Buden, Kinderkarussell und Autoscooter, das Zelt, in dem das abendliche Tanzvergnügen stattfinden sollte. Die Aufteilung solcher Zelte ist immer gleich: links vom Eingang ein endloser Tresen und auf der anderen Seite die Bühne. Auf ihr verlegten zwei Männer gerade die letzten Kabel. Der eine kletterte von der Bühne, um mich zu begrüßen. Er war schon deutlich über dreißig und ziemlich schmächtig. Mir fielen die großen Wasserflecken auf seinen Collegeschuhen auf. Das optische Zentrum seines Gesichts bildete ein akkurat getrimmter Riesenschnauzer.
«Hallo, ich bin der Gurki. Schön, dass du dabei bist.»
Das also war der Gurki. Ich versuchte, irgendeine Verbindung zwischen dem selten blöden Spitznamen und seinem Äußeren auszumachen, konnte aber auf die Schnelle nichts entdecken. Dann kam auch Jens herunter. Er war wie Norbert und Torsten um die zwanzig, hatte blondes, bereits leicht schütteres Haar und ebenfalls einen Schnäuzer, der allerdings so dünn war, dass man ihn erst bei ganz genauem Hinsehen wahrnahm. Als er mir die Hand gab, hatte ich das Gefühl, eine Art Stumpen anzufassen. Später am Abend habe ich mir seine Hände dann genauer angeguckt: Derjenige, der sich das Wort Wurstfinger ausgedacht hat, muss Jensens Hand vor Augen gehabt haben. Schwer vorstellbar, wie er damit die Tasten bedienen wollte. Auf dem Weg zurück zur Bühne fing er sofort an zu pfeifen. Nachdem ich ausgepackt hatte, begannen wir mit dem Soundcheck.
«Und, was spielen wir? Wie immer?», fragte Norbert.
Gurki schaute mich an.
«Hast du ein bestimmtes Stück?»
«Nö, nö, macht man ruhig, wie ihr immer macht.»
«Okay, dann Hello Dolly. Torsten, zähl an!»
Tacktacktacktack.
Im ersten Durchgang spielte Gurki das Thema auf der Gitarre. Schon nach wenigen Takten war mir klar, was die Stunde geschlagen hatte. Der Bandleader musste sich enorm konzentrieren, um die Melodie einigermaßen fehlerfrei zu spielen, außerdem hatte er überhaupt kein Rhythmusgefühl. Norberts Bass und Torstens Schlagzeug rumpelten, ohne Bezug aufeinander zu nehmen, unbeholfen vor sich hin. Dabei guckten sie sich die ganze Zeit angestrengt an und taten so, als ob es so richtig grooven würde. Jens hatte bei seinem Korg Polysix Synthesizer einen ganz abscheulich schrillen Streichersound eingestellt und griff mit seinen zu kurzen Fingern ständig daneben. Klöter klöter klöter, schrammel schrammel schrammel, matsch matsch matsch. Auch der Sound war eine Katastrophe. Katzenmusik. Besonders überraschen konnte mich das nicht, Holunder hatten ähnlich geklungen. Und dem Publikum war es immer seltsam egal gewesen. Entweder, weil sie es nicht anders gewohnt waren, oder vielleicht auch, weil das dilettantische Geklöter bewies, dass die Band wirklich live spielte. Nach dem ersten Durchgang bedeutete mir Gurki durch Kopfnicken, zu übernehmen. Ich spielte das Thema auf der Flöte und improvisierte einen zweiten Durchgang. Dann griff ich zum Altsaxophon und gniedelte, was das Zeug hielt. Die neuen Kollegen waren beeindruckt.
«Super Saxsolo.»
«Ich fand die Flöte aber auch gut, fast noch besser.»
«Und jetzt mal einen mit der Rotzkanne.»
Mit der Rotzkanne war das Tenorsaxophon gemeint.
«Du hängst dich einfach rein!»
«Sie sind erstens sehr teuer, zweitens ganz neu, und drittens trägt so was kein anderer Boy … blaue Wildlederschuh.»
Blue Suede Shoes in der Version von Paul Kuhn. Ich fand den deutschen Text lustig und hängte mich rein. Tiffanys: begeistert! Dann wurde der mir nicht geläufige Schlager Der Morgen danach von Tommy Steiner intoniert. In F-Dur.
«Der Morgen danach,
er wird es entscheiden,
wer von uns beiden, er oder ich?
Nur du kennst die Antwort auf diese Frage.
Ich wünsch mir,
dass du dich entscheidest für mich.»
Ich entschied mich für die Flöte. Pfeif, tirilier, Sechzehnteltriolen, Zweiunddreißigstel, ich wollte sie schwindlig spielen.
«Ein Leben mit dir, das möchte ich erleben, Tage voll Sonnenschein, an deiner Seite, da möchte ich leben, möchte ich lieben und noch viel mehr.»
Tiffanys: begeistert! Zu Recht. Schließlich hatte ich entscheidende Teile meiner Jugend dem Erlernen von Blasinstrumenten geopfert. Während sich meine Schulkameraden mit Alkoholexperimenten, Fußball und Heavy Petting die Zeit vertrieben, hatte ich in den Räumen des Seniorentreffpunkts Harburg-Rönneburg drei Stunden täglich Querflöte und Saxophon geübt. Mindestens. Manchmal auch vier oder fünf.
Alles, um jetzt mit Tiffanys in Moorwerder zu spielen. Alles für die Katz. Katz und Maus. Katzenjammer. Und wieder Refrain. Der Morgen danach, er wird es entscheiden … In einiger Entfernung zur Bühne stand eine Rotte Schützenbrüder, die uns argwöhnisch beäugten. Aus ihren Reihen löste sich plötzlich ein schwitzender Talgbrocken und quoll uns erstaunlich behände entgegen.
«Sagt mal, Klaus und Klaus, das habt ihr ja wohl drauf!?»
Gurki setzte sofort sein Vertretergesicht auf und schüttelte dem sichtlich überraschten Rohling die Hand.
«Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Beckmann, erst einmal meinen herzlichen Glückwunsch.»
Aha, ich begriff. Der neue Schützenkönig. Gurki sülzte weiter.
«Sie meinen doch bestimmt An der Nordseeküste. Natürlich haben wir das drauf, wir spielen das immer mit zwei Akkordeons, hahaha.»
Dieser letzte Teil der Information drang nicht mehr recht zur Majestät durch.
«Jaja, dann ist ja alles klar. Und nicht so laut. Einmarsch ist um halb neun, und ihr spielt erst mal auf jeden Fall nur zwei Tänze, damit alle rumkommen.»
Gurki nickte, und der grüne Mann trollte sich wieder.
«Alles klar, dann erst mal ein Bierchen!»
Endlich. Ich hatte schon befürchtet, bei Tiffanys herrsche Alkoholverbot. Wir gingen zum Tresen, und Torsten bestellte.
«Wirt, machst du mal fünf Stützbier fertig.»
Stützbier! Torsten schien sich auszukennen mit Trinkerhumor.
«Wenn der Abend so läuft wie der Soundcheck, dann mach ich mir keine Sorgen.»
«Prost!»
«Prost!»
«Prost!»
«Prost!»
«Prost!»
Das Bier war eine schauderhafte, dünne Plörre, von der man nicht richtig besoffen wurde. Und da kam schon der nächste Schützenbruder im Stechschritt auf uns zu.
«Guten Abend, mein Name ist Eggers, ich bin der zweite Zeugwart. Sie können jetzt zum Essen gehen. Spielbeginn ist Punkt zwanzig Uhr.»
Er klang so zackig wie ein Kommentator der Deutschen Wochenschau. Grußlos marschierte er wieder ab, wahrscheinlich Spinde kontrollieren und anschließend Jungschützen auspeitschen. Jens klatschte zweimal kurz in die Hände.
«Auf geht’s, meine Herren.»
Hinter dem Tresen stand unser Essen, Kartoffelsalat und Würstchen. Ein paar Meter weiter vertilgten ein paar Schützen appetitlich aussehende Lachsbrötchen. Eine kulinarische Zweiklassengesellschaft. Torsten starrte missmutig auf die vom überlangen Wasserbad aufgerissenen Wiener.
«Die haben da ihre Gourmetsemmeln, und wir müssen Luftpumpen fressen.»
Luftpumpen, astrein. Kannte ich noch gar nicht. Der Junge schien ein Garant für originelle Ausdrücke zu sein. Dann ging es ab hinter die Bühne zum Umziehen. Verstohlen musterten wir gegenseitig unsere deformierten Körper. Gurki, typischer Leptosom mit dünnen Ärmchen und Beinchen, sah aus wie ein zerrupfter Truthahn. Bleich, unzählige Leberflecke, trotz schmächtiger Erscheinung Schwimmring und Autofahrerbäuchlein. Norbert, jugendlich-straffe, leicht gebräunte Haut, jedoch als schweres Handikap ausladendes Becken; er war rhombenförmig. Jens, untersetzt, feist, vierschrötig, Typus Hummel. Torsten, Pykniker wie aus dem Lehrbuch, Rücken, Schultern und Brust stark verpickelt, Oberschenkel dick wie Fußgängerampeln, trotzdem fest, kompakter Gesamteindruck. Ich, weiß wie eine Wand, komplett zugepickelt, wenige unsymmetrische Haarinseln, Ansatz zur männlichen Fettbrust, den sog. Herrentitten, trotz Normalgewichts irgendwie eingefallen, schwabbelig wirkend.
Zentraler Blickfang der Tiffanys-Bühnengarderobe waren pinkfarbene Glitzerjackets, die mit einer farblich abgestimmten Fliege und schwarzen Bundfaltenhosen im Stil von Errol-Flynn-Piratenfilmen kombiniert wurden. Gurki hielt mir ein zerschlissenes und ungefähr zwei Nummern zu großes Ersatzsakko vor die Nase:
«Probier mal.»
Hier sollte ein Mensch gebrochen werden.
«Wir lassen demnächst neue maßschneidern.»
«Auch in Rosa?»
«Ja sicher, das muss doch zum Gesamtbild passen.»
Er deutete hinter sich in die Tiefe der Bühne, wo eine ungefähr drei Meter hohe Aluminiumjalousie stand, auf die eine Paulchen-Panther-Figur gesprüht war.
«Ach so, ja.»
Grotesk. Jetzt war ich also plötzlich mittendrin in der Welt von Kater Garfield, Diddlmaus und Paulchen Panther.
«Das Paulchen-Panther-Thema ist auch unsere Pausenmelodie», erklärte Norbert. «Aber nur der erste Teil. Dadapp, dadapp, dadappdadappdadapp dadappdadada dadapp und dann Abschlag. In E.»
Jens klatschte zweimal in die Hände.
«Auf geht’s, es ist Punkt.»
Der Opener des Tanzabends war Time is tight, ein etwas debiles Instrumentalstück, dessen Thema lediglich die Brechung eines Sextakkords bildet. Als Zweites der von Jens gesungene romantische Schlager Sommernacht in Rom von G.G. Anderson. In G-Dur.
«Sommernacht in Rom, und wir beide träumen,
Sommernacht in Rom, dieser Traum wird bleiben.»
Niemand tanzte. Ich war überrascht von der Disziplinlosigkeit der jungen Schützengeneration.
«Der Zauber der ewigen Stadt führte mich zu dir. Ich fliege zu den Sternen neben dir.»
Knödel knödel. Jens sang irgendwie gepresst, aber mit Herz. Eigenartige Kombination. Intonation mangelhaft.
«Sommernacht in Rom, sie geht nie zu Ende, Sommernacht in Rom, unsere Herzen brennen.»
Tacktacktacktack, Paulchen-Panther-Melodie, Pause. Wir blieben mit gefalteten Händen auf der Bühne stehen. Bereits nach zwei Minuten ging es weiter.
«Auf geht’s. Die Leute müssen in Schwung kommen. Nordseeküste und Hello Dolly.»
Bei den ersten Takten von An der Nordseeküste ging ein Ruck durchs Zelt. Es war offenbar der erste Trumpf, den wir da aus dem Ärmel schüttelten. Die Schützen waren von ihren Bänken aufgestanden, hatten sich eingehakt und sangen begeistert mit.
«An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand,
Sind die Fische im Wasser und selten an Land.»
Leadgesang Gurki. Trotz der einfachen Melodie ein Festival der schiefen Töne. Egal, die Schützen waren aus dem Häuschen und schnappten vor Begeisterung stumm nach Luft. Ansage Gurki, die gute Stimmung nutzend:
«Jaaaaaaaaaaaa, liebe Freunde, und jetzt dem neuen Schützenkönig ein dreifaches Gut –»
«Schuss!», dröhnte es lautstark zurück.
«Gut –»
«Schuss!»
«Gut –»
«Schuss!»
Ich murmelte natürlich «Sieg Heil» vor mich hin.
Gurki euphorisch: «Jaaaaa, liebe Freunde, und jetzt Hello Dolly aus dem Musical Hello Dolly.»
Hello Dolly aus dem Musical Hello Dolly. Wichtige Sachinformationen. Die Schützen hatten sich leider schon wieder hingesetzt. Sie waren nach dieser ersten Eruption kollektiv in sich zusammengesackt.
«It seems it never rains in Southern California, I often heard this kind of talk before.»
Gegen Ende des Stückes schlurfte ein verwitterter, steinalter Schützenbruder zusammen mit seiner Madame auf die Tanzfläche. Er war offensichtlich eine Art Alphatier, denn die Tanzfläche füllte sich auf einen Schlag. Endlich! Wir schoben
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: