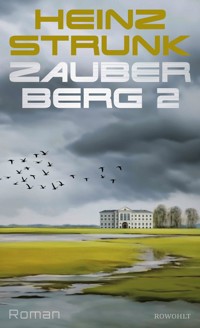Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacheles!
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heinz Strunk erzählt von Männern und Frauen und von dem, was zwischen ihnen nicht passiert. Jürgen lebt in Harburg, arbeitet als Parkhauswächter, pflegt daneben seine Mutter und hat es auch sonst nicht leicht. Trotzdem ist für ihn das Glas immer halbvoll, und er findet, dass er es im Leben eigentlich ganz gut getroffen hat. Um es mal deutlich zu sagen: Jürgen ist ein ganz armer Willi, nur weiß er das nicht. Woher denn auch, sein Freund Bernd z.B. ist auch nicht besser dran und sitzt dazu im Rollstuhl. Die beiden müssen so einiges im Leben entbehren, am schmerzlichsten die Liebe einer Frau. Das soll sich nun aber ändern. Doch leider schlagen Speed-Dating und Fachlektüre so gar nicht an. Da muss wohl mehr investiert werden, und zwar in eine nicht eben billige Reise nach Polen mit der Firma «Eurolove». Ob das gutgeht? «Mit ‹Jürgen› erweist sich Heinz Strunk einmal mehr als wirklich großer deutscher Humorist.» (NDR) «Für Lachnummern ist das alles zu schlau … überragend … ein tolles Buch. Mit ‹Jürgen› steht Strunk Sprachschleifern wie Ödön von Horváth und Karl Kraus näher, als einem auf Slapstick abonnierten Publikum lieb sein kann.» (Die Zeit) «Heinz Strunk lotet mit seinem Roman aufs schönste aus, wie weit die Sprache trägt.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) «Wieder ein präziser Blick auf die Verhältnisse und wie sie den Einzelnen gängeln und verbiegen.» (Die Zeit) «An Witz kaum zu überbieten.» (Hamburger Abendblatt) «So ist das nun einmal: Schriftsteller, auf jeden Fall die besseren, haben ihre Motive und Themen, die sie immer von neuem durchspielen und variieren. Manche mögen das als Recycling beklagen, was aber eher darauf schließen lässt, dass ihnen die ganze Richtung nicht passt. Wer Strunk schätzt, wird auch ‹Jürgen› mögen.» (Deutschlandradio Kultur) «Strunk schreibt leicht und gewitzt und streut jede Menge Pointen auf die Seiten seines Romans. Aber er gibt seine Charaktere nie der Lächerlichkeit preis, sondern richtet einen Fokus auf Menschen wie Jürgen Dose, den diese sonst – zumindest außerhalb von RTL II – nicht bekommen. Und schon gar nicht so feinfühlig. Das ist großes literarisches Kino.» (Hamburger Morgenpost)
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:5 Std. 48 min
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Heinz Strunk
Jürgen
Roman
Über dieses Buch
Heinz Strunk erzählt von Männern und Frauen und von dem, was zwischen ihnen nicht passiert.
Jürgen lebt in Harburg, arbeitet als Parkhauswächter, pflegt daneben seine Mutter und hat es auch sonst nicht leicht. Trotzdem ist für ihn das Glas immer halbvoll, und er findet, dass er es im Leben eigentlich ganz gut getroffen hat. Um es mal deutlich zu sagen: Jürgen ist ein ganz armer Willi, nur weiß er das nicht. Woher denn auch, sein Freund Bernd z.B. ist auch nicht besser dran und sitzt dazu im Rollstuhl. Die beiden müssen so einiges im Leben entbehren, am schmerzlichsten die Liebe einer Frau. Das soll sich nun aber ändern. Doch leider schlagen Speed-Dating und Fachlektüre so gar nicht an. Da muss wohl mehr investiert werden, und zwar in eine nicht eben billige Reise nach Polen mit der Firma «Eurolove». Ob das gutgeht?
«Mit ‹Jürgen› erweist sich Heinz Strunk einmal mehr als wirklich großer deutscher Humorist.» (NDR)
«Für Lachnummern ist das alles zu schlau … überragend … ein tolles Buch. Mit ‹Jürgen› steht Strunk Sprachschleifern wie Ödön von Horváth und Karl Kraus näher, als einem auf Slapstick abonnierten Publikum lieb sein kann.» (Die Zeit)
«Heinz Strunk lotet mit seinem Roman aufs schönste aus, wie weit die Sprache trägt.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
«Wieder ein präziser Blick auf die Verhältnisse und wie sie den Einzelnen gängeln und verbiegen.» (Die Zeit)
«An Witz kaum zu überbieten.» (Hamburger Abendblatt)
«So ist das nun einmal: Schriftsteller, auf jeden Fall die besseren, haben ihre Motive und Themen, die sie immer von neuem durchspielen und variieren. Manche mögen das als Recycling beklagen, was aber eher darauf schließen lässt, dass ihnen die ganze Richtung nicht passt. Wer Strunk schätzt, wird auch ‹Jürgen› mögen.» (Deutschlandradio Kultur)
«Strunk schreibt leicht und gewitzt und streut jede Menge Pointen auf die Seiten seines Romans. Aber er gibt seine Charaktere nie der Lächerlichkeit preis, sondern richtet einen Fokus auf Menschen wie Jürgen Dose, den diese sonst – zumindest außerhalb von RTL II – nicht bekommen. Und schon gar nicht so feinfühlig. Das ist großes literarisches Kino.» (Hamburger Morgenpost)
Vita
Der Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk wurde 1962 in Bevensen geboren. Seit seinem ersten Roman Fleisch ist mein Gemüse hat er elf weitere Bücher veröffentlicht. Der goldene Handschuh stand monatelang auf der Bestsellerliste; die Verfilmung durch Fatih Akin lief im Wettbewerb der Berlinale. 2016 wurde der Autor mit dem Wilhelm-Raabe-Preis geehrt. Mit seinen Romanen Es ist immer so schön mit dir und Ein Sommer in Niendorf war er zwei Jahre in Folge für den Deutschen Buchpreis nominiert.
Die Verfilmung von «Jürgen» mit Heinz Strunk und Charly Hübner in den Hauptrollen wurde mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Umschlagabbildung: Steven Taylor/Getty Images
ISBN 978-3-644-00036-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Ciri
Stadtkäfer
Wenn am Montag in aller Herrgottsfrühe der Wecker klingelt, bin ich meist schon hellwach und grüble darüber nach, was die neue Woche wohl bringen wird. Ob alles halbwegs glattgeht, damit man am Freitag durchschnaufen und sich «Puh, das wäre wieder mal geschafft» sagen kann. Ich weiß ganz genau, irgendwann, vielleicht viele Jahre in der Zukunft, wird ein Tag kommen, an dem man das nicht mehr so unbeschwert sagen kann und spürt, dass das der Anfang vom Ende ist und man bald den Regenschirm zuklappen muss. Aber bis es so weit ist, verstreicht hoffentlich noch ein erkleckliches Weilchen.
Wie ich so daliege, lasse ich die Woche geistig schon mal sozusagen im Voraus Revue passieren: Was liegt an? Was ist wichtig, was weniger? Ich denke das so lange durch, bis sich diese Notizen an mich selbst förmlich in meinem Kopf eingebrannt haben. Um halb sieben springe ich dann, guten Gewissens und ohne eine Sekunde zu zögern, aus dem Bett.
Es gab einmal eine Zeit, in der mir eine innere Stimme zuzuflüstern schien: «Nur noch ein kleines Weilchen, Jürgen. Bleib doch ruhig ein Minütchen länger liegen.» Doch aus einer Minute wurden schnell fünf, aus fünf zehn und so weiter, und am Ende war ich so kraft- und saftlos, dass ich am liebsten für immer liegen geblieben wäre. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die irgendwann einfach nicht mehr hochkommen und von denen man dann auch nie wieder etwas hört. In der Sprache der Immobilienwirtschaft nennt sich so etwas zufällige Verschlechterung und zufälliger Untergang.
Es war dies zum Glück nur eine kurze Phase, die wie ein Spuk aus dem Nichts auftauchte und auch wieder dorthin verschwand. Was einen jedoch nicht in Sicherheit wiegen sollte. Denn das Motto lautet: «Der Fuchs schläft nicht, er schlummert nur.»
Morgens liegt der Tag vor einem wie eine endlose, gleichförmige Steppe. Damit man ihn sich untertan macht und es nicht umgekehrt ausgeht, gilt es, den Riesenklumpen Zeit in mundgerechte Häppchen zu unterteilen, denn in kleine Portionen und kleinste Portiönchen zerschnitten, verliert selbst die größte Schwierigkeit ihren Schrecken. Zauberwort Zäsuren, zu Deutsch Unterteilungen. Beispiel: Ich habe irgendwann die morgendliche Kaffeegabe durch Tee ersetzt. Denn auch der Wirkstoff in Tee ist anregend, aber keine so gewaltige Keule wie Koffein. Es gibt ja nicht wenige Zeitgenossen, die sich sozusagen am laufenden Meter eine Tasse nach der anderen in den Hals schütten und dann staunen, wenn ihr Nervenkostüm zerrüttet ist und sie vor lauter Aufregung nicht mehr schlafen können. Das für mich Entscheidende ist jedoch: Durch die Verlegung der Kaffeestunde auf den Nachmittag habe ich eine Zäsur gesetzt. Zu den morgendlichen Zäsuren zählt, nach dem Aufstehen für ein paar Minuten das Radio einzuschalten und so Anteil an der Welt zu nehmen, als ein Zeitgenosse, der sich wie alle anderen auch für Nachrichten, Wetter und aktuelle Verkehrsmeldungen interessiert.
Diese genannten und noch viele andere Vorkehrungen mehr nenne ich zusammengefasst lebensoptimierende Maßnahmen. Einmal, so stelle ich es mir vor, kommt der Punkt, an dem alles, aber wirklich alles verbessert und geregelt ist und das Leben nahezu geräuschlos vor sich hin schnurrt. Dann ist alle Wäsche gewaschen, sind alle Einkäufe erledigt, alle Telefonate geführt und sämtliche Arzt- und Behördengänge absolviert. Und endlich eine Frau an meiner Seite. Zukunftsmusik.
Kaum habe ich das Radio ausgedreht, ruft meine Mutter nach mir, die trotz ihres Alters noch sehr gut hören kann. Die Nacht schläft sie friedlich durch wie ein Murmeltier, aber sobald in der Frühe die ersten Radioklänge ertönen, ist sie von einer Sekunde zur nächsten blitzwach. Sie wartet aber wie gesagt ab, bis das Radio wieder aus ist. Eine stillschweigende Verabredung zwischen uns, oder wie der Engländer sagt: ein Gentlemen’s Agreement. Solange das Radio läuft, weiß Mutter, dass ich noch für mich herumklamüsere, danach bin ich für sie und die Allgemeinheit da.
Mutter hatte vor Jahren einen schweren Unfall und ist seither bettlägerig. Um ihr einen Pflegeheimaufenthalt zu ersparen, habe ich sie zunächst bei mir aufgenommen. Was als Zwischenlösung geplant war, ist mittlerweile allerdings Dauerzustand geworden. Tja.
Begrüßen tun wir uns jeden Morgen per Handschlag. Das mag zwischen Mutter und Sohn etwas ungebräuchlich erscheinen, aber die üblichen Küsschen auf Wange oder Stirn waren uns irgendwann regelrecht zuwider. Außerdem muss ein Händedruck nicht zwangsläufig weniger herzlich oder wert sein. Ganz im Gegenteil. Denn der Kuss, den wir uns zu besonderen Anlässen geben, behält so seinen ganz einmaligen, unverwechselbaren Charakter. Merke: Ein fröhlicher Handschlag ist mehr wert als ein trauriges Küsschen!
Mutter fragt als Erstes, was es Neues gibt. Eine merkwürdige Angewohnheit, denn es gibt praktisch nie Neuigkeiten, gerade wenn man sich so oft sieht wie wir. Danach schüttele ich ihre Decke auf, für sie ein außerordentlich erfrischender Moment, da ihr Bett heißer als gewöhnliche Betten ist. Es handelt sich nämlich um ein vollelektrisches, sog. bewegtes Bett, das durch ständige Gewichts- und Schwerpunktverlagerung etwaigem Wundliegen vorbeugt, um es einmal einfach und für den Laien verständlich auszudrücken. Für Mutter kommt aufgrund ihrer Maleschen nämlich nur noch Rückenlage in Frage. Die einzige Abwechslung ist die Position ihrer Arme: mal starr und schnurgerade neben dem Körper, mal über der Brust gefaltet, mal hinter dem Kopf verschränkt.
Mutter wurde in Pflegestufe 2 eingeordnet und hat deshalb dauerhaft Anspruch auf dreimal am Tag medizinische Versorgung, die sich die diensthabenden Schwestern Petra (Brohm) und Angela (Raubal) vom mobilen Pflegedienst Stadtkäfer aufteilen. Was dessen Chef, Herrn Engel, geritten hat, seinem Pflegedienst einen so albernen Kindergartennamen zu verleihen, würde ich nur zu gerne wissen. Die Arbeit wird jedoch stets pünktlich und zuverlässig verrichtet.
Herrn Engel selbst habe ich nur ein einziges Mal gesehen, am Tage der Vertragsunterzeichnung im winzigen Büro der Stadtkäfer, das sich in einem schäbigen Gewerbegebiet im Stadteil Tonndorf befindet. In Erinnerung geblieben ist mir vor allem sein verschwitzter, kalter Händedruck. Heiß und schweißig ist ja schon unangenehm, aber eisekalt und feucht, da zuckt man unwillkürlich zusammen. Insgesamt machte Herr Engel einen schmuddeligen Eindruck, besonders die Haare wirkten wie zwischen Tür und Angel geschnitten. Auffallend waren zwei Büschel, die wie Hörner aus dem Rest der «Frisur» herausstachen. So wird aus einem Engel ganz schnell ein Teufel!
Angela, die zweite Schwester im Bunde, bekomme ich so gut wie nie zu Gesicht, weil sie den Spätdienst verrichtet, da bin ich meist noch auf der Arbeit. Petra hingegen sehe ich so gut wie jeden Tag. Sie ist eine flache, platte Erscheinung, alles an ihr scheint an jeder Stelle ebenmäßig gleich zu sein und seltsam in die Länge gezogen, ganz schwer zu beschreiben ist das. Dabei ist sie nicht sonderlich groß, sie misst sicher nicht mehr als 1 Meter 65. Ich könnte aus den genannten Gründen auch überhaupt nicht abschätzen, wie viel sie wiegt und ob sie eher als dünn zu gelten hat oder als dick.
Privat weiß ich praktisch nichts von Schwester Petra, auch nicht, ob sie verliebt, verlobt oder verheiratet ist. Ich glaube aber nicht, reines Bauchgefühl. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, nutze ich diese, um unauffällig mit ihr zu flirten, also so, dass sie es am besten gar nicht merkt. Dahinter stehen keine ernst gemeinten Absichten, sondern ausschließlich Trainingszwecke. Wenn einem die Frau nämlich egal ist und man insofern auch nichts zu verlieren hat, geht einem die Flirterei kinderleicht von der Hand, weil die Angst vor einem Korb entfällt. Körbe sind zwar unsichtbar, aber sehr schmerzhaft! Diese Angst führt nämlich zu einer Erstarrung, und man macht dann bei weiteren Gelegenheiten traumwandlerisch alles falsch, was man nur falsch machen kann. Dieses dumpfe Gefühl in der Magengrube, die Kraftlosigkeit der Glieder, die nassen Hände, der umso trockenere Mund – schrecklich alles.
Es ist eben wie bei allem anderen auch: Übung macht den Flirter. Meine derzeitige Situation einmal ganz nüchtern und sachlich in Zahlen ausgedrückt: Ich kenne aktuell weniger als fünf Frauen und habe weniger als zwei Dates im Monat. Lernt man aber weniger als zehn Frauen pro Jahr kennen und spricht man weniger als vier Frauen pro Monat an, fehlt es eindeutig an Übung, und man sollte sich dann dringend um die Erweiterung seines Bekanntenkreises kümmern. Kleines Rechenbeispiel: Jeder Bekannte hat im Schnitt zwanzig bis fünfzig andere Bekannte, die wiederum im Schnitt auch mindestens fünfundzwanzig andere Bekannte haben, die man nicht kennt. Mit anderen Worten: Wenn ich selbst fünfundzwanzig Bekannte habe, dann gibt es in meinem weiteren Umfeld etwa fünfzehntausend Menschen, die ich kennenlernen könnte. Und Frauen sind in der Bevölkerung in der Überzahl, da kommt also ganz schön was zusammen!
Eine Möglichkeit, seine neuen Bekannten besser kennenzulernen, ist, ihnen Hilfe anzubieten. Zum Beispiel beim Umzug oder bei der Vorbereitung auf eine Geburtstagsparty. Wenn man eine gute Kamera hat, kann man dem Gastgeber auch anbieten, Fotos von der Party zu machen. Immer daran denken: Wer attraktiv sein will, muss aktiv werden. Man kann eine Kochgruppe gründen, eine Leichtathletikgruppe, einen Spanischkurs, einen Aktivkreis.
Weiter: Wichtige Fragen, die man im eigenen Interesse ehrlich beantworten sollte.
Wie viele Frauen kenne ich aktuell?
Seit wie vielen Jahren interessiere ich mich für Frauen? (Wenn ich zum Beispiel neununddreißig Jahre alt bin und mich seit meinem siebzehnten Lebensjahr für Frauen interessiere, sind das zweiundzwanzig Jahre.)
Mit wie vielen Frauen pro Quartal komme ich in Kontakt, und wie viele davon lerne ich näher kennen?
Wie viele Frauen spreche ich in einem durchschnittlichen Monat aktiv an?
Von wie vielen davon etwa erhalte ich eine positive Reaktion, von wie vielen eine negative? Wie lautet die Begründung?
Gibt es Frauen, die sich zurzeit für mich interessieren?
Zurück nun aber zu Schwester Petra. Für mich bedeutet es, wie gesagt, einen Glücksfall, dass ich mit einer Frau flirten kann, die mir nichts bedeutet. Eine vergleichbare Situation im Alltag: Auf einer Parkbank sitzt eine Frau, die entweder nicht mein Typ ist oder schon etwas älter/sehr alt. (Frauen, die deutlich älter sind als man selbst, sind oft dankbar für positive Aufmerksamkeit.) Sie scheint betrübt. Nun kritzle ich «Hallo! Kopf hoch!» oder so etwas auf einen Zettel und reiche ihr den mit den Worten «Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht» oder etwas Ähnlichem, Aufmunterndem, vor allem aber Unaufdringlichem. Dann gehe ich weiter, als ob nichts gewesen wäre. Entscheidend ist, dass ich etwas getan habe, ohne etwas dafür zu wollen. Andere Trainingsmethoden: Einfach das Wort Hallo (oder je nach Region Moin, Servus, Grüß Gott) auf einen Zettel schreiben und es der Frau gegenüber (zum Beispiel in einem Café oder in der Bahn) zuschieben. Dann gehen. Oder abends in der Kneipe auf eine Frauengruppe zugehen mit den Worten: «Hallo» – alle schauen mich verdutzt an – «Keine Angst, ich will euch nicht anbaggern, sondern nur mal ein Kompliment loswerden: Ihr seid die mit Abstand attraktivsten Mädels in dem Schuppen hier. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend.» Direkt nach diesem Satz umdrehen und weggehen. Alle Frauen sind total baff und würden diesen netten, mutigen Typen gerne kennenlernen. Nur schade, dass er einfach wieder gegangen ist!
Wer Frauen auf sich aufmerksam machen will, macht am besten den Polnischen und hinterlässt somit Fragezeichen. In einer nächsten, etwas frecheren Stufe nähert man sich einer fremden Frau, die gerade auf ihrem Handy rumtippt, und sagt: «Hallo. Du brauchst doch keine SMS mehr zu schicken, ich bin doch schon da.» Big LOL. Aber auch dann weitergehen. Und so weiter und so fort.
Schlag sieben Uhr ein Schlüssel, der energisch im Schlüsselloch stochert, und einen Augenblick später schon fliegt die Wohnungstür in hohem Bogen auf. Schwester Petra stürmt mit dem Schlachtruf «GRÜSS, GRÜSS!» mehr die Wohnung, als dass sie sie betritt. Zeit ist eben Geld. Das spiegelt sich auch in dieser bis dato nie vernommenen Grußformel wider. «GRÜSS, GRÜSS!» scheint so viel zu bedeuten wie «LASS MICH DURCH, ICH HABE KEINE ZEIT». Es ist sozusagen der Kern des Grüßens, der absolute Gruß, wenn es so was denn gibt.
Petras Programmpunkt Nummer eins ist die Morgentoilette, während deren sie die Tür zu Mutters Zimmer fest hinter sich verschließt und ich mich diskret in die Küche zurückziehe. Es ist keineswegs so, dass ich mich vor Mutter ekele, aber ich bin doch recht froh, nicht für Belange der Körperpflege eingespannt zu werden. Außerdem kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es ihr recht wäre, wenn ihr eigener Sohn sie der Länge nach abseift, kämmt oder ihr die paar verbliebenen Zähne putzt. Leider weigert sie sich, ein Gebiss zu tragen, mit der gebetsmühlenhaften Begründung: «Gebiss macht alt.» Ich antworte dann zum Scherz immer: «Schlechte Haut macht jung», weil ich selbst als erwachsener Mann gelegentlich noch mit Pickeln und diversen anderen Hautunreinheiten zu kämpfen habe.
Während der Morgentoilette kommt es oft zu erbittert ausgetragenen Wortgefechten zwischen Schwester und Pflegling, die im Wesentlichen nach ein und demselben Schema ablaufen: Mutter piesackt Petra so lange, bis der die Hutschnur platzt. Petra erträgt Mutters Tiraden zunächst mit stoischer Geduld. Was dann aber jedes Mal folgt, ist ein Drama in drei Aufzügen. Akt Numero uno: Mutter beschwert sich, dass sie ihrer Meinung nach viel zu viel essen muss. Es könne ja wohl nicht Sinn des Lebens sein, den ganzen Tag in einem laut brummenden Bett zu liegen und sich den Bauch vollzuschlagen.
Außerdem werden ihr angeblich nachts, während sie schläft, regelmäßig innere Organe entnommen. So zetert sie in einem fort, während die Schwester stumm und ergeben die Tiraden über sich ergehen lässt.
Dann zieht Mutter das nächste Register. Akt Numero zwei: Sie behauptet, die Pflegekraft würde extra brutal mit ihr umspringen. Was nicht stimmt, vielmehr ist Mutter seit ihrem Unfall empfindlich wie ein Neugeborenes. Jede Bewegung und Berührung schmerzt, und sie hat starke Blaufleckenneigung. Mutter ruft mit schriller Stimme, Petra soll nicht so doll machen, dies nicht tun und jenes nicht. Noch weiß sich die Pflegekraft zu beherrschen und ihrer Arbeit sachlich und fachlich nachzugehen. Bis sich Akt Numero drei anbahnt, und der heißt: persönliche Beleidigungen. Sie unterstellt der Schwester beispielsweise, dass sie kein Mensch sei, sondern ein Teufel. Oder gleich der Teufel höchstpersönlich.
«SCHWESTER PETRA, WAS HABEN SIE LETZTE NACHT WIEDER GEMACHT?! ICH GLAUBE, SIE HABEN MIR DIE MILZ ENTNOMMEN. DAS FÜHLT SICH NÄMLICH GANZ KOMISCH AN. WAS MACHEN SIE EIGENTLICH MIT DEN ORGANEN? ICH HOFFE, DASS SIE WENIGSTENS ORDENTLICH GELD DAFÜR BEKOMMEN!»
Absurde Unterstellungen dieser Art sind regelmäßig der Punkt, an dem mit Schwester Petra die Gäule durchgehen und sie zurückbrüllt, welche Unverfrorenheit Mutter besitze, ihr solche Dinge an den Kopp zu schmeißen. Das Gekeife, das nun folgt, steigt bei sich überschlagenden Stimmen bis hinauf in höchste Höhen. Unwahrscheinlich, was aus so einem papierdünnen Persönchen wie Mutter alles herauskommt. Sie kann viel lauter schreien als Petra. Aber verwunderlich ist das nicht, denn Neugeborene und Kleinkinder brüllen ja auch ohrenbetäubend laut. Das hat die Natur so eingerichtet, weil die Stimmbänder die einzigen Waffen von hilflosen Personen sind. Mit ihren dünnen Ärmchen und Beinchen können sie sich ja wohl schlecht gegen Erwachsenenkraft durchsetzen. Ganz am Ende droht Petra regelmäßig damit, den Pflegevertrag zu kündigen, was aber wohl in den Bereich «leere Drohung» fallen dürfte. Zum einen kann nur Herr Engel den Vertrag kündigen, und zum anderen lebt Petra auch und gerade von so schwierigen Zeitgenossen wie Mutter. Man kann sich eben nicht immer alles aussuchen.
Während Mutter weiterzetert, kommt Petra mit hochrotem Kopf in die Küche gestürmt, um Frühstück zu bereiten. Das mittägliche Essen auf Rädern wird gegen 14 Uhr vom Bringdienst Appetito Spezial angeliefert.
Von sich aus redet Schwester Petra eigentlich nur über das Thema Besorgungen. Wenn ich mal wieder etwas vergessen habe, ist regelmäßig High Life in Tüten angesagt, sie nutzt dann die Gelegenheit, um ihre durch Mutters Breitseiten angestaute Wut an mir auszulassen. Ich wiederum knöpfe mir meine alten Stofftiere aus der Kinderzeit vor. Die Tiere habe ich in meinem Zimmer so drapiert, dass sie Spalier stehen und mich mit ihren lieben Gesichtern freundlich und aufmunternd anschauen. Sobald ich den Raum betrete, wird die Parade abgenommen, und eigentlich freue ich mich jedes Mal von neuem auf sie und ihre unkomplizierte Art. Nach einer von Petras Attacken teile ich allerdings selber aus. Es ist wie ein Wutkreislauf, der nie unterbrochen wird. Zum Glück sind es nur Stofftiere, aber leid tun sie einem doch, vor allem das allerälteste Tier, Bautzi, ein hoffnungslos zerrupfter Dackel. Dann gibt es noch einen Elch ohne Namen, eine Giraffe und einen Tiger, ebenfalls beide namenlos. Seltsam, ich hatte nun wahrlich genug Zeit, alle Tiere zu taufen, aber irgendwann war es zu spät, und nun habe ich keine Lust mehr.
Wenn Schwester Petra nach einer Dreiviertelstunde schließlich mit hängenden Schultern und glasigem Blick von dannen zieht, vermag man sich kaum noch vorzustellen, wie sie vorhin heftig schnaubend und «GRÜSS, GRÜSS» schmetternd hereingestürmt gekommen ist wie die Kavallerie. Erstaunlich, wie Mutter es immer wieder schafft, die robuste Pflegekraft in die Knie zu zwingen. Sie könnte, denke ich, auch einen ausgewachsenen Mann spielend erledigen. Ich stelle mir manchmal vor, wie Schwester Petra von Patient zu Patient eilt und jeweils noch und noch einen Kopf kleiner gemacht wird. Am Abend ist sie dann auf Däumlingsgröße geschrumpft und muss in der Nacht wieder auf Normalmaß wachsen.
Wo Mutter, so klein und mickrig sie auch ist, trotz körperlicher und seelischer Defekte diese Energie herzaubert, ist und bleibt ein Riesenrätsel. Sie scheint jederzeit zu Dingen fähig, die ihr niemand zugetraut hätte.
Erst wenn die Schwester gegangen ist, nehme ich eine erste Kleinigkeit zu mir. Aber nur Nahrungsmittel, die Magen und Verdauungssystem nicht über Gebühr belasten. Eine Schüssel Obstsalat spendet schnelle Energie, die auch vom Körper rasch umgewandelt werden kann. Außerdem gehöre ich zu den Menschen, die der Meinung sind, dass Mahlzeiten nicht vom Himmel fallen, sondern erst verdient werden müssen. Nichts geleistet haben, aber sich die Wampe bis obenhin vollstopfen, das ist ja wohl nicht Sinn der Sache! Ich verabschiede mich per Handschlag von Mutter und hänge, bevor ich zur Arbeit gehe, noch den Besteckkasten an den Ventilator, damit sie nicht so alleine ist. Das fröhliche Klappern ist für sie wie Besuch, hat sie mal gesagt.
Das Äffche
Nachdem ich aufgrund des Zusammentreffens verschiedener unglücklicher Umstände meine Ausbildung nicht abschließen konnte, gehe ich seit vielen Jahren einer ungelernten Arbeit nach, die einerseits ein Traumberuf ist, mir andererseits aber auch alles Mögliche und vor allem Unmögliche abverlangt: Ich betreue als einer von insgesamt dreizehn Berufspförtnern eine Tiefgarage mit nahezu 1400 Stellplätzen. Durch Vernetzung mit anderen Tiefgaragen sind es sogar 2100 Stellplätze. Sie zählt somit zu den Top Zehn in ganz Europa. Um sich in dem hochkomplizierten System von Gängen, Buchten, Schächten, Aufzügen, Zu-, Ausgängen und Parkebenen zurechtzufinden, müsste man wohl einen Großteil seiner Zeit opfern. Ich schätze, dass ein einzelner Mensch die Garage in allen Einzelheiten gar nicht kennen kann, noch nicht mal der ausführende Architekt, der unter Garantie längst andere, noch gigantischere Garagenkomplexe am Wickel hat und unsere, in seinen Augen mittlerweile kleine oder mittlere, sicher schon vergessen hat, ganz nach dem Motto: «Aus den Augen, aus dem Sinn.»
Neunzig Prozent meiner Arbeitszeit verbringe ich damit, in meinem Pförtnerkabuff sitzend die insgesamt vierzehn Monitore im Blick zu halten. Direkt vor mir ist eine Batterie mit acht Monitoren, und links von mir befinden sich noch mal sechs. Selbst damit kann ich einen im Grunde genommen nur kleinen Ausschnitt der Gesamtanlage überblicken. Ich muss dauernd auf der Hut sein, denn irgendwas ist immer: Bei Pforten und Schranken ist der Schließmechanismus ausgefallen, der Kassenautomat klemmt, Fremdparker blockieren die Stellplätze der Dauermieter oder hochspezialisierte Diebesbanden entwenden Wertgegenstände aus den geschlossenen Fahrzeugen. Obdachlose, die im Winter nach einer günstigen Übernachtungsmöglichkeit suchen, sind auch ein Problem. Und so weiter und so fort. Darüber ließe sich ein ganzer Roman schreiben, hätte ich die Zeit dazu!
Wenn ich in meiner Konzentration nur einen Moment nachlasse, laufe ich Gefahr, einen Anschiss von meinem Chef, Herrn Schmidt, zu bekommen. Im Pförtnerkabuff ist nämlich eine kleine Kamera installiert, die wiederum mich beobachtet. Der Psychoterror besteht darin, dass man nie genau weiß, wann der Chef zuschaut und wann nicht! Also tut man besser daran, sich nicht bei irgendwelchen dummen Faxen erwischen zu lassen. Der eigentliche Clou: Ich kenne meinen Chef gar nicht, jedenfalls nicht persönlich, sondern nur seine Stimme. Das Einstellungsgespräch hat seinerzeit der Personalleiter geführt, ein gemütlicher Endvierziger namens Hummel. Schon seltsam, wie manche Menschen ihrem Namen bis aufs Haar gleichen! Mein Chef heißt ja, wie gesagt, Schmidt, was den anonymen Eindruck noch verstärkt. Ein Allerweltsname, hinter dem sich alles und nichts verbergen könnte.
Auch wir Pförtner untereinander kennen uns praktisch nicht. Beim Schichtwechsel ein paar verlegene Worte, lascher Händedruck, fahriger Blick, das Übliche eben. Es gab mal den halbherzigen Versuch, im jugoslawischen Spezialitätenrestaurant Bogdans Taverne einen Pförtnerstammtisch einzurichten, aber das erwies sich als ausgesprochener Schuss in den Ofen. Kamen anfänglich noch ein gutes Dutzend Pförtner, wurden es rasch weniger, und in den letzten Wochen saß Herr Sowieso, genannt Qualle, seinen richtigen Vornamen kenne ich nicht, mehr oder minder alleine dort. Bogdan hat sich wohl ab und an dazugesetzt, aber das erwies sich als zähe Angelegenheit, da der serbische Wirt zwar nett sein soll, aber praktisch kein Deutsch spricht und versteht, außer natürlich die Karte.
Weibliche Pförtner, also Pförtnerinnen, gibt es keine, was natürlich sehr schade ist, denn wie man herausgefunden hat, nehmen zwei Drittel aller Liebesbeziehungen auf der Arbeit ihren Anfang. Man wird selten eine Frau so intensiv beobachten und gut kennenlernen wie im Job. Wenn man nicht gerade auf einer Ölbohrinsel arbeitet, begegnet man auf der Arbeit jeden Tag zig Frauen. Und viele von ihnen sieht man immer wieder. So gesehen ähnelt die Tiefgarage leider einer Bohrinsel.
Nach zwei Stunden lege ich meine erste Pause ein. Bis dahin – ich bin zu dem Zeitpunkt immerhin gut fünf Stunden auf den Beinen – war schon die eine oder andere Heißhungerattacke zu überstehen. Dafür schmeckt es jetzt doppelt so gut. Nur wer vorher etwas einsetzt, kann sich später eine Belohnung abholen, nicht von ungefähr lautet mein Motto: «Qualität kommt von Qual.» Klingt einfach, ist aber kompliziert. Oder woran liegt es sonst, dass sich so wenig Menschen daran halten? Jedenfalls nicht auf Dauer. Ein kleines Strohfeuer, welches aber bald schon abgebrannt ist, und das war’s dann, bis zum nächsten missglückten Versuch.
Ich habe mittlerweile richtigen Kaffeedurst, aber den spare ich mir für die nächste Pause auf. Die Kaffeemaschine ist ein schon etwas älteres Baujahr der Marke Wessel oder Wesste oder Wessme (der Schriftzug ist abgeschrappt und gleichzeitig verblichen), sie verrichtet jedoch treu und brav ihre Dienste. Wenn nach den ersten Schlucken das Koffein in die Blutbahn einschießt, durchläuft meinen Körper vom Scheitel bis zur Sohle ein wohliger Schauer. Jetzt bin ich Mensch, jetzt darf ich sein! Mutter hat früher auch immer gesagt, dass sie erst nach einer Tasse anständigen Bohnenkaffees ganz da ist und dass sich ein Leben ohne Kaffee nicht zu leben lohnt. Und jetzt der ewige Tee. Ich habe sie nie gefragt, warum sie keinen Kaffee mehr trinkt. Aber auch dafür gibt es sicher eine Erklärung, wie es bekanntlich für alles eine Erklärung gibt.
Mein Lohn ist zwar nicht gerade üppig, aber am Monatsende habe ich doch immer eine recht schöne Stange Geld gespart. Die Ausgabenseite ist überschaubar, da alle laufenden Kosten wie Miete, Essen, Kost und Logis durch Mutters Rente abgedeckt sind: brutto für netto, sozusagen.
Der Schub des Koffeins klingt nach einer halben Stunde ab, und die restliche Zeit bis zum Feierabend gestaltet sich in der Folge meistens etwas zäh. Mehr als diese Portion Kaffee darf ich mir aber nicht gönnen, weil sie sonst zum einen nicht mehr die erwünschte Wirkung hätte, und zum anderen das Nervenkostüm Schaden nähme. Ich könnte mir natürlich auch eine Tasse bleifrei (Scherzausdruck für ohne Koffein) genehmigen, aber für mich ist das ein ausgesprochenes Quatschgetränk, wie Wodka Zero. Also weiter geduldig auf das Verstreichen der Zeit warten. Oberste Regel: Nicht dauernd auf die Uhr gucken! Telefon und Internet funktionieren hier unten nur sehr eingeschränkt, was einerseits gut ist, andererseits die Zahl möglicher Zerstreuungen weiter reduziert. Ab und an in einem Buch blättern ist erlaubt, wenn es nicht gleich zu einer Lesestunde ausartet. Selbst Herr Schmidt hat ein Einsehen, dass kein Mensch, auch nicht der Robusteste, stundenlang in höchster Konzentration auf Monitore starren kann. Die Augen würde man sich ruinieren damit. Außerdem sind meine Sinne mittlerweile so geschärft, dass ich die leiseste Bewegung schon aus den Augenwinkeln registriere.
Manchmal stelle ich mir vor, ich wäre Herrscher über dieses riesige Areal, und alles würde eben nicht wie von Geisterhand geschehen, sondern nach meiner Pfeife tanzen. Oder ich würde einer schönen Frau begegnen, die sich in mein Kabuff verirrt, weil sie ihre Stellplatznummer vergessen hat und schon stundenlang durch die Gänge geirrt ist, halb verdurstet und drei Viertel wahnsinnig, und ich bin dann so etwas wie ihre letzte Rettung. Ruhig und sachlich nehme ich die Angelegenheit in die Hand, und gemeinsam suchen wir über die Monitore nach dem verloren geglaubten PKW. Ich biete der Dame wahlweise heiße oder kalte Getränke an, fordere sie fürsorglich auf, eine Kleinigkeit zu essen, sich aufzuwärmen usw. Langsam trete ich aufs Gas und lenke das bis dahin rein praktische Gespräch unmerklich auf die Flirtebene. Damit dies gelingt, sollte man einer Frau zunächst signalisieren, dass man ungefährlich und somit harmlos ist. Wenn Frauen nämlich irgendetwas fürchten, dann, dass sich ihr Gegenüber als tickende Zeitbombe entpuppt, die bei nächster Gelegenheit zum aufdringlichen Grapscher, Tatscher und Fummelkönig wird!
Damit der Flirt nicht im Frust endet, sollte man aufmerksam die Körpersprache der Frau registrieren. Denn Körpersprache (wozu auch die Gesichtsmimik zählt) hat gegenüber der gesprochenen Sprache einen Vorsprung von Hunderten Millionen Jahren (Evolution). Der Mensch ist zunächst einmal ein nonverbales Wesen, wobei das Gesicht viel wichtiger ist als der Körper (Face-Body-Advantage). Es macht zwar nur fünf Prozent unserer gesamten Körperoberfläche aus, ist aber in Sachen nonverbale Ausstrahlung Klassenprimus. Während Worte ausdrücken, was wir denken, zeigen Gesicht und Körper an, was wir fühlen. Häufig stimmen Worte und Körpersprache nicht überein, dann spricht man von Inkongruenzen. Gerade Frauen senden oft widersprüchliche Signale, gesprochene Sprache und Körpersprache laufen auseinander. Sie sagen auch häufig Dinge, die sie nicht meinen. Das hängt unter anderem mit ihrer ständig schwankenden Stimmungskurve zusammen, denn das ganze System Frau funktioniert nach dem Prinzip Hü/Hott.
Wenn eine Frau beispielsweise erzählt, dass sie gerne mal mit einem ins Kino möchte, dazu aber leicht den Kopf schüttelt, verneint ihr Körper unbewusst das, was sie sagt. Will man also Täuschungsmanöver der Frau durchschauen, muss man ständig auf diese Nichtübereinstimmungen achten. Auch sollte man im Blick haben, welche Distanz die Frau zu einem wählt. Man unterscheidet zwischen öffentlicher Distanz, die 3,60 m beträgt, sozialer Distanz (1,22 m bis 3,60 m), persönlicher Distanz (0,46 m bis 1,22 m), intimer Distanz (15 bis 45 cm) und sehr intimer Distanz (15 cm und weniger). Angenommen, die Frau (in diesem Fall diejenige, die ihr Auto sucht) wählt in meinem sowieso nur etwa sechs Quadratmeter großen Kabuff die persönliche Distanz, dann ist das zunächst einmal ein gutes Zeichen.
Ein weiterer Indikator für Interesse: Sie zieht Augenbrauen und obere Augenlider hoch, öffnet dabei leicht den Mund und schürzt die Lippen. Auch der Anstieg der Blinzelrate ist ein gutes Zeichen. Wenn eine Frau flirtet, blinzelt sie meist drei- bis fünfmal schnell hintereinander. Schlägt sie ihre Beine über und wippt ihr Fuß dabei in Richtung des jeweiligen Mannes, verrät ihr Körper unbewusst, wo sie hinwill. Ebenfalls ein günstiges Zeichen ist, wenn sie den Mann von unten durch ihre Wimpern ansieht. Wenn sie ihre Achselhöhlen präsentiert, möchte sie den Mann an ihren hochwirksamen Pheromonen, also den weiblichen Lockstoffen, teilhaben lassen. Und wenn sie sog. Putzverhalten zeigt oder längliche Gegenstände streichelt, ist das für den Eingeweihten ebenfalls sehr aussagekräftig. Dann spielt sie mit dem Mann und möchte ihm gefallen. Noch besser: Sie sieht ihm immer wieder abwechselnd in die Augen und auf den Mund, denn das bedeutet, dass sie ihn gerne küssen möchte. (Anderes Zeichen: Sie haucht die Worte mit immer schwächer werdender Stimme, sodass der Mann immer näher rücken muss, um sie zu verstehen, bis es quasi automatisch zu einem Kuss kommt.)
Negativ hingegen: Sie schaut permanent auf ihr Handy. Das drückt ungewollt Desinteresse und Langeweile aus. Andere Warnzeichen: asymmetrisches Lächeln. Ein nur höfliches, sog, schiefes Lächeln ist ungleichmäßiger als der Ausdruck wahrer Freude. Auch falsches Timing ist ein zuverlässiger Indikator: Gespielte Mienen setzen meist etwas zu plötzlich ein und werden zu lange gezeigt. Wenn die Frau außerdem einen Mundwinkel einpresst, gleichzeitig den Blickkontakt unterbricht und fast vom Stuhl zu rutschten droht, sollte man sich besser anderweitig umschauen. Ebenfalls wichtig: Mikroexpressionen. Diese winzigen Bewegungen huschen für ganz kurze Zeiträume von vierzig bis fünfhundert Millisekunden übers Gesicht, sie bleiben dem untrainierten Auge deshalb meist verborgen. Na ja, und so weiter.
Zurück zur Frau, die sich in mein Kabuff verirrt hat. Ich stelle mir vor, dass irgendwann auch der Wagen wieder auftaucht. Ich begleite sie dann noch zum Fahrzeug, Service muss sein, und zum Abschied gibt sie mir ihre Telefonnummer, verbunden mit der Bitte, sie doch bei nächster Gelegenheit anzurufen. Ich verabschiede mich ausgesucht höflich, aber mit Pokerface und lasse mir nicht das Geringste anmerken. Doch innerlich zerspringe ich vor Freude!
So in etwa würde die Geschichte schließlich ihren Lauf nehmen. Träumen erlaubt.
Um 17 Uhr ist es endlich geschafft, und Ablösung naht in Gestalt von Herrn Schleicher. Schon wieder so ein Name, der Programm ist, denn Herr Schleicher bewegt sich nicht nur zeitlupenhaft, er ist auch irgendwie ganz krumm und verbogen, in sich. Man möchte ihm auf die Schulter oder den Rücken klopfen oder hauen und ihn richtig anherrschen: «MENSCH, MACH DICH DOCH MAL GERADE!», oder so etwas. Menschen mit schlechter Körperhaltung haben von vornherein verloren. Ich frage mich, weshalb manche Zeitgenossen bei jeder sich bietenden Gelegenheit sofort in sich zusammensacken. Wie das schon aussieht! Herr Schleicher macht mich mit seiner ganzen Art fuchsteufelswild, obwohl ich wirklich nicht der Rumpelstilzchentyp bin. Wenn er mich mit seinem piepsigen Lispelstimmchen nach besonderen Vorkommnissen der vergangenen Stunden fragt, bin ich regelmäßig kurz davor, aus der Haut zu fahren. Mit letzter Kraft beherrsche ich mich, greife nach meiner Jacke und wünsche dem krummen Häuflein Elend einen erfolgreichen Dienst. Gleichzeitig tut er mir leid. Was es doch für arme Willis gibt auf Gottes weitem Erdenrund.