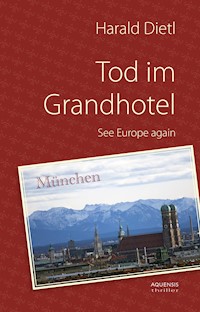Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: NIBE Media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Jay-Jay Clark hat durch eine Gesetzeslücke den australischen Staat um Millionen betrogen. Um dieses Geld zu "waschen" errichtet JJC 1967 in Perth eine Chinatown für Flüchtlinge aus Hong Kong. Deren Aktien sollen acht Jahre in einem Safe der
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harald Dietl
Flucht nach Samoa
Roman
Impressum
© NIBE Media © Harald Dietl
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags und des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Created by NIBE Media
Coverbild: Andrea Thurner
Covergestaltung: TomJay - bookcover4everyone / www.tomjay.de
NIBE Media
Broicher Straße 130
52146 Würselen
Telefon: +49 (0) 2405 4064447
E-Mail: [email protected]
www.nibe-media.de
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden.
Der Roman enthält darüber hinaus zahlreiche Bezüge zu historischen Ereignissen und Gegebenheiten.
Die Volksrepublik China hat eine neue Schreibweise eingeführt, die beispielsweise aus Chinas Hauptstadt „Beijing“ werden ließ.
Übernähme man das neue System, würde ein im letzten Jahrhundert in Peking und Hong Kong spielender Roman zweifellos an Wirkung und Atmosphäre verlieren; des gleichen chinesische Namen.
Der Autor hat deshalb die Schreibweise gewählt, wie sie zur Zeit der Handlung gebräuchlich war. Zumal die Regeln für die neue Schreibweise erst 1979 in Kraft traten.
HD
Hinter jedem großen Vermögen steht ein Verbrechen.
Honoré de Balzac
Einer, der durch Diebstahl reich wird, gilt als Gentleman.
Altes englisches Sprichwort
Kein Betrug der möglich ist, ist verboten.
Schuld hat immer der Betrogene.
Altes chinesisches Sprichwort
Es gibt kein Geschäft, das unmöglich wäre.
Selbst mit abgebrannten Streichhölzern.
Chinesische Weisheit
Inhaltsverzeichnis:
Erstes Kapitel
Jay-Jay Clark
Perth
Macao
Perth
Hong Kong
Perth
Hong Kong
Perth
Hong Kong
Hamburg
Perth
Canberra
Perth
Macao
Zweites Kapitel
Der rote Drache
Perth
Sydney
Perth
Hong Kong
Cayman Islands
Sydney
Perth
Hong Kong
Sydney
Hong Kong
Sydney
Hong Kong
Perth
Drittes Kapitel
Entdeckung
Peking
Hong Kong
Peking
Hong Kong
Bankpräsident Qi Wei
Peking
Perth
Hong Kong
Perth
Macao
Peking
Perth
Peking
Perth
Peking
Hong Kong
Perth
Kanton
Perth
Cayman Islands
Klippen
Viertes Kapitel
Die Fahndung
Hong Kong
Perth
In der Luft
Perth
Hong Kong
Perth
Hamburg
Brisbane
Cayman Islands
Der letzte Flug
Perth
Hamburg
Seeteufel
Spekulationen
Peking
Esmeralda
Perth
Kurs Samoa
Anmerkungen
Erstes Kapitel
Jay-Jay Clark
Sydney 1960
Zwar hatte Mary McMullun ihren Ruf als temperamentvoller Nimmersatt bestätigt, doch als sie zum dritten Mal hauchte „Ich kann nicht mehr“ fielen ihre Arme schlaff von ihrem Partner und sie lag ermattet auf beider Liegestatt. John Jeremy Cox glitt zur Seite. Zu beiderseitiger Stärkung goss er ein Glas Champagner ein, nahm einen ordentlichen Schluck, dann reichte er Mary das Glas, doch sie nippte nur daran. Während sich Mary beseelt in ihre Decke räkelte, wachte John Jeremy als sich die BBC-Fernsehnachrichten automatisch einschalteten, aus seinem Halbschlaf auf.
Zunächst empfand er die Sendung als ‚jetzt störend’, doch bald verfolgte er die Nachrichten mit steigendem Interesse. Eine Reporterin berichtete von einem Prozess, der gerade in Hong Kong stattfand:
Als der seit langem begehrteste Stempel wurde in der Kronkolonie das Visum westlicher Staaten gehandelt. Vor einiger Zeit war ein Stoß entsprechender Anträge im Passamt gestohlen worden; auf dem night-market gab es Kopien davon zu kaufen. Doch die Visa-Stempel waren derart stümperhaft geraten, dass die Fälschung jedem Verkehrspolizisten auffiel. Jetzt standen jene vor Gericht, die die Nachahmungen für einige Dollar verhökert hatten.
„Es sind dies, wie üblich, die Ärmsten der Armen“ kommentierte die Journalistin, „denn die echten Passanträge werden ohnehin nur den Reichen gegen Bares ausgehändigt.“
Für diesen letzten Satz hätte John Jeremy Cox die adrette Gerichtsreporterin knutschen können, denn sie hatte ihn auf eine wunderbare Idee gebracht. Außerdem kam diese Meldung zur rechten Zeit, denn John Jeremy Cox brannte es unter den Nägeln.
Er war ein smarter, sport-gestählter, athletischer Typ Mitte dreißig, der sich durch Humor, gelegentliche Geistesblitze und durch auffallend gutes Benehmen auszeichnete. JJC, – so paraphierte er gelegentlich ‚nicht ganz wichtige Papiere’, – war in dem Maße unsolide, wie sein bisheriger Lebenslauf dies gestattete: Da gab es ein paar Chorsängerinnen und Hupfdohlen aus der örtlichen Laienspielschar, eine Modeschöpferin, sowie drei eigentlich tugendhafte, weil eigentlich verheiratete Damen der besseren Gesellschaft. Doch diejenigen Frauen, die er begehrte, blieben unerreichbar, die anderen waren durchweg enttäuschend.
Versuchsweise verlobte er sich mit Mary McMullun, einer ebenso hübschen wie wohlhabenden Tochter mit betörendem Busen. Doch letztlich hatte sich Marys ungebildete Fadheit als unüberwindbar erwiesen: Mit Grauen dachte JJC an die Eintönigkeit der kommenden Ehe-Abende, die Geistlosigkeit der Unterhaltungen, und er malte sich die Völlerei der sonntäglichen ‚Zwangs’-Mittagessen am Tische der spießigen Schwiegereltern aus.
Nach dieser Nachricht schlich er sich quasi auf Zehenspitzen von dannen und lag richtig in der Einschätzung, dass nach einem Monat übler Nachrede alles überstanden wäre und ein neues Leben vor ihm läge.
John Jeremy Cox war es, eine Gesetzeslücke ausnützend, gelungen, den australischen Staat beim Auto-Import um horrende Zollgebühren zu betrügen. Dieser Coup konnte ebenso dreist wie genial genannt werden, denn behördlicherseits blieb die Tat jahrelang unentdeckt. Da jedoch die Konkurrenz misstrauisch geworden war, schien es geraten, aus Sydney zu verschwinden, ehe Hand- und Fußfesseln dies verhinderten. Außerdem harrte auf einer Bank in Macao eine beträchtliche Summe einer einträglicheren Verwendung.
Da der Premierminister von West-Australien nicht nur Arbeitskräfte, sondern vor allem Investoren suchte, bot sich hiermit eine hervorragende Gelegenheit, seine Millionen durch Investitionen ‚zu waschen’ resümierte John Jeremy Cox nach dem Fernsehbericht. Weshalb er beschloss, nach Perth zu fliegen, um sich unauffällig umzuhören.
Dazu nutzte er das gültige Recht, dass australische Staatsbürger ihren Namen mehrmals ändern dürfen und jedes Mal einen neuen Pass beantragen können. Da seine Hemden, Taschentücher und ähnliche Ausstattungen sein Kürzel JJC trugen, suchte er aus Sparsamkeitsgründen einen entsprechenden Namen und kann nach kurzer Überlegung auf Jay-Jay Clark: Dieser Name schien ihm knapp und eindrucksvoll – ‚typisch für ihn’ zu sein. Es war dies übrigens bereits seine zweite Namensänderung. – Während des Fluges vertiefte sich JJC in den Wirtschafts- und Immobilienteil der News of Perth.
* * *
Perth
Die Hauptstadt des australischen Bundesstaates West-Australia ist wohl die einsamste, dabei aber die graziöseste und anmutigste aller australischen Städte. Bis Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts galt sie auch als 'tiefste Provinz'. Die offizielle Bezeichnung WA für West-Australia verballhornte man längst für „Wait a While“, aber vielleicht machte gerade das den Charme dieser Stadt und seiner Bewohner aus, denn Stress und Hektik waren hier unbekannt – allein schon, weil es dazu viel zu heiß war.
Jay-Jay Clark legte Wert auf sein Äußeres: Er kleidete sich mit jener nachlässigen Schlichtheit, die den echten Gentleman auszeichnete. Zwar war ihm zu sehr aufzufallen zuwider, doch nicht beachtet zu werden ein Grund zur Beunruhigung. Denn er fühlte sich seinen Mitmenschen in mehr als einer Hinsicht überlegen: Er war überzeugt cleverer, intelligenter, gebildeter und weniger oberflächlich als das Gros zu sein. Mit dieser Einstellung waren die Jahre verflogen und mit ihm seine Jugend.
Die Hauptpost von Perth war ein uralter, übergroßer, stucküberladener Koloss mit schweren, eisenbeschlagenen Holztüren, mehr eine Kathedrale des Postwesens die den Eintretenden sofort in Demut versetzte damit er sich als Bittsteller fühlte. Beherrscht wurde die Halle von einem ob seines Volumens bedrohlichen Kronleuchter, aus dessen Kerzenfassungen immerhin schon elektrisches Licht kam. Verschiedene Uhren zeigten die Ortszeiten von London, New York, Shanghai und Tokio an. Die Schalter waren aus dunklem Holz und mit Glasscheiben gegen das Publikum abgedeckt. In deren Mitte gab es ein kleines rundes Fenster in Messingrahmen, durch die sich die gegenseitige Atemluft austauschte. Erfüllt war die Halle vom Geruch nach Schweiß und faulem Atem, sowie dem nervösen Stakkato, mit dem zwei Postbedienstete mit ihren Hämmern mit rundem Kopf die Briefmarken abstempelten.
JJC ging zu einem der Steh-Schreibpulte, wählte unter drei verschiedenen Federhaltern, tauchte einen schließlich in schwarze Tinte und füllte einen Antrag aus: Zwar hatte er noch keine Ahnung wo er sich niederlassen würde, aber als Gentleman brauchte man eine Adresse, und dafür genügte zunächst eine Post Box.
Jay-Jay Clark mietete sich im <Hotel Central> ein, was den Hotelmanager umgehend bewog, eine happy hour anzusetzen und JJC mit anderen Gästen und Einheimischen bekannt zu machen. Nach dem Abendessen setzte sich Jay-Jay Clark in die Bar, zündete sich eine Zigarre an, orderte einen französischen Cognac sowie die britische ‚Times’. Nur selten ließ er sich zur Teilnahme an einem Würfel- oder Dominospiel überreden, denn bei beiden langweilte er sich unsagbar.
Tagsüber erkundete JJC die Stadt. Um sich zunächst einen generellen Überblick zu verschaffen, fuhr er zum Kings Park hinauf, der hoch über der Stadt gelegenen Grünanlage mit gewaltigen Eukalyptusbäumen und einem riesigen, mehrere Jahrhunderte alten Morton-Bay-Feigenbaum. JJC ließ sich auf der gepflegten Rasenböschung nieder und genoss den wunderschönen Blick: Durch die zu Füßen liegende Stadt schlängelte sich der in der Sonne blau-grün gleißende Swan River; weiße Wolken hingen am tiefblauen Himmel als seien sie hingemalt; im leichtem Wind roch es nach Gras; an einzelnen Holztischen picknickten Familien oder beugten sich schweigende Zuschauer über ihre Schachpartie. Im Dunst des Nordens bezeichnete ein einzelner Förderturm das Industriegebiet, im Süden der Stadt lag eine große Fläche brach.
Anschließend bummelte Jay-Jay Clark durch die City: Zwischen den Türmen moderner Hochhäuser behaupteten sich hie und da kleine, zweigeschossige Häuser aus dem achtzehnten Jahrhundert mit verspielten Stuckfassaden. In den zahlreichen Parks dominierten blassrosa Hibiskus und purpurfarbene Bougainvilleen in denen Papageien krächzten. Die Stadt selbst empfand JJC sofort als reizvoll, erholsam und liebenswert; betriebsam, doch nicht nervös, verkehrsreich, aber keineswegs hektisch; kommerziell und dennoch nicht herzlos: So recht zur Akklimatisierung für sein neues Leben geeignet.
Der morgendlichen Temperatur von 28 Grad Celsius, die mittags auf gnadenlose 42 Grad anstieg, um abends wieder auf angenehme 30 Grad abzukühlen, passte die Bevölkerung ihre Kleidung an: Männer mit Aktenkoffern trugen helle Strümpfe, die fast bis zu den Knien reichten, dazu Hosen, die ebenfalls erst kurz vor den Knien endeten; dies galt als British colonial correct. Als smart casual galten Herren in weißen Hemden mit Krawatte, Damen in eleganten Sommerkleidern. Jay-Jay Clark beobachtete, wie Juristen in wehenden Talaren über ihren kurzen Hosen mit nachlässig über den Kopf gestülpten, weiß-grauen Allongeperücken und mit Akten unter dem linken Arm an der Seite ebenfalls kurz behoster Zivilisten dem großen, in seinem viktorianischen Stil Verdammnis verheißenden Gerichtsgebäude zustrebten. Jay-Jay sah ihnen nach und musste schmunzeln: Merry old England ließ grüßen.
Generell hielten Australier von den Vorteilen harter und systematischer Arbeit weit weniger als Angelsachsen anderswo, und dass Perth die sonnenreichste Stadt des Kontinents war, förderte nicht gerade die Arbeitslust seiner Bewohner: Die Geschäfte schlossen um 16.30 Uhr; behördliche Schreibtische wurden Freitag-Vormittag nur bei Regenwetter besetzt. Wer als Unternehmer oder Selbständiger in einem Jahr zu viel verdient hatte, machte drei oder vier Monate Pause, damit die Rechnungen und Unkostenaufstellungen zeitlich verteilt werden konnten und das Finanzamt weniger zu kassieren bekam.
Wach und gesellig wurden die Bewohner von Perth am Wochenende, wenn sie vom Gelächter der Kookaburra-Vögel und dem Krach der Rasenmäher in ihrem Schlummer gestört wurden. Speziell die Perther sind leidenschaftliche Heimwerker: Sie verbringen jede freie Minute, um ihren Rasen auf englische Kürze zu trimmen, Unkraut in riesigen Öfen zu verbrennen und dadurch die Luft zu verpesten. Oder sie reparieren etwas an ihrem Haus, was nicht nur den Wert der Immobilie erhöht, sondern auch den Mythos von mateship bestätigt: Jener Kumpelgesellschaft von Bankdirektor und Arbeiter, die im Alltag bedeutete, dass man sein Gepäck gefälligst selbst ins Taxi zu tragen hatte, da es niemand wagte, deswegen einen Portier oder Chauffeur beim Lesen seiner Zeitung zu stören.
Drei Tage der Eingewöhnung genügten Jay-Jay Clark, dann galt es eine Firma zu gründen. Er nannte sie <Olga Investment Corporation>. Nicht nur im Andenken an seine verstorbene Mutter, sondern offiziell nach den im Zentrum Australiens liegenden Felsen, die von ihrem deutschen Entdecker aus Sehnsucht nach der württembergischen Prinzessin Olga benannt waren. ‚Olga’ klang patriotisch und Jay-Jay Clark folgte damit dem Trend vieler Australier die verschwiegen von ehemaligen Sträflingen abzustammen.
Beim Registergericht bezifferte JJC sein Firmenstammkapital auf 10 Millionen Dollar, die er dem Finanzamt gegenüber insofern als sauber auswies, indem er eine Gewinnbestätigung der Spielbank von Macao, sowie die offizielle Ausfuhr-Genehmigung des portugiesischen Finanzamtes und der Zollbehörden von Macao vorlegte.
Nachdem Jay-Jay Clark bei der <West-Australian Bank of Commerce> ein Konto eröffnet und einen Scheck über eine Million Dollar über den Schalter geschoben hatte, wurde er umgehend vom Executive Vice President empfangen. Dieser, ein großer, breitschultriger Mann mit rotem Vollbart, war ihm schon bei einer Sportveranstaltung aufgefallen. Obwohl in Australien geboren, pflegte George Bernhard O'Conner seinen ererbten Aberdeener Akzent, um zu demonstrieren, dass er keinesfalls von Sträflingen abstammte; schon gar nicht von englischen. Er sprach leise und mit ruhiger Stimme. Er war ein ziemlich pedantischer Mann.
„Haben Sie eine bestimmte Vorstellung, Mister Clark, wie ich Ihr Geld anlegen soll?“
„Nun, Mister O'Conner, ich denke, dass ich etwa fünftausend Dollar pro Monat benötigen werde. Sollten Sie die Summe von 60.000 Dollar am Jahresende erwirtschaftet haben, käme das einer Verzinsung von sechs Prozent gleich, mit der ich bei dieser für Ihr Haus natürlich unbedeutenden Summe wohl zufrieden sein will.“
Im Laufe des weiteren Gesprächs deutete JJC an, dass er anderswo weit mehr deponiert habe, jedoch bei entsprechenden Objekten und Renditen durchaus gewillt sei, in die west-australische Wirtschaft zu investieren. Damit war der Köder ausgelegt: JJC wusste, der Schotte saß in diversen Gremien, hatte sein Ohr an der Wirtschaft.
Als der Bankdirektor zwei Tage später von den Liquiditätsproblemen einer Firma erzählte, der eines der modernen Bürohäuser in der Innenstadt gehörte, griff Jay-Jay Clark zu. Da die Kommanditisten untereinander zerstritten waren, setzte er bei denen an, die unbedingt und vor allem schnell Geld sehen wollten: Er bot genau ein Viertel des effektiven Wertes und lockte mit umgehender Zahlung. Da er im Laufe der Verhandlungen herausgefunden hatte, dass es eigentlich allen Kommanditisten unter den Nägeln brannte, stellte er Termin „bis Montagvormittag“.
Bei der notariellen Verbriefung legte JJC ein Bonitätsschreiben der <Banco Português do Pacifico> sowie einen entsprechenden Scheck vor. Um einen Teil des Geldes zu waschen, belieh JJC das Haus umgehend mit zwei Dritteln seines Wertes und transferierte das nun saubere Geld wieder nach Macao. Anschließend ließ er ein blitzendes Messingschild anbringen, das dieses Haus als <Jay-Jay Clark-Building> auswies.
Die ersten Einladungen erfolgten via Bank zu gelegentlichen business lunches, denen solche zu Golf- und Tennisturnieren folgten; was gleichbedeutend mit einer offerierten Mitgliedschaft war, denn ein Mann, der eine Million auf seinem Konto hatte, brauchte natürlich nirgendwo einen Bürgen noch sonst eine Empfehlung. Dass er sich auf Bällen als eleganter, nimmermüder, jede Dame beglückender Tänzer erwies, brachte JJC weibliche Sympathie, aber auch gelegentlich männlichen Neid, wenn nicht sogar Eifersucht ein.
Südlich von Perth lag ein großes, ungenutztes Gebiet. Hier war im Laufe der Zeit ein Slum entstanden, der seinesgleichen auf dem Kontinent suchte: Eine wilde Aneinanderreihung erbärmlicher Bruchbuden, zusammengeflickt aus gestohlenem Holz, Pappe, Plastik und aufgeschnittenem Blechkanistern, meistens im Zustand der Verrottung. Die wenigsten Bewohner verfügten über das, was man ein Bettgestell nennen konnte; mitunter schliefen in so einem Kabuff ein halbes Dutzend Personen auf dem nackten Boden und steckten sich gegenseitig an. Rostige Nägel in der Wand und daran aufgehängte Tüten hatten die Funktion von Schränken. Die Slum-Bewohner stahlen notwendigerweise bei jeder sich bietenden Gelegenheit und schlugen sich um rares Brennmaterial für ihre primitiven Kochstellen. Elektrisches Licht brauchten sie nicht, da die Sonne sie täglich für ihr tristes Dasein weckte und sie abends, wenn sie genug billigen Fusel intus hatten, nicht mehr behelligte. Sie benutzten willkürlich ausgehobene Gruben; und die wenigsten konnten sich einmal pro Woche für fünf Pence einen Eimer Trinkwasser leisten, das Tankwagen herbeischafften. Wenn die Regenzeit alles unter Wasser setzte, unterblieben die Wasserlieferungen. Dann mussten die Bewohner bis zu den Knöcheln in Schlamm, Dreck und Abfall wie durch eine stinkende Kloake stapfen. Der Müll türmte sich mitunter kniehoch, Myriaden von Fliegen schwirrten durch die Luft, Moskitoschwärme übertrugen Malaria, nachts kamen die Ratten. Oft herrschten Krankheit, Seuchen, Pestilenz und Tod. Der Slum war ein Labyrinth ohne Straßennamen. In dem Bruchbudengewirr nisteten Gewalt, Vergewaltigung, Schwarzbrennerei, Rauschgift, und wen wundert’s, gelegentliche Selbstjustiz.
Weder Wohlfahrtsorganisationen noch die Staatsmacht ließen sich hier jemals sehen: Für die Perther existierten „die da draußen“ nicht. Wurde, was regelmäßig vorkam, einer dieser bedauernswerten Existenzen in einem Supermarkt beim Mundraub ertappt, gefielen sich sämtliche Lokalpolitiker darin, von der Regierung einen Stacheldrahtzaun zu fordern, um ihre Steuer zahlenden Wähler vor diesem Abschaum zu schützen. Besitzer dieses unkultivierten Bodens war der Bundesstaat West-Australien.
Eines Tages gab Jay-Jay Clark einer Firma den Auftrag, dieses Gebiet zu vermessen.
Sein nächstes Golfturnier bestritt JJC mit einem Manager aus der Ölbranche und einem Staatssekretär aus dem Innenministerium. Als Jay-Jay Clark dem Politiker im Laufe der folgenden Woche seinen Plan unterbreitete, den Slum zu eliminieren, den daneben liegenden Sumpf trocken zu legen und alles zu parzellieren, um dort ein großes Wohngebiet mit Sportplätzen, Einkaufsmärkten, Kinos, Kindergärten und anderen Veranstaltungsmöglichkeiten zu errichten, erntete er zunächst ungläubiges Kopfschütteln. Doch JJC unterbreitete schließlich einer Kommission Pläne, Daten, detaillierte Kalkulationen und andere Berechnungen, denn er hatte mit einem kleinen Stab bereits glänzende Vorarbeit geleistet: Das Ganze hörte und sah sich auf dem Papier phantastisch an.
„In sechs Jahren steht mein Projekt“ versprach Jay-Jay zuversichtlich.
„Und jetzt möchten sie natürlich, dass der Staat Ihr Vorhaben subventioniert?“, die Skepsis des Beamten aus dem Finanzministerium war unüberhörbar.
„Nein, Sir. Ich brauche keine Vor-Kasse des Staates. Nur eine Vor-Leistung.“
„Worin besteht der Unterschied, Mister Clark?“
„In seinem jetzigen Zustand ist das Gebiet wertlos: Ein großer Teil ist Sumpf der trocken gelegt und planiert werden muss. Den trockenen Teil haben die Slumbewohner, krass gesagt, durch das Nichteinschreiten der Staatsgewalt begünstigt, missbraucht und verdorben. Der Boden muss entgiftet werden, ehe man daran denken kann, diese Fläche für eine Parzellierung zu vermessen. Da sich die Behörden an diesen Leuten nicht schadlos halten können, stehe ich auf dem Standpunkt, dass der Staat einen präsentablen Zustand des Bodens herstellen muss. Die Bruchbuden sind an Ort und Stelle zu verbrennen. Sonst ist das neue Gesetz, das Regierungsland für neue Industrialisierungs-, Agrar- und Besiedelungsprojekte zu Sonderkonditionen verheißt, hierauf nicht anwendbar.“
Ein schwaches Nicken einiger Herren bestätigte Jay-Jay Clark, auf dem richtigen Weg zu sein.
„Pioniere“, fuhr er fort, „verfügen über das entsprechende Gerät und wissen, wie man ein Sumpfgebiet trockenlegt. Die Bundesregierung diskutiert in Canberra gerade darüber, das australische Kontingent in Viêt Nam auf viereinhalbtausend Mann zu vergrößern. Ich fände es innenpolitisch wesentlich eindrucksvoller, die Soldaten im eigenen Land einzusetzen, zum Wohle der eigenen Bürger, zur Arbeits- und Wohnraumbeschaffung …“
Jay-Jay Clark warf einen Blick in die Runde: Sämtliche Kommissionsmitglieder hörten ihm aufmerksam zu.
„Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Ich will vom Staat keinen einzigen Dollar, weil ich das ganze Projekt über eine Aktiengesellschaft zu finanzieren gedenke. Aber erst, wenn sich der Grund und Boden in einem bebaubaren Zustand befindet, kann ich Interessenten davon überzeugen, dass hier einmal die <Jay-Jay Clark Housing Area> stehen soll. Das meinte ich mit 'VOR-Leistung', Gentlemen.“
„Wo und wie gedenken Sie so viele Aktionäre für dieses gewaltige Projekt zu finden, Mister Clark?“
„Ich werde keinesfalls 'Volksaktien á eintausend australische Dollar’ ausgeben, da allein deren Verwaltung zu viel Personal erfordert. Außerdem will ich keine Investoren haben, die sich eigentlich nicht einmal ein neues Badezimmer leisten können. Ich offeriere die Aktien nur zu fünfhunderttausend und eine Million US-Dollar nicht einmal an institutionelle Investmentgesellschaften, sondern nur an persönliche Investoren.“
„Da Ihr Projekt rund zweihundertfünfzig Millionen Dollar kosten soll – wie glauben Sie, in Australien so viele Millionäre aufzutreiben, die bereit sind, auch nur eine einzige Aktie zu kaufen? Das ist doch reine Illusion!“
„Da ich selbst beabsichtige mit zehn Millionen in das Projekt einzusteigen, brauche ich nur noch 240, maximal 480 Investoren, und die finde ich mit Leichtigkeit in Hong Kong: Nicht alle gut Situierten sind Tschiang Kai-shek 1949 nach Taiwan gefolgt. Viele sind ins nahe Hong Kong geflohen, und die vor geraumer Zeit in Rot-China wütende 'Lasst tausend Blumen sprechen'–Kampagne trieb neue Flüchtlingsströme in die britische Kronkolonie. Hong Kong fällt im Sommer 1997 wieder an Peking. Na, und was glauben Sie, wie viele Millionäre aus Hong Kong jetzt schon händeringend eine Basis im freien Westen suchen? Und sei es nur für ihre Kinder!“
Geschickt nutzte JJC dabei eine in jenen Tagen die Bevölkerung und die Medien beherrschende Debatte aus: Zukunftsforscher, Wirtschaftsfachleute und Politiker hatten gemeinsam festgestellt, dass Australien nach wie vor britisch geprägt war und ohne die nach dem II. Weltkrieg aufgenommenen europäischen Einwanderer der unterentwickelte, isolierte Erdteil geblieben wäre, der er über einhundertfünfzig Jahre lang gewesen war. Doch der europäische Zustrom versiegte allmählich, das Land brauchte neue Impulse, neue Ideen, tatkräftige, fleißige Menschen und Moneten – von denen es genügend in Asien gab.
„Ich muss gestehen, dass mich die kanadische Regierung auf die Idee brachte: Jedem aus Hong Kong stammenden Chinesen erteilt die Regierung, so er drei Millionen Dollar ‚mitbringt’, die Aufenthaltserlaubnis. Nach drei Jahren im Land kann der Chinese die kanadische Staatsbürgerschaft erwerben. Führend ist die Stadtverwaltung von Vancouver, die durch den Zuzug reicher Chinesen inzwischen zu ‚Hongcouver’ wurde. Perth ist näher an China, und ich will den Chinesen auf dieser großen Fläche ein ‚Little China’ errichten, wo sie alles wie aus dem ‚Reich der Mitte’ vorfinden: Ihre Märkte, Garküchen, Spielsalons, und dabei sollen sie in Häusern wohnen, die so gebaut sind, wie die in ihrer Heimatprovinz, aus der sie einstmals geflohen sind.
Das Wichtigste jedoch, Gentlemen, es wird Kapital aus dem Ausland sein, das in Perth investiert wird. Und zwar auf der Basis von harten US-Dollars! Mil-li-o-nen- von-Dol-lars! Und mit den umfangreichen chinesischen Familien kommen neue Arbeitskräfte ins Land, die ja ebenfalls dringend gesucht werden.“
Die Verhandlungen zogen sich natürlich einige Zeit hin. Aber schließlich erreichte Jay-Jay Clark, dass ihm ein sehr großes Gebiet zum symbolischen Preis von einem Dollar pro Quadratmeile übertragen wurde: Man hielt das Land behördlicherseits nach wie vor für wertlos und war umso froher, dadurch den Plebs los zu werden. – Eine mit dem Hauskauf verbundene, ‚automatische’ australische Staatsbürgerschaft lehnte die Regierung allerdings ab. So weit war man in Perth und Canberra noch nicht.
In den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts war Perth nahezu keimfrei: Die Innenstadt wurde täglich gründlich gekehrt; nach den Fegekolonnen rückten Kontrolleure aus, denen keine Zigarettenkippe, kein Schnipselchen, kein ausgespukter Kaugummi entging. Schattenspendende Bäume bekamen regelmäßig Wasser; man hörte keine falschspielenden Straßenmusikanten, und natürlich wagte niemand – angesichts horrender Strafen – das Stadtbild durch falsches Parken zu verunzieren; tagsüber sah man keine Bettler und nicht einmal nachts patrouillierende Huren. Selbst die kirchlichen Organisationen, die für Obdachlose jeweils ein Dutzend Feldbetten bereit hielten, waren unterbelegt – was freilich mehr daran gelegen haben mag, dass das von den Geistlichen auferlegte Bet- und Gesangspensum den Obdachlosen zu umfangreich erschien.
Wer nun annimmt, dass irgendjemand in dieser rührigen, für alles sorgenden Stadtverwaltung für die Slumbewohner einen Sozialplan erstellt, ein Arbeitsbeschaffungs- und Unterbringungsprogramm oder ähnliches entworfen hätte, dem wäre nur fassungsloses Erstaunen begegnet. Auch die Bürger von Perth verschwendeten keinen einzigen Gedanken an das weitere Schicksal dieses ‚Abschaums’; je weiter weg der zog, umso besser schien es für alle zu sein.
Das Credo der Kommunalen lautete: „Da diese Asozialen keinen Rechtstitel besitzen, müssen sie ohnehin jeden Tag mit ihrer Vertreibung rechnen“, während die Bürgerlichen sagten „ … sollen die sich doch woandershin verziehen, das Land ist doch groß genug …“, und jeder ABC-Schütze hätte hinzugefügt „Australien ist so groß wie die Vereinigten Staaten von Amerika ohne Alaska.“
Das einzige 'Entgegenkommen' bestand aus zwei sich durch den Dreck des Slums kämpfenden Polizeijeeps, deren Lautsprecher lapidar verkündeten, dass anderntags alle Bewohner das Gelände zu verlassen hätten. Eine Nacht gab man den Menschen, um ihre Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Wie Alte, Schwache, Kranke das bewerkstelligten, kümmerte niemand.
Mit Sonnenaufgang erschien eine Hundertschaft Polizei in Arbeitskluft und Gummistiefeln mit langen Knüppeln und stieß die Schläfer unsanft aus ihren Räuschen ins Dasein zurück. Dass die Polizisten Atemschutzmasken trugen, erwies sich als weise Vorsichtsmaßnahme, denn in den Bruchbuden herrschte ein die Schleimhäute reizender Gestank aus Alkohol, Schweiß und Fauligem, dass sogar aus dem Bellen und Hecheln der begleitenden Hunde bald ein Niesen und Husten wurde. Die wenigen nicht Volltrunkenen pochten auf ihr Gewohnheitsrecht, schimpften und unternahmen schwache Versuche der Gegenwehr, doch das immer näher rückende Dröhnen von Planierraupen demonstrierte die Realität.
Es dauerte länger als zwei Monate, ehe der Slum verschwunden war und das Areal durch eine Kommission als seuchenfrei und bebaubar erklärt werden konnte. Während die Landvermesser auf den Plan traten, gingen Pioniere daran, das anschließende Sumpfgebiet trocken zu legen. Dabei förderten sie unversehens zwei Leichen zutage, denen jeder Laie ansah, dass es sich nicht um prähistorische Skelette von Ureinwohnern handelte. Die herbeigerufene Kriminalpolizei stoppte die Arbeiten, bis sie ihre Spurensuche beendet hatte. Dabei schimpften die Kriminalisten nicht nur auf „die dämlichen Pioniere, die die Leichen ausgebaggert hatten, anstatt sie liegen zu lassen“, sondern auch auf ihre uniformierten Kollegen, da diese eventuelle Zeugen vorab vertrieben hatten. Merkwürdig blieb, dass niemals eine Person als vermisst gemeldet wurde.
Von jedem günstigen Punkt aus ließ Jay-Jay Clark das planierte Gelände fotografieren. Aus seit langem gesammelten Prospekten und Werbebroschüren schnitt er drei verschiedene Bungalowtypen heraus, dazu Supermärkte, Tankstellen, Geschäfte, Bars, Handwerksbetriebe, Spiel- und Sportplätze, Tempel, Kirchen mehrerer Konfessionen und anderes mehr.
JJC ließ ein Werbeheft zusammenstellen, das sehr geschickt mit einem Foto nackter Erde und der Überschrift 'Mondlandschaft – oder neue Heimat?' begann und nacheinander verschiedene Bauphasen und Haustypen vorstellte und mit der Frage endete: „Sind Sie ganz sicher, dass Sie nicht hier wohnen wollen?!“ Mit dieser Ideenvorgabe plus entsprechenden Texten und Zahlen besuchte JJC einen Graphiker, der daraus eine übersichtliche, ansprechende Werbebroschüre zusammenstellte. Mit diesem Muster flog Jay-Jay Clark nach Hong Kong und nahm die nächstmögliche Fähre nach Macao.
* * *
Macao
Nachdem er wieder ein Zimmer im <Hotel Bella Vista>, einem welken Kolonialpalast mit phantastischer Aussicht bezogen hatte, ließ sich JJC jetzt zuerst nach Taipa, der nächstgelegenen Insel bringen. Dort löste er im Canidrome eine Eintrittskarte für die nächtlichen Hunderennen, doch ihn interessierten weniger die Whippets, als vielmehr die einzelnen Vorgänge: Zuerst wurden die dürren Tiere des jeweils nächsten Laufs an der Leine vorgeführt. Jay-Jay Clark sah sich jedoch mehr die Profiwetter an: Die achteten genau darauf, welcher Hund sich erleichterte. „Hunde, die sich erleichtern sind aufgeregt und laufen schneller“, meinte ein Wetter zu JJC. Doch jener Hund, der den größten Haufen hinterlassen hatte, wurde Vorletzter, der Sieger kackte anschließend.
Jeder Wetter erhielt zwar über seinen Einsatz einen Beleg, jedoch nicht über den Gewinn. Da der Einsatz außerdem limitiert war, ließ sich Jay-Jay enttäuscht in einer Rikscha zur nahen Trabrennbahn bringen. Einige Male setzte JJC, doch da gleich beim ersten Mal der Favorit gewonnen hatte, fiel die Quote entsprechend gering aus.
JJC ließ sich zum Hafen fahren und betrat das aus Aberdeen stammende ehemalige Restaurantschiff, in dem es inzwischen alte chinesische Glücksspiele gab. Aber auch das war nicht, was Jay-Jay Clark suchte, weshalb er nach kurzer Zeit das Schiff verließ und sich zum <Hotel Lisboa> kutschieren ließ.
Das sah mit Tausenden von Glühbirnen, die den Namen des Casinos aufblitzen ließen, aus wie ein Turban. Eine breite, weiße Freitreppe führte zu einem Hauptportal, vor dem indische Portiers in meergrünen Uniformen mit Samtbesatz standen. Stumm neigten sie ihr Haupt und öffneten Türen, durch die es in eine kreisrunde Halle ging. Die Gemälde an den Fliesenwänden vermittelten den Eindruck einer billigen Imitation der Sixtinischen Kapelle. In den Hotelpassagen, in denen sich Restaurants, Souvenirshops und Massagesalons zur Regeneration ermatteter Spieler befanden, gab es auch Wettannahmestellen, in denen genau alle zehn Minuten per Lautsprecher ein Trabrennen, ein Hunderennen oder aus dem Jai-Alai-Stadion ein baskisches Pelota-Spiel übertragen wurden. Der Kindergarten unmittelbar neben den Casinoräumen ließ darauf schließen, dass man sich der Kinder nur allzu gern entledigte, wenn Kopf und Sinne nur noch auf das Spielen ausgerichtet sind, denn hier beherrschte choi-sun, der ‚Gott des Glücks’ alles und jeden.
JJC beeindruckten die überall angebrachten Taifunsirenen. Doch die Spieler scherten sich keinen Deut um einen Wirbelsturm: Befanden sie doch in einem Haus, in dem selbst bei einem Beben der Stärke 6,4 höchstens ihr Martini geschüttelt wurde.
Jay-Jay Clark betrat die riesige, kreisrunde Spielhölle, die mehrfach unterteilt war. Alle Räume wirkten überladen und kitschig, schwere Tabakschwaden suchten vergeblich eine Abzugsmöglichkeit; ebenso der von den erhitzten Körpern ausgehende Schweißgeruch. Dazu herrschte ein gewaltiger Krach. Die Menge, die hier drängte, schubste und stieß, war nicht annähernd zu schätzen. Nur die grünen Spieltische schlugen Breschen in diese geballte Masse Mensch. In Vierer-, ja Fünferreihen waren die Tische umlagert; Schulter an Schulter drängte man sich nach vorne, um Chips zu setzen: Besessene mit verkniffenen Mienen, zitternd vor Sucht, schweißüberströmt, mit fahrigen Bewegungen und zum Teil glasigen Augen – niemand lächelte. Man war schließlich nicht zum Vergnügen hier. Bakkarat, Würfel, Fan-Tan, Paigow – jedes erdenkliche Glücksspiel wurde hier betrieben. Jay-Jay Clark ergatterte sich einen Platz auf einer Empore und sah dem Geschehen eine Zeit lang zu.
Es wurde gewürfelt, gesetzt, gewettet, und dabei ging es überraschend nüchtern zu: Kein Jetset, keine elegante Abendgarderobe, keine glitzernden Juwelen. Stattdessen Pulverkaffee in Pappbechern, Pullover gegen die Eiseskälte aus der Klimaanlage; fahrige Bewegungen beim bündelweisen Setzen zerknittert-schmutziger Geldscheine, leere Augen, ungesunde Gesichtsfarben. Keiner lachte, feierte oder trank nebenbei Champagner. Denn in der Welt größter Glücksspielhauptstadt galt ‚yi qing’, traditionelles Spielen, als ‚den Geist belebend’. Folglich ging hier mehr Geld über die Tische als irgendwo sonst.
Eine Lady, deren Gesichtshaut aus glasigem Pergament zu bestehen schien, verlor in drei Spielen hintereinander hunderttausend Dollar, zündete sich eine Zigarette an und holte neue Geldbündel aus einem Koffer, der auf einem kleinen Tisch neben ihrem Stuhl lag. Der diesen Schatz nicht aus den Augen lassende uniformierte Casino-Bedienstete hatte ihr diesen Koffer hierhertragen müssen, denn 1 Million Dollar in einhundert-Dollar-Scheinen wogen 48,7 Kilo. Die meisten Spieler waren Kettenraucher mit zittrigen Händen, denen man langen Schlafentzug ansah.
Jay-Jay Clark beobachtete Unentschlossene, die offensichtlich durch Schlepper von der Straße direkt an die Tische bugsiert wurden und, wenn sie ihr Geld verspielt hatten, durch Überredung unter Zuhilfenahme von sanfter Gewalt in den Fahrstuhl geschoben und in den 7. Stock gebracht wurden, wo die Kredithaie saßen, die ihnen, höchstwahrscheinlich zu Wucherzinsen, einen Kredit aufschwatzten. Denn diese Leute kehrten alsbald an den Spieltisch zurück, um – höchstwahrscheinlich – wieder zu verlieren. – JJC hatte davon gehört: Wessen Spielschulden wiederholt nicht eingetrieben werden konnten, den sperrte man in hauseigene Kerker, bis Verwandte ihn auslösten. Gerüchten zufolge soll es auch vorgekommen sein, dass absolut Zahlungsunfähige ‚von Haien entsorgt’ wurden.
Im ersten Stock kontrollierte ‚Mister Macao’ seine harmlos klingende Gesellschaft <Sociedade de Tourismo e Diversoes de Macao>. Mister Fugh gehörte ‚halb Macao’: nicht nur dieses Casino und der lukrative Fährverkehr zwischen den beiden Kolonien, sondern auch die Windhundrennen, die Pferderennbahn mit dem Jockey-Club, die Fußball-Lotterie, der Golfplatz, sowie die besten Restaurants und Bordelle der Stadt. Freiwillig zahlte Mister Fugh so viel Steuern, dass davon drei Viertel des macensischen Haushalts bestritten werden konnten.
Jay-Jay Clark wanderte weiter durch das Haus: Als gut gekleidetes ‚Rundauge’ war es für ihn kein Problem, in die zahlungskräftigen VIPs vorbehaltenen Räume mit so wohlklingenden Namen wie ‚Goldener Drache’ oder ‚Royal’ zu gelangen. In diesen Salons machte das Casino die Hälfte seines Umsatzes.
Jay-Jay setzte sich etwas abseits in einen Sessel und überlegte angestrengt, wie er seinen Plan verwirklichen könnte. Dabei fielen ihm langbeinige Chinesinnen auf, die sich an die Fersen von Gewinnern hefteten und ihnen in den verwinkelten Gängen des ‚Lisboa’, während sie Leidenschaft vorspiegelten, den Gewinn durch geschickten Zugriff wieder abnahmen. Betuchten älteren Stammkunden wurde offensichtlich eine Spezialbehandlung zuteil: Zeigten sie Ermüdungserscheinungen, nahmen sich ihrer ‚PR-Damen’ an, die mit den Klienten im Fahrstuhl verschwanden und zu ‚Privat Rooms’ führten.
Schließlich ging JJC noch in die im gleichen Haus laufende 'Crazy Paris Show'. Hatte er an den Spieltischen eher selten Zweier- und Dreiergruppen im Mao-Look auftretende Männer gesehen, war er doch erstaunt, hier gleich ein Dutzend Zuschauer aus der nahen Volksrepublik vorzufinden. Sprachlos und mit weit geöffneten Mäulern hockten sie auf dem vordersten Rand ihrer Stühle in der ersten Reihe und stierten in den Schoß von zwölf fast nackten Französinnen, die in reiner Routine ihr Programm absolvierten. Wahrscheinlich aus Scheu vor ebenfalls anwesenden Kadern wagte keiner, die sich vor ihnen abspielende 'korrupte Dekadenz des Kapitalismus' zu beklatschen – weshalb am Ende einer jeden Nummer Applaus vom Tonband ertönte.
Am nächsten Morgen wachte JJC mit leichtem Kater auf: Der portugiesische Wein, den er noch in einer Pinte getrunken hatte, war wohl doch etwas schwerer gewesen als der gewohnte australische Landwein. Die Sonne näherte sich bereits ihrem Zenit, als er durch die engen Gassen der Altstadt, einem sino-portugiesischen Potpourri aus mediterraner Leichtigkeit, lusitanischer Gelassenheit und konfuzianischer Lebensweisheit bummelte: Da drängten sich in Taipa Village hundertjährige Kolonialhäuser mit Arkaden und Balkonen neben Tempeln, Barock-Kirchen und zweisprachigen Geschäften. Ihr sichtbarer Verfall schmerzte. Grau-schwarzer Schimmel bedeckte viele Fassaden mit vom Regen verwaschenen Pastellfarben: Rost & Schimmel waren die vorherrschenden Assoziationen Macaos.
In einfachen Läden wurden oft mehrere Gewerbe ausgeübt: Auf der rechten Seite gab’s einen Frisör, auf der linken arbeitete ein Uhrmacher an seinem Holztisch, während im hinteren Teil Konserven verkauft wurden. In einem Trödelladen, der alles feilbot, was sich auf dem Karren eines Hausierers finden ließ, entdeckte JJC auf einer Couch eine Eurasierin von unglaublicher Schönheit: Halb sitzend, halb in lässig-lasziver Haltung liegend, trug sie einen bonbonfarbenen Morgenrock, der zu der Bronze ihres wunderschönen, ovalen Gesichts kontrastierte. Hinzu kamen dichte, tiefschwarze Haare und dunkle, glühende Augen. Die junge Frau musste einem Märchen aus Tausendundeiner Nacht entstammen: Sie strahlte eine sinnliche Trägheit und zugleich Wollust aus, dass es Jay-Jay Clark den Atem benahm. Während er auf ihre Figur starrte, überlegte er, wie er mit dieser Schönheit ins Gespräch kommen könnte. Gerade, als JJC alles auf eine Karte setzen wollte, erschien ihr Ehemann aus dem Hintergrund: Ein langer, bärtiger, ausgemergelter alter Chinese mit Brille, so wie man allerorts in Asien Krämern begegnet: klug, gerissen, dem Kunden gegenüber unterwürfig, seinen – wahrscheinlichen – Wohlstand verbergend. Jay-Jay Clark wandte sich ab.
Über ‚Loja de Sopas e Fritas’, einem Nudelgeschäft, praktizierte João Felipe Wong, Dentista. Daneben setzten ein Dutzend zierliche Füße uralte Nähmaschinen in Bewegung, um Hemdenknöpfe anzunähen; auf den Etiketten der Hemden stand ‚Handmade in China’. Schreibkundige, die auch Horoskope erstellten, hatten kleine Tischchen aufgebaut, umlagert von neugierigen Kindern und Greisen. Es roch nach Holzkohlenfeuer, Stockfisch, Räucherstäbchen und Sojasauce; überall wurden gehäutete Schlangen, Hunde, Fische, Schalentiere, chinesische Arzneien, Knochen, Tier-Embryos, „ganz neue Antiquitäten“, kalter vinho verde und warmer Reisschnaps feilgeboten.
Für ein paar Macao Patacas bestellte Jay-Jay Clark bei einem Chinesen, der gebratene Eulen, Waschbären, getrocknete Seepferdchen und Schuppentiere anbot, eine einfache Nudelsuppe, setzte sich vor dessen Geschäft auf einen wackligen Plastikstuhl und betrachtete das rege Treiben. Dabei sinnend, wie er wo vorgehen konnte.
Gegenüber hatte sich eine Apotheke auf Ginseng und Aphrodisiaka spezialisiert, die, zu JJCs Verwunderung, hauptsächlich von Nord-Koreanern frequentiert wurde. Auf sein Befragen erklärte ihm der Wirt in drolligem Pidgin-Englisch, dass das stalinistische Nord-Korea seit seinem Überfall auf Süd-Korea auf dem Index der Vereinten Nationen stehe und von der Freien Welt – offiziell – mit totalem Boykott belegt sei. Dann neigte sich der Chinese näher zu JJC, legte den Zeigefinger auf seine Kinnseite, was bedeutete, ‚jetzt sage ich Dir ein ganz großes Geheimnis’ und flüsterte: „Über diese ‚Apotheke’ besorgt sich Nord-Korea alles, was es zum Überleben braucht – hauptsächlich jedoch Luxusartikel für die obersten Parteibonzen.“
Jay-Jay Clark wurde nervös: Er war nicht als folkloristisch interessierter Tourist gekommen! Er wusste, dass man in den Gassen mit den aus Portugal stammenden großen Pflastersteinen für gutes Geld alles bekam; eine echte Jungfrau ebenso wie einen skrupellosen Killer. Nur: An wen sollte er sich für das was er brauchte wenden? Er konnte doch nicht jemand Wildfremden auf der Straße ansprechen?!? Jay-Jay merkte, wie sich seine Gedanken im Kreis drehten: irgendetwas lief falsch.
Unversehens kam JJC in der Toilette des Hotels <Bella Vista> mit zwei älteren Portugiesen ins Gespräch: Ein so junger, gutaussehender und höflicher Ausländer weckte deren Interesse, so dass sie ihn aufforderten, an ihrem Tisch Platz zu nehmen. Daran saßen pensionierte Staatsbeamte, Offiziere und Kaufleute, die, wie sie scherzhaft erklärten, „sich noch nicht entschieden hatten, ob sie hier sterben sollten bevor die Rot-Chinesen einmarschieren, oder ob sie vorher in ihr Mutterland, das ihnen längst kein Vaterland mehr war, remigrieren sollten …“ Jay-Jay Clark hatte mehr das Gefühl, dass der eine oder andere nur noch auf einen wie auch immer gearteten Coup, eine Gelegenheit wartete, um einen Abgang der besonderen Art hinzulegen.
Nach einer Weile bat Jay-Jay Clark die Herren um die Ehre, eine Runde Roten ausgeben zu dürfen, was mit dem größten Vergnügen angenommen wurde.
Nachdem man sich allseits zugeprostet hatte, fragte ein Herr mit dem strengen Gesichtsschnitt eines Vasco da Gama: „Haben Sie denn schon so viel beim Spielen gewonnen?“
„Nein, noch gar nichts“ antwortete JJC, um nach einer winzigen Zäsur hinzuzusetzen, „aber deswegen bin ich auch nicht nach Macao gekommen.“
„Wo kommen Sie denn her?“
„Meine Nationalität ist Geschäftsmann und ich brauch' was Bestimmtes …“
An der plötzlichen, kurzen Stille merkte JJC, dass er hier richtig war.
„Was 'Bestimmtes'? Das klingt ja sehr geheimnisvoll. Junger Mann: Außer dem Besorgen einer Atombombe stellt in Macao nur wenig ein Problem dar“ bemerkte ein Weißhaariger zu JJCs Erleichterung.
„Was brauchen Sie denn?“, fragte der mit dem Zwicker.
„Bestimmte Papiere.“
„'Be-stimm-te-Pa-pie-re'? – Meinen Sie Falschgeld, junger Mann?“
„Nein, nein, ganz bestimmt kein Falschgeld. Ich brauch' eine Art Bestätigung.“ JJC wusste, dass er mit Offenheit ein gewisses Risiko einging, aber es blieb ihm nichts anderes übrig.
„Na, wenn Sie nur bedrucktes Papier brauchen, das ist doch kein Problem. Da kannst Du doch behilflich sein, lieber Graf“, meinte 'Vasco da Gama' und wandte sich an einen Herrn, dessen Haltung den ehemaligen Offizier erkennen ließ, der etwas abseits saß und sich an dem Gespräch bisher nicht gerade lebhaft beteiligt hatte.
Als der Kreis dieser ehrwürdigen Senhores schließlich aufbrach, blieb 'der Offizier' zurück und sagte: „Junger Mann, erzählen Sie mir nicht, dass Sie auf einem Sack voll Rauschgift hocken und dafür eine Ausfuhrgenehmigung brauchen – da mach' ich nicht mit!“
Unwillkürlich musste JJC lachen. „Senhor, Sie können ganz beruhigt sein: Mit Rauschgift habe ich wirklich nichts im Sinn.“
„Welche Art Bescheinigung brauchen Sie denn?“
„Sind Sie ehemaliger Graphiker?“
„Nein. Mein Name ist Graf Duarte Nunie de Castro Cesare Machado; ich war hier mal der Polizeichef.“ Damit überreichte er seine Visitenkarte. “Obwohl inzwischen außer Diensten, pflege ich immer noch gewisse Kontakte. Und nun erzählen Sie mal, junger Mann.“
„Mein Name ist Jay-Jay Clark, und ich bin als Kaufmann eigentlich ganz erfolgreich. Aber nach der Weisheit 'eine Braut muss unter die Haube solange sie schön ist', hab' ich mein Geschäft günstig verkauft und diesen Erlös auch ordnungsgemäß versteuert. Den weitaus größeren Teil meines Vermögens habe ich jedoch mit Geschäften gemacht, die, sagen wir mal: nicht durch die Bücher liefen.“
„'Cash'“, fügte der Graf den etwas zögerlich vorgetragenen Worten JJCs hinzu.
„Ja: 'Cash'!“ Jay-Jay Clark war über die Geschäftscharakterisierung, die keine weitere Erklärung erforderte, glücklich. „Aber ich bin noch zu jung, um mich auf eine Südsee-Insel zurückzuziehen und den Hula-Röcken hinzugeben. Im Gegenteil: Ich will was Neues anfangen und möchte mein Geld in einer neuen Branche investieren. Und da wird mich todsicher irgendwann das Finanzamt fragen: 'Wo haben Sie denn eigentlich Ihr Kapital her?'“
„Vor allem wird Sie das Ihr Konkurrent fragen!“
„Eben. – Ich versteh' nichts von Bankgeschäften, aber ich dachte mir, wenn ich den Umtauschbeleg einer Bank und Eintrittskarten von verschiedenen Spielcasinos oder der Pferderennbahn vorlege …“
„Mister Clark“, unterbrach der ehemalige Polizeichef JJC lachend, „das sind doch peanuts, das muss man doch im großen Stil machen. Wie hoch ist denn die Summe, die Sie offiziell verdient und versteuert haben?“
„Umgerechnet zwei Millionen US-Dollars.“
„Und der inoffizielle Gewinn?“
„Zehn Millionen US-Dollars.“
„Respekt, junger Mann! Sie scheinen ja ganz schön clever zu sein.“
„Es geht“ meinte Jay-Jay bescheiden.
„Wie wollen Sie bezahlen? Mit Scheck oder cash?“
„Das offiziell versteuerte Geld per Scheck.“
„Gut. Da Spielbanken von einer Geld-Meldepflicht befreit sind, – selbst wenn sie international vorgeschrieben wäre, würde man sie in Macao ignorieren, – fahren Sie morgen mit der Fähre nach Hong Kong, gehen zu irgendeiner Bank, zahlen auf das Spielbank-Konto vom <Hotel Lisboa> zwei Millionen Dollar ein und ordern gleich Spiel-Chips. Eine Woche später haben Sie den Jackpot geknackt und ziehen mit fast zwölf Millionen von dannen.“
„Das geht?“
„Die Casinos von Macao sind die größten Geldwaschanlagen der Welt.“
„Was kostet mich die Sache?“
„Zehn Prozent“ kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen.
Jay-Jay wechselte die Farbe: „Vom gesamten Betrag, Senhor?“
Der Ex-Polizeichef ergötzte sich an dem Schrecken des Australiers: „Nein, junger Mann, von dem eingezahlten Betrag. Also lächerliche zweihunderttausend Dollar.“
„Und wenn ich den Scheck zuhause einlösen will – krieg' ich dann die zwölf Millionen, oder ist die Tinte mittlerweile verblasst?“
„Mister Clark, die Chinesen sind zwar raffinierte Geschäftsleute, aber absolut ehrlich. Das heißt: Es kann lange dauern, bis ein Geschäft mit ihnen zustande kommt, aber wenn es per Handschlag abgeschlossen wird, können Sie sich auf dessen Einhaltung hundertprozentig verlassen. Was ich nicht von jedem Europäer behaupten möchte.“
„Kann ich außer dem Scheck noch eine Art Gewinnbestätigung haben?“
„Der Casino-Kassierer wird Ihnen das Duplikat jener Empfangs-Bestätigung aushändigen, auf der Sie die Nummer des Schecks und dessen Höhe quittiert haben. Außerdem kann' ich noch ein Interview im 'Diario de Macao' arrangieren, in dem Sie strahlend hinter einem Berg von Chips am Roulettetisch sitzen.“
„Ein Foto? Im Spielcasino? Ich denke …“
„Diese Zeitung wird vom Spielcasino auf Bedarf, das heißt: nur für solche Zwecke gedruckt. Aber überlassen Sie das alles mir“ unterbrach der Portugiese. „Ich benötige von Ihnen nur ein Passfoto aus dem nächsten Automaten. Sollte in Australien jemand Zweifel hegen, sagen Sie am besten, dass die ansonsten sehr auf Diskretion bedachte Direktion sich keine bessere Reklame wünschen kann, als wenn bekannt wird, dass wieder einmal ein Spieler aus Übersee in Macao sein großes Glück gemacht hat.“
„Dass das sooo einfach geht, hätte ich nicht gedacht.“
„Glauben Sie mir: Es geht nur dank meiner nach wie vor gut gepflegten Kontakte sooo einfach. Sie mögen in Ihrer Branche ja ganz erfolgreich sein, aber wenn Sie HIER an den Falschen geraten, nimmt man Sie aus bis auf den letzten Pataca.“
Jay-Jay Clark spendierte noch einige Gläser von dem Rotwein, der prompt die Zunge des Portugiesen löste: „Hier läuft jährlich ein Multimillionengeschäft im Verborgenen ab und die chinesischen Triaden stecken überall mit drin. Die haben die besten Geräte der Welt, großartiges Material, das erstklassig gefälschte Reiseschecks und Papiergeld produziert: britische Pfundnoten, amerikanische Dollars, Yen, D-Mark, Hong Kong-Dollars. In meiner Amtszeit sind mir sogar falsche pakistanische und indische Rupien auf den Tisch geflattert. Sie können sich gar keine Vorstellung davon machen, WAS hier alles präpariert oder gefälscht werden kann. Etwas nachzumachen oder zu fälschen ist eine in China traditionelle und sehr geachtete Kunst.“
Dieser letzte Satz war der Grund, warum Jay-Jay Clark wieder nach Macao gekommen war, um sich mit Graf Duarte Nunie de Castro Cesare Machado zu treffen.
* * *
Als die Bedienung das nächste Glas Wein brachte, sagte JJC: „Graf, ich würde gerne etwas mit Ihnen besprechen.“
„Bitte“ sagte der ehemalige Polizeichef und erhob sein Glas.
Jay-Jay Clark erzählte von seinem großen Urbanisationsprojekt und überreichte seinem Gast den Prospekt.
Graf Duarte Nunie de Castro Cesare Machado ließ sich Zeit und blätterte interessiert in der provisorischen Broschüre, bevor er die Kardinalfrage stellte: „Warum erzählen Sie mir das?“
„Wer arbeitet 364 Tage im Jahr? Die Chinesen. Nicht nur die Kulis, viel mehr noch die Millionäre! Und von denen weniger die Erben als vielmehr diejenigen, die 1949 vor Mao Tse-tungs Kommunisten flüchteten und in Hong Kong wieder ganz von vorne anfingen! Und je näher der Zeitpunkt der Rückgabe Hong Kongs an Peking rückt, desto dringender suchen diese Leute nach einer Niederlassungsmöglichkeit im freien Westen. Deswegen bin ich hier.“
„Weiter.“
„Der Bebauungs-Prospekt existiert bislang nur aus diesem einen Exemplar. Ich möchte ihn hier drucken lassen und später auch die Aktien. Aus Zweckmäßigkeitsgründen.“
„Welche Figur soll ich dabei in Ihrem Spiel sein?“
„Graf Duarte, ich würde Sie gern in mein Spiel, wie Sie es nennen, aktiv einbinden. Ich stelle mir das so vor: Ich gebe in Hong Kong eine große Pressekonferenz, in der ich das Projekt ausführlich vorstelle. Da ich mich in Perth um die Bauarbeiten kümmern muss, brauche ich in Hong Kong eine Anlaufstelle, einen vertrauenswürdigen Vertreter für mögliche Interessenten. Deswegen würde ich auf der Pressekonferenz Sie, Graf, als den zuständigen Repräsentanten vorstellen. Ich dachte, dass dies gegen eine Beteiligung von zehn Prozent pro Abschluss eine für Sie durchaus reizvolle und interessante Tätigkeit sein kann.“
„Was hätte ich zu tun?“
„Kurz gesagt: Ihre Beziehungen spielen zu lassen, um die Bonität ernsthafter Interessenten zu überprüfen. Sehen Sie, Graf, es dauert bestimmt sechs, vielleicht sieben Jahre, ehe die Siedlung vollständig fertig gestellt ist; was bedeutet, dass diese Kapitalanlagen als langfristig zu betrachten sind. Es gibt nur zwei Grundstücksgrößen mit Bungalows bei Aktien á fünfhunderttausend Dollar und einer Million. Natürlich kann jemand mehrere Aktien kaufen, aber es wäre zwecklos, von einem Geschäftsmann eine Million anzunehmen, wenn dieser die Summe spätestens nach Jahresfrist wieder braucht oder auf Zinsen angewiesen ist. Um das ganze Projekt auf eine gesunde Geschäftsbasis zu stellen, gehört zu den Bedingungen, dass die Aktien sieben Jahre im Depot einer Bank liegen bleiben, ehe sie veräußert, beliehen oder zu Spekulationszwecken benutzt werden dürfen. Deswegen brauchen wir Millionäre, die ein bis zwei Millionen flüssig, ja sie im Geiste abgeschrieben haben, aber wissen, dass sie dafür nach der Grundbucheintragung die Niederlassung und später die Staatsbürgerschaft in einem freien Land bekommen. Dafür sollen sie nach sieben Jahren eine garantierte Dividende von sieben Prozent erhalten. Ich nehme doch an, dass es in Hong Kong genug solche Millionäre gibt?“
„Auch in Macao und vor allem in Taiwan.“
„Taiwaneßen kommen nicht in Frage“, stieß Jay-Jay Clark etwas hastig hervor, um nach einer Zäsur der Überlegung hinzuzufügen „zumindest zunächst noch nicht.“
Der Graf gab sich gar keine Mühe, sein Erstaunen zu verbergen: „Was haben Sie gegen ‚fat cats’ aus Taiwan?“
„Im Prinzip natürlich nichts.“ Jay-Jay Clark stieß, wenn er unsicher war oder eine Unwahrheit zu kaschieren versuchte, mitunter nach Vokalen mit der Zunge an seine obere Zahnreihe: „Die Termine der außlaufenden Pachtverträge zwischen China und England sind ja allgemein bekannt: Sommer 1997 für Hong Kong, die Jahreßwende 1999 für Macao. Taiwan dagegen ist ein sicheres Land, das nicht zuletzt von der dort patrouillierenden 8. US-Flotte beschützt wird. Warum sollten die Taiwaneßen auswandern? Hinzu kommt, dass in Australien die Tendenz besteht, Menschen, die vor den Kommunisten geflohen sind, bevorzugt aufzunehmen, ihnen eine neue Heimat zu geben. Außerdem ist man in Außtralien den mit Tschiang Kai-shek geflohenen Kuomintang-Chineßen weßentlich weniger gewogen als den armen Flüchtlingen, die es nur biß Hong Kong geschafft haben.“
Dass Jay-Jay Clark die australische Staatsbürgerschaft quasi garantierte, war nicht seine letzte Täuschung in diesem Vorhaben.
Damit erschienen die ersten Schweißtropfen auf seiner Stirn. Der portugiesische Graf bemerkte eine gewisse Unsicherheit seines Gesprächspartners, beschloss jedoch, es dabei zu belassen.
Um abzulenken, sagte JJC schnell: „Der Grund, warum ich sowohl die Werbebroschüre wie auch die Aktien hier drucken lassen will, ist sowohl deine Kosten- wie eine Zeitfrage: Die Drucksachen von Perth hierher zu schicken kostet beides. Davon abgesehen, dass die Löhne und Druckkosten in Macao wesentlich geringer sein werden, könnte es sich erweisen, dass wir schnell Prospekte nachdrucken lassen müssen. Und das geht hier bestimmt einfacher als in Australien.“
Die beiden Herren besprachen noch lange Details, wie über ein repräsentatives Büro mit Telefon und Sekretärinnen, und sie vereinbarten als Provision fünfzehn Prozent vom Ertrag, allerdings bei Übernahme der örtlichen Werbe- und Bürokosten durch den Grafen. Der ehemalige Polizeichef war sicher, die zweihundertvierzig Millionen US-Dollar unter den Chinesen von Hong Kong und Macao zusammen zu bekommen.
„Was brachte Sie auf die Idee, die Aktien sieben Jahre im Depot liegen zu lassen und sieben Prozent Dividende auszuzahlen?“
„In Australien gilt die Sieben als Glückszahl und ich hoffe auf eine animierende Ausstrahlung.“
„In Asien ist die Sieben bedeutungslos. Die Glückszahlen differieren regional: In Peking ist es die Neun, weswegen der Kaiserpalast über 999 Zimmer verfügt. In Hong Kong ist es die Acht.“
„Die Acht?“
„Auf den New Territories gibt es genau acht Berge, die für die Chinesen Drachen, also Glücksbringer sind: Als der letzte Sung-Kaiser vor den Mongolen hierher floh, sagte er: ‚Seht her, da sind acht Drachen!’ Seine Höflinge sagten: ‚Aber Ihr, Herr, seid doch auch ein Drache’ – diesen Status hatte er als Kaiser. ‚Also’, sagte er, ‚nennen wir den Ort hier ‚neun Drachen’, – gau lung, – daraus wurde Kowloon. Da die Mongolen den Kaiser trotzdem töteten, gilt hier nicht die Neun, sondern die Acht als Glücksbringer, und zwar als großer. Chinesen lieben Homonyme.“
„Ist das was Unanständiges?“ unterbrach Jay-Jay Clark.
„Ein Homonym ist ein Wort, das genau wie ein anderes klingt: Verheißt das eine Wort Glück, gilt dies auch für andere. Zum Beispiel ‚mehr’ und ‚Meer’. Allen Aufklärungstendenzen zum Trotz glauben die Armen und die Reichen, die Gebildeten und die Analphabeten, Bankiers und Bettler an die Magie der ‚lucky numbers’: Bei einer Telefon-Auktion ersteigerte kürzlich ein Chinese für einhunderttausend Dollar die Telefonnummer 135 8585 8585; chinesisch ausgesprochen klingt dies wie ‚Laß mich reich sein, reich sein, reich sein, reich sein.’ – ‚Acht’ heißt auf Kantonesisch baat und bedeutet ‚Glück’, auf Mandarin heißt es pa. Beide Wörter klingen wie faat, das ‚Glück’ bedeutet. Wenn also die Adresse oder eine Telefonnummer eine Acht hat, verheißt dies ‚noch mehr Glück als großes Glück’. In Hong Kong hat jüngst ein Chinese eine Million Hong Kong-Dollar bezahlt, um für sein neues Auto die Nummer 8888 zu bekommen.
„Man muss daran glauben“ sagte JJC.
„ … und jegliche vier vermeiden.“
„Warum?“
„‚Vier’ klingt wie ‚Tod’. Kein Krankenhaus hat einen vierten Stock: Jeder Chinese würde glauben, man schübe ihn ins Sterbezimmer ab.“
Wäre der Graf noch im Amt gewesen, hätte er niemals diesen ‚Spezialisten’ empfohlen. Da er bei dieser Sache jedoch selbst ein Schnäppchen der besonderen Art zu machen gedachte, war dieser Mann auch für ihn genau der Richtige: Der chinesische Drucker freute sich über den umfangreichen, komplikationslosen Auftrag umso mehr, als Jay-Jay Clark eine beachtliche Anzahlung leistete. Auch dass er eine bunte, briefpapiergroße Aktie selbst entwerfen sollte, gab dem Drucker sehr viel Gesicht, und er machte sich mit Feuereifer ans Werk.
Eines musste man Jay-Jay Clark zugestehen: Er war nicht nur Hasardeur, sondern auch ein polyglotter Mensch, der es verstand, in der Sprache seines jeweiligen Gegenübers zu sprechen. Wo es nötig war, trug er ein unergründliches Pokergesicht zur Schau, bei Politikern zeigte er unerwartetes diplomatisches Geschick; je nach Bedarf konnte er wie ein an die Wand zu nagelnder Pudding sein, oder mit Gangstern brutal schachern. Es zielte eben alles was er unternahm, auf Wirkung ab.
* * *
Perth
In Perth hatte sich ein Kreis zusammengefunden, der sich 'The Dolphins' nannte und – nicht zu Unrecht – für mobiler galt als die örtlichen 'Rotarier' und 'Lyons'. Es waren dies etwa vierzig Manager, Kaufleute, Politiker, Bankiers, progressive Künstler, die an einer prosperierenden Entwicklung der Stadt interessiert waren. Bei ihren, in selbstironischer Weise 'Seancen' genannten Zusammenkünften standen entsprechende Vorträge und Analysen im Mittelpunkt, wobei die Herren für jede Innovation dankbar waren.
Da die Mitglieder im besten Mannesalter standen, war eine Fluktuation durch berufliche oder tödliche Abgänge selten. Weshalb der Präsident der 'Dolphins' am Ende jeder 'Seance' routinemäßig fragte: „Gibt's wen Neues zur Blutauffrischung?“
Und George Bernhard O'Conner, der Executive Vize President der <West-Australian Bank of Commerce> antwortete eines Abends: „Na ja, wir haben da einen Neuzugang, der interessant zu sein scheint.“
„Aha. Wie heißt der?“
„Jay-Jay Clark.“
John McFergusson, ein vor einiger Zeit nach Perth versetzter Manager der Ölbranche gesellte sich zu den beiden Gentlemen mit einem Glas in der Hand.
„Jay-Jay Clark?“
„Ja.“
„Wo kommt der her?“
„Weiß ich nicht, ist Australier. Etwa Mitte 30.“
„Was ist er?“
„Nennt sich Kaufmann. Er hat das große Bürogebäude in der City gekauft und bar bezahlt.“
„Wie bitte?“
„Ja, hat bar bezahlt und nach der notariellen Eintragung das Gebäude zu zwei Dritteln seines Werts mit Hypotheken belastet.“
„Warum?“
„Das weiß ich nicht, Mister Präsident.“
„Woher hat er das Geld?“
„Das kam aus Macao. Und dahin hat er es auch wieder rück-überwiesen.“
„Warum zahlt einer bar und belastet dann? Ganz klar: Um einen Teil wieder ins Ausland zu transferieren. Und das tut man doch nur um Geld zu waschen.“
Mister John McFergusson, der Ölmanager, gab sich den Anschein, als interessiere ihn dieses Gespräch nicht sonderlich, er platzierte sich jedoch so, dass ihm kein Wort entging. Scheint ja ein interessanter Mann zu sein, pfiffig und clever, dachte er. Und da er sich nicht zu erhaben dünkte, auch von jungen Menschen, vor allem wenn es um Gewinn ging, noch was zu lernen, begann John McFergusson sich für Jay-Jay Clark zu interessieren.
Auf seine Initiative hin wurde Jay-Jay Clark zum nächsten der einmal monatlich stattfindenden Abendessen im <Queens Hotel> eingeladen. Nicht dass diese Abende immer ungeheuer interessant oder informativ abliefen, sie boten einfach eine Gelegenheit in lockerer Atmosphäre über Frauen, Pferde oder Politik zu reden. Gelegentlich wurden auch Geschäfte besprochen, Gerüchte aktualisiert und Gefälligkeiten oder Kontakte genutzt. Manchmal waren die ‚Seancen’ nützlich, mitunter aber auch öde. Aber es gab nur wenige Alternativen die Abende in Perth zu verbringen.
* * *
Hong Kong
Graf Duarte Nunie de Castro Cesare Machado wusste um das chinesische Sprichwort: ‚Um einen großen Fisch zu fangen, muss man eine lange Schnur auswerfen.’ Und für das, was der Ex-Polizeipräsident vorhatte, konnte ‚die Leine’ nicht lang genug sein! Außerdem suchte er eine Klientel, die Wert auf Diskretion legte; Marktschreierei war in diesem Falle völlig fehl am Platz. – In der Des Voeux Road inmitten von Hong Kong fiel ein großes, jedoch schlichtes Messingschild auf, das in Kantonesisch, Englisch, Französisch und Portugiesisch besagte, dass sich in der obersten Etage die Zentrale der <Global Investment Company> befand.
Die Zeit, in der Chinesen ihren Reichtum nicht zeigten, war besonders bei jenen vorbei, die aus Rot-China geflüchtet waren: Nur wenige hatten seinerzeit mehr als ein paar Goldklumpen in der Hosentasche, viele nur das Hemd, das sie am Leibe trugen. Aber wenn sie es wieder zu etwas gebracht hatten, protzten diese Neureichen mit großartigen Villen in den besten Wohngegenden, mit Nobelkarossen der teuersten Marken, Schmuck und trotz subtropischer Temperaturen mit Pelzen für Gattin und Mätressen; selbst Kinder verfügten bereits über eigenes Personal. Repräsentanz war alles, wusste Graf Duarte Nunie. Gespannt wartete er auf seinen ersten Besucher, einen Journalisten.
Als dieser in der 20. Etage aus dem Fahrstuhl trat, wurde er von einem großen, Respekt einflößenden indischen doorman in Phantasieuniform begrüßt und um seine Visitenkarte gebeten.
Jeder Asiate von Ansehen und Reputation hat seine Visitenkarte, anstatt eines 'nutzlosen' Ziertuchs, in seiner obersten Jackett- oder Hemdentasche griffbereit. Darauf steht im Chinesischen an erster Stelle der Familienname, oft gefolgt vom westlichen, dann dem chinesischen Vornamen. Neben einer möglichst noblen Geschäftsadresse ist das Wichtigste eine Berufsbezeichnung, die Europäer oft schmunzeln lässt. Heißt es doch zum Beispiel: 'Erster Zureicher von Chefkoch Wang im Hotel Mandarin', oder 'Persönlicher Assistent des 2. Managers', 'Ober-Hilfsaufseher', oder 'Chefseilbahnführer im Ruhestand'; irgendein Titel muss sein, denn nur der gibt Gesicht. Wer es sich leisten kann, lässt seine Karten in erhabenem Stahlstich drucken. Diejenigen, die schon etwas gelten, überreichen die Karte mit beiden Händen in einer selbstverständlichen, harmonischen Bewegung indem sie dabei lächeln. Die anderen zerren die Karte viel zu hastig hervor. Derjenige, der die Karte mit beiden Händen entgegennimmt, lächelt in jedem Fall, schaut schnell auf Namen und Titel und fährt unauffällig mit einem Fingernagel über die Karte, um zu prüfen, ob es sich um gewöhnlichen Druck oder um teuren Stahlstich handelt.
Als der Journalist vor ihm stand, erhellte sich jener Teil des Inders, der sich zwischen dem gewaltigen Bart und dem in die Stirn geschobenen Turban als Gesicht erkennen ließ und sagte mit einer Verbeugung: „Oh, Mister Chang, haben Sie die Freundlichkeit, mir zu folgen, der Vice President wird sich freuen, Sie zu sehen.“ Damit hatte der Sikh die schwere Eingangstür geöffnet, ließ den Journalisten eintreten und geleitete ihn zu einem Empfangstresen, der jeden Besucher überraschte: Er bestand aus einem großen, nierenförmigen Glastisch, unter dem aus schwarzen Röcken die sechs schönsten Beine hervorschauten, die jeder Mann glaubte noch nie nebeneinander gesehen zu haben. Die Distanz bis zum Tisch legte der Inder gemessenen Schritts zurück, um dem Besucher Zeit zu geben, seine Augen schweifen zu lasse: Hier saß eine perfekte Melange aus indischem Dunkel, vietnamesischem Braun und chinesischem Gelb. Und jede Frau trug ein typisches Kostüm ihrer Heimat. Um das Maß voll zu machen, blickte der Besucher in so wunderschöne Gesichter, wie sie eurasischen Frauen oft zu eigen sind.
Einen Meter vor dem Tisch sagte der Sikh: „Das ist Mister Chang. Er möchte zu Vice President Graf Duarte Nunie de Castro Cesare Machado.“ Das Trio sagte synchron miteinander: „Guten Morgen, Mister Chang“, wobei alle auf das Bezauberndste lächelten und die tiefdunklen Augen strahlten, dass dem Journalisten die Knie weich zu werden drohten, zumal er unwillkürlich abzuschätzen versuchte, welche wohl die Allerschönste sei. Die Vietnamesin erhob sich, lächelte, nahm vom doorman die Visitenkarte entgegen und kratzte, da sie es in der Eile noch nicht besser gelernt hatte, mit ihrem langen Fingernagel über den Stahlstich, als wetzte eine Katze ihre Krallen. Der Journalist bemerkte dies jedoch nicht, da er fasziniert ihr schönes Gesicht anstarrte, während das Mädchen sagte: „Mister Chang, ich werde Sie sofort avisieren. Darf ich Sie bitten, solange auf der Couch Platz zu nehmen“, wobei sie auf eine Sitzgruppe aus schwarzem Leder wies.
„Ja, danke, Miss …“, stotterte der Journalist, indem er auf das Namensschild zu schauen versuchte.
„Lucy“ sagte die Vietnamesin, was den Journalisten erröten ließ. Er wandte sich ab und ging zu der Couch. Kaum hatte er sich niedergelassen, stand die Inderin vor ihm:
„Mister Chang, was darf ich Ihnen bringen? Tee? Kaffee? Dazu Gebäck?“
„Oh, … mhm … Tee bitte.“
„Chinesischen Tee? Indischen Tee? Sri Lanka Tee?“ Sie zählte ihre Auswahl langsam und deutlich auf.
„Oh, …“, der Journalist blickte unverwandt in das wunderschöne Gesicht. „Grünen Tee, bitte“ entschied er endlich.
„Grünen Tee, Mister Chang, sehr gerne.“ Die Grazie rührte sich nicht vom Fleck. „Wünschen Sie Zucker oder Saccharin, Mister Chang?“
„Zucker, bitte.“
„Wünschen Sie Salz- oder süßes Gebäck, Mister Chang?“
„Oh, … kein Gebäck, danke.“
„Sofort, Mister Chang.“ Damit entschwand die Schönheit in dem langen Gang.
Währenddessen hatte die Chinesin zum Telefon gegriffen und den Besucher bei der Chefsekretärin angemeldet. Man ließ Mister Chang genügend Zeit, sich einmal umzusehen und den Betrieb und seine Geräusche aufzunehmen: Aus der Telefonzentrale ertönte fortwährendes Klingeln; durch die gläserne Tür war zu sehen, wie drei Telefonistinnen ununterbrochen sprachen, notierten, sowie verschiedene Knöpfe und Hebel bedienten. Ein Herr im dunklen Geschäftsanzug begleitete einen Kunden, der einen zufriedenen Eindruck machte, zur Tür, befahl dem Sikh „für Mister Chen den Fahrstuhlknopf zu drücken.“ Unter vielen gegenseitigen Verbeugungen verabschiedete sich die Herren, der Sikh hielt dem Kunden die Tür auf, der Kunde verschwand im Fahrstuhl, der Mann im dunklen Anzug um die Ecke in dem langen Gang. Die Chinesin nahm den Telefonhörer ab, horchte kurz und sagte: „Mister Chang, Vice President Graf Duarte Nunie de Castro Cesare Machado ist es eine Ehre, Sie empfangen zu dürfen. Würden Sie mir erlauben, Sie zu ihm zu bringen, Mister Chang?“
„Aber ja, natürlich.“
In dieser Firma schien unter Hochdruck gearbeitet zu werden: Angestellte trugen Unterlagen über den Gang, Sprachfetzen drangen aus den Türen der Sekretärinnen, zwei Herren im dunklen Anzug besprachen im Gang eine Börsennotierung. Als der Journalist an der Teeküche vorbeiging, kam eine Beauty mit einem größeren Tablett mit Teetassen heraus und Mister Chang bekam zufällig mit, wie die Vietnamesin drinnen klagte: „Jetzt habe ich Mister Chang vergessen zu fragen, ob er Streu– oder Würfelzucker haben möchte. Dabei ist das doch so ein wichtiger Mann, wie der Vice President sagte …“ Ein Blick in eine andere, sich zufällig öffnende Tür zeigte einen voll besetzten Konferenztisch.
Die Chefsekretärin, eine Chinesin von ungewöhnlich großer, schlanker Statur war entweder 'Miss Hong Kong', wenn nicht gar die personifizierte 'Miss China': „Oh, Mister Chang“, strahlte sie, „der Vice President freut sich über Ihren Besuch. Wir können gleich hineingehen.“ Währenddessen hatte sie die Visitenkarte entgegengenommen und mit ihrem Fingernagel geprüft; sie sagte „Danke, Amy“ und öffnete die Tür zum Chefbüro. „Mister Chang Joseph Wego, Vice President“ avisierte sie. Sie ließ den Journalisten eintreten, dann schloss sie die Tür.