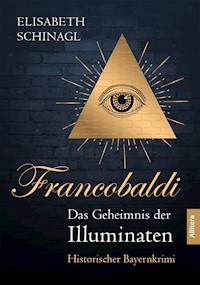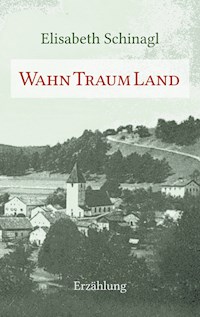Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eichstätt, 1792: Die Gefahr eines möglichen Kriegs gegen Frankreich schwelt über Europa. Statt fortschrittlicher Ideen gewinnen konservative Strömungen in der Gesellschaft die Oberhand. So sollen Frauen heiraten, Kinder gebären und den Haushalt versorgen. Trotzdem versucht Enrico Francobaldis Stieftochter Babette, als Frau gegen alle Widerstände ein selbstbestimmtes Leben zu führen und wird Gesellschafterin einer Adeligen in Wien. Während eines Besuchs ihrer Eltern bittet Babettes Dienstherrin Francobaldi, den Nachlass ihrer verstorbenen Gouvernante zu regeln. Was als harmloser Auftrag beginnt, entwickelt sich rasch zu einem ausgewachsenen Kriminalfall. Denn der Tod der Gouvernante weist einige Ungereimtheiten auf. Und was hat es mit den rätselhaften Namenslisten auf sich, die Francobaldi in ihren Habseligkeiten findet? Ein historisch bestens recherchierter, dramatischer Krimi vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Moralvorstellungen im ausgehenden 18. Jahrhundert. Der zweite Fall für Enrico Francobaldi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ELISABETH SCHINAGL, geboren 1961 in München, studierte in Eichstätt und Regensburg Latein und Germanistik. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Mittellateinische Philologie an der Katholischen Universität Eichstätt. Nach ihrer Promotion war sie zunächst als Gymnasiallehrerin und anschließend als Referentin im Bayerischen Landtag tätig. Seit 2018 ist sie freie Autorin. In ihren Romanen und Erzählungen befasst sie sich vorwiegend mit historischen Themen. Sie lebt in Eichstätt und München.
Originalausgabe August 2023Allitera VerlagEin Verlag der Buch&media GmbH, München© 2023 Buch&media GmbH, MünchenLayout, Satz und Umschlaggestaltung: Mona KönigbauerGesetzt aus der Adobe Garamond und ParchmentGrafik Titelseite: © Julia Kitaeva, thenounproject.comPrinted in Europe · ISBN 978-3-96233-385-0
Allitera VerlagMerianstraße 24 · 80637 MünchenFon 089 13 92 90 46 · Fax 089 13 92 90 65
Weitere Publikationen aus unserem Programm finden Sie auf www.allitera.deKontakt und Bestellungen unter [email protected]
Inhalt
Eisheilige
Die Reise
Wien
Enttäuschungen
Theaterluft
Eine unerwartete Bitte
Jungfer Engelharts Geheimnis
Eine traurige Geschichte
Stille Wasser
Eine grässliche Entdeckung
Diebe in der Nacht
Umwege
Endlich daheim!
Hoffen und Bangen
Ein neuer Freund
Töchter und Söhne
Fortunas Launen
Sündenböcke
Illuminati
Unerwarteter Besuch
Schlussfolgerungen
Die Brautwerbung
Gerüchte
Das Porträt
Post von Babette
Verzeichnis der historischen Personen
Zeitgenössische Quellen
Die freie Gedanken- und Meinungsäußerung ist eines der kostbarsten Rechte der Frau, denn diese Freiheit garantiert die Vaterschaft der Väter an ihren Kindern. Jede Bürgerin kann folglich in aller Freiheit sagen: »Ich bin die Mutter eines Kindes, das du gezeugt hast«, ohne dass ein barbarisches Vorurteil sie zwingt, die Wahrheit zu verschleiern.
Olympe de Gouges (geb. 7.5.1748, hingerichtet am 3.11.1793) Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, Art. 11
Eisheilige
m Kachelofen brannte selbst jetzt Mitte Mai noch Feuer und wärmte unsere Stube aufs angenehmste. Meine liebe Frau saß in ihrem gewohnten Fauteuil und war, wie so häufig mit der Anfertigung irgendeiner Stickarbeit beschäftigt. Ottilie liebte es, Kissenbezüge, Tischwäsche, Taschentücher oder Deckchen mit Blumen, Vögeln, Monogrammen oder geometrischen Mustern aus seidig schimmerndem Garn zu verzieren. Unter ihren geübten Fingern verwandelten sich unscheinbare Stofftücher in kleine Kunstwerke. Mit einer mir völlig unverständlichen Leidenschaft zauberte sie Hohlsäume, Lochstickereien und sonstige Feinheiten, von denen ich nicht einmal den Namen wusste.
»Lesen ist nichts für mich. Dazu fehlt mir die Geduld. Ich höre dir gerne zu, wenn du mir vorliest, aber meine Hände brauchen derweil etwas zu tun«, hatte sie mir erklärt, als ich zu Beginn unserer Ehe versucht hatte, sie mit ausgewählter Lektüre an die Literatur heranzuführen. So war es mehr oder weniger geblieben. Ottilie hörte mir tatsächlich stets aufmerksam zu, wenn ich ihr vorlas, doch sie selbst widmete ihre Zeit nur äußerst selten einem Buch. Vier Jahre waren wir nun schon verheiratet und ich hatte diese Entscheidung noch nicht einen Tag bereut. Mit Ottilie war wieder Freude in mein Leben eingekehrt. Mit dem ihr angeborenen Mutterwitz brachte sie mich auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn ich mich in meinen allzu luftigen Gedankengebäuden zu verlieren drohte. Wenn ich ganz ehrlich war, beneidete ich meine liebe Frau in letzter Zeit bisweilen. Sie schien keine Langeweile zu kennen. Immer hatte sie etwas zu tun, war geschäftig in unserer Wohnung oder in unserem großen Garten draußen vor den Toren der Stadt, strickte, nähte oder flickte irgendetwas und schien stets ganz in ihrer Beschäftigung aufzugehen. Ihr zu Füßen hatte es sich der kleine Karl, der ledige Sohn unserer Dienstmagd, auf dem Teppich gemütlich gemacht und spielte mit seinem hölzernen Kreisel. Hingebungsvoll und ganz in seine Bemühungen versunken versuchte er mit seinen noch recht ungeschickten Fingern das Spielzeug möglichst lange in Drehung zu bringen. Wie meist, wenn er so vertieft war, summte er dabei ganz leise vor sich hin. Ottilie hegte inzwischen fast mütterliche Gefühle für ihn. Er half ihr, die Trennung von ihrem Sohn Adam und ihrer Tochter Babette besser zu verkraften. Beide hatten ihr Vorhaben wahrgemacht, eine gewisse Zeit in Wien zu verbringen. Nur widerwillig, ja zähneknirschend hatte meine Frau diesem Ansinnen ihrer beiden Jüngsten schließlich zugestimmt und das erst, nachdem ich wochenlang diesbezüglich auf sie eingeredet hatte.
Die aktuelle Ausgabe von Barths Vaterländischer Monatsschrift hatte ich bereits mehrmals von vorne bis hinten durchgelesen. Ich bewunderte den Hofkammerrat für seinen Eifer, mit dem er dieses Blatt veröffentlichte. In wenigen, handgeschriebenen Exemplaren stellte er für seinen ›Zirkel traulicher Freunde‹ Monat für Monat zusammen, was er an Geschichtlichem und Neuigkeiten in unserem Fürstbistum bemerkens- und erwähnenswert fand. Er berichtete darin vom Zustand der Chausseen ebenso wie über einen zu befürchtenden Holzmangel, fürstbischöfliche Dekrete sowie über Einnahmen und Ausgaben des Hofs. Nun fiel mir an diesem friedlichen Nachmittag nichts anderes mehr ein, als mich dem Eichstätter Intelligenzblatt zuzuwenden. Viel war nicht passiert. Eine mit Silber beschlagene Meerschaumpfeife war verloren gegangen und der Finder wurde gebeten, diese gegen ein ordentliches Recompence im Hotel »Traube« abzugeben. Der Stadtsyndikus Gerstner, so wurde außerdem vermeldet, war durchs Ostentor wieder in unsere Stadt repatriiert. Wo er gewesen war, erfuhr man allerdings nicht. Gerstner … früher war ich oft bei ihm zu Gast gewesen. Meinen ersten Abend in seinem Lesekreis würde ich nie vergessen. Damals hatte ich mich ziemlich blamiert und daraufhin gefürchtet, nie wieder eingeladen zu werden. Diese Angst war freilich unbegründet gewesen. Nun aber, nach Jahren regelmäßigen geselligen Beisammenseins, war unser Kränzchen zerstreut und der Kontakt so spärlich, dass ich erst aus der Zeitung erfahren musste, dass der verehrte Herr Stadtsyndikus auswärts gewesen war. Lustlos legte ich das Blatt beiseite und trat ans Fenster. Ich blickte hinab auf den Marktplatz mit dem schönen Willibaldsbrunnen. Gewöhnlich herrschte hier reges Treiben. Heute jedoch wirkte der Platz wie ausgestorben. Schwere, graue Wolken hingen über der Stadt und ab und zu ging aus ihnen ein kalter Schauer nieder, der manchmal sogar in Graupel oder gar Schnee überging. Kein Wunder, denn von Norden wehte ein frostiger Wind. Die Eisheiligen machten ihrem Namen dieses Jahr alle Ehre und man tat gut daran, in der warmen Stube zu bleiben. Nicht weniger ungemütlich als der kalte Nordwind aber war der politische Sturm, der uns von Westen drohte und der geeignet war, ganz Europa in Aufruhr zu versetzen. Vor etwa drei Wochen hatte Frankreich auf Drängen des Nationalkonvents dem jungen Thronfolger Franz, dem künftigen König von Österreich-Ungarn, den Krieg erklärt. Das wiederum hatte Preußen, das im Jahr zuvor gemeinsam mit Österreich eine Deklaration zum Schutz des französischen Königs vor den Revolutionären unterzeichnet hatte, dazu bewogen, seinerseits Frankreich den Krieg zu erklären. Die Lage war verworren. Jedenfalls hatte ich bislang recht wenig in Erfahrung bringen können. Dennoch konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, die Ereignisse im fernen Paris wirkten bis hierher, in unsere kleine Stadt und der eisige Hauch des Umsturzes hätte nicht nur unseren Lesekreis auseinander geblasen. Nein, plötzlich war alles anders! Lediglich die Statue des heiligen Willibald thronte stoisch und erhaben wie eh und je in der Mitte des großen Brunnens. Gleichmütig und scheinbar von allen Veränderungen unangefochten blickte unser Schutzpatron auf die Stadt.
Ottilie und ich bewohnten eine geräumige, repräsentative Wohnung in bester Lage am Marktplatz. Wenn ich das Fenster geöffnet und mich weit hinausgelehnt hätte, hätte ich zu meiner Rechten die Normalschule sehen können. Doch ich vermied diesen Anblick nicht nur mit Rücksicht auf das ungemütliche Wetter. Wenn ich ehrlich war, versetzte mir der Anblick des Gebäudes auch Monate nachdem ich retiriert war, noch leichte Stiche ins Herz.
Fürstbischof Johann Anton von Zehmen hatte sein Versprechen wahr gemacht und mich schließlich zum Leiter der Normalschule ernannt, die ich gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen Martin Sausenhover aufgebaut hatte. Bis zum Tod seiner Exzellenz vor nunmehr fast zwei Jahren war ich dieser Aufgabe mit Begeisterung nachgekommen. Es hatte mir Freude bereitet, jungen Männern die Normen des Unterrichtens zu vermitteln und aus ihnen tüchtigere Lehrer zu machen, als es ihre Vorgänger gewesen waren. Johann Anton hatte mir bei der Erarbeitung des Lehrstoffes weitgehend freie Hand gelassen. Sein Nachfolger, Graf von Stubenberg, mochte ein glühender Katholik, guter Bischof und freundlicher Landesherr sein, auch war er mir als gebürtiger Grazer im Zungenschlag näher als der sächselnde von Zehmen – dennoch fanden wir nie wirklich zueinander. Wo Johann Anton mir mit einer freundlichen Gleichgültigkeit begegnet war, fühlte ich mich von seinem Nachfolger nicht nur zunehmend kritisch beäugt, sondern sogar in meinen Plänen behindert. Das Schulwesen lag ihm weit weniger am Herzen als die Ausgestaltung seiner Privatgemächer im neuesten Stil, die Anschaffung neuer Galauniformen für seine Geheimen Räte oder die cappae magnae, offene Mäntel mit langer Schleppe, für die Mitglieder des Domkapitels. Das alles kostete Geld und so hatte seine Exzellenz die verbesserte Ausgestaltung der Normalschule, die sein Vorgänger angestoßen hatte, kurzerhand wieder zurückgenommen. Meine Enttäuschung darüber war grenzenlos und so hatte ich mich schließlich entschlossen, ihn um meine Demission zu bitten und mich ins Privatleben zurückzuziehen. Endlich, so hoffte ich, konnte ich mich ausgiebig meinen eigenen Interessen und Studien widmen. Finanziell bereitete mir dieser Entschluss keine Probleme. Ich konnte mir ein Leben als Privatier ohne weiteres leisten. Das Juweliergeschäft meines Bruders in Wien, dessen stiller Teilhaber ich war, lief erfreulich gut, um nicht zu sagen hervorragend. Ja, mein Bruder hatte es inzwischen sogar zum Hoflieferanten gebracht. Die vornehmsten Kunden gingen bei ihm ein und aus. Dazu hatte ich noch die Einnahmen von meiner Wiener Wohnung, die ich seit meinem Wegzug von dort vermietet hatte. Im Vergleich zu diesen Einkünften war mein Salär als Leiter der Normalschule ohnehin nur gering, ja geradezu lächerlich gewesen. Doch wie gesagt, hatte mir die Tätigkeit Freude bereitet. Aus diesem Grunde spielte ich auch mit dem Gedanken, nach dem Ausscheiden aus dem Dienst in Anlehnung an Felbigers Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen ein ähnliches, jedoch fortschrittlicheres Werk zu verfassen. Darin sollten auch die Lehren Rousseaus und die anderer führender Köpfe unserer Zeit Eingang finden. Ich hatte gehofft, mein verehrter Freund, der Dompropst Graf Cobenzl, werde mich bei meinem Vorhaben unterstützen. Tatsächlich war er begeistert gewesen, als ich ihm meinen Vorschlag im Sommer des vergangenen Jahres unterbreitet hatte. Das lag zum einen sicher daran, dass Cobenzl den modernen Wissenschaften gegenüber äußerst aufgeschlossen war und ihm aufrichtig daran lag, das Licht der Erkenntnis in die Welt zu tragen. Zum anderen konnte ich mich aber auch des Eindrucks nicht erwehren, es bereite ihm eine gewisse, fast diebische Freude, unserem neuen Fürstbischof, dem die moderne Philosophie ebenso ein Dorn im Auge war wie Cobenzls Lebensweise, mit dieser Unternehmung ein wenig zu ärgern.
Weit waren wir mit unserem Vorhaben allerdings nicht gekommen. Am 31. März diesen Jahres war mein guter Freund völlig unerwartet am hitzigen Fieber verstorben. Vier Tage später wurde er abends unter Läuten aller Glocken in- und außerhalb der Stadt im Mortuarium feierlich beigesetzt. Er war erst achtundvierzig Jahre alt gewesen. Sein Dahinscheiden riss eine ähnlich große Lücke in mein Leben wie seinerzeit der frühe Tod meiner ersten Frau Clara. Auch jetzt, gute sechs Wochen nach Cobenzls Ableben, konnte ich den Verlust noch immer nicht fassen. Aller häuslichen Behaglichkeit zum Trotz fühlte ich mich wie verloren, die ganze Stadt schien mir verwaist. Der Dompropst in seiner leutseligen, allem Weltlichen zugeneigten Art, war für mich das Zentrum aller Geselligkeit gewesen. Es war zum Exempel maßgeblich seinem Einsatz zu verdanken gewesen, dass wir im vergangenen November und Dezember die Fallerische Schauspielgesellschaft in unserer Stadt hatten, die unter anderem Shakespeares Macbeth und Mozarts Entführung aus dem Serail zur Aufführung brachte. Letztere freilich, man muss es leider zugeben, mit allenfalls mittelmäßigen Sängern. Nach derlei Vergnüglichkeiten stand mir im Moment zwar nicht der Sinn, doch Cobenzls Tod würde neben meinem persönlichen Verlust seiner treuen Freundschaft auch für das gesellige Leben der Stadt einen unwiederbringlichen Verlust bedeuten. Dessen war ich mir sicher. Und dieses Gefühl war in den letzten Tagen sogar noch schlimmer geworden. Denn nun war auch der letzte Dienst, den ich meinem verstorbenen Freund erweisen konnte, endgültig abgeschlossen. Cobenzls Bruder, Johann Philipp, war zwar eilends zur Beerdigung aus Wien angereist, doch musste er Eichstätt nur wenige Stunden nach der Beisetzung auch schon wieder verlassen. Die politischen Umstände erforderten es. Der junge, noch völlig unerfahrene Franz, Erzherzog von Österreich sowie Herr der übrigen Länder der Habsburgermonarchie, künftiger König von Ungarn und in wenigen Monaten wohl auch Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, bedurfte in dieser allgemein fragilen Situation der Unterstützung erfahrener Köpfe. Und Johann Philipp, dessen war ich mir sicher, wollte die Gunst der Stunde nutzen und seinen Einfluss auf den künftigen Kaiser festigen. Daher hatte der Graf mich mit der Abwicklung des Testaments betraut. Mein verstorbener Freund hatte nicht nur eine umfangreiche Bibliothek von etwa viertausend Bänden sein Eigen genannt, sondern auch leidenschaftlich wissenschaftliche Instrumente gesammelt. So galt es, diesen wertvollen Bestand erst einmal zu katalogisieren, um anschließend nach Wien zu schreiben und sich abzustimmen, wie mit der Hinterlassenschaft weiter zu verfahren sei. Mein größtes Augenmerk aber galt dem Garten meines verblichenen Freundes. Die weite, im englischen Stil gehaltene Anlage war sein ganzer Stolz gewesen. Cobenzls Garten mit dem reizenden Pavillon, einem herrlichen Rosengarten, einem Bienenhaus, ja sogar einer Kegelbahn, war in der ganzen Stadt berühmt gewesen. Er lag jenseits der Altmühl vor den Toren der Stadt und wenn man ihn besuchen wollte, musste man sich vom Stadtfischer mit dem Kahn übersetzen lassen. Das war zwar ein wenig umständlich, hatte aber auch den Vorteil, vor allzu neugierigen Blicken geschützt zu sein. Wie oft hatten wir Freunde uns alle dort getroffen, hatten der Musik gelauscht und waren auf den terrassierten Wegen flaniert. Cobenzl hatte zahlreiche Bänke und andere Sitzgelegenheiten aufstellen lassen, von denen man den Blick in die Landschaft schweifen lassen konnte. Am zauberhaftesten aber war die kleine Grotte, die er in den Fels hatte hauen lassen. Auch sie bot Sitzgelegenheit und diente uns an manchem lauen Sommerabend als Treffpunkt. Wie oft hatten wir dort über die eine oder andere Neuerwerbung aus Cobenzls Bibliothek diskutiert! In der Grotte hatte er uns Auszüge aus Kants Kritik der reinen Vernunft oder aus Lessings Bühnenstücken vorgelesen. Wir waren nicht immer derselben Meinung, doch vielleicht gerade deshalb waren die Debatten stets bereichernd gewesen und hatten unsere Freundschaft noch vertieft. Nun erinnerte ich mich voller Wehmut daran, wie uns Cobenzl einmal voller Inbrunst ein Gedicht eines gewissen Schiller vorgetragen hatte, das es ihm besonders angetan hatte. Es trug den Titel Ode andie Freude und feierte in überschwänglichen Tönen die Freundschaft. Mir war der Text damals zu pathetisch gewesen. Doch was hätte ich in diesem Moment darum gegeben, diese Worte noch einmal aus Cobenzls Mund zu hören! Natürlich hatten wir dort auch über die Ereignisse in Paris gesprochen. Wir alle waren vom Kampf der tapferen Franzosen für bürgerliche Freiheitsrechte und eine konstitutionelle Monarchie begeistert gewesen. Die Nationalversammlung hatte eine Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verabschiedet, die in siebzehn Artikeln die Rechte festlegte, die jedem Franzosen unveräußerlich als Mensch und als Bürger Frankreichs zuerkannt wurden. Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit! Wir hatten geglaubt, nun endlich lang ersehnte Ziele verwirklicht zu sehen. Nun, knappe drei Jahre später, schien das alles wie eine Illusion.
Mein Freund war noch nicht wirklich unter der Erde, da gab es auch schon Verwüstungen in seiner prächtigen Anlage zu beklagen. Zwar hatte seine Exzellenz sofort im Intelligenzblatt ankündigen lassen, die mutwilligen Frevler hart zu bestrafen, doch konnte ich mich des Verdachts nicht erwehren, er tue dies nur pro forma. Gott verzeihe mir, wenn ich ihm Unrecht tat, doch im tiefsten Inneren meinte ich sogar, Graf von Stubenberg selbst könnte die Übeltäter zu ihrem Tun angestachelt haben. Es war ein offenes Geheimnis, dass Cobenzls Anlage beziehungsweise die Treffen und Feste, die der Dompropst dort regelmäßig abgehalten hatte, seiner Exzellenz ein beständiges Ärgernis gewesen waren. Noch dazu eines, das er buchstäblich immer vor Augen gehabt hatte. Denn die fürstbischöfliche Sommerresidenz mit ihrem Park im strengen französischen Stil lag Cobenzls Anlage direkt gegenüber, diesseits der Altmühl. Der friedlich dahinfließende Fluss bildete an dieser Stelle die Trennlinie zweier unvereinbarer Weltanschauungen. Trotzdem musste Graf Stubenberg schon mit Rücksicht auf Cobenzls einflussreichen Bruder Johann Philipp offiziell gegen die mutwillige Verwüstung des ihm ungeliebten Gartens vorgehen. Der Erhalt der prächtigen Anlage war Johann Philipp ein besonderes Anliegen gewesen. Doch natürlich konnte er sich von Wien aus nicht um dieses Besitztum kümmern. So hatte er mich vor seiner Abreise noch einmal ausdrücklich gebeten, mich nach einem geeigneten Käufer umzusehen. Die Suche hatte einige Wochen in Anspruch genommen. Von den etablierten Eichstätter Domherren oder Beamten wollte sich niemand zum Kauf entschließen. Entweder fehlten ihnen die finanziellen Mittel oder der Mut. Nun hatte ich in Freiherr von Hompesch endlich einen würdigen Interessenten gefunden. Er war gerade dreißig und mir zuvor nur flüchtig von Cobenzls Erzählungen bekannt gewesen. Der hatte große Stücke auf ihn gehalten. Sie kannten sich seit Langem aus gemeinsamen Zeiten in Lüttich und später auch in Eichstätt. Hompesch war allerdings nicht lange in der kleinen Domstadt geblieben, sondern hatte sich anderweitig umgesehen. Doch hatten Cobenzl und er viele Jahre in regem Briefkontakt gestanden. Hompesch hielt sich die meiste Zeit in Berg bei Düsseldorf auf, wo er als Assessor des Herzogs tätig gewesen war. Nun hatte er vor einigen Wochen die Nachfolge meines Freundes als Domkapitular angetreten und war fest entschlossen auch dessen Parkanlage zu übernehmen. Er schien ein ernstzunehmender Mann zu sein, der wusste, was er wollte und dabei angenehme Umgangsformen besaß. Ein wenig erinnerte er mich in seinem selbstbewussten Auftreten an meinen Bekannten Johann Pezzl, ein Freigeist und kritischer Denker, der seit vielen Jahren in Wien lebte. Der Mord an seinem Bruder hatte ihn vor einige Jahren nach Eichstätt geführt und unsere Bekanntschaft begründet. In seiner Denkart war ihm der junge Freiherr von Hompesch sicher ähnlich, doch war sein Auftreten deutlich distinguierter. Er schien eher ein Mann der leisen Töne zu sein. Kurz, er machte einen guten Eindruck auf mich und ich hatte sein Kaufinteresse sofort nach Wien weitergeleitet. Dies war die letzte Aufgabe im Zusammenhang mit der Testamentsabwicklung gewesen, die ich noch zu erledigen gehabt hatte. Eigentlich hätte ich mich nun ganz meinen Studien hingeben können. Eigentlich … Ich hätte glücklich sein können. Aber ich war es nicht.
»So kann’s nicht weitergehen!« Ottilies zorniger Ausruf riss mich aus meinen wehmütigen Erinnerungen unsanft in die Gegenwart zurück. Verwundert drehte ich mich zu ihr um. Doch meine liebe Frau hatte bei ihrer Äußerung keineswegs meine Gemütsverfassung im Sinn, wie sich herausstellen sollte.
»Ich mache mir Sorgen. Dieser Brief gestern, wirklich, so kann’s nicht weitergehen!«
»Ich verstehe nicht …«
»Ich meine Babettes Brief, den, der gestern hier angekommen ist. Das heißt, nicht nur den von gestern, sondern eben überhaupt. Wirklich, Francobaldi, so kann’s nicht weitergehen!«
»Ja, was stört dich denn? Deiner Tochter geht es doch gut.«
»Gut, ja, zu gut! Da schreibt sie von Spazierfahrten hier und Einladungen dort, Soiréen, an denen dieses Fräulein von Gleizenstein teilgenommen hat und wen sie dort getroffen hat. Da berichtet sie uns seitenlang über Mozarts Tod und irgendwelchen Gerüchten, die darüber im Umlauf sind, Wiener Klatsch und Tratsch – als ob uns das irgendwie interessieren oder gar etwas angehen würde. Die Menschen sterben nun einmal. Manche auch jung und unerwartet. Denk nur an Cobenzl. Gut, er war schon immer von einer schwächlichen Konstitution. Trotzdem hat doch niemand mit seinem Ableben gerechnet. Aber um nicht vom Thema abzukommen: Babette hat offenbar nur noch Vergnügen im Sinn!«
»Und das beunruhigt dich?«
»Ja, wahrhaftig, mein Lieber, das beunruhigt mich! Sogar mehr als das. Es bereitet mir ernsthafte Sorge. Ich habe Angst, sie könnte sich überheben. Überlege doch bitte einmal! Welcher anständige Handwerker soll sie denn heiraten, wenn das so weitergeht? Ich hatte nichts dagegen, dass sie gemeinsam mit Adam nach Wien geht. ›Gut, dachte ich. Dann lernt sie im Haushalt deines Bruders die feine Wiener Küche kennen. Das kann nicht schaden.‹ Auch gegen die Übersiedelung zu diesem Fräulein von Gleizenstein hatte ich anfangs nichts. Wieder dachte ich ›Gut. Da kann sie auch noch feinere Umgangsformen lernen. Sie lernt feines Porzellan und Kristall kennen und vornehmere Tischsitten als ich sie ihr beibringen könnte. Das könnte ihr für ihre Verheiratung nützlich sein. Wer weiß, vielleicht hält ja später sogar ein Hofbeamter um ihre Hand an. Dann wüsste sie, Gäste standesgemäß zu empfangen und ein vornehmes Haus zu führen.‹ Aber jetzt? Das Mädel hat nur Flausen im Kopf! Nur Zerstreuung, Kunst und Klavierspiel. Von Kenntnissen der Haushaltsführung schreibt sie nichts. Wenn das so weitergeht, ist sie weder für einen Handwerker noch für einen Beamten die Passende und dann endet sie noch als alte Jungfer oder gar noch Schlimmeres, woran ich gar nicht denken und was ich noch weniger aussprechen möchte.«
»Also wirklich. Ich finde, du übertreibst. Babette ist in guten Händen, um nicht zu sagen in bester Gesellschaft. Sie trifft Personen von Stand, sie lernt zu konversieren. Dank Fräulein von Gleizenstein lernt sie etwas von der Welt kennen.«
»Gute Gesellschaft – was heißt das schon? Ständig ist sie unterwegs: Mal sind sie zur mehrwöchigen Kur in Karlsbad und machen von dort einen Abstecher nach Prag, mal geht’s nach Budapest und jetzt schreibt sie gar von Reiseplänen nach Triest, Mailand, Verona und Venedig! Wirklich, Francobaldi, ich bitte dich inständig. Wir müssen das Mädel zurückholen! Wir müssen nach Wien. Ich möchte persönlich mit der von Gleizenstein sprechen und ihr die Sache erklären. Und meine Babette nehme ich wieder mit nach Hause, selbst wenn sie sich auf den Kopf stellt!«
Mein Eheweib war eine gutmütige Person, die nichts so schnell aus der Ruhe bringen konnte. Wenn sie aber einmal der Furor gepackt hatte, das wusste ich mittlerweile aus Erfahrung, hatte es keinen Zweck mit ihr zu disputieren. Andererseits … Vielleicht war eine Reise nach Wien gar keine so schlechte Idee. Ich hatte zwar keineswegs vor, meine liebe Stieftochter aus der Stadt, in der sie sich so offenkundig wohl fühlte, fortzureißen. Aber einmal nachzusehen, wie es ihr und ihrem Bruder ging, konnte nicht schaden. Graf Johann Philipp Cobenzl hatte mich zum Dank für meine Mühen bei der Abwicklung des Testaments ohnehin zu sich eingeladen. Vielleicht war das nun, nachdem dieser letzte Freundschaftsdienst an seinem Bruder abgewickelt war, eine gute Gelegenheit das grässliche Gefühl der Leere, das mich quälte, hinter mir zu lassen. Vielleicht würde ein Tapetenwechsel mich tatsächlich auf neue Gedanken kommen lassen. Versuchen konnte ich es zumindest. So griff ich den Vorschlag meiner lieben Gattin also dankbar auf.
Die Reise
ie Kälte war endlich doch gewichen und mit einem Schlag war es Frühling geworden. Die Farben kehrten zurück. Kaum waren Veilchen, Schlüsselblumen und Küchenschellen verschwunden, standen die Obstbäume in voller Blüte und kurz darauf blühten auch schon überall an den Waldrändern die Akeleien in allen Farbschattierungen zwischen zartrosa, blau und dunkelviolett, der Weißdorn stand übersät mit zarten Blüten und aus manchen Gärten drang der schwere, süße Duft des Flieders. Die Wiesen waren übersät von Hahnenfuß und Margeriten. Die Bienen schwärmten wieder und in Cobenzls Park würde sich der künftige Besitzer bald an den ersten duftenden Rosen erfreuen können. Über der friedlich dahinfließenden Altmühl sausten Libellen und die Schwalben hatten schon ihre Nester gebaut.
»Besser können wir’s nicht treffen. Die Wege sind trocken und gut passierbar. Das Wetter ist angenehm, nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Ein wunderbarer Zeitpunkt, um unsere Reise anzutreten. Unser heimisches Intelligenzblatt wird in seiner nächsten Ausgabe vermelden können, dass der Herr Francobaldi nebst Gemahlin durch das Ostentor ausgereist ist.«
Es würde sicher Wochen dauern, bis die Bürger der Stadt lesen konnten, wir seinen wieder repatriiert. Zu meiner Freude hatte Ottilie meinem Vorschlag zugestimmt, nicht auf schnellstem Wege nach Wien zu eilen, sondern uns auf der Reise Zeit zu nehmen und unterwegs einige Städte und Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Ursprünglich hatte sie zwar Bedenken gehabt, den Haushalt für so lange Zeit allein der Obhut der Magd anzuvertrauen, aber ihre älteste Tochter sowie die Schwiegertochter hatten sich bereit erklärt, regelmäßig nach dem Rechten zu sehen. Ich fühlte mich mit einem Mal wie befreit und mein Lebensmut kehrte zurück. Endlich war Schluss mit dem tristen Einerlei träge zerrinnender Tage! Wir würden Neues entdecken und viele schöne Begegnungen haben. Wir würden Adam wieder sehen, der nun seine Studien bald beendet hatte, Ottilie würde endlich meinen Bruder, also ihren Schwager, und dessen Frau kennenlernen. Ich war mir sicher, dass wir uns alle prächtig verstehen würden. Ich konnte endlich einmal alte Wiener Bekannte wieder treffen. Wir würden in Parks flanieren, Konzerte und die Oper besuchen, uns an der Schönheit der Stadt erfreuen – und schließlich und endlich konnte Ottilie ihrer Tochter ins Gewissen reden. Ich war mir allerdings nach wie vor nicht sicher, ob das erfolgreich sein würde, ja, ob es überhaupt nötig war. Wie so ganz anders war doch diese Fahrt zurück in meine ehemalige Heimatstadt, anders als vor einigen Jahren meine Reise von dort nach Eichstätt in eine ungewisse Zukunft. Und nun? Nun hatte ich längst ein Zuhause gefunden und nannte nicht nur eine Frau, sondern gar eine Familie mein Eigen. Ich hatte diesmal Pezzls Buch Reise durch den Baierschen Kreis im Gepäck und wollte Ottilie während der Fahrt daraus vorlesen. Pezzl hatte einige Jahre zuvor die Eindrücke seiner Reise von Passau donauaufwärts festgehalten. Wir würden nun einem Teil seiner damaligen Reiseroute in umgekehrter Richtung folgen. Zunächst aber fuhren wir mit der Postkutsche die Altmühl abwärts über Dietfurt und Essing nach Kelheim. Dort mündete der Fluss in die Donau, der wir nun den Rest unserer Reise folgen würden.
Unser erster wirklicher Aufenthalt war die Freie Reichsstadt Regensburg. Hier wollten wir zwei Tage zubringen. Pezzl hatte dort zwar ganz offensichtlich nicht sehr viel Charme entdecken können und beschrieb sie als eine finstere, melancholische und in sich selbst vertiefte Stadt. Doch ich wollte mir selbst ein Bild machen. Wir quartierten uns im »Goldenen Kreuz« ein, dem besten Gasthof der Stadt, in dem weiland schon Kaiser Ferdinand I. und Kaiser Karl V. residiert hatten, wie uns der Wirt mit sichtlichem Stolz erzählte. Seine Erläuterungen verfehlten ihre gewünschte Wirkung keineswegs. Wir beide waren von der Geschichtsträchtigkeit, ja Würde unseres Domizils durchaus beeindruckt. Von unserem Gasthaus zum Dom waren es nur wenige Gehminuten. Die Kirche war dem heiligen Petrus geweiht.
»Der ist ja noch viel größer als unser Dom in Eichstätt! Da kann unserer leider nicht mithalten. Allein schon dieses Portal! Hier hat man ja wirklich das Gefühl, als beträte man eine andere Welt. Schau, die herrlichen Glasfenster! Und dort, der Hochaltar – nur Gold und Silber, dass die Augen fast geblendet werden von all dem Glanz!«
Wie ich erwartet hatte, war Ottilie mehr als beeindruckt und ihr Staunen war durchaus berechtigt. Ich aber fühlte mich nun doch in meiner Ehre als ehemaliger Wiener gekränkt.
»Ja, ja, alles schön und recht und verglichen mit Eichstätt natürlich beeindruckend. Aber warte, bis wir erst in Wien sind. Da wirst du richtig Augen machen. Denn an unseren Stephansdom, den Steffl, wie wir Wiener ihn nennen, kommt nicht einmal der Regensburger heran. Warte nur, bis du erst das berühmte Dach unseres Steffls siehst. Das ist nicht einfach nur ein Dach. Das ist ein Kunstwerk für sich. Es besteht aus glasierten Ziegeln, die ein wundersames Muster bilden.«
Ottilie nahm meine Schwärmereien recht unbeeindruckt auf. Ganz offensichtlich wollte sie sich ihre augenblickliche Begeisterung für Regensburg nicht durch künftige Attraktionen rauben lassen. An der Donau herrschte reges Treiben. Der Fluss diente seit alters her zum Warentransport und als Handelsroute. Und so gab es auch einige Kaufmannsfamilien hier. Freilich nicht so berühmte wie einstmals die Fugger und Welser in Augsburg oder die Nürnberger Patrizier ferner Jahrhunderte. Doch behauptete Pezzl in seiner Schilderung der Stadt, dass über die ansässigen Speditionsgesellschaften das gesamte Umland mit Waren wie Tabak, Kaffee, Zucker, Eisen, Wachs und Stoffen versorgt werde. Das schien mir durchaus glaubhaft. In der Stadt gab es noch einige steinerne Zeugen alter Kaufmannsherrlichkeit in Form von Geschlechtertürmen. Sie waren in der Tat eindrucksvoll. In seiner Reisebeschreibung empfahl Pezzl auch die berühmte Steinerne Brücke, die bereits seit dem Mittelalter die Donau überspannte, zu überqueren und die kleine Siedlung Stadtamhof aufzusuchen.
»Dort drüben ist man schon auf bayerischem Gebiet und von einem kleinen Hügel aus hat man dann eine schöne Aussicht. Nach Süden auf die Stadt und nach Norden in die Landschaft der Oberen Pfalz. Was meinst du, sollen wir diesen kleinen Ausflug wagen?«
Ottilie war einverstanden und so überquerten wir die alte Donaubrücke, um uns von der Freien Reichsstadt auf die bayerische Seite hinüberzubegeben. Wieder zurück in der Stadt dinierten wir dann köstlich. Sogar die Betten, die in unserem letzten Quartier kaum mehr als einfache Strohsäcke gewesen waren, waren leidlich bequem. Selig aneinandergeschmiegt wie schon lange nicht mehr schliefen wir schließlich ein. Wir verbrachten noch einen weiteren Tag in der schönen alten Stadt, bewunderten die Auslagen der Geschäfte und ließen es uns gut gehen.
Tags darauf führte uns unser Weg weiter in Richtung Straubing. Ich überlegte kurz, ob wir nicht einen kleinen Abstecher in südliche Richtung nach Kloster Mallersdorf machen sollten, wo Pezzls Vater Klosterbäcker gewesen war, verwarf den Gedanken aber alsbald wieder. Viel zu sehen gäbe es dort wahrscheinlich nicht und ich scheute den beschwerlichen Weg auf schlecht ausgebauten Pfaden. Er würde uns nur einen unnützen Tag zusätzlicher Reisezeit und ein wenig bequemes Quartier bescheren. Also weiter der Donau entlang unserem nächsten Ziel entgegen.
»Wenn Pezzl in seiner Beschreibung recht hat, dürften wir heute Abend gut und preiswert speisen. Hör, was er über Straubing schreibt:
Alle Lebensmittel sind in sehr geringem Preise hier. Die Stadt steht mitten in dem besten Kornmagazin. Das Vieh hat gute Weide. Die Donau gibt vortreffliche Karpfen … Wildpret, Butter und Eier kommen aus dem sogenannten Wald … Diese Umstände tragen vermutlich das meiste dazu bei, dass die Straubinger so aufgeräumt und so sehr zur Bonvivanterie geneigt sind.
Pezzl schreibt auch, dass es dort viele Wirtshäuser gibt. Lassen wir uns also überraschen.«
In der Tat fuhren wir durch eine fruchtbare Gegend. Ottilie blickte mit sichtlichem Wohlgefallen auf die vorbeiziehenden Felder.
»Hier die Ernte einzubringen, dürfte ein echtes Vergnügen sein. Ganz anders als auf den steinigen Äckern bei uns daheim. Man könnte glatt neidisch werden, wenn man das sieht.«
Im Gegensatz zu mir hatte sie in der vollbesetzten Kutsche einen Fensterplatz ergattert. Ich dagegen saß eingezwängt zwischen einem beleibten, übel nach Schweiß riechendem Geistlichen und einem jungen Mann, der offenbar noch seinen Rausch vom Tag oder der Nacht zuvor ausschlafen musste und dabei von Zeit zu Zeit laut schnarchte. So hatte ich wenig Muße, mich der Landschaft zu widmen. Zu meinem Leidwesen blieben beide bis Straubing unsere Begleiter. Eine gute Mahlzeit und einen kräftigen Schluck Wein hatte ich mir am Ende dieses Tages wahrhaftig verdient gehabt! Unsere Erwartungen diesbezüglich wurden nicht enttäuscht. Das Essen, das man uns servierte, war deftig und ohne besondere Raffinesse zubereitet, aber wohlschmeckend. Hungrig wie wir waren, machten wir uns vergnügt über die üppigen Würste, das kräftige Brot und das Kraut her. Wein hatte unsere Unterkunft allerdings wenig zu bieten, dafür war das Bier angenehm kühl und süffig. Satt, zufrieden und todmüde schliefen wir ein, sobald wir unsere müden Häupter auf die Kissen gebettet hatten. Morgen würde es in aller Frühe weitergehen.
Unsere Ankunft in Passau am darauffolgenden Tag hätte nicht schöner sein können. Die Stadt empfing uns im Abendrot und unter feierlichem Glockengeläut vom nahen Dom her. Es war der Tag der letzten Maiandacht.
»Schade, dass wir nicht ein wenig früher hier eingetroffen sind«, meinte Ottilie. »Dann hätten wir der Andacht beiwohnen können. Der Dom ist sicher wunderbar reich mit Blumen geschmückt. Na ja. Wenigstens bleibt uns morgen früh noch ein bisschen Zeit zur Besichtigung.«
Pezzl erwähnte in seiner Beschreibung Passaus auch eine gut sortierte Buchhandlung, die ich gerne aufgesucht hätte. Angeblich führte ein gewisser Herr Rothwinkler dort sogar Werke von Rabelais, Voltaire und Grécourt. Zumindest war es so gewesen, als Pezzl sein Buch geschrieben hatte. Das war allerdings mittlerweile bereits acht Jahre her. In der Zwischenzeit hatte sich manches verändert und die jüngsten Ereignisse in Frankreich ließen es vielleicht nicht mehr geraten sein, französische Literatur zu vertreiben. Heute war es für einen Besuch bereits zu spät und auch morgen würden wir sicher keine Zeit dazu finden. Andererseits waren wir ja bald in Wien. Dort würde ich nach Lust und Laune stöbern können. An diesem Abend genossen wir den milden Mai im Freien. Wir nutzten die Dämmerstunde, um uns nach der langen Fahrt eng gedrängt mit weiteren Reisenden in der unbequemen und stickigen Kutsche an der Donaupromenade nun endlich ein wenig die Beine zu vertreten und die frische Luft zu genießen, die vom Fluss her wehte.
»Soweit ich weiß, vereinigen sich gleich hinter Passau die Flüsse Ilz und Inn mit der Donau. Der Fluss wird dann merklich breiter. Das werden wir morgen bald nach unserer Abreise von hier sehen.«
Den folgenden Vormittag wollten wir für eine kurze Besichtigung nutzen. Wie der Steffl in Wien war auch der Passauer Dom dem heiligen Stefan geweiht. Vor dem Kirchenportal begegneten wir einem Mann auf Krücken. Seine Kleidung war schäbig und verdreckt. Sein linker Fuß war verkrüppelt und ebenso seine Hand, so dass er Mühe hatte, seine linke Krücke überhaupt zu halten. Ganz offensichtlich ein Bettler, wie man sie so oft auf den Eingangsstufen der großen Kirchen vorfand. Die wenigen Münzen, die ihnen Mitleidige zusteckten, reichten kaum für ein kümmerliches Leben. Angesichts der Unzahl dieser ärmlichen Kreaturen war es aber unmöglich, sie alle zu unterstützen.
»Wünschen die Herrschaften eine Kirchenführung?«
Dieses ungewöhnliche Angebot erstaunte mich und ich nickte nur zögerlich. Ein wenig Zeit hatten wir bis zur Abfahrt unserer Kutsche noch. Nicht, dass ich mir von dieser Elendsgestalt irgendwelche kunsthistorischen Kenntnisse erwartet hätte, aber er tat mir leid. Er schien noch relativ jung zu sein, dennoch war sein Gesicht bereits ausgezehrt. Wahrscheinlich litt er dauerhaft unter Schmerzen. Zu meinem Erstaunen bewies er im Kircheninneren mehr Kenntnisse, als ich es ihm zugetraut hätte. So erfuhren wir etwa, dass das mittelalterliche Gotteshaus bei einem Stadtbrand schwer beschädigt worden und große Teile schließlich eingestürzt waren. Infolgedessen habe man die Kathedrale nach den Plänen eines italienischen Architekten im neuen Stil wieder aufgebaut.
»Hier seht, die vergoldete Kanzel. Ist sie nicht ein Prachtwerk? Geschaffen hat sie übrigens ein Wiener Künstler, der Hoftischler Johann Georg Series. Auch zu den Seitenaltären gäbe es noch eine Menge zu sagen. Vor allem aber möchte ich die verehrten Herrschaften auf unsere Orgel aufmerksam machen. Sie besitzt drei Manuale, eine Seltenheit, die es sonst nur noch im Salzburger Dom gibt. Außerdem hat sie eine 32'-Fußlage. Das bedeutet, dass die längste Orgelpfeife sechsmal größer als ein Mensch ist. Wie gesagt, das ist eine echte Seltenheit. Wirklich schade, dass Ihr sie jetzt nicht hören könnt. Ich versichere Euch, das Orgelspiel hier ist ein wirklicher Genuss! Man könnte fast meinen, man sei schon im Himmel.«
Allmählich konnte ich meine Neugierde nicht mehr bremsen. Woher hatte diese armselige Gestalt all dieses Wissen?
»Das ist eine lange Geschichte, mein Herr. Ich bin im Waisenhaus aufgewachsen, meine Eltern habe ich nie kennengelernt und auch sonst keine Verwandten. Aber weil ich eine sehr schöne Singstimme hatte, sind die Patres auf mich aufmerksam geworden. Man hat mich schließlich im Domchor untergebracht und weil ich auch sonst musikalische Begabung bewies, hat man mich im Orgelspiel unterrichtet. Ich durfte bereits aushilfsweise zu einigen Gelegenheiten spielen; doch dann ereilte mich ein Unglück. Ein großer Stein fiel von einer Baustelle herab und zerschmetterte mir Hand und Fuß. Da war es mit meiner Organistenlaufbahn natürlich aus.« Er seufzte. Dann fuhr er fort: »Die Kirchenleute kennen mich noch von früher her und dulden es, dass ich von Zeit zu Zeit Fremden wie Euch unseren Dom zeige und mir so ein paar Kreuzer verdiene.«
Unser Führer hätte uns gerne noch weitere Kunstwerke gezeigt, doch dazu reichte die Zeit nicht mehr. So verabschiedeten wir uns also.
»Was für eine traurige Geschichte! Ich hoffe, du hast ihm wenigstens einen ordentlichen Lohn zugesteckt, diesem armen Kerl. Ich begreife einfach nicht, wie hart das Leben bisweilen sein kann. Da schafft es dieser junge Mann durch eigene Tüchtigkeit aus dem Waisenhaus heraus in eine einigermaßen gesicherte Existenz zu gelangen und dann schlägt das Schicksal erneut erbarmungslos zu. Gottes Wege sind unergründlich, pflegt man in solchen Fällen zu sagen. Aber ganz ehrlich, Francobaldi, manchmal könnte man bei solchen Schicksalen doch fast an seiner Güte und Gnade zweifeln.«
Das Schicksal jenes jungen Mannes ging uns auch während der Fahrt noch nach. Wir saßen die meiste Zeit schweigend. An diesem Tag wollten wir Linz erreichen. Ich freute mich schon, Ottilie die Stadt zu zeigen. Das würde uns wieder auf andere Gedanken bringen. Doch es kam anders. Es war schon den ganzen Vormittag über schrecklich schwül gewesen. Das verhieß nichts Gutes und tatsächlich gerieten wir etwa auf halber Strecke in eine heftige Gewitterfront. Es blitzte und donnerte. Doch vor allem goss es wie aus Kübeln. Schwere Regentropfen prasselten hernieder. Im Nu waren die Wege teilweise ausgespült und kaum noch passierbar, so dass wir nur noch langsam vorankamen. Schließlich blieben wir gar mit einem Rad in einem tiefen Schlammloch stecken. Der Kutscher fluchte so laut, dass wir es auch im Wageninneren hören konnten. Er hatte wahrhaftig Grund dazu. Denn so sehr er sich auch bemühte, er bekam die Kutsche nicht mehr flott. Ja ganz im Gegenteil: Je länger er es versuchte, desto tiefer versank das Rad im Matsch. Die Kutsche neigte sich schon bedenklich. Es half alles nichts. Wenn wir keinen Radbruch riskieren wollten, mussten wir Männer uns aus dem Wagen bequemen. Neben mir war nur noch ein weiterer Herr als Passagier an Bord, außerdem drei Frauen. Zu zweit bemühten wir uns, dem Kutscher zu helfen, das Rad wieder freizubekommen. Doch die Mühe war vergeblich. Mitsamt den verbliebenen Insassen war das Gefährt einfach zu schwer. Also mussten schließlich auch die Damen aussteigen und sich Wind und Wetter aussetzen.
»Hau ruck auf drei! Eins, zwei …«
Endlich gelang es uns mit vereinten Kräften, das Rad hochzuheben und aus dem Schlammloch zu ziehen. Wir waren alle nass bis auf die Knochen und von oben bis unten mit Dreck bespritzt. Aber wenigstens konnten wir unsere Fahrt fortsetzen. Bald schon herrschte im Wageninneren eine unangenehm dampfige, von Schweiß getränkte Luft. Mit gut zwei Stunden Verspätung kamen wir endlich durchgerüttelt und ausgefroren erst weit nach Einbruch der Dunkelheit in Linz an. Die Wirtin kredenzte uns nur unwillig zu dieser späten Stunde noch etwas zu essen. Brot, Schmalz und ein wenig kalter Braten waren alles, was wir noch bekommen konnten. Aber hungrig wie wir waren, nahmen wir auch diese einfache Mahlzeit dankbar an.
»Wenn es dir recht ist, fahren wir morgen nur bis Ybbs. Das sind etwa fünfzig Meilen. Dann könnten wir morgen ausschlafen und erst die spätere Postkutsche nehmen. Nach der langen, unerquicklichen Fahrt heute haben wir uns etwas Ruhe verdient. Außerdem könnten wir dann übermorgen bequem das Kloster Melk erreichen. Das möchte ich dir unbedingt zeigen.«
Ottilie war mit meinem ersten Vorschlag einverstanden. An einem Besuch des Klosters lag ihr zu meiner Enttäuschung allerdings wenig.
»Das heben wir uns für die Rückreise auf«, entgegnete sie.
Todmüde von der anstrengenden Reise sank ich schließlich auf mein Kissen.
»Meinst du, das Fräulein wird mich überhaupt empfangen?«
Ich war schon fast eingeschlummert. Ottilies Frage drang kaum mehr in mein Bewusstsein vor. Ich hatte auch keine Ahnung, wovon sie sprach und war viel zu müde, um darüber nachzudenken. So antwortete ich ihr nur noch mit einem Brummen und schon war ich eingeschlafen.
Am nächsten Morgen waren unsere Kleider wieder leidlich trocken und einigermaßen sauber, nachdem meine Frau sie gründlich ausgebürstet hatte. Das Gewitter war vorüber, die Luft angenehm erfrischt und wir konnten unsere Reise fortsetzen. Mit uns stieg nur noch eine Frau ein. Sie hatte einen großen Korb frühreifer Sauerkirschen bei sich und Ottilie und sie kamen sehr bald in eine angeregte Unterhaltung über Kirschen im Allgemeinen und Speziellen und mögliche Verarbeitungsformen von Kirschen, Johannis- oder Stachelbeeren und was sonst noch alles. Derlei Weiberthemen interessierten mich nicht und so schaute ich gedankenverloren hinaus in die Landschaft. Unvermittelt kam mir Ottilies Frage von gestern in den Sinn: ›Meinst du, das Fräulein wird mich überhaupt empfangen?‹ Plötzlich wurde mir bewusst, welche Überwindung es Ottilie kosten musste, Fräulein von Gleizenstein überhaupt um eine Unterredung zu ersuchen. Das Fräulein war immerhin eine Adlige und meine Frau, wie die meisten Bürgerlichen, den Umgang mit höher gestellten Persönlichkeiten nicht gewohnt. Sie mied ihn so gut sie konnte. Meine Freundschaft mit Graf Cobenzl und anderen Personen von Stand aus seinem Umkreis hatte sie stets mit Verwunderung, ja Unverständnis betrachtet. Sie hatte kein Wort dagegen verloren, aber ich hatte bei mehr als einer Gelegenheit gespürt, wie wenig geheuer ihr diese Vermengung, ja Aufhebung der gesellschaftlichen Standesgrenzen stets gewesen war. Schuster, bleib bei deinen Leisten! lautete ihr Wahlspruch. So unbefangen und offen sie mit Ihresgleichen sprach, so scheu zeigte sie sich bei den seltenen Begegnungen mit gesellschaftlich höher gestellten Persönlichkeiten. Unter gewöhnlichen Umständen wäre sie nicht im Traum darauf gekommen, ein adliges Fräulein um eine Unterredung zu bitten oder ihr gar ein Anliegen vorzutragen. Unter gewöhnlichen Umständen hätte dazu auch keinerlei Anlass bestanden. Aber für Ottilie, das wurde mir jetzt schlagartig klar, waren die Umstände alles andere als gewöhnlich. Erst jetzt begriff ich, wie ernst es ihr mit ihrem Vorhaben war. Die Reise war für sie keineswegs zu ihrem Vergnügen gedacht, wie das bei mir der Fall sein mochte. Meine Frau hätte diese Fahrt selbst dann auf sich genommen, wenn sie durch Gebirge oder Wüsteneien geführt hätte. Sie wollte ihre Tochter unbedingt zurückholen – zum Zwecke der Verheiratung. Dafür war sie bereit, jede Mühe auf sich zu nehmen. Je näher wir unserem Ziel kamen, desto entschlossener schien sie mir. Für Sehenswürdigkeiten, die mich faszinierten und die ich ihr unbedingt zeigen wollte, hatte sie keinen Blick mehr. Ottilie war ganz offenkundig auf einer Mission.
Wien