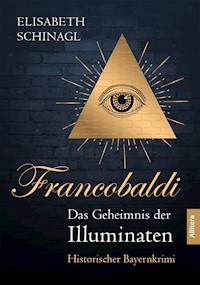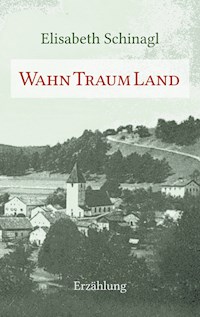Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Italien um 600 n. Chr. Die Langobarden haben weite Teile des Landes erobert. Das Römische Reich ist endgültig zusammengebrochen. Flavius Aurelius Cassiodor, einst höchster Beamter unter dem Gotenkönig Theoderich, erzählt die dramatische Geschichte von Machtkämpfen, Kriegen und religiösem Fanatismus. Entschlossen kämpft er allen Widrigkeiten zum Trotz für die Rettung antiker Wissensschätze und schafft damit die Grundlage für die geistige Wiedergeburt Europas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Elisabeth Schinagl, geb. 1961 in München, studierte Latein und Germanistik in Eichstätt und Regensburg. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für mittellateinische Philologie an der Katholischen Universität Eichstätt und danach Gymnasiallehrerin. Von 2009 bis 2017 war sie als Referentin im Bayerischen Landtag tätig.
Werke von Elisabeth Schinagl
Alles wie immer. Die Wahrheit darf keiner wissen — Fast ein Kriminalroman
Francobaldi — Historischer Kriminalroman
Bayerisches Panoptikum — Geschichte und Geschichten in 21 literarischen Porträts
UND JETZT? — Der Mutmacher und Ratgeber für junge Erwachsene zu persönlichem und beruflichem Erfolg
Soll ich? Darf ich? — Erfolg anders denken. Der Ratgeber für Frauen um die Lebensmitte
Besuchen Sie Elisabeth Schinagl auf ihrer Homepage unter htp://www.elisabethschinagl.de oder auf Facebook.
Man soll entweder rücksichtslos das schreiben, was man glaubt, oder ganz den Mund halten. (Arthur Koestler, Gottes Thron steht leer)
Inhaltsverzeichnis
Kloster Vivarium, Episode I
Incipit Liber Secretus Flavii Magni Aurelii Cassiodori Senatoris Lectori Ignoto Dedicatus
Kloster Vivarium, Episode II
Von meinem Vater
Kloster Vivarium, Episode III
Von Theoderich, Patricius, Magister militum und Königder Goten
Kloster Vivarium, Episode IV
Theoderichs Herkunft und Jugend
Kloster Vivarium, Episode V
Lobpreis Theoderichs
Kloster Vivarium, Episode VI
Rex Gothorum
Kloster Vivarium, Episode VII
Das Geflecht der Macht
Kloster Vivarium, Episode VIII
Hochverrat
Kloster Vivarium, Episode IX
Das Vermächtnis des Boethius
Kloster Vivarium, Episode X
Flucht nach vorne
Kloster Vivarium, Episode XI
Lustrum
Kloster Vivarium, Episode XII
Tenebrae
Kloster Vivarium, Episode XIII
Die Herrscher im Osten
Kloster Vivarium, Episode XIV
Krieg
Kloster Vivarium, Episode XV
Wolf und Lamm
Kloster Vivarium, Episode XVI
Trost der Philosophie
Kloster Vivarium, Episode XVII
Die Rückkehr
Appendix
Register
Zeittafe
Kloster Vivarium, Episode I
Wie das Meer leuchtet im roten Glanz der untergehenden Sonne! Ein Schauspiel, das ich seit Kindertagen kenne und an dem ich mich auch nach so vielen Jahrzehnten noch nicht sattsehen kann. Der Blick von der Klippe hinunter auf die sanfte Krümmung der Bucht mit ihrem schmalen Sandstrand ist seit Ewigkeiten gleich und scheint doch jeden Tag neu zu sein. Nahezu reglos liegt das Meer heute da, nur ein leichtes Kräuseln der Wellen, wo gewöhnlich der Wind das Wasser treibt und immer in Bewegung hält. Ein seltener Anblick also und ein trügerisches Bild von Frieden. Die Wärme des Tages weicht, Land und Meer liegen in tiefer, fast regloser Ruhe. Nur hin und wieder das Geschrei einer Möwe, dieser Künstlerin der Lüfte, kurz bevor sie sich auf ihrem Beutezug in die Fluten stürzt.
Pax est tranquilla libertas. Friede ist stille Freiheit. Wer hat das noch einmal gesagt? Ich meine Cicero. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Tatsache ist: Noch herrscht sie, diese herrliche, tiefe Ruhe. Ich weiß nur zu gut, wie schnell es damit vorbei sein wird. Bald, in wenigen Wochen schon, wird der Wind aus dem Norden kommen. Seine Stürme werden die Wellen heftiger noch als gewöhnlich aufpeitschen. Neptuns Pferde, wie die alten Dichter sagten. Ein schönes Bild.
Ich mag den Anblick des stürmischen Meeres — aber es wird dann unpassierbar sein. Für etliche Monate gibt es dann keine Möglichkeit mehr, nach Africa zu gelangen und in den dortigen Bibliotheken nach vielleicht noch verborgenen Schätzen zu suchen. Und, was im Moment für mich noch schwerer wiegt: auch keine Möglichkeit mehr, von Karthago hierher zurückzukommen. Auf Karthago, vor Jahrhunderten Roms Erzfeindin, setzen wir nun, seit uns der Weg in den Norden nahezu versperrt ist, einen großen Teil unserer Hoffnung. Ich kann nur beten, dass Marcus und Gregor noch rechtzeitig vor Einbruch der Winterstürme gesund und unversehrt von dort zurückkommen. Vielleicht hätte ich sie so spät im Jahr gar nicht mehr losschicken sollen. Es ist ohnehin mehr als fraglich, ob sie von der weiten Reise außer ihren persönlichen Erfahrungen überhaupt etwas mitbringen — etwas, was uns für die Bibliothek nützlich sein kann.
Die Schriften der Alten sind unser Steinbruch. Aber es wird immer schwieriger, an die Texte zu kommen. Ich darf gar nicht daran denken, wie vieles in den Kriegswirren der vergangenen Jahre vernichtet worden ist! Riesige Schätze an Wissen fielen den Flammen zum Opfer, unzählige Buchrollen wurden in den Ruinen der Städte begraben, viele Bibliotheken geplündert. Ihr Inhalt fiel dem Vergessen zum Opfer, verrottete unbeachtet. Das reiche Erbe unserer Vorfahren — wir konnten es nur zu einem geringen Teil bewahren. Aber ich sollte nicht klagen, nicht an die Verluste denken, sondern dankbar die kurze Zeit der herbstlichen Stille, die uns noch vergönnt ist, genießen.
Was gäbe ich dafür, wenn endlich auch in mich Ruhe einkehren könnte! Wie verzweifelt ich mich danach verzehre! Aber ich erlange sie nicht. Nicht wirklich. Nicht die tiefe Ruhe im Einklang mit mir selbst, nach der ich mich so sehne. Und es ist beileibe nicht nur die Sorge um Marcus und Gregor, die mich umtreibt. Sicher, die Äcker und Fischteiche werden mit Gottes Hilfe wohl reichen Ertrag bringen und die Mühlen haben auch in diesem Jahr viel Korn zu mahlen. Es gibt Trauben und Oliven in Mengen. Wir werden wohl nicht alles selbst verbrauchen und einiges sogar verkaufen können. Meine Mönche haben auch heute wieder im Dienst unseres Herrn ihr Tagwerk verrichtet und zuverlässig Abschriften aus den Werken der Alten gefertigt. Ich sollte mich darüber freuen. Stattdessen treiben mich immer neue Sorgen um.
Wäre doch nur Boethius noch am Leben! Um wie vieles reicher wäre unsere Bibliothek — und überhaupt: Um wie viel leichter wäre alles! Auch wenn böse Zungen behaupten, ich hätte von seinem Tod profitiert — es stimmt nicht. Das heißt doch, ja, indirekt war sein Tod meiner Karriere sicher förderlich. Das kann ich nicht bestreiten. Aber ich habe seinen Sturz weder betrieben noch gewünscht — zugegebenermaßen habe ich auch nicht dagegen interveniert. Hätte ich ihn verhindern können, wenn ich es versucht hätte? Nein. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Trotzdem betrauere ich seinen Tod auch nach all den Jahren immer noch. Vielleicht sogar mehr denn je. Und ich empfinde Scham über meine Tatenlosigkeit, Scham auch über die Untätigkeit und die Feigheit unseres gesamten Standes. Womöglich wäre ohne diese Untat überhaupt alles anders gekommen. Wer kann das schon wissen. Aber das Schicksal hat anders entschieden. „Schicksal” sage ich und meine doch die verworrenen Fäden der Macht, die in den Händen von Menschen liegen. Ist das Schicksal?
Wie weit zurück das alles liegt. Das Rad der Geschichte hat sich unerbittlich weiter gedreht. Die Dinge sind nicht mehr zu ändern. Immerhin: Meine Mönche sind willig. Tüchtige Männer. Wie eifrige Zugtiere bestellen sie den Acker des Herrn mit ihren frommen Übungen. Sie wissen: Jedes Wort, das sie kopieren und niederschreiben, versetzt dem Ungeist unserer Zeit Schläge — so habe ich es ihnen wieder und wieder eingebläut. Auch wenn wir keine Geistesgrößen vom Rang eines Boethius hier haben — ich hoffe trotzdem, dass unsere Bemühungen die Zeiten überstehen und einer glücklicheren Nachwelt reiche Frucht bringen. Die, die nach uns kommen, werden das Wenige, das wir bewahren konnten, brauchen. Der Erfolg all dieser Bemühungen liegt zwar nicht mehr in meiner Hand, doch hoffe ich, dass mein Vivarium eine reiche Quelle der Gelehrsamkeit hier im Okzident bleiben wird. Eine Quelle, die auch nach meinem Tod noch über viele Jahrhunderte sprudelt.
Doch Schluss mit den Grübeleien! Ich höre die Glocke. Ihr Klang ist leider nicht gerade der reinste. Vielleicht hätte ich damals doch eine etwas höhere Summe in ihre Herstellung investieren sollen. Aber der Aufbau der Bibliothek war und ist mir wichtiger. So gut wie alles, was ich zur Verfügung hatte, habe ich in den Erwerb von Handschriften investiert. Die Bibliothek sollte das Herzstück unseres Klosters sein und das ist mir auch gelungen. So muss ich mich eben mit diesem leicht scheppernden Glockenklang zufriedengeben. Immerhin erfüllt sie ihren Zweck und erinnert mich daran, dass es an der Zeit ist zurückzukehren. Die Mönche haben ihr Tagwerk vollendet und begeben sich bereits zur Abendandacht. Es wird Zeit, ins Kloster zurückzukehren, wenn ich mich ihnen auch heute bei ihrem Gebet anschließen will. Selbst der kurze Weg zurück dauert in meinem Alter doch seine Zeit.
***
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ich mag dieses Gebet. Es begleitet mich seit Kindesbeinen und beschließt meist meinen Tag. Doch heute rauscht sein vertrauter Klang nur an mir vorbei, ohne dass ich den Sinn der Worte aufnehme. So sehr ich mich bemühe, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich sitze zwar hier in der Kirche bei meinen Mönchen, doch bin ich im Geist weit weg. Da sehe ich mich bereits in meinem Studierzimmer, in das ich mich gleich nach der Andacht zurückziehen möchte. Das Gespräch, um das Bellator mich vorhin gebeten hat, muss warten. Mir steht jetzt wahrhaftig nicht der Sinn nach Übersetzungsfragen und zur Ruhe legen kann und will ich mich auch noch nicht. Ich finde ja doch keinen Schlaf und möchte die wenige Zeit, die mir — vielleicht! — noch geschenkt ist, nutzen.
Eine Sache liegt mir noch am Herzen. Eine Schrift, will ich noch verfassen, eine, die sehr wahrscheinlich in keiner Bibliothek je zu finden sein wird. Aut prodesse volunt aut delectare poetae. Die Dichter wollen erfreuen oder nützen, sagt Horaz in seiner Ars poetica. Nun, erfreuen wird das Buch, das ich schreiben will, sicher nicht. Wird es nützen (falls es überhaupt jemals ein Nachgeborener zu Gesicht bekommt)? Ich bezweifle es. Wann hätten die Menschen jemals etwas aus der Geschichte gelernt? Sein Nutzen ist also nicht einmal für mich selbst auf Anhieb erkennbar. Wenn ich mich trotz aller Bedenken daran mache, ist das keineswegs der Eitelkeit geschuldet. Ich leugne es nicht: Von den sieben Kardinalsünden bin ich zweifelsohne am ehesten der „Superbia”, dem Stolz, zugeneigt. Ein Leben lang war ich stolz auf meinen gesellschaftlichen Rang, meinen politischen Einfluss, mein Ansehen, ja auch auf die von mir verfassten Werke. Doch, ich betone es noch einmal, in diesem Fall ist es nicht der Stolz, der mich zu meinem Tun treibt. Ich sehe es vielmehr als meine Verpflichtung, wahrheitsgemäß über die Vorfälle, deren Zeuge ich war, zu berichten. Es ist keine angenehme Pflicht, weil sie an vielen Stellen auch mit meinem eigenen Scheitern, meiner falschen Einschätzung der Gegebenheiten, ja auch mit meinen eigenen Versäumnissen zu tun hat. Es ist mein Gewissen, das mich treibt, Rechenschaft abzulegen vor mir selbst und der Welt (wenn auch vor dieser bis auf weiteres nur ganz im Verborgenen). Ich bin sehr wahrscheinlich der letzte Zeuge all dieser Vorfälle. Alle anderen sind schon lange tot und auch ich werde nicht mehr ewig zu leben haben. 85 Jahre sind eine lange Zeitspanne, mehr als den meisten Menschen vergönnt ist.
Ich habe mein Vorhaben lange, sehr lange vor mir hergeschoben. Stets war anderes wichtiger: der Aufbau des Klosters, der Erwerb möglichst vieler Handschriften, die Sorge um dies, die Sorge um das… Manchmal meine ich sogar, Gott habe mir nur deshalb so viele Jahre hier auf Erden vergönnt, weil ich diese eine, letzte Aufgabe noch nicht vollbracht habe. Wenn ich der Nachwelt also Kunde davon hinterlassen möchte, was wirklich geschehen ist, duldet es nun keinen Aufschub mehr. Und doch muss ich gestehen, dass ich diese Aufzeichnungen weniger im Dienst an den Menschen verfasse. Viel mehr noch drängt es mich, die Erlebnisse meines an Erfahrungen überreichen Lebens für mich selbst niederzuschreiben. Ich will mir selbst Rechenschaft ablegen, Klarheit gewinnen über die Ereignisse, deren Zeitzeuge ich war, und auch über meine eigene Rolle in dieser unglücklichen Geschichte. Zu meinen Lebzeiten soll kein Mensch sie zu Gesicht bekommen, doch hoffe ich insgeheim, diese Blätter mögen nach meinem Tod einen Leser finden. Falls dies Hochmut ist, möge Gott mir verzeihen.
***
Stille. Die tiefe Stille der Nacht. Drüben im Kloster brennt kein Licht mehr, die Mönche schlafen alle. Nicht einmal die Zikaden vollführen ihre Gesänge. Dazu ist es um diese Jahreszeit bereits zu kühl. Auch kein Käuzchen lässt sich hören. Man könnte meinen, ich sei allein auf der Welt. So sitze ich eingewickelt in eine wärmende Decke zum Schutz gegen die Kälte der Nacht im Schein meiner Öllampe vor dem leeren Pergament. Wo fange ich an? Die Geschichte, die ich hier erzählen werde, ist eine andere als die offizielle Version. Die lange Historie der Schlachten und tapferen Heldentaten des edlen Volks der Goten mag ein interessierter Leser in meiner Gotengeschichte nachlesen, wenn er noch ein Exemplar davon findet, oder — kürzer gefasst, dafür aber bis zum unglücklichen Ende erzählt — in den Getica des Jordanes. Wer wissen will, was die Wirren der Zeit für die Bevölkerung mit sich gebracht haben, all das Elend, Tote und Verwundete, verwüstete Städte und vernichtete Ernten, der sollte versuchen, an eine Abschrift der Vita Sancti Severini des Eugipp zu gelangen. Seine Beschreibung der Vorfälle in Noricum mag als Exempel für unzählige Ereignisse dieser Art in unserem Jahrhundert gelten. Viele Stürme erschütterten über einen langen Zeitraum weite Teile unseres Römischen Reichs: In immer neuen Schüben ergossen sich Vandalen, Hunnen und auch die Goten über das Land. Später kamen dann die verheerenden Kriege Kaiser Justinians — und schließlich, in den zurückliegenden Jahren, nun, gegen Ende meines Lebens, eroberten die Langobarden weite Teile. Wie wird das alles enden? Wann?
Ich bin nun schon so lange nicht mehr meiner Funktion als höchster Beamter des Reichs unterworfen, längst schon keinem König mehr zu Treue und Gehorsam verpflichtet und auch nicht der unglücklichen Königin. Mein geheimes Buch soll nicht die vermeintliche Wahrheit der Sieger enthalten, sondern die eines Augenzeugen, der ein Reich untergehen sah. Wo also fange ich an? Ein Vogel, der seinem Käfig entflogen ist, weiß oftmals nicht sofort etwas mit der neuen Freiheit anzufangen. Unsicher hüpft er hin und her, zaudert, bevor er sich in die Lüfte erhebt. Und wer es ein Leben lang gewohnt war, seine Worte sorgsam abzuwägen, auf jede sprachliche Nuance zu achten, jeden Halbsatz zu hinterfragen, schreibt nicht plötzlich, wie es ihm in den Sinn kommt. Vielleicht einfach deshalb, weil ihm angesichts der ungewohnten Freiheit einfach gar nichts in den Sinn kommt.
So sitze ich, Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, genannt Senator, vormals Quaestor sacri palatii, später dann Magister officiorum und schließlich sogar als Praefectus praetorio der ranghöchste Beamte des Römischen Reichs, Träger des Ehrentitels Patricius, Verfasser einer Weltchronik sowie der Geschichte der Goten in zwölf Bänden und mit der von mir edierten Sammlung von Briefen, Urkunden und Erlassen stilistisches Vorbild meiner Zeit, vielleicht sogar für nachfolgende Generationen — so sitze ich nun um Worte ringend vor einem leeren Blatt Pergament. Die Stunden verrinnen und ich bewege mich nur tastend voran, suche den Weg in eine Geschichte, die es wert ist, sie dem kostbaren Schreibstoff anzuvertrauen und finde doch keinen Zugang. Zu viele Erinnerungen, zu viele Ereignisse. Wie die Meister der Mosaike kunstvoll Steinchen an Steinchen setzen, so dass sich in der Zusammenschau schließlich ein Bild ergibt, so versuche ich mit Worten, die wechselvollen Ereignisse unserer Zeit nachzuzeichnen und schließlich ein Bild zu formen. Die klösterliche Abgeschiedenheit Vivariums soll mir dabei helfen, sie soll mir das sein, was einem Cicero einst sein Tusculum war. Weit entfernt von meinem früheren Leben, von Ravenna mit seinen Ränkespielen und Machtkämpfen, zum Glück auch dem Einfluss Konstantinopels entzogen, lebe ich nun schon lange zurückgezogen von einem Leben im Dienst des Reiches und nur noch im Dienste der Bücher und der Wissenschaften. Ich gebe zu, die Entscheidung dazu habe ich nicht ganz freiwillig getroffen. Im Gegenteil. Solange es mir möglich war, habe ich versucht, den Dingen eine andere Wendung zu geben. Doch das Schicksal hat schließlich anders entschieden. Man könnte auch sagen, der Lauf der Geschichte habe mir meine Entscheidung schließlich aufgezwungen.
Wäre mein Buch ein Mosaik, welche Grundfarbe würde ich wählen? Ein tiefes, beruhigendes Blau, so wie in der Kirche des heiligen Kreuzes, die einst die Kaiserin Galla Placidia in Ravenna erbauen ließ? Strahlendes Gold, wie es der Gotenkönig Theoderich und später dann der Eroberer Justinian zu ihrem eigenen Ruhm dort, in Ravenna, dem damaligen Zentrum der Macht, in den Basiliken anbringen ließen? Ein hoffnungsvolles Grün, wie es im Presbyterium des Gervasius zu bewundern ist? Nichts von alledem. Mein Hintergrund müsste ein flammendes Rot sein — Sinnbild all der brennenden Städte und sinnlos vergossenen Blutes.
Ob alles anders gekommen wäre, wenn Amalasuntha nicht so früh hätte sterben müssen, wenn Athalarich, ihr Sohn, nicht nur offiziell, sondern tatsächlich König geworden wäre und das Land regiert hätte? Was wäre gewesen, wenn der große Theoderich selbst einen Sohn gezeugt hätte? So viele Möglichkeiten, den Lauf des Schicksals anders zu bestimmen — und doch hat der Weltenlenker diese eine, diese nach menschlichem Ermessen unwahrscheinlichste aller Möglichkeiten gewählt, deren Sinn ich immer noch nicht wirklich erkennen kann.
Wo also fange ich an? Bei meinem Altersgenossen Boethius, meinem Vorgänger im Amt des Magister officiorum, der jetzt bereits seit fast fünfzig Jahren tot ist, unschuldig hingerichtet als Hochverräter? Oder soll das Buch mit Amalasuntha seinen Anfang nehmen, unserer unglücklichen Königin, deren Namen mir auch heute noch so schwer über die Lippen kommt? Ich konnte mich nie an den Klang der gotischen Namen gewöhnen. Zu hart, zu sperrig und zu wenig melodiös klingen sie mir.
Während ihrer Herrschaft stand ich, ohne es zu ahnen, auf dem Höhepunkt meiner Macht. Amala, wie ich sie im Stillen nannte, schließlich entrechtet und zuletzt gefangen auf einer winzigen Insel. Oft sehe ich sie nachts in meinen Träumen vor mir. Sie muss geahnt haben, dass sie dem Tod geweiht ist, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis sie kämen, sie zu töten. Jeden Tag die bange Frage: Wann? Heute? Morgen? In einer Woche? Hat sie in ihren letzten Lebenstagen an Boethius gedacht? Konnte sie, wie er, Trost in ihrer Verzweiflung finden? Ihre Ermordung verfolgt mich seit Jahren. Hätte ich die Dinge wenden können, wenn ich anders gehandelt hätte? Wenn ich überhaupt gehandelt hätte, anstatt allein auf die Macht des Wortes zu hoffen? So viele Tote.
Wahrscheinlich muss man, um die Geschehnisse, die ich hier berichten will, begreifen zu können, mindestens hundert Jahre in die Vergangenheit gehen. Also noch in die Zeit vor meiner Geburt, eine Zeit, die auch ich nur aus Geschichtsbüchern kenne. Vielleicht bis zur Zeit der Galla Placidia, Tochter des Kaisers Theodosius und spätere Kaisermuter und trotz, oder besser gesagt gerade wegen ihrer vornehmen Abstammung, über viele Jahre hinweg kaum mehr als ein besonders wertvolles Faustpfand im Kampf um die Macht. Schon lange vor ihr waren die letzten Kaiser Roms bereits kaum noch mehr als Spielbälle anderer, mehr oder weniger geduldet von Konstantinopel, auch Ostrom genannt, und oftmals Opfer ihres eigenen Ehrgeizes. Um nur ein beliebiges Beispiel von unzähligen dafür zu nennen, wie schnell sich ihr Schicksal wenden konnte, könnte ich den Fall des Kaisers Maximus anführen, von dem ich in Geschichtswerken gelesen habe. In Gallien, damals noch ein Teil des westlichen Reichs, war er als Herrscher hoch angesehen. Aber als Maximus Gallien verließ und italischen Boden betrat, verließ ihn auch sein Glück. Im Kampf gegen seinen früheren Mitkaiser Valentinian verlor er zwei Schlachten und stürzte schneller als er es sich wohl hätte träumen lassen. Der oströmische Kaiser Theodosius ließ ihn schließlich in Aquileia gefangen setzen und hinrichten. Ich könnte auch vom Schicksal des eben bereits genannten Valentinian, des Sohns der Galla Placidia, erzählen. Der stand so vollkommen unter dem Einfluss seines fränkischen Heermeisters Arbogast, dass er es schließlich nicht mehr ertragen konnte, und nach einer öffentlichen Demütigung keinen anderen Ausweg mehr für sich sah, als sein junges Leben in Ohnmacht und leerem Prunk durch Selbstmord zu beenden.
Wäre mein Buch ein Bühnenstück, dem Zuschauer würde schwindlig. So viele würden darin auftreten, gewaltsam ums Leben kommen und damit nach kurzer Zeit wieder von der Bühne verschwinden. Ich könnte lange Listen mit den Namen von Ermordeten verfassen. Wer wird sie später noch kennen, die Täter und die Opfer, die Kaiser, die Heermeister und Würdenträger? Bereits jetzt sind sie kaum mehr als eine Fußnote im stetig dahin fließenden Strom der Geschichte.
Wo also fange ich an? Vielleicht doch bei Galla Placidia. Sie war zweifelsohne außergewöhnlich. Nicht nur, weil sie eine Regentin war. Als eine der wenigen auf dem Kaiserthron Westroms hat sie zumindest überlebt. Mehr als das. Was vielen der Männer vor und nach ihr nicht gelang, sie hat es zustande gebracht. Unter ihrer Regierung erlebte das Reich ein Vierteljahrhundert Stabilität — wenn auch um einen hohen Preis. Wenn ich auch viele ihrer Entscheidungen nicht gutheißen kann, so muss ich doch zugeben: Ravenna erstrahlte unter ihr in frischem Glanz. Die meisten ihrer Nachfolger dagegen haben ihren Machthunger mit dem Leben bezahlt. In den gut zwanzig Jahren nach ihrem Tod gab es nicht weniger als neun Regenten. Im Gegensatz zu ihr hielt sich keiner von ihnen lange genug, um wirklich Spuren zu hinterlassen. Und so drohte auch das herrliche Ravenna, nach ihrem Tod im Morast der Sümpfe unterzugehen. Bis schließlich Theoderich kam und es wiederum in neuem Glanz erstrahlen ließ. Es gab eine Zeit, da habe ich gehofft, seine Tochter Amala könnte in die Fußstapfen dieser Galla Placidia treten. Das Schicksal hat es anders gewollt.
IncipitLiber Secretus Flavii Magni Aurelii Cassiodori Senatoris Lectori Ignoto Dedicatus1
Nach langer Überlegung habe ich mich entschlossen, diese Geschichte mit meinen Vorfahren und ihrer Rolle am Kaiserhof beginnen zu lassen. Das ist keineswegs meiner Eitelkeit geschuldet. Aber da du, unbekannter Leser, als Nachgeborener vielleicht nicht so sehr vertraut bist mit den Wirren unserer Zeit, erscheint mir dieses Vorgehen sinnvoll.
Seit vielen Generationen hatte unsere Familie schon hoch angesehene Senatoren hervorgebracht. Der große Aufstieg unserer Familie aber begann mit meinem Urgroßvater. Er organisierte im Kampf gegen die einfallenden Vandalen die römische Verteidigung in Bruttium und Sizilien. Er, mein Großvater und mein Vater haben mir mit ihren militärischen und politischen Verdiensten den Weg geebnet: Mein Großvater war Tribun unter Kaiser Valentinian, dem Sohn jener berühmten Galla Placidia. Doch im Gegensatz zu seiner Mutter war der Kaiser selbst kaum mehr als ein Spielball in den Händen anderer, allen voran in denen seines Heermeisters Aëtius.
Über die Rolle meines Großvaters am Hof kann ich leider nur wenig berichten. Ich weiß nur so viel: Er wurde damals mit einer Delegation eben dieses Aëtius als Unterhändler für Friedensverhandlungen zum Hunnenfürsten Attila gesandt. Attila. Sollte die Nachwelt vielleicht auch nicht mehr viel von den Wirren unserer Zeit wissen, sein Name wird die Jahrhunderte überdauern, dessen bin ich mir sicher. Sein Heer soll 500.000 Mann umfasst haben. Ein Mann, geboren zur Erschütterung der Völker. Er schritt hochmütig umher und rollte gleichzeitig drohend mit den Augen, damit seine stolze Macht auch durch seine Körperbewegung sichtbar werde. Er war von kleiner Gestalt, mit breiter Brust und einem ziemlich großen Kopf. Er hatte kleine Augen, schwachen Bartwuchs, graues Haar und eine dunkle Gesichtsfarbe. So habe ich ihn in meiner Gotengeschichte porträtiert und ich bin immer noch überzeugt, dass diese Worte einen treffenden Eindruck vermitteln. Seine Hunnen haben zu viel Leid über unser Land gebracht, als dass die Welt es je vergessen könnte. Städte wurden geplündert und dem Erdboden gleichgemacht. Ein Strom der Verwüstung zog sich in langen Jahren von Osten nach Westen.
Sogar die mächtige Handelsstadt Aquileia fiel ihm schließlich zum Opfer. Der Name dieser Stadt mag dir, mein unbekannter Leser, nur noch wie ein fernes Echo vergangener Zeiten scheinen. Wie jenes rätselhafte, vor Jahrhunderten begrabene Pompeji, das Plinius in seinen Briefen erwähnt. Doch war es im Falle Aquileias keine Naturkatastrophe, die den Untergang herbeiführte, sondern menschliche Zerstörungswut. Ich habe die Stadt fast ein Jahrhundert nach dem berüchtigten Einfall der Hunnen besucht. Damals ahnte ich freilich noch nicht, dass ich selbst einige Jahrzehnte später sogar den Untergang von so mächtigen Städten wie Ravenna oder gar Rom miterleben würde. Ich war an Frieden gewohnt und so wirkte Attilas Vernichtungswerk damals umso stärker auf mich. Vom Glanz der einst mächtigen Hafenstadt war nicht mehr viel übrig. Die vormals viertgrößte Stadt Italiens, einst Knotenpunkt zwischen Ost und West, zwischen Italien und den Provinzen Noricum, Pannonien und Illyrien war nach dem Hunneneinfall kaum noch mehr als eine verschlafene, traurige Provinzstadt. Der Hafen, einst ein wichtiger Umschlagplatz für Waren aller Art, war versandet. Viele der vormals prächtigen Villen hoher Beamter und reicher Händler dienten nun nur noch einfachen Bauern als Behausung und Unterstand für ihr Vieh. Die Straßen waren in katastrophalem Zustand. Nur die Basilika und der Sitz des Bischofs zeugten damals noch von der ehemaligen Größe und Bedeutung. Inzwischen ist selbst das schon längst wieder Geschichte. Aber bereits damals, beim Anblick des geschundenen Aquileia, stellte ich mir die Frage, die ich mir seitdem unzählige Male wieder gestellt habe: Wie war so etwas möglich? Was war aus dem einst so mächtigen, glorreichen Römischen Reich geworden?
Angeblich hatte Attila ursprünglich sogar überlegt, ob er die Belagerung der mächtigen und mit starken Mauern geschützten Stadt nicht doch lieber abbrechen sollte. Drei Monate hatte er mit seinem Heer schon vor Aquileia gelagert und immer noch war ihm kein militärischer Erfolg beschieden. Da soll sich ihm eines Tages ein Zeichen ihres nahe bevorstehenden Untergangs offenbart haben: Störche, die aus der Stadt heraus flogen. Ist es denkbar, dass eine solch gewaltige Katastrophe sich auf einen derart trivialen Grund wie den vom Zufall geleiteten Flug einiger Vögel zurückführen lässt? Oder ist eben auch der scheinbar zufällige Zug der Vögel letztendlich doch Teil eines seit Anbeginn der Zeiten vorgesehen Plans, den wir armen Sterblichen trotz allen Bemühens nicht erkennen können? Doch zurück zu unserer Geschichte und Attila, dem Schrecken der Menschheit, dessen verfluchter Name unvergessen bleiben wird. Dabei hatte ursprünglich über viele Jahre hindurch sogar ein gutes Verhältnis zwischen diesem mächtigen hunnischen Heerführer, seinen Truppen und Westrom bestanden. Besagter Flavius Aëtius, der Heermeister und heimliche Herrscher unter Kaiser Valentinian, pflegte lange Zeit gute persönliche Beziehungen zu ihm. Doch das sollte sich ändern. Auf die Gründe will ich nicht näher eingehen, die habe ich in meiner Gotengeschichte ausführlich dargestellt. Ich möchte hier nur exemplarisch aufzeigen, in welch wechselvollen, unsicheren Verhältnissen sich alles befand. Bündnisse, die an einem Tag galten, konnten am nächsten schon wertlos sein. Aus Verbündeten wurden Feinde und aus Feinden unter veränderten Umständen wiederum mögliche Verbündete.
Der Hunnenkönig Attila, der Heermeister Aëtius und Kaiser Valentinian – ihre Macht konnte sie nicht retten, vielmehr war sie ihr Verhängnis. Sie alle starben schließlich einen gewaltsamen Tod. Mord und Totschlag waren zu dieser Zeit bereits über Jahrzehnte an der Tagesordnung. Selbst wer die zahllosen Schlachten glücklich überlebt hatte, war nicht davor gefeit, plötzlich von einem nahen Verwandten oder einem vermeintlichen Freund ermordet zu werden. So erzählt man beispielsweise von Attila, er sei in der Hochzeitsnacht von Ildico, seiner jungen Braut, vergiftet worden. Das mag stimmen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Das Schicksal des Aëtius dagegen kenne ich genau: Er wurde von Kaiser Valentinian trotz, oder vielleicht auch gerade wegen seiner großen Verdienste und seines Einflusses, eigenhändig erschlagen. Sein Machthunger wurde ihm letztlich zum Verhängnis. Denn schließlich wollte der Kaiser seinen Heermeister, der ihm offiziell jahrelang treu gedient hatte, in Wahrheit aber die Fäden der Macht bei sich konzentrierte, endlich loswerden und schreckte dabei selbst vor einem Mord nicht zurück. Als ihm Aëtius bei einer Audienz die Finanzlage erläuterte und die Steuereinnahmen vorrechnete (es war nicht zum besten darum bestellt), bezichtigte ihn der Kaiser urplötzlich wutschnaubend der Betrügerei und behauptete, Aëtius wolle ihn um die Herrschaft bringen, indem er ihm, Valentinian, die Schuld an den aktuellen Problemen zuschob. Auch den unglücklichen Präfekten Boethius ließ Valentinian in seiner Raserei damals töten. Wenn man bedenkt, welch sinnlosen Tod auch dessen Enkel sterben musste, könnte man meinen, ein Fluch liege auf der Familie. Valentinian selbst fiel übrigens kurze Zeit später einem Racheakt der Anhänger des Aëtius zum Opfer. Wie gesagt: In ihrer Willkür und Brutalität sind diese Ereignisse exemplarisch für die Zeit und sie erscheinen mir auch wie Vorboten auf die Ereignisse, deren Zeuge ich selbst später wurde.
Doch zurück zu meinem Großvater: Im Gegensatz zum machthungrigen und letztlich unglücklichen Aëtius bezahlte er durch die Gnade Gottes seine Dienste für das Reich nicht mit dem Leben. Vielleicht hat er die Gefahr geahnt, die der Umgang mit Herrschern und allzu große Machtfülle mit sich bringen. Jedenfalls zog er sich, noch bevor er die höchsten Ämter erreicht hatte, hierher auf unsere Güter in Bruttium zurück und widmete sich fortan seinen privaten Studien. Vor meinem geistigen Auge sehe ich ihn noch vor mir: ein uralter, dünner Mann mit schmalem, von Falten zerfurchtem Gesicht, aber wachen Augen (ich selbst bin ihm inzwischen wohl gar nicht so unähnlich!), vertieft in seine Bücher. Ich war noch zu klein, als dass er sich ernsthaft mit mir abgegeben hätte. So muss die Beschreibung seines Charakters auch äußerst vage bleiben. Abgesehen von der Tatsache, dass er sich für Literatur interessierte, weiß ich kaum etwas von ihm. Kein einziges Gespräch zwischen uns ist mir in Erinnerung geblieben, nur das Bild eines alten Mannes, der bei seiner Lektüre nicht gestört werden wollte.
Einmal, es war kurz vor seinem Tod, und ich muss damals wohl an die sechs Jahre alt gewesen sein, hat er mir aus Vergils Aeneis vorgelesen. Den Sinn der Worte begriff ich damals freilich kaum. Aber die Tatsache, dass dieser würdige, alte Herr sich entgegen seiner Gewohnheit an mich wandte, ist mir in Erinnerung geblieben. Was er wohl sagen würde, wenn er wüsste, dass auf den angestammten Ländereien unserer Familie nun eine Klostergemeinschaft lebt? Wenn er sehen könnte, dass in den Teilen des Wohnhauses, wo früher Luxus herrschte, nun einfache Mönchszellen untergebracht sind, und ich, sein Erbe und Herr der Besitzung, mit der vergleichsweise bescheidenen Unterkunft des ehemaligen Verwalters Vorlieb nehme? Wahrscheinlich würde er ungläubig den Kopf schütteln. Zumindest aber die Bibliothek unseres Klosters hätte seine Bewunderung erregt. Dessen bin ich mir sicher.
Hier endet das erste Kapitel des geheimen Buchs.
1Hier beginnt das geheime Buch des Flavius Magnus Aurelius Cassiodor, genannt Senator, das einem unbekannten Leser gewidmet ist.
Kloster Vivarium, Episode II
«Epiphanius hat die Übersetzung aus der Kirchengeschichte des Sokrates Scholastikos beendet, Cassiodor. Er wartet auf seine nächste Aufgabe. Was soll ich ihm sagen? Womit soll er fortfahren? Außerdem hat auch Severus endlich seine Arbeit an der Handschrift des Augustinus abgeschlossen. Die Erleichterung darüber war ihm gestern förmlich ins Gesicht geschrieben. Seit Wochen habe ich ihn nicht mehr so heiter erlebt. Er erwartet jetzt ebenfalls neue Aufträge von dir.»
«Sehr gut, wunderbar! Vor allem auf die Fertigstellung der Übersetzung habe ich schon ungeduldig gewartet. Für Epiphanius habe ich nämlich eine ganz besondere Aufgabe vorgesehen. Ich will das Werk des Flavius Josephus, Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία, Jüdische Altertümer endlich wieder auch in lateinischer Fassung. Soviel ich weiß, gibt es davon nur noch wenige Abschriften. Und wir können mit Stolz sagen, dass unser Kloster eine davon besitzt. Erinnerst du dich: Vor etlichen Jahren hatten wir bereits eine lateinische Übersetzung angefertigt. Ich weiß nicht mehr sicher, welcher unserer Mönche das damals gemacht hat — ich meine, es könnte Pankratius gewesen sein. Er war ja ein sehr tüchtiger Übersetzer. Schade, dass er so früh sterben musste!
Aber wie dem auch sei. Die Übersetzung habe ich dann jedenfalls für ein anderes Werk eingetauscht. Für welches, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich meine aber, es war der Dioskurides.»
«Du meinst das Werk über die Arzneimittel?»
«Genau das, Bellator.»
«Das liegt uns aber ebenfalls nur in griechischer Sprache vor.»
«Ich weiß. Und wenn Marcus wohlbehalten von seiner Reise zurückkommt, soll er sich auch so bald wie möglich an die Übersetzung machen. Das habe ich bereits so vorgesehen. Es sei denn, er bringt tatsächlich etwas völlig Neues mit. Aber das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Auch in Karthago sind die Bibliotheken nach der Vandalenherrschaft und den Rückeroberungskriegen Justinians längst nicht mehr das, was sie einmal waren. Ich hoffe auf die medizinischen Lehrstühle, die Justinian dort hat einrichten lassen. Vielleicht findet Marcus dort neues Material. Zumindest aber wird er wohl praktische Erfahrung in der Heilkunde sammeln können. Das ist immerhin etwas.»
«Bist du sicher, dass ich Epiphanius also tatsächlich das Geschichtswerk des Flavius Josephus zum Übersetzen geben soll? Ist es wirklich der Mühe wert? Du musst bedenken, wie viel Zeit eine Übersetzung erfordert — und es gibt noch so vieles, was einer Bearbeitung bedarf. Immerhin hast du es damals, als du es eingetauscht hast, offensichtlich nicht für so wertvoll gehalten. Reicht es also nicht, das Werk zumindest vorerst einem der Schreiber nur zum Kopieren zu geben? Wir hätten dann zumindest wieder eine neuere Abschrift, wenn dir so daran liegt. Vielleicht können wir es dann später übersetzen lassen.»
«Das ist viel zu kurz gedacht, Bellator. Außerdem: Was sollen wir denn mit zwei griechischen Exemplaren, wenn ohnehin kaum jemand mehr Griechisch beherrscht? Was meinst du, weshalb wir uns hier die Mühe machen, möglichst vieles aus dem Griechischen zu übersetzen, wenn wir es doch auch einfach nur abschreiben könnten? Glaub mir, allein mit griechischen Abschriften werden wir vieles nicht mehr vor dem ewigen Vergessen retten. Wir arbeiten gegen die Zeit! Du weißt das doch genauso gut wie ich. Glaub mir, dieser Umstand treibt mich manchmal fast zur Verzweiflung. Schau dir doch nur einmal unser Vivarium an! Wie viele Übersetzer haben wir und wie viele Kopisten? Seit Silvester verstorben ist seid ihr noch sieben, die Griechisch wirklich so gut beherrschen, dass sie auch anspruchsvolle Texte ins Lateinische übertragen können. Mich selbst rechne ich nicht mehr mit. Meine Augen sind inzwischen nicht mehr zuverlässig genug. Und ganz ähnlich verhält es sich bei Agathos. Marcus hat ihm zwar eine Tinktur gemischt, die seine Sehkraft erhalten soll, aber Wunder wirkt die auch nicht. Lange Texte kann er jetzt schon nicht mehr bearbeiten und es ist sicher nur noch eine Frage von kurzer Zeit, bis auch das vorbei sein wird. Ich habe mir überlegt, dass er statt zu übersetzen lieber Martinus und Silverius in der griechischen Grammatik unterweisen soll. So wäre wenigstens für Nachwuchs gesorgt. Manchmal fürchte ich ehrlich gesagt, dass, wenn es so weitergeht, uns wohl nichts anderes übrig bleiben wird, als Kinder im Kloster aufzunehmen und sie selbst im Lesen und Schreiben auszubilden. Auf die Schulen ist immer weniger Verlass. Es gibt kaum noch welche und die wenigsten davon sind gut. Ja, an vielen Orten gibt es wohl überhaupt kaum noch Lehrer.»
«Mit Verlaub, ich glaube, jetzt übertreibst du, Cassiodor.»
«Meinst du? Ich wäre mir da nicht so sicher. Aber vielleicht hast du recht und es ist nicht ganz so schlimm, wie ich befürchte. Aber in einem bin ich mir sicher: Im Norden Italiens beherrscht kaum noch jemand Griechisch. Schlimmer noch: Ich fürchte, die meisten der Langobarden dort werden überhaupt weder lesen noch schreiben können. Ihre Sprache ist das Schwert. Die beherrschen sie leider nur zu gut. Insofern können wir hier im Süden sicher noch von Glück sprechen. Trotzdem: Ich habe das Gefühl, bei den jungen Männern, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, lassen inzwischen sogar die Kenntnisse der Grammatik und der Rechtschreibung sehr zu wünschen übrig. Wenn das so weiter geht, sehe ich mich auf meine alten Tage vielleicht sogar noch gezwungen, für die Klostergemeinschaft ein Buch über die Rechtschreibung zu verfassen. Du hast dich vielleicht gewundert, weshalb ich ausgerechnet den jungen Gregor mit Marcus auf die lange Reise nach Karthago geschickt habe. Ich will dir das Geheimnis verraten: Es geschah wegen seiner zahlreichen Verstöße gegen die Orthographie. Die Cicero-Rede, die er vor seiner Abreise beendet hatte, musste er, Gott sei’s geklagt, fast auf jeder Seite an zwei oder gar mehr Stellen nachbessern. Also habe ich mir gedacht, es könnte ihn zu größerer Sorgfalt anspornen, wenn er einmal buchstäblich am eigenen Leib erfährt, unter welch immensen Mühen und Strapazen wir oft die Manuskripte für unsere Bibliothek beschaffen. Er soll mehr Demut vor den Schriften entwickeln und ihnen größere Sorgfalt angedeihen lassen. Ob die Maßnahme etwas hilft, wird sich zeigen. Wie dem auch sei: Jedenfalls bin ich täglich gezwungen, Entscheidungen zu fällen: Für das eine Werk und damit gleichzeitig gegen ein anderes, das mir aber doch ebenfalls am Herzen liegt. Was darf auf keinen Fall dem Vergessen anheimfallen? Was müssen wir den Nachfolgenden unbedingt überliefern, was nur unter günstigen Umständen? Was soll zuerst getan werden, was kann noch warten? Die Altertümer des Flavius Josephus möchte ich unbedingt auch bei uns im Westen bewahren, ich halte sie für fast so bedeutend wie das Geschichtswerk Ab urbe condita des Livius. Aber wie gesagt, eine einigermaßen gesicherte Überlieferung ist nur mit einer Übersetzung ins Lateinische möglich. Viel zu wenige verstehen in unseren Tagen noch gut genug Griechisch und es werden trotz der Herrschaft Konstantinopels im Süden Italiens sicher nicht mehr.»
«Und warum hältst du die Altertümer für so wichtig, dass du dafür sogar die Bibelkommentare hintanstellst?»
«Nun, zum einen hoffe ich, dass auch anderswo fromme Mönche sich an die Kommentare machen und sie fleißig verbreiten. Davon gehe ich zumindest aus. Im Castellum Lucullanum und in anderen Klöstern wird man sich um die religiösen Texte sorgen. Für die Antiquitates des Juden Flavius Josephus scheint mir das weit weniger sicher. Aber in meinen Augen sind sie eine einmalige Quelle für die Geschichte des jüdischen Volks und damit letztendlich auch für unsere eigene Geschichte. Ich möchte sie nicht dem Vergessen preisgeben. Du weißt, mein Ziel ist es, Vivarium einer Hochschule so nahe wie möglich zu bringen, auch wenn meine Mittel beschränkt sind. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, braucht es eben nicht nur theologische Werke, sondern ein möglichst breites Spektrum aller Wissenschaften, und die Geschichtsschreibung halte ich für eine äußerst wichtige Disziplin. Ich stelle übrigens nicht nur die Bibelkommentare hintan, sondern schweren Herzens beispielsweise auch die Kirchengeschichte des Eusebius.»
«Du bist der Herr. Ich werde Epiphanius also deine Anweisungen übermitteln. Und was ist mit Severus? Welchen Auftrag hast du für ihn? Soll er eine weitere Rede Ciceros kopieren?»
«Nein, vorerst nicht. Aber es trifft sich sehr gut, dass er mit dem Augustinus zu Ende ist. Gerade vergangene Woche hat mich nämlich der Bischof von Scylaceum um eine Abschrift unserer Liste der Ostertermine gebeten. Die Sache eilt zwar nicht, aber vielleicht ist es trotzdem günstig, sie jetzt gleich anzugehen, wenn Severus gerade Zeit hat. Das ist kein langer Text und das wird ihm zur Abwechslung einmal ganz recht sein. Trotzdem ist es eine Aufgabe, die äußerste Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit verlangt und die ich deshalb nicht ohne weiteres jedem übertragen könnte. Die Liste, wiewohl relativ kurz, erfordert vielleicht sogar mehr Konzentration und Sorgfalt als manche längere Abschrift. Bei ihr kommt es wirklich auf die Richtigkeit jedes einzelnen Eintrags an, jeder noch so kleine Fehler wäre fatal. Aber so, wie ich Severus kenne, kann man ihm diese verantwortungsvolle Aufgabe zutrauen. Ich bitte dich aber zur Sicherheit und für alle Fälle, noch einmal abschließend persönlich zu kontrollieren, ob er auch tatsächlich alles fehlerfrei kopiert hat. Wenn ihr fertig seid, gebt die Abschrift bitte an Hilarius, der soll sie, ihrer Bedeutung gebührend, schön mit Ornamenten verzieren. Wenn Severus mit der Liste fertig ist, bitte ihn, eine Abschrift der Consolatio des Boethius anzufertigen.»
«Aber davon haben wir doch bereits ein sehr schönes Exemplar. Ich sehe nicht, weshalb wir jetzt ein weiteres davon anfertigen sollten.»
«Ich denke dabei weniger an unsere Bibliothek. Es soll gewissermaßen ein Buch auf Vorrat sein. Man kann ja nie wissen. Dieser Tage ist es zwar schwer, noch an irgendeine interessante Schrift zu kommen, aber trotzdem, man kann eben nie wissen. Und falls sich so eine Gelegenheit einmal unverhofft bieten sollte, hätte ich gerne ein Werk, das ich dagegen eintauschen könnte. Die Consolatio scheint mir dafür äußerst geeignet. Je älter ich werde, desto mehr lerne ich dieses Werk schätzen. Ich bitte dich also darum zu tun, was ich dir aufgetragen habe.»
Von meinem Vater
Mein Vater, klug wie er war, hatte die Zeichen der Zeit früh erkannt. Das Kaisertum Westroms war am Ende. Romulus Augustulus, der letzte Kaiser auf dem Thron, war kaum mehr als ein Kind, viel zu jung für diese Bürde. Er konnte nicht mehr als eine unglückliche Marionette abgeben. Das war Odoakers Stunde. Sein Stern begann nun zu leuchten. Der germanische Offizier war durch eine Meuterei an die Macht gekommen. In einer letzten Entscheidungsschlacht tötete er Orestes, den Vater des jungen Kaisers und setze Romulus Augustulus, den offiziell letzten Kaiser Westroms, ab. Odoaker wusste, der junge Mann war viel zu schwach, als dass er ihm künftig hätte gefährlich werden können. So schickte er ihn zwar in die Verbannung, schenkte ihm aber doch wenigstens das Leben.
Eine Zeitlang agierte Odoaker politisch nicht einmal unklug. So schaffte er endlich eine Verständigung mit den Vandalen, die daraufhin für einige Jahre ihre fortgesetzten Angriffe auf Italien aussetzten und dem Land damit wenigstens eine kurze Atempause vergönnten. Sie verpachteten Odoaker sogar das reiche Sizilien und als höchster Beamter verwaltete mein Vater die Insel in seinem Namen. Ich war damals noch ein Kind, wohl behütet auf unseren Ländereien hier in Bruttium. Mein Vater ließ mich, wie es unserem Stand entsprach, sorgfältig erziehen. Ich sah ihn in meiner frühen Kindheit kaum, da er sich meist in Mailand, Ravenna, Rom oder eben Sizilien aufhielt.
Wenn ich an diese Jahre zurückdenke, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, ich erinnerte mich nicht nur an eine längst vergangene Zeit, sondern an eine untergegangene Welt; so vieles ist seitdem anders geworden. Ich meine nicht die natürliche Veränderung, die zwischen einem Kind und einem alten Mann liegt. Ich meine auch nicht die Veränderungen der politischen Verhältnisse, die ja wahrnehmbar sind. Ich meine eine tiefgreifende Veränderung, die schleichend, und ohne dass wir sie bemerkt hätten, von statten gegangen ist. Omnia mutantur,