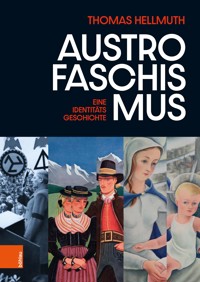Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Böhlau Verlag Wien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Frankreich im 19. Jahrhundert: Das erinnert an prunkvolle Boulevards, an Weltausstellungen, an den Eiffelturm - das Symbol der bürgerlichen Fortschrittseuphorie -, an rauschende Feste, aber auch an verkannte Künstler, an die Bohème des Montmartre, an weibliche Aktmodelle, an Kabaretts und Tanzlokale. Eine widersprüchliche und abenteuerliche Welt tut sich auf, die aber durch ein bürgerliches Gesellschaftsmodell, das sich seit der Aufklärung durchzusetzen begonnen hatte, geprägt war. Ein bürgerlicher Werte- und Normenkanon erfasste alle Bereiche des Lebens, definierte einen spezifischen, noch heute aktuellen Freiheitsbegriff, die "eingezäunte Freiheit", und gab vor, wie die Bürgerin und der Bürger sich zu kleiden, zu bewegen und zu kommunizieren hatten. Das Buch geht diesen Phänomenen nach, taucht dabei ein in die ländlichen Gesellschaften, die zunehmend verbürgerlicht wurden, und begibt sich auf die Spuren der bunten und widersprüchlichen literarischen, künstlerischen und politischen Bewegungen. Den Leserinnen und Lesern eröffnet sich ein faszinierender und vielschichtiger, über den nationalen "Tellerrand" hinausreichender Einblick in das so genannte "bürgerliche Zeitalter".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Hellmuth
Frankreich im 19. Jahrhundert
Eine Kulturgeschichte
Böhlau Verlag Wien Köln Weimar
Gedruckt mit Unterstützung der Universität Wien
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2020 by Böhlau Verlag GmbH & Co.KG, Zeltgasse 1, 1080 WienAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigenschriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Henri Gervex, Une séance de jury de peinture, © akg-images / Erich Lessing, AKG227209Das auf dem Buchcover abgedruckte Gemälde „Une scéance du jury de peinture“ (Die Jury des Salons, Henry Gervex, 1885) zeigt die Auswahl von Kunstwerken für den Pariser Salon, einer regelmäßig stattfindenden Kunstausstellung, durch eine Jury, die ihre Zustimmung oder Ablehnung mit erhobenen Spazierstöcken oder Regenschirmen ausdrückte. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Vorgaben der „Académie des beaux-arts“ (Akademie der Schönen Künste), die als alleinige Instanz in Fragen der Kunst galt, vom Künstler auch berücksichtigt worden waren. Lange Zeit war die Karriere eines Künstlers davon abhängig, ob er einmal im Salon ausgestellt hatte. Erst in den 1880er Jahren, in der Dritten Republik, wurden andere Salons als Konkurrenz zum traditionellen gegründet. Auf dem Gemälde von Gervex entscheiden nur Männer, Künstler und Kunstliebhaber bzw. Kunstsammler, über die Qualität eines Gemäldes. Frauen waren bei der Auswahl nicht zugelassen. Das Gemälde steht symbolisch für die geschlechtliche Rollenbilder in der bürgerlichen Gesellschaft: Im Hintergrund ist das im Sinne des Klassizismus zu einem Ideal verklärte Gemälde einer nackten Frau zu sehen, das allein Männer beurteilen. Zwar durften auch Malerinnen im Pariser Salon ausstellen, vor allem dienten Frauen aber als Modell und waren als Objekte dem männlichen Blick und der männlichen Begierde ausgesetzt. Als Künstlerinnen wurden Frauen kaum oder erst allmählich akzeptiert (und in der Folge von der Geschichte mehr oder weniger vergessen).
Korrektorat: Ute Wielandt, SchöpsUmschlaggestaltung: Michael Haderer, WienSatz: Bettina Waringer, WienEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-205-21247-8
Inhalt
Von der Kunst, die Perspektiven zu wechseln – eine Einleitung
1.Das bürgerliche Gesellschaftsmodell
1.1Die eingezäunte Freiheit
1.2Der offene Diskurs
1.3Das kulturelle Regelsystem
1.4Geschlechterrollen und Sexualmoral
1.5Die Erfindung der Pädagogik
2.Bürgerliche Vergesellschaftung
2.1Die „zivilisierte“ Nation
2.2Ideologische Infiltration
2.3„Zivilisierung“ des Alltags
2.4Widerstand an der Peripherie
2.5Integration der Peripherie
3.Die Vielfalt in der Einheit
3.1Der Mythos des verkannten Genies
3.2Die eingezäunte Freiheit der Kunst
3.3Evolution
4.Widersprüche und Reaktionen
4.1Der Verlust des „Ganzen“
4.2Kompensation und Flucht
4.3Rückkehr in die eingezäunte Freiheit: Politik und offener Diskurs
Von der Kunst, ein passendes „Röcklein“ zu schneidern – ein Nachwort
Zeittafel – politische Entwicklung seit 1789
Anmerkungen
Literatur und Quellen
Quellen und Primärliteratur
Sekundärliteratur
Abbildungsnachweis
Sach- und Ortsregister
Personenregister
Von der Kunst, die Perspektiven zu wechseln – eine Einleitung
Auf einem 2003 veröffentlichten Album der französischen Musikgruppe „Têtes Raides“ („Sture Köpfe“) findet sich ein Chanson mit dem Titel „Civili“. Dieses spielt mit gängigen musikalischen Harmonien, die sich aber dann doch immer wieder auflösen. Die Musik gleitet über in Lärm, bricht mit herkömmlichen Hörgewohnheiten und entspricht so gar nicht den Erwartungen, die üblicherweise an ein klassisches französisches Chanson gestellt werden. Der Text, der an manchen Stellen an konkrete Poesie erinnert, korreliert mit den in der Musik auftretenden Dissonanzen: „Civili civila / Civilalisation / wenn das Leben, wenn Lisa / Lisa Recht hatte / Werden wir weder in den Liedern / noch im Wasser meines Weins / die Zivilisationen / von morgen erschaffen“.1 Als Illustration zum Chanson ist im Textheft, das dem Album beigelegt ist, eine „Histoire de France“, eine „Geschichte Frankreichs“, abgebildet, die in Flammen steht. Das Spiel mit solchen Provokationen mag freilich – angesichts der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen – heikel sein und gerade im deutschsprachigen Raum ein beklemmendes Gefühl hervorrufen. Betrachten wir jedoch die Geschichte Frankreichs seit dem 19. Jahrhundert und die Instrumentalisierung von Geschichte bei der französischen Nationsbildung, wird diese Provokation durchaus verständlich und kann letztlich sogar als Kritik am Faschismus interpretiert werden. „Têtes Raides“ schaffen eine Art „verkehrte Welt“ und wenden die Mittel der Diktatur gegen diese selbst.
Eine solche Perspektive setzt voraus, sich mit der Aufklärung und der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft, die noch immer unsere Gegenwart prägen, zu beschäftigen. Damit sind aber auch die damit verbundenen Widersprüche zu analysieren, die sich etwa im Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus manifestierten. Die Moderne, die ihre Wurzeln in der Aufklärung hat und eng mit der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft in Beziehung steht, lässt sich keineswegs als eine Erfolgsgeschichte verklären, die direkt in eine bessere, demokratische Welt mündete. Vielmehr bewegt sich die aufgeklärte bürgerliche Gesellschaft, mit der sich das vorliegende Buch am Beispiel Frankreichs genauer beschäftigt, bis heute auf einen steinigen und oft nicht klar abgesteckten Weg, der auch auf Abwege führen kann, die in autokratischen und diktatorischen Systemen enden. Diese sind nicht das Gegenteil zur bürgerlichen Gesellschaft, das „Böse“, mit dem etwa der Faschismus in christlicher Tradition oftmals bezeichnet wird, sondern ein Teil von ihr, eine Fehlentwicklung, die immer wieder droht.2 Daher beschreiben „Têtes Raides“ die bürgerliche Gesellschaft provokant als ein „So lala“, als eine „Civilalisation“, die sich „Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit“, die säkularisierte Dreifaltigkeit der Französischen Revolution, zwar auf ihre Fahnen geschrieben hat. Zugleich verwässert sie aber den „Wein“ und scheint nicht imstande, die „Zivilisationen / von morgen [zu] erschaffen“, die eine bessere Welt und individuelle Freiheit garantieren – eine Freiheit, wie sie die Aufklärung postuliert hat, eine Freiheit in sozialer Verantwortung und nicht eine grenzenlose Freiheit, in der das Individuum allein auf sich selbst zurückgeworfen, d.h. im neoliberalen Sinn aus dem gesellschaftlichen Verband losgelöst ist.
In diesem Zusammenhang lässt sich auch die verstörende Illustration zum Chanson „Civili“ verstehen: Die französische Nation wird seit dem 19. Jahrhundert in den Tiefen der Vergangenheit verankert und dadurch – letztlich auch mit ihren Widersprüchen und somit als „Civilalisation“ – legitimiert. Nun lässt sich aber Geschichte nicht mit Vergangenheit gleichsetzen. Der Historiker oder die Historikerin (wobei die Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert freilich weitgehend Männern vorbehalten war) haben nicht unmittelbar Zugang zur Vergangenheit. Sie können sich ihr nur über Quellen annähern, die sie aus der Gegenwart heraus interpretieren. Somit ist Geschichte ein Konstrukt, das immer auch Gefahr laufen kann, politisch instrumentalisiert zu werden. Es verwundert daher nicht, dass „Têtes Raides“ die „Geschichte Frankreichs“ in Flammen aufgehen lassen, zumal etwa der Kolonialismus, Rassismus und Antisemitismus sowie die rechtsextremen Bewegungen dem Begriff der „Zivilisation“ Hohn sprechen. In ihrer Kritik stehen „Têtes Raides“ nicht allein. So hatte etwa der Grundschullehrer Gaston Clémendot bereits 1923 bei seinen Kollegen enormes Aufsehen hervorgerufen, als er auf einer Versammlung des „Syndicat national des instituteurs“ (SNI), der „Nationalen Gewerkschaft der Grundschullehrer“, die Abschaffung des Geschichtsunterrichtes forderte. Die Gräuel des Ersten Weltkrieges vor Augen, betrachtete er den Geschichtsunterricht als eine Voraussetzung für zukünftige Kriege, weil dieser den Hass gegen Fremde fördere und den Krieg glorifiziere. In einer Gesellschaft aber, die Geschichte auch weiterhin als Zivilisierungsprozess verstand, stieß seine Forderung auf Ablehnung und Verständnislosigkeit.3 Auch aufgrund ihres zunehmenden Bedeutungsverlustes nach dem Ersten Weltkrieg wollte bzw. konnte die „Grande Nation“ nicht darauf verzichten, ihre Ursprünge in den Tiefen der Vergangenheit zu verorten.
Im vorliegenden Buch soll freilich die Geschichte Frankreich keineswegs abgeschafft, sondern die Vergangenheit aus einer anderen Perspektive als der von „Têtes Raides“ oder Gaston Clémendot kritisierten nationalgeschichtlichen, nämlich aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive betrachtet werden. Diese dient nicht dazu, eine bestimmte politische Situation zu legitimieren oder das Selbstverständnis einer sozialen Gruppe, wie sie im weiteren Sinn auch die Nation darstellt, zu verfestigen. Ganz im Gegenteil übt sich die Kulturgeschichte in konstruktiver Gesellschaftskritik und analysiert gesellschaftliche Phänomene in ihren vielfältigen Zusammenhängen. Dabei hinterfragt sie die Geschichtspolitik und betrachtet die Vergangenheit – im Sinne von Multiperspektivität – aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ihr ist daher auch der Konstruktionscharakter von Geschichte bewusst, die Tatsache, dass es „die“ eine historische Wahrheit freilich nicht gibt. Dennoch sind ihre Ergebnisse nicht willkürlich, sondern an wissenschaftliche Regeln gebunden, die in wissenschaftlichen Kreisen anerkannt sind und somit argumentativ nachvollziehbar.
Kulturgeschichte bedeutet aber nicht nur die Relativierung vermeintlicher „Wahrheiten“, sondern ermöglicht auch einen breiteren Zugang zur Vergangenheit als andere historische Teildisziplinen. Wir nähern uns also der französischen Vergangenheit des 19. Jahrhunderts nicht etwa aus einer traditionellen politikgeschichtlichen Perspektive, mit der sich – auch im deutschsprachigen Raum – ohnehin schon zahlreiche Publikationen beschäftigen. Vielmehr wird ein breiter Kulturbegriff verwendet, der über die Beschäftigung mit Musik, Kunst und Literatur hinausgeht. Unter „Kultur“ werden daher im Folgenden alle immateriellen und materiellen Produkte menschlichen Handelns sowie menschliche Wahrnehmungs- und Deutungsmuster subsumiert. Selbst Politik ist als kulturelles Produkt zu verstehen, das mit Musik, Kunst und Literatur, mit wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen sowie mit einzelnen Akteuren und Akteurinnen in ein Beziehungsnetz eingewoben ist.4 „Kultur“ umfasst damit auch Sprache und Kommunikation, „verschiedene kollektive Codes, sowohl verbale als auch nonverbale“, also auch „die Gesten, die Mimik sowie die Arten des Zusammenseins und Nichtzusammenseins“. Zur ihr gehören „auch Gegenstände, sobald sie durch ihren Gebrauch sinnhaft werden, […] eine gemeinsame Art […], die Welt zu betrachten“.5 Die vollständige Erfassung dieses Beziehungsnetzes ist selbstverständlich unmöglich, auch wenn im Folgenden mehrere tausend Seiten zur Verfügung stünden. Um sich ihm aber anzunähern und die Komplexität von Gesellschaften zumindest ansatzweise zu erfassen, müssen die Ebenen der Makro- und Mikrogeschichte miteinander in Verbindung gesetzt werden. Die Kulturgeschichte hat daher „die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Stockwerken des Bauwerks“, wie Robert Muchembled die unterschiedlichen gesellschaftlichen Untersuchungsräume umschreibt, zur Aufgabe.6 Diese vertikale Perspektive ist schließlich durch eine horizontale zu ergänzen: Auch die Beziehungen der verschiedenen Räume auf den Stockwerksebenen, etwa zwischen Wirtschaft, Politik und Kultur, sind freilich in eine kulturgeschichtliche Betrachtung miteinzubeziehen.
Eine zeitliche, räumliche und inhaltliche Einschränkung erscheinen somit in der Kulturgeschichte als problematisch, müssen aber aus arbeitsökonomischen Gründen bzw. aufgrund der Unmöglichkeit, die Vergangenheit in ihrer Komplexität vollständig zu erfassen, vorgenommen werden. Das vorliegende Buch beschäftigt sich daher mit dem 19. Jahrhundert, unternimmt aber immer wieder „Ausflüge“ in das 18. und auch 20. Jahrhundert. Räumlich beschränkt es sich auf Frankreich, obwohl etwa der französische Sozial- und Kulturhistoriker Christophe Charle nicht zu Unrecht die Notwendigkeit betont, „die Kulturgeschichte aus der Bevormundung der nationalen Territorialisierung zu befreien“.7 Wie schwierig eine solche Befreiung aber ist, zeigt sich bei seiner europäischen Kulturgeschichte unter anderem darin, dass ein erweiterter Blickwinkel auf Europa die Grenzen lediglich verschiebt, nicht zuletzt auch, weil Europa definiert werden muss. Außerdem entfliehen ein Historiker oder eine Historikerin niemals der Sozialisation, die sie in ihrer Weltwahrnehmung und ihrem Selbstverständnis prägt. Ihre daraus resultierenden Interessen wirken sich auf die Ergebnisse der historischen Forschungen aus, womit sie letztlich selbst ein Teil der Geschichtsschreibung, ihres eigenen historischen Werkes, sind.8 So findet sich etwa auf dem Cover von Charles europäischer Kulturgeschichte bezeichnenderweise ein französisches Kunstwerk abgebildet: „La Danse“, eine Skulptur von Jean-Baptiste Carpeaux, die 1869 als Teil eines größeren Skulpturengruppe für die „Opéra Garnier“ angefertigt wurde. Die Skulptur, die Bacchus umgeben von nackten Tänzerinnen zeigt, führte in der Öffentlichkeit wegen der angeblich obszönen Darstellung zu heftigen Diskussionen. Daher war sie sogar einem Akt von Vandalismus ausgesetzt und wurde mit schwarzer Tinte bemalt.9 Letztlich präsentiert Charle mit dem Coverbild ein Detail französischer Kulturgeschichte, das aber unter einem bestimmten Blickwinkel auch übernationale Bedeutung haben kann. So lässt es sich auch als Beispiel für dem Umgang mit Sexualität oder auch für die zentrale Rolle der Provokation in der bürgerlichen Gesellschaft allgemein verstehen.
Die hier vorliegende Kulturgeschichte Frankreichs, die wegen der Komplexität von kulturhistorischen Zugangsweisen explizit als „eine“ Kulturgeschichte bezeichnet wird, nimmt einen solch anderen Blickwinkel ein. Trotz nationaler Einschränkung versucht sie, die Treppen zwischen den „unterschiedlichen Stockwerke“ der Gesellschaft auf und ab zu steigen sowie die Gänge, welche die Räume auf den einzelnen Stockwerken miteinander verbinden, abzuschreiten und deren Türen zu öffnen. Manchmal gelingt dies durchaus mit Leichtigkeit, manchmal auch mit viel Mühe. Und manchmal mag das virtuose Spiel auf den verschiedenen Tonleitern der Kulturgeschichte für manchen Leser oder manche Leserin auch als partiell gescheitert erscheinen. Insgesamt gesehen eröffnet sich diesen aber doch ein faszinierender, über den nationalen „Tellerrand“ hinausreichender Einblick in die französische Gesellschaft des „langen“ 19. Jahrhunderts. Dies gelingt, weil ein bestimmter Blick auf diese Gesellschaft geworfen bzw. das Thema, das einer kulturwissenschaftlichen Betrachtung unterzogen werden soll, eingegrenzt wird. Ausgehend von der Definition des bürgerlichen Gesellschaftsmodells wird die Durchsetzung und die partielle Transformation des Modells auf den „unterschiedlichen Stockwerken des Bauwerks“ untersucht: auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, damit auch in den unterschiedlichen Lebenswelten und gelegentlich auch in ihrer Auswirkung auf die individuelle Identitätsbildung. Gleichzeitig öffnen wir die Türen zwar nicht aller, aber doch einiger Räume auf den einzelnen Stockwerken, etwa zur Kunst und Literatur sowie zur Tischkultur. Wir durchwandern die Verbindungsgänge, etwa von der Kultur zur Politik, verharren in manchen Räumen und widmen uns gleichsam dem Interieur, unter anderem den unterschiedlichen Malstilen sowie ihrem Verhältnis zueinander.
Somit gelingt es, das bürgerliche Gesellschaftsmodell in den städtischen Zentren und im ländlichen Raum festzumachen, Politik mit Trinkkultur und Tanzstilen zu verbinden sowie Musik, Kunst und Literatur als Ausdruck eines bürgerlichen Kosmos zu analysieren. Diskursräume werden analysiert und damit der Mythos der so genannten „Gegenkulturen“ aufgedeckt, zumal sich der Widerstand gegen den „Mainstream“ als Teil eines offenen Diskurses erweist, der sich als unverzichtbares Korrektiv gegenüber dem gesellschaftlichen Stillstand und somit als überlebensnotwendiger Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft entpuppt. Aber auch die Widersprüche, die diese Gesellschaft birgt, kommen zur Sprache, etwa die nationale Manipulation und Indoktrination, die den von der Aufklärung postulierten „mündigen“ Bürger diametral gegenüberstanden. Ebenso wird die Behäbigkeit des bürgerlichen Normen- und Regelsystems, die den Menschen in seiner Handlungsfreiheit immer wieder beengte, thematisiert. Diese Behäbigkeit führte zu vergeblichen Fluchtversuchen, welche die Verzweifelten aber zumeist wieder in die bürgerliche Realität zurückwarfen. Letztlich waren die Bürger und Bürgerinnen dazu „verdammt“, gesellschaftlich zu partizipieren und auf diese Weise die Regeln und Normen zu erweitern, gleichsam das Regelkorsett zu lockern. Dabei gerieten sie aber auch auf Abwege, folgten rechtsextremen Ideologien und Bewegungen, die keineswegs eine Randerscheinung der bürgerlichen Gesellschaft, sondern inmitten dieser zu finden waren. So wurden dem Rassismus und Antisemitismus die Türen vieler Räume, die sich auf den verschiedenen „Stockwerken des Bauwerkes“ befinden, weit geöffnet.
Die vorliegende Kulturgeschichte liefert also ein vielschichtiges und vielfarbiges Gemälde, das sich beim Lesen zu einem – freilich nicht harmonischen, sondern mit Dissonanzen durchzogenen – Ganzen fügt. So wie das Chanson „Civili“ von Têtes Raides mit Harmonien bricht, um auf die Widersprüche der bürgerlich-aufgeklärten Gesellschaft und somit auf die Gefahren, welche diese bedrohen, hinzuweisen, wird auch der Leser des vorliegenden Buches durch manche Dissonanzen aufgerüttelt und zur Reflexion angeregt. Dazu werden mehrere historische Teildisziplinen, unter anderem die Sozialgeschichte, Politikgeschichte und Alltagsgeschichte sowie die historische Anthropologie, miteinander verschränkt. Eine Art kulturgeschichtliches Referenzsystem entsteht, das eben keine isolierte nationale Kulturgeschichte erlaubt und am Beispiel Frankreichs einen – nicht immer gefälligen – Einblick in einen zentralen Bereich der Kulturgeschichte des Okzidents, in das so genannte „bürgerliche Zeitalter“, gibt.
1. Das bürgerliche Gesellschaftsmodell
Welche unbegreifliche Kunst wies uns den Weg, die
Menschen zu unterwerfen, um sie frei zu machen […]?Wie ist es möglich, daß sie gehorchen und keiner befiehlt,daß sie dienen und keinen Herrn haben […]?
(Jean-Jacques Rousseau, Encyclopédie)1
Mit bürgerlicher Gesellschaft werden gewöhnlich Damen und Herren in zauberhaften Abendgarderoben assoziiert, glanzvolle Bankette, prunkvolle Ballsäle oder prächtige Bauten und Boulevards. Bürgerliche Theater- oder Opernhäuser, aber auch Wohnhäuser scheinen sich durch einen enormen und zugleich sinnlosen Aufwand an Materialien, Ornamenten und durch prahlerische Fassaden auszuzeichnen. Hinter dem Prunk und dem Zauberhaften, der freilich einen Teil der bürgerlichen Gesellschaft ausmachte, steckt aber ein System von Werten und Lebensstilen, das die unterschiedlichen bürgerlichen Gruppen zusammenhielt und schließlich weite Teil der Gesellschaft erfasste, wenn auch in unterschiedlichen Ausformungen bzw. im Sinne einer bürgerlichen Binnendifferenzierung.2 Nicht jeder konnte sich Karten und Garderobe für einen Opernbesuch leisten. Es kostete aber nichts, sich an der Hysterie zu beteiligen, die ein Opernstar zuweilen hervorrief. Die bürgerliche Gesellschaft ist demnach nicht als eine „Klasse“ im marxistischen Sinn zu analysieren, sondern als ein – aus der Aufklärung geborener – kultureller Kosmos zu verstehen, der sich vom Ancien Régime abgrenzte, allerdings keineswegs eine Homogenisierung der vielfältigen sozialen Struktur bzw. unterschiedlicher sozialer Gruppen ermöglichte.
Ein neuer Mensch und eine neue Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft, musste geschaffen und damit der „Zivilisation“ zum Durchbruch verholfen werden. Die damit verbundenen Denk-, Verhaltens- und Handlungsmuster sind im Sinne Pierre Bourdieus als „Habitus“ zu verstehen.3 Der Habitus ist einerseits durch milieu- bzw. kulturbedingten Vorgaben geprägt und trägt damit zu deren Erhalt bei, andererseits können oder müssen diese Vorgaben notwendigerweise auch verändert werden, um ökonomischen und sozialen Wandlungsprozessen gerecht zu werden.4 Das bürgerliche Gesellschaftsmodell ist daher keineswegs statisch, sondern ständigen Veränderungen unterworfen. Gewisse Fixpunkte, gleichsam Koordinaten im Zeitenwandel, sind jedoch erhalten geblieben: eine bestimmte Auffassung von individueller Freiheit, d. h. die Idee einer eingezäunten Freiheit, das Prinzip des offenen Diskurses sowie spezifische kulturelle Regeln und Normen.
1.1 Die eingezäunte Freiheit
„Zivilisierung“ bedeutete zunächst die Abschaffung des Ancien Régime und die Errichtung eines Verfassungsstaates. Max Weber hat diese Entwicklung als Übergang von der „traditionellen“ zur „legitimen Herrschaft“ bezeichnet. Zwar waren die Entscheidungen des traditionellen Herrschers „streng traditional gebunden, soweit diese Bindung aber Freiheit“ ließ, erfolgten die Entscheidungen auch nach „juristisch unformalen und irrationalen Billigkeits- und Gerechtigkeitspunkten des Einzelfalls“. Die an der Aufklärung orientierte Französische Revolution legte nun die Grundlage5 für eine weitgehend kontrollierbare Herrschaft, die nicht mehr durch Gott, sondern durch das – wie auch immer definierte – „Volk“ legitimiert war: „Gehorcht wurde nicht [mehr] der Person, kraft deren Eigenrecht, sondern der gesatzten Regel“.6 Und diese „gesatzte Regel“ ist wiederum Ausdruck einer „volonté génerale“, wie Jean-Jacques Rousseau schreibt, eines „Gemeinwille[ns], der stets auf die Erhaltung und das Wohl des Ganzen und jedes einzelnen Teiles gerichtet ist und die Quelle des Gesetzes darstellt“.7 Diese „legitime Herrschaft“ hatte der englische Arzt und Philosoph John Locke bereits im 17. Jahrhundert als Voraussetzung für die bürgerliche Freiheit betrachtet. In seinem Werk „Two treatises of government“ (Zwei Abhandlungen über die Regierung, 1681) sah er diese im „Naturzustand“ begründet:
Die natürliche Freiheit des Menschen bedeutet, auf Erden keine ihm übergeordnete Macht anzuerkennen, dem Willen oder der gesetzgeberischen Autorität von niemandem unterworfen zu sein und lediglich das Naturrecht als Regel anzuerkennen. Die Freiheit des Menschen in der Gesellschaft heißt, sich nur der legislativen Gewalt zu beugen, die im Staat nach allgemeiner Zustimmung etabliert worden ist; nicht der Autorität und keinem Gesetz außer denjenigen, welche die gesetzgebende Gewalt gemäß des in ihr gesetzten Vertrauens erlässt.8
Bürgerlicher Individualismus ist somit nicht möglich, ohne in das Kollektiv eingebunden zu sein. „Der Mensch, der nur seinem besonderen Wille gehorcht, ist der Feind der Menschheit“, schreibt Denis Diderot in der berühmten, von ihm und Jean Le Rond d’Alembert 1749 herausgegebenen „Encyclopédie“.9 Die individuelle Freiheit besteht laut viertem Artikel der französischen „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ vielmehr darin, „alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet“.10 Somit scheint die Bereitschaft des Einzelnen, sich freiwillig in ein von der Gemeinschaft errichtetes „Gehege“ zu begeben, eine notwendige Voraussetzung, um die in der Gesellschaft größtmögliche Freiheit zu garantieren.11 Mit diesem „Gehege“ ist nichts anderes als ein „Gesellschaftsvertrag“ gemeint, der das Zusammenleben der „freien“ Individuen regeln soll. Im Detail beinhaltet dieser „Gesellschaftsvertrag“ zunächst das „Privatrecht“, das die Grenzen der Freiheit des Einzelnen zu Gunsten der größtmöglichen Freiheit aller festlegt. Um das Überschreiten dieser Grenzen zu verhindern, bedarf es zusätzlich des Staates, „der das Gewaltmonopol besitzt, aber nur im Freiheitsinteresse nutzen darf“.12 Neben das Privatrecht trat somit das öffentliche Recht, das die Einhaltung des ersteren garantiert.
Ergänzt wurde diese Grundlage moderner Demokratie durch die so genannte Gewaltentrennung, die zunächst den Monarchen „zähmen“ und den Machtmissbrauch des staatlichen Souveräns verhindern sollte. Bereits im Werk von John Locke wird dem König als Exekutive das Parlament als Legislative gegenübergestellt. Charles de Montesquieu setzte neben diese beiden Gewalten schließlich die Judikative, welche die Gesetzgebung und das Handeln der Exekutive auf ihre Verfassungs- und Gesetzmäßigkeit zu überwachen hat.13 Als sich die französische Monarchie nicht in Richtung einer konstitutionellen Monarchie weiterentwickeln ließ, wurde das Prinzip der Gewaltentrennung von der Republik übernommen. Die Frage der Balance zwischen Legislative und Exekutive hat im Übrigen in der französischen Geschichte immer wieder zu heftigen politischen Konflikten geführt, etwa nach dem Zweiten Weltkrieg, als Charles de Gaulle und seine Anhänger eine Verfassung forderten, die den Präsidenten gleichsam als tragenden Pfeiler des politischen Systems betrachtete und ihm daher weitreichende Rechte eingeräumt hätte bzw. – in der Fünften Republik – auch eingeräumt hat.14
Ohne Zweifel hat die bürgerliche Gesellschaft mit der „legitimen Herrschaft“ den Grundstein unserer modernen Demokratie geschaffen. Dies zeigt sich auch in der „Zivilisierung“ von Gewalt, in ihrer Verstaatlichung, womit sie gebändigt und somit für die bürgerliche Freiheit ungefährlich gemacht wurde.15 Als Beispiel kann etwa der so genannte „Zug der Frauen nach Versailles“ im Oktober 1798 dienen, ein Protestmarsch, der letztlich von revolutionären „Aktivisten“, von Männern, in geregelte Bahnen geleitet und instrumentalisiert wurde. „Maillard16 ergreift […] eine Trommel“, schreibt Thomas Carlyle in seinem 1837 erschienen Werk „The French Revolution“,
steigt die Haupttreppe hinunter und schlägt mit lauten Wirbeln und kräftigem Ran-tan, ran-tan seinen Schelmenmarsch: nach Versailles, vorwärts nach Versailles! Wie man auf einem Kessel aber eine Wärmeflasche oder dergleichen zu schlagen pflegt, wenn wütende weibliche Bienen oder verzweifelt umherfliegende Wespen sich vor ihrem Stock sammeln sollen, und die wütenden Insekten, sobald sie es hören, sich denn auch wirklich darum sammeln, wie um eine Führung, die bisher nicht vorhanden war, – so sammeln sich denn auch jetzt die Mänaden um den gewandten Maillard […].17
Carlyles Vergleich der aufständischen Frauen mit Insekten und Mänaden hinterlässt freilich einen bitteren Beigeschmack. Dennoch weist er auf die Zähmung der Massen hin, auf den Versuch, die Wut und den Protest zu kanalisieren. Das „Rant-tan“, das Trommeln, lässt die Aufständischen in Gleichschritt marschieren und verwandelt die existentielle Forderung nach Brot in eine geordnete Demonstration, in der die Forderung nach Freiheit und Gleichheit dominiert.18 Im zunehmenden Maße wandte sich der Staat gegen spontane Gewaltakte, etwa in Beauvais (Oise), wo Revolutionsgegner gezwungen wurden, unter einem Freiheitsbaum der Revolution zu huldigen. Die Gemeindeverwaltung, beunruhigt über diese von ihr nicht genehmigten Aktionen, ließ daraufhin Zäune um den Freiheitsbaum aufstellen.19
Auf die „Befriedung“ der Bevölkerung weist auch die Guillotine hin, die nicht als grausames Folter- und Hinrichtungswerkzeug galt, sondern als geeignetes Mittel, um das Töten schneller und gleichsam „humaner“ als im Ancien Régime zu gestalten. Die Guillotine ist somit ein Symbol für das gewandelte Verständnis von Gewalt, für deren Zähmung und Humanisierung. In der „Carmagnole“, einem Revolutionslied, heißt es: „Man muss die Riesen kürzen / Und die Kleinen vergrößern / Alle gleich groß / Das ist das wahre Glück“.20 Wohl nicht zufällig wird mit diesen Versen die Guillotine assoziiert, zumal die staatliche kontrollierte Gewalt durchaus dazu dienen sollte, der bürgerlichen Gesellschaft und ihren Prinzipien – „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ – zu ihrem Durchbruch zu verhelfen. Allerdings wurde die Guillotine seit 1848 nicht mehr öffentlich aufgestellt, sondern der Tod gleichsam ausgeblendet – ein weiterer Beleg für die sanfte Evolution der Sensibilität.21 Sogar die Abschaffung der Todesstrafe wurde zunehmend diskutiert. Der Historiker und Politiker François Guizot hatte etwa 1822 in seiner Schrift „De la peine de mort en matière de politique“ (Die Todesstrafe als Thema der Politik) die Abschaffung der Todesstrafe bei politischen Verbrechen gefordert. Und auch Victor Hugo attackierte zeit seines Lebens die Todesstrafe, etwa in seinem Roman „Le dernier jour d’un condamné“ (Der letzte Tag eines Verurteilten, 1829).22 „Wir wollen im Übrigen nicht allein die Abschaffung der Todesstrafe“, schrieb er 1832 im Vorwort zur Neuauflage des Romans, „wir wollen eine völlige Neugestaltung des Strafsystems in all seinen Formen […]. Die Guillotine schwankt.“23 Dennoch sollte die Todesstrafe in Frankreich erst am 9. Oktober 1981, unter der Präsidentschaft von François Mitterand, offiziell abgeschafft werden.
Gleichzeitig mit der Errichtung des bürgerlichen Verfassungsstaates kam es zur Säkularisierung der Gesellschaft sowie zur Trennung von Kirche und Staat; hatte doch die Kirche das verhasste Ancien Régime legitimiert. „Ein Hindernis bereitete die Kirche schon durch die Prinzipien ihres Regiments den Prinzipien, die jene Männer in der weltlichen Regierung zur Geltung bringen wollten“, schreibt Alexis de Tocqueville in seinem 1856 veröffentlichten Buch „Der alte Staat und die Revolution“ (L’Ancien Régime et la Révolution). „Sie stützte sich vornehmlich auf die Tradition, jene äußerten eine große Verachtung gegen alle Institutionen, die sich auf Ehrfurcht vor der Vergangenheit gründen; sie erkannte eine höhere Autorität über der individuellen Vernunft an, jene appellierten gerade ausschließlich an diese Vernunft; sie gründete sich auf eine Hierarchie, jene strebten nach Ausgleichung aller Rangstufen.“24 Bereits 1791 wurden Geistliche in den Beamtenstatus versetzt und mussten daher einen Eid auf die Verfassung schwören. Wer diesen verweigerte, lief Gefahr, überwacht, auf eine schwarze Liste gesetzt und inhaftiert zu werden.25 In manchen Departements ging die Entchristianisierung sogar noch weiter, etwa in Nièvre, wo jede gottesdienstliche Handlung außerhalb der Kirche verboten und per Dekret die Zerstörung aller religiösen Zeichen außerhalb der Kirche, beispielsweise der Kreuze und Kreuzwege, angeordnet wurde.26 Religiöse Konventionen und Tabus wurden gebrochen, etwa das Verbot aufgehoben, während bestimmter Perioden wie der Fasten- oder Adventzeit zu heiraten.27 Zudem versuchten die Revolutionäre, die christlichen Bezüge aus dem französischen Wortschatz zu entfernen und gleichzeitig, wie Lynn Hunt schreibt, „die Geschichte der klassischen Antike zum Modell einer neuen, unschuldigen Gesellschaft, einer idealen Republik“, hochzustilisieren.28 Das „Saint“ wurde in den alten Namen gestrichen, während antike Namen wie Brutus, Grachus oder Spartakus, aber auch „Constitution“ (Verfassung) zu Modenamen avancierten. Ferner erhielten Orte neue Bezeichnungen: Versailles, als ehemalige Residenz des Königs ein Symbol des alten Systems, wurde etwa in Berceau-de-la-Liberté („Wiege der Freiheit“) oder die Kathedrale Notre Dame in „Tempel der Vernunft“ umbenannt.29 Und auch der 1793 eingeführte Revolutionskalender weist keinerlei christliche Bezüge mehr auf: Die Monate wurden zum Beispiel nach den Merkmalen der Jahreszeit benannt, etwa der „Vendémaire“, der „Weinmonat“, der den ersten Monat des Revolutionskalenders (22. September bis 21. Oktober) bezeichnete.30 In ganz Frankreich tanzten die Sansculotten – Arbeiter und Kleinbürger, die im Gegensatz zu den von Adeligen getragene Kniebundhosen („culotte“) lange Hosen trugen und die radikalen Jakobiner unterstützten – um säkularisierte Scheiterhaufen, die sie auf den Marktplätzen aus Beichtstühlen, holzgeschnitzten Heiligen und anderen brennbaren religiösen Gegenständen errichtet hatten. Ähnlich wie in der „verkehrten Welt“ des Karnevals stapelten sie auf Karren, die von Eseln gezogen wurden, die Insignien der alten Macht, gemeinsam mit Puppen, die Könige und Päpste darstellten und schließlich verbrannt wurden.31
Trotz aller Bemühungen, die religiöse Tradition auszulöschen, blieben die regionale und die nationale Kultur in Frankeich aber weiterhin partiell christlich bzw. katholisch gefärbt. Während etwa der Revolutionskalender zunehmend als kurioses Produkt der revolutionären Ära betrachtet wurde, übernahm der republikanische Kalender neuerlich die christlichen Feiertage. Und auch die staatliche Verwaltung des religiösen Kulturerbes, seine Einbettung in das „patrimoine national“ (S. 112), das „nationale Kulturerbe“, ließ letztlich die Auslöschung der religiösen Traditionen, wie sie die Revolutionäre gewünscht hatten, nicht zu. Außerdem waren religiöse Praktiken als Bestandteil kollektiver und individueller Identitäten nicht einfach von heute auf morgen abzuschaffen. Maurice Agulhon unterscheidet daher zwei Formen von Zivilreligionen: Einerseits eine „Religion“, die dem Christentum diametral gegenüberstand und daher mit diesem inkompatibel war. Sie zeichnete sich durch die Erziehung zum Rationalismus sowie durch Feste und Riten aus, welche die kirchlichen Bräuche ersetzen sollten. Andererseits vertraten gemäßigte Republikaner wie Léon Gambetta32 oder Jules Ferry33 die Ansicht, dass der Katholizismus in Frankreich nicht einfach entwurzelt werden könne, und plädierten daher für eine Zivilreligion, welche die von der Republik akzeptierten Religionsgemeinschaften einbinden sollte.34 Unter „Zivilreligion“ wurde daher ein bürgerliches Glaubensbekenntnis verstanden, eine Art Vernunftreligion, die zum einen bürgerliche Tugenden wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Toleranz, zum anderen aber auch die Überschneidungen mit religiösen Grundsätzen sucht.35 Letztlich sollte sich ein katholisch gefärbter Laizismus, ein „Katholaizismus“36, durchsetzen. Dennoch hat sich seit der Französischen Revolution eine gänzlich neue Lebenseinstellung gegenüber der Welt herausgebildet, die in der wirtschaftlichen Entwicklung, im Individualismus und Rationalismus der bürgerlichen Gesellschaft sowie in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Glauben, der Kirche und den Autoritäten begründet liegt. Zunehmend betrachtete der Mensch das Diesseits, das er nach seinen Wünschen gestaltbar erlebte, als seine Heimat. „Man könnte in diesem Sinne von einem neuzeitlichen Lebenspositivismus sprechen“, schreibt Bernhard Groethuysen, „von einer Zentrierung des Lebens in sich selbst, von einer Emanzipation des Lebens nicht nur gegenüber dieser oder jener Deutung der Welt, sondern gegenüber allen kosmischen Anschauungen überhaupt.“37
Diese „Emanzipation des Lebens“, der Ausbruch aus den Fesseln der christlichen Vergangenheit, spiegelt sich im „percement“, im „Durchbruch“ durch die Stadt. Alte Stadtmauern und Gebäude wurden abgerissen; anstelle dieser schufen Plätze und Boulevards weite Räume im engen Stadtgefüge.38 Das Individuum erhielt damit Bewegungsfreiheit, und die Städte, die früher durch dicht aneinander gedrängte Häuser und enge Gassen geprägt waren, wurden mit Licht durchflutet – nicht von ungefähr wird die Aufklärung im Französischen als „siècle des lu mières“, als „Jahrhundert der Lichter“, bezeichnet. „Wenn man eine Avenue so weit führt, dass ihr Ende nicht zu sehen ist“, schreibt der Architekt Etienne-Louis Boullée, „vermitteln die Gesetze der Optik und die perspektivischen Effekte den Eindruck von Unermesslichkeit“.39 Bereits 1791 ließ der revolutionäre Pariser Stadtrat auf der Place Louis XV, der heutigen Place de la Concorde, die Bäume fällen und die Gärten pflastern, um gleichsam ein „Volumen der Freiheit“ zu schaffen, wie Richard Sennett die weiten, beinahe grenzenlosen Räume im Pariser Stadtensemble bezeichnet.40 Der neu gestaltete Platz wurde in „Place de la révolution“ umbenannt und entsprach einem neuen Raumempfinden, dem Bedürfnis einer weithin unbegrenzten Bewegungsfreiheit, das aus dem Individualismus der Aufklärung resultierte. Und dennoch wurde die weitläufige „Place de la révolution“ von gleichförmigen Gebäuden eingefasst, zumal eine bestimmte Vorstellung von individueller Freiheit, die eingezäunte Freiheit eben, auf den städtischen Raum projiziert wurde. „Kurz gesagt: Raum ist ein Praxisraum“, schreibt Michel de Certeau41 und weist darauf hin, dass Straßen, Plätze und Monumente nicht nur Bauwerke sind, sondern auch Sinn vermitteln. Dieser ist wiederum vom sozialen und kulturellen Umfeld abhängig, in dem Menschen agieren.42 So begann das Bürgertum „die urbane Landschaft als ein Mittel zu verwenden, um ihre Verschiedenheit von der Aristokratie auszudrücken“.43 Somit entspricht die Einzäunung der Place de la révolution dem bürgerlich-liberalen Prinzip der „legalen“ Herrschaft und symbolisiert eine Freiheit, die nur innerhalb eines – durchaus wandelbaren – normativen Rahmens möglich sein sollte: im Rahmen einer Verfassung sowie bestimmter kultureller Regeln und Normen.
Dieses bürgerliche, dieses vermeintlich unendliche und doch „eingezäunte“ Universum symbolisierte Boullée, ein „Revolutionär des Raumes“, 1793 in seinem Projekt eines „Tempels der Natur und Vernunft“. Er bediente sich bei diesem Tempel, der im Übrigen nie realisiert wurde, der Form einer Kugel. Die untere Halbkugel, die so genannten „Hälfte der Natur“, sollte einen Erdkrater darstellen, die obere Halbkugel, die „Hälfte der Vernunft“, war als Kuppel gedacht, die vollständig glatt und ungebrochen war. Genau auf der Höhe, wo Natur und Vernunft zusammentrafen, sollten die Menschen in einem Säulengang die Weiten des bürgerlich-aufgeklärten Universums bewundern können. Blickten sie nach oben, erschien ihnen der Raum grenzenlos, der aber doch durch die Kuppel begrenzt war. Und auch der felsige Erdkrater, der die „Hälfte der Natur“ bildete, wirkte unermesslich.44 Jules Michelet hatte, bezogen auf das Marsfeld, nicht umsonst „die Leere“ als Denkmal der Französischen Revolution bezeichnet: „Das Empire hat seine Säule, und es hat den größten Anteil am Triumphbogen; das Königtum hat seinen Lourve, seinen Invalidendom; die feudale Kirche von 1200 thront noch immer in Notre-Dame […]. Und die Revolution hat als Denkmal … die Leere …“45
Während der Julimonarchie wurde in Paris die Politik des „percement“ fortgesetzt.46 Letztlich war es aber Georges-Eugène Haussmann vorbehalten, dem bürgerlichen Raum seine „Unermesslichkeit“ zu verleihen. Als Präfekt des Département de la Seine ließ er zwischen 1853 und 1870 ganze mittelalterliche Pariser Viertel abreißen, betrieb die „Boulevardisierung“ der Stadt und zeichnete für die Errichtung der Pariser Oper und der Bibliothèque Nationale, die Erweiterung des Louvre und die Eisenkonstruktion der Pariser Markthallen verantwortlich. Haussmann schuf zudem offene Freizeiträume, etwa den Bois de Boulogne und den Bois de Vincennes.47 Das neu gestaltete Paris sollte nach der Vorstellung Napoleons III. den Ruhm Frankreichs in die ganze Welt hinaustragen – ein Ruhm, den Frankreich der bürgerlichen Gesellschaft zu verdanken hatte, die paradoxerweise gerade unter der Herrschaft eines autokratischen Regimes, dem Zweiten Kaiserreich, eine ihrer Blütezeiten erlebte. Hauptverantwortlich für die bauliche Modernisierung war letztlich auch das Großbürgertum, das die Finanzen kontrollierte.48 Das Haussmann‘sche Paris hatte somit, freilich neben der verbesserten Möglichkeit polizeilicher Überwachung, zwei Funktionen: einerseits den Ruhm der Kaiserzeit zu bezeugen, andererseits dem Bürgertum zur Repräsentation zu dienen und ihm zudem Bewegungsraum zu schaffen, jenes „Volumen der Freiheit“, in dem der „Flaneur“, der Spaziergänger, seine Heimat fand. Während die Aristokratie die Kutsche zur Fortbewegung benutzte, ging der Bürger zu Fuß durch die Stadt, flanierte über die weiten Plätze und Boulevards, entspannte sich dabei und gab sich dem Gefühl des Unendlichen hin, beschränkte sich nicht auf Details, sondern erfasste das Ganze des bürgerlichen Universums.49 Zugleich sollte der „Flaneur“ aber auch kritischer Beobachter sein, der die Schattenseiten und Widersprüche dieses bürgerlichen Universums aufspürte. Er war die Verkörperung des (männlichen) Individualisten und des perfekten Bürgers, indem er als „unaufhörlicher Müßiggänger, Leseratte oder Schaufensterbummler“ auftrat, „der die Stadt Paris als ein für ihn inszeniertes Schauspiel betrachtete“.50 Ob die breiten und langen Boulevards sowie die großen Plätze aber tatsächlich die Entfaltung seiner individuellen Freiheit gestatteten, ist freilich in Frage zu stellen. Möglicherweise ging die „Individualität […] wieder verloren, sobald man auf die Straße trat, wo man einer Vielzahl von Menschen begegnete, wo aber keiner mehr den anderen betrachtete“.51
Unabhängig davon führte die Umgestaltung von Paris zu einer stärkeren Trennung von privater und öffentlicher Sphäre. Durch geschlossene Häuserfronten oder durch Gartenmauern und Gärten, gleichsam Sicherheits- bzw. Übergangszonen, wurde die Autonomie der Privatsphäre geschaffen, die sich deutlich vom öffentlichen Straßenraum abgrenzte,52 vom „Bürgersteig“, auf dem sich der Bürger als „Flaneur“ weitgehend unerkannt unter Bürger mischte. Diese Zweiteilung des bürgerlichen Raumes in eine private und eine öffentliche Sphäre hatte sich bereits Ende des 18. Jahrhunderts angekündigt, als Gebäude mit Zimmern, die nicht miteinander verbunden waren, durch geschlossene Wohnsysteme abgelöst wurden, d.h. durch ganze Wohnungen, in die sich nun Familien zurückziehen und sich von anderen Familien weitgehend abgrenzen konnten. Ferner wurden Vorzimmer eingeführt, die ebenfalls als Übergangszonen zwischen öffentlichem und privatem Raum dienten.53 Dennoch bildeten Öffentlichkeit und Privatheit auch weiterhin kein wirkliches Gegensatzpaar, zumal sich Elemente des Privaten in den öffentlichen Raum ausdehnten: Während der Restauration stieg etwa die Anzahl der Fenster in den Häuserfronten, die sich der Straße zuwandten. In der Julimonarchie wurden Balkone modern, die am Ende des Zweiten Kaiserreiches in allen Etagen vorzufinden waren.54 Mit diesen Fenstern und Balkonen entstanden Interferenzzonen, in denen Privatheit und Öffentlichkeit einander überlagerten.
Der private Raum war aber ursprünglich notwendig gewesen, um den öffentlichen bürgerlichen Raum, das „Volumen der Freiheit“, überhaupt „anzudenken“ und zu konstituieren. Die neue Form des Wohnens mit allen ihren Interferenzzonen weist auf die Geburt der bürgerlichen Gesellschaft im (semi-)privaten Raum und ihren Transfer in den öffentlichen Raum hin. In ihr spiegelt sich der gleichsam „organische“ Zusammenhang von Privatheit und Öffentlichkeit.55 Ohne die Erfindung des Privaten – die individuelle geistige Beschäftigung im Studierzimmer und in der hauseigenen Bibliothek, schließlich die private Diskussion mit Gleichgesinnten in Salons und Cafés – hätte sich die öffentliche Meinung nicht etablieren können, zumal im (semi-)privaten Raum die Voraussetzungen für den offenen Diskurs geschaffen wurden, der als ein zentrales Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft betrachtet werden kann.56
1.2 Der offene Diskurs
Der offene Diskurs ist nicht nur als Abwägen und Zusammenprallen unterschiedlicher Aussagen bzw. als Konsenssuche innerhalb eines vorgegebenen normativen Rahmens zu verstehen. Vielmehr umfasst er auch so genannte „Grenzüberschreitungen“, Aussagen und Handlungen, die angesichts der herrschenden gesellschaftlichen Normen und Werte als unerhört gelten und Aufsehen erregen, aber dennoch eine Diskussion bzw. einen Disput nach sich ziehen. Freilich ist man, um mit Michel Foucault zu sprechen, nur „im Wahren […], wenn man den Regeln einer diskursiven ‚Polizei‘ gehorcht, die man in jedem seiner Diskurse reaktivieren muss“.57 Allerdings sind der „Austausch und die Kommunikation […] positive Figuren innerhalb komplexer Systeme der Einschränkung“,58 d.h. dass etwa rhetorische wie schriftliche Regeln vorgegeben sind, die aber dennoch das „Unerhörte“ zulassen. Dies gilt umso mehr für die bürgerliche Gesellschaft, deren Normen- und Regelsystem – wie noch anhand der Entwicklung der Kunst und Literatur gezeigt werden soll – im Laufe des 19. Jahrhunderts ausgedehnt wurde. Die Grenzen wurden durchlässig, die Infragestellung von Grenzen selbst zur Regel. Der offene Diskurs ist daher ein Inklusionskonzept: Einerseits schreibt er einen auf Rationalismus basierenden Typus von Kommunikation vor, andererseits ist er aber im Bezug auf Sachthemen durchaus offen,59 weshalb das „Unerhörte“ letztlich gehört wird und somit die bürgerliche Gesellschaft bereichern und weiterentwickeln kann. Der jeweilige Diskurs dreht sich also nicht um die eigene Achse, sondern lässt sich durchaus erweitern, weshalb hier der Begriff des offenen Diskurses gewählt wurde.
Dieser offene Diskurs resultierte nicht zuletzt aus der „fureur d’apprendre“, der „Leidenschaft zu lernen“, die das Bürgertum seit dem 18. Jahrhundert erfasst hatte.60 Eine wichtige Voraussetzung für diese Leidenschaft ist die zunehmende Bedeutung der Literalität. „Das Schreiben steigert die Bewußtheit“, meint der Medientheoretiker Walter Ong. „Um zu leben, um voll zu verstehen, benötigen wir nicht nur Nähe, sondern auch Entfernung. Schreiben schafft diese Entfernung […]. Es beflügelt das Selbstgefühl und begünstigt eine bewußtere Interaktion zwischen Personen. Schreiben ist Bewußtseinserweiterung.“61 Folglich ist auch die kritische Betrachtung der Gesellschaft nur aus der Entfernung, d.h. mit dem Aufkommen der schriftlichen Kultur möglich, die schließlich ihren maßgeblichen Teil zum Kampf gegen das feudale System beitragen sollte. Roger Chartier hat die Geschichte der Produktion und Aneignung von Texten untersucht und dabei entdeckt, dass mit der vermehrten Zirkulation des Gedruckten zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert die schöpferische Freiheit des Individuums, obzwar Regeln unterworfen, gefördert wurde.62 Nicht zufällig stieg im 18. Jahrhundert die Zahl der Zeitungen stark an. In Paris gab es 1785 bereits 14 regelmäßig erscheinende Zeitungen. Während der Französischen Revolution wurde schließlich die Zensur abgeschafft und in der Folge eine unübersehbare Zahl von Zeitungen gleichsam über Nacht herausgegeben. Auch royalistische Blätter konnten zunächst unter dem Schutz der Pressefreiheit publizieren werden. Weil die Revolutionäre aber befürchteten, die Revolutionsgegner mit solchen Zeitungen zu stärken, wurden sie 1792 verboten.63
Tatsächlich bedingt Literalität nicht nur Reflexion, sondern beeinflusst auch das Handeln. Sie ermöglicht den politischen Diskurs und damit auch die Durchsetzung politischer Ideen, womit sie letztlich zur Etablierung der bürgerlichen Gesellschaft beitrug. „Sie [die Literaten, Anm. d. V.] beschäftigten sich unablässig mit den Gegenständen, die sich auf die Regierung beziehen“, schreibt Alexis de Tocqueville im Jahr 1856.
Täglich hörte man sie sprechen über den Ursprung der Gesellschaft und deren primitive Formen, über die ursprünglichen Rechte der Bürger und der Staatsgewalt, über die natürlichen und künstlichen Beziehungen untereinander, über den Irrtum oder die Berechtigung des Herkommens und über die Prinzipien der Gesetze. […] Die Schriftsteller gaben dem Volke, das diese Revolution machte, nicht nur ihre Ideen, sondern auch ihr Temperament und ihre Stimmung.64
In dem von Caron de Beaumarchais 1784 verfassten Theaterstück „Le mariage de Figaro“ (Die Hochzeit des Figaro) tritt etwa der Diener Figaro als Kritiker und Gegner des Grafen Almaviva auf. Bei der Uraufführung soll es, wohl wegen des politisch brisanten Inhalts, drei Tote gegeben haben. Im Stück „La mère coupable“ (Die Schuld der Mutter), das Beaumarchais 1792, also bereits während der Französischen Revolution, schrieb, rettet Figaro schließlich dem ruinierten Grafen, der noch dazu verbürgerlicht wird, das Leben. „Figaro“, meinte Napoleon Bonaparte, „das war die fortschreitende Revolution“.65 Wenn nun der Adel in der Literatur thematisiert wurde, etwa in „Liaisons Dangereuses“ (Gefährliche Liebschaften, 1792) von Pierre Choderlos de Laclos, dann als absterbende Gesellschaft.66 Zudem verlor die so genannte „Ständeklausel“ an Bedeutung, die das Bürgertum und die unteren Schichten nur in Komödien auftreten hatte lassen. „Man gelangt nicht immer dann zur Revolution“, schreibt Alexis de Tocqueville, „wenn eine schlimme Lage zur schlimmsten wird.“67 Voraussetzung ist vielmehr, dass sich eine soziale Gruppe, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung erlangt hat, in ihrer weiteren Entfaltung eingeschränkt sieht und überdies einen konkreten Entwurf von der Zukunft besitzt.68 Bei der Französischen Revolution war dies der Fall: Das Bürgertum hatte längst eine unanfechtbare Stelle in der Gesellschaft eingenommen, wurde aber durch das absolutistische System in seinem Handeln beschränkt. Und die aufgeklärte Literatur hatte bereits das Modell einer neuen Gesellschaft formuliert, das die Revolutionäre schließlich zu verwirklichen versuchten.
Entstanden war dieses Modell unter anderem in so genannten „Salons“, halbprivaten Zusammenkünften, die seit dem 17. Jahrhundert zunächst von gebildeten Damen der aristokratischen Gesellschaft organisiert wurden. Sie boten den Gelehrten und Schriftstellern einen Raum, um über Politik und gesellschaftliche Veränderungen zu diskutieren. Zu den Stammgästen des bekannten Salons von Madame Marie-Thérèse de Geoffrin gehörten um 1750 unter anderem Philosophen wie d’Alembert, der Schriftsteller Bernard Le Bovier Fontenelle, der Naturforscher Georges Louis Leclerc Graf von Buffon sowie der Publizist und Diplomat Melchior Grimm. Es verwundert daher auch nicht, dass Madame Geoffrin die Herausgabe der 35-bändigen „Encyclopédie“ finanziell unterstützte.69 Die „Encyclopédie“, zugleich Nachschlagewerk und Kampfinstrument der Aufklärung,70 sollte den Fortschritt der Naturwissenschaften, der Technik und der Geschichte dokumentieren. Im Gegensatz zur absoluten Gewalt des Fürsten und zur Regelung der Wirtschaft durch das Zunftwesen wurden die eingezäunte Freiheit des Individuums, die Meinungs- und Pressefreiheit sowie die Freiheit von Industrie und Handel gefordert. In einem Brief an Voltaire schreibt Diderot: „Dies soll unser Leitspruch sein: keine Nachsicht für die Abergläubischen, die Fanatiker, die Ignoranten oder für die Narren, Übeltäter oder Tyrannen. Ich möchte unsere Brüder vereint sehen im Streben nach dem Wahren, Guten und Schönen.“71 Am Beispiel der „Encyclopédie“ zeigt sich deutlich, wie Salons die private mit der öffentlichen Sphäre vermischten und gleichsam eine Brücke zwischen zwei Welten darstellten, die lediglich zwei Seiten einer Medaille, der Aufklärung und der bürgerlichen Gesellschaft, waren.
Neben den Salons, deren Zugang auf die bürgerliche und intellektuelle Elite beschränkt war, entwickelten sich seit dem 18. Jahrhunderts auch Cafés zu Orten, an denen unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallten und somit der offene Diskurs gepflegt wurde. Cafés ermöglichten eine „lecture collective“72, ein „kollektives Lesen“, indem Zeitungsartikel vorgelesen wurden. Damit konnten auch „häufig […] die Grenzen zwischen Bücherlesern und Analphabeten übersprungen“ werden.73 Literalität wurde in den Cafés wieder oralisiert, schriftlicher und mündlicher Diskurs ergänzten einander. Vor der Revolution entstanden in diesen Cafés politische Zirkel, etwa im Pariser Café „Procope“, in dem sich zunächst alle konkurrierenden politischen Gruppen trafen. Später konnte diesen Gruppen jeweils ein eigenes Café zugeordnet werden.74
Raum für den offenen Diskurs boten auch die Restaurants, die in den zwei Jahrzehnten vor der Revolution entstanden waren und neben den Cafés als bürgerliche Orte schlechthin gelten können. Das erste große Pariser Restaurant, „La Grande Taverne de Londres“, war von Antoine Beauvilliers in den 1780er Jahren eröffnet worden. Die Revolution erhöhte schließlich die Nachfrage nach solchen Einrichtungen, zumal viele Deputierte zur Nationalversammlung, die aus der Provinz stammten, in Pensionen wohnten und ihre Mahlzeiten außerhalb einnahmen. Der steigende Bedarf an Restaurants wurde zunächst durch Köche gedeckt, die ihre Anstellung verloren hatten, weil ihre aristokratischen Dienstgeber geflüchtet oder bemüht waren, durch eine wenig aufwändige Haushaltsführung nicht als Revolutionsgegner verdächtigt zu werden. Als neue Möglichkeiten der Existenzsicherung bot sich diesen Köchen die Gründung eines Restaurants an.75 „Sie sind Wirte geworden“, schreibt der Schriftsteller Louis Sébastien Mercier 1789, „und haben angekündigt, dass sie für alle gegen Bezahlung die Wissenschaft des Maules, wie Montaigne sagt, lehren und praktizieren werden.“76 Diese „Wissenschaft“ förderte auch eine andere „Wissenschaft“: die Politik. So gründete etwa ein Koch des Prinzen Condé, der unmittelbar nach dem Sturm auf die Bastille in das Exil geflüchtet war, ein Restaurant, zu dessen Stammkunden führende Jakobiner zählten.77 Die steigende Zahl von Restaurants in Paris zeigt gleichsam seismographisch die Dursetzung der bürgerlichen Öffentlichkeit an: 1789 existierten in Paris rund 50 Restaurants, 1820 bereits 3.000.78
1.3 Das kulturelle Regelsystem
Die eingezäunte Freiheit und das gesellschaftliche Prinzip des offenen Diskurses spiegeln sich im kulturellen Regelsystem des bürgerlichen Frankreichs, das – trotz mancher Anleihen aus dem Ancien Régime – zur Abgrenzung von der aristokratischen Welt diente und somit als Ausdruck der bürgerlichen Emanzipation zu interpretieren ist. Der bürgerlichen Gesellschaft anzugehören bedeutete, spezifische Denk-, Verhaltens- und Handlungsmuster zu übernehmen, die von Sozialisation und somit von einem bürgerlichen „kollektiven Gedächtnis“79 (S. 59) abhängig waren. Honoré Daumier stellt etwa in seiner Zeichnung „Le Connaisseur“ einen älteren Herrn dar, welcher – der Realität entrückt und in höchster ästhetischer Erregung – in einem mit Kunstwerken vollgestopften Zimmer auf eine verkleinerte Nachbildung der Venus von Milo blickt. Letztlich präsentiert er hier ein gesellschaftlich vorgegebenes Modell des bürgerlichen Kunstgenusses, das sich im kollektiven Gedächtnis verankert hat und dem der Erhalt der bürgerlichen Gesellschaft über das Mittel spezifischer Kunstbetrachtung zugrunde liegt. Ganz in diesem Sinne wollte der Journalist und Verleger Edouard Charton mit der Kunst das „Gefühl der Liebe zum Schönen“ in der französischen Nation geweckt sehen, um den „Fortschritt ihrer Zivilisation“ und „ihren Ruhm“ zu gewährleisten.80 Folglich kann gleichsam der Müßiggang, der temporäre Rückzug aus der Öffentlichkeit, als zentraler Bestandteil des bürgerlichen Gesellschaftsmodells betrachtet werden.81
1875, als Charton dieses leidenschaftliche Plädoyer für die Kunst schrieb, liebte das Bürgertum die Oper, begeisterte sich für das Theater oder interessierte sich für Museen und Gemäldegalerien – oder tat zumindest so, um zu beweisen, dass man zur bürgerlichen Gesellschaft gehörte. Kunst und bürgerliche Gesellschaft waren untrennbar miteinander verbunden. Prächtige Gebäude wurden errichtet, in denen die Kunst eine Heimat finden sollte, etwa die von Charles Garnier im neubarocken Stil entworfene und zwischen 1862 und 1875 realisierte Pariser Oper, die „Opéra“. Als Höhepunkt des Pariser Kulturlebens ließ sich das Bürgertum den Pariser Salon nicht entgehen – eine staatliche Kunstausstellung, die seit 1791 zunächst unregelmäßig und seit 1831 alljährlich stattfand. Bis in die 1880er Jahre galt der Pariser Salon als maßgebende Institution für die bildenden Künste. 1849 wurde er in die Tuilerien und 1850 in den Palais-National (Palais-Royal) verlegt, später schließlich in den Palais de l’Industrie, der für die Weltausstellung von 1855 errichtet worden war.82 Die Dimension dieser Ausstellung war nicht nur für damalige Verhältnisse beeindruckend: Im Salon von 1880 konnten die Zuschauer etwa 3.975 Ölgemälde und 2.063 Aquarelle, Pastellbilder, Miniaturen, Kunstglasscheiben, Emaillearbeiten, Porzellangeschirr und Steingut bewundern, ferner 131 Skultpuren, 111 Architekturstudien und -projekte, 305 Stiche und 100 Lithografien.83
Das bürgerliche Interesse für die Kunst wurde aber nicht nur durch Museums- und Ausstellungsbesuche bewiesen, sondern auch, wie es der „Connaisseur“ von Daumier vorzeigt, durch das Sammeln von Kunstgegenständen. Während die Reicheren wertvolle Sammlungen anlegten, begnügten sich die weniger Begüterten mit Kopien von Gemälden und Plastiken (S. 153).84 „Niemand sagt einem Sammler, was er sammeln und wieviel Zeit, Geld oder Energie er seiner Sucht widmen soll“, schreibt Peter Gay. „Aber die Motive für das Sammeln deckten […] ein breites Spektrum von Triebkräften ab, die ihre tiefsten Wurzeln im Unbewussten haben.“85 Und da bekanntlich das Unbewusste zu keinem geringen Teil durch Sozialisationsprozesse determiniert ist, waren Sammler geradezu gezwungen, bestimmten Trends zu folgen. Der Kunstkritiker Théophile Thoré veranschaulicht diesen Zwang am Beispiel von Alexandre Decamps, der sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts als Orientmaler und noch dazu als technischer Erneuerer größter Beliebtheit erfreute: „Ohne einen Decamps kann man keine Sammlung anfangen, und jeder, der einen Decamps besitzt, ist verloren; er beginnt die Malerei zu lieben; er muß Bilder sammeln: voilà, schon ist er ein Sammler.“86 Untergebracht waren die privaten Kunstsammlungen in den bürgerlichen Villen und Wohnungen, deren Interieur im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr an Antiquitätengeschäfte, Kunsthandlungen oder Galerien erinnerte.87
Im „grand salon“ (großen Salon) dieser bürgerlichen Privatmuseen ahmte die bürgerliche Dame die Salons des 18. Jahrhunderts nach. An einem bestimmten Tag, einem „jour fixe“, empfing sie ihre Gäste und inszenierte gleichsam das Theater der Bürgerlichkeit: Gedichte wurden rezitiert und aus Romanen vorgelesen, über die jüngste Theateraufführung diskutiert oder Kammerkonzerte gegeben. Nicht selten dilettierten die Gastgeberin oder ihre Tochter selbst auf dem Klavier, das zur unentbehrlichen Ausstattung des bürgerlichen Haushaltes geworden war. Bereits um 1840 zählte man in Paris rund 20.000 Klaviere.88 Für die Töchter aus „gutem Hause“, ganz gleich ob sie nun Begabung hatten oder nicht, war es eine Verpflichtung, den Klavierunterricht zu besuchen. In Paris standen dafür um 1860 über 20.000 Klavierlehrer zur Verfügung.89 Manche der regelmäßigen Zusammenkünfte der bürgerlichen Elite in einem „grand salon“ wurden zu gesellschaftlichen Ereignissen, an denen bekannte Künstler und Künstlerinnen der Opéra Comique, der Opéra oder der Comédie-Française mitwirkten.90 „Le Figaro“ berichtete um 1900 in der Rubrik „Le Monde & la Ville“ unter anderem auch regelmäßig über bekannte Pariser Salons und bestätigte immer wieder den großen „Erfolg für alle diese bewundernswerten Künstler“.91 Der Ruf eines Salons hing letztlich von der Gastgeberin ab. „Kennen Sie eine andere Stadt der Welt“, fragte etwa die britische Schriftstellerin Violet Trefusis im Zusammenhang mit dem unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg etablierten Pariser Salon von Marie-Louise Bousquet, „wo man jeden Donnerstag zu einer Frau eilen würde, die weder jung noch schön noch reich ist? Einfach nur, weil sie Esprit besitzt.“92
Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatte der Salon aber seine politische Bedeutung verloren und sich zu einem kulturellen Ereignis gewandelt, das sich nicht selten durch Oberflächlichkeit auszeichnete. So schreibt etwa der Schrifsteller Prosper Mérimée Anfang der 1860er Jahre in Erinnerung an Juliette Récamier, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts einen der bekanntesten Salons in Paris führte:
Man findet in einem Salon eine gewisse Anzahl vorgefertigter Meinungen und Ideen, die man übernimmt und anderswo verbreitet. Er ist ein Arsenal, dem man Munition entnimmt, um Lärm zu machen. […] Es ist notwendig, Leute mit Geist anzulocken und sie festzuhalten. Man muss ihren Geist jenen näher bringen, die nur Titel oder Geld haben.93
Viele Republikaner waren daher davon überzeugt, dass die Republik keine Salons benötige, weil die Oberflächlichkeit der Konversation in den Salons an die Aristokratie des Ancien Régime erinnere. So bezeichnet das „Große Universalwörterbuch“ von Pierre Larousse unter dem Schlagwort „Salon“ diesen als „tot“. Gleichzeitig belehrt es jene, die deswegen „den Verlust des Esprit der Konversation“ befürchteten: „Wenn man darunter die Kunst versteht, nichts im eleganten Stil zu verbreiten, die Kunst, gelangweilt seine Zeit zu verlieren, werden wir die Letzten sein, darüber zu klagen, dass sich der französische Esprit letztlich ernsthaften Angelegenheiten und Gedanken widmet.“94
Die Oberflächlichkeit, die Larousse beklagt, zeigt sich unter anderem auch darin, dass die Zeitung „Le Figaro“ seit 1913 die Berichte über private und öffentliche Gesellschaften in der Rubrik „Le Monde & la Ville“ vermischte, während etwa in den 1870er Jahren, in den ersten Jahren der Dritten Republik, noch eine strikte Trennung stattgefunden hatte. Dieser Wandel scheint weniger darauf zurückzuführen zu sein, dass „die republikanische Elite ab diesem Zeitpunkt [seit der Jahrhundertwende, Anm. d. V.] einen integralen Bestandteil des mondänen Pariser Netzwerks“ bildete, also von der französischen gesellschaftlichen Elite endlich akzeptiert wurde, wie Anne Martin-Fugier meint.95 Denn republikanische Politiker waren auch zuvor Teil der gesellschaftlichen Elite und somit Gäste diverser Salons gewesen, etwa bei Aline Ménard-Dorian, die der „gauche caviar“96, der „Kaviar-Linken“, eine gleichsam gesellige Heimat gab, unter anderem dem Journalist Henri Rochefort sowie dem späteren französischen Ministerpräsidenten Georges Clemenceau. Ein anderer Salon, der von Republikanern gerne besucht wurde, war jener von Madame und Monsieur Henry Liouville, wobei der Gastgeber selbst in der Nationalversammlung als Deputierter saß.97 Daher lässt sich die Vermischung öffentlicher Gesellschaften, etwa von Empfängen, mit privaten Salons bei der Berichterstattung in „Le Figaro“ wohl darauf zurückführen, dass sich die Dritte Republik nach politischen Krisen wie der Boulanger-Krise (S. 248) und der Dreyfus-Affäre (S. 249) gefestigt hatte. Offizielle Gesellschaften verloren nun ihren oftmals politischen Charakter und nahmen die Form eines kulturellen Ereignisses an, das – genauso wie die Salons, der Opern- und Theaterbesuch oder das Dîner in einem vornehmen Restaurant – die bürgerliche Gesellschaft im Kleinen abbildete.
In diesen öffentlichen und (semi-)privaten Räumen der bürgerlichen Gesellschaft war es notwendig, den vorgegebenen Normen zu entsprechen und etwa die „richtige“ Haltung beim Sitzen oder Stehen, zu Tisch oder beim Tanz zu beherrschen. Wer die vorgeschriebenen Regeln in den jeweiligen Räumen – im privaten Salon, im Theater oder in der Oper, beim Flanieren oder in den Cafés und Restaurants – nicht beherrschte, war sofort als jemand entlarvt, der nicht zu bürgerlichen Gesellschaft gehörte. Als Teil der bürgerlichen Körper- und Bewegungskultur spiegelte eine spezifische Körperhaltung die eingezäunte Freiheit und lehrte das Individuum, sich darin auch angemessen zu bewegen. So entsprach etwa das Verhalten beim bürgerlichen Tanz den Prinzipien der „legalen Herrschaft“: Die Tanzpartner agierten gemeinsam, behinderten einander nicht und durchkreuzten mit anderen Paaren das Tanzparkett, freilich ohne mit diesen zusammenzustoßen. Eine Tanzveranstaltung war ohne Zweifel ein buntes Treiben, das aber letztlich in geregelten Bahnen verlief, obwohl kein Tanzmeister wie bei den adeligen Gesellschaftstänzen für Ordnung sorgte. Die Autonomie eines Tanzpaares wurde – im Sinne des „Naturzustandes“, wie ihn John Locke definiert hatte – durch jene der anderen tanzenden Paare mitbestimmt, und der Rhythmus der Musik zähmte die Wildheit der Bewegungen. Dennoch verschmolz die gesamte Tanzgesellschaft wie ein natürlicher Organismus zu einem Ganzen.98
Auf dem Gemälde „Le Bal du Moulin de la Galette“ (1876) hat Pierre-Auguste Renoir eine Tanzveranstaltung in einer „guinguette“ verewigt, einem Gartenlokal auf dem Montmartre, in dem die „petite bourgeoisie“ (Kleinbürgertum) und das so genannte „einfache“ Volk verkehrten (siehe Tafel 1). Die auf dem Gemälde dargestellten Gäste vermischen sich zu einer vibrierenden Einheit, in der sich jedoch die tanzenden Paare, eingegrenzt von einer Menschenmenge und verloren in Zweisamkeit, die durch die verschwommene Darstellung des Tanzbodens99 noch verstärkt wird, ungehindert bewegen können. Die einzelnen Tanzpartner verschmelzen aber letztlich miteinander; das „Ich“ und das „Du“ suchen und finden einander im „Volumen der Freiheit“. Renoirs Gemälde lässt den Menschen nicht als „geschlossene Persönlichkeit“ erscheinen, sondern verweist auf ein „Geflecht der Angewiesenheit der Menschen aufeinander“, auf eine „Figuration“, die Norbert Elias am Beispiel der gesellschaftlichen Tänze veranschaulicht:
Man denke an eine Mazurka, ein Menuett, eine Polonaise, einen Tango, einen Rock’n Roll. […] Die gleiche Tanzfiguration kann gewiß von verschiedenen Individuen getanzt werden; aber ohne eine Pluralität von aufeinander ausgerichteten, voneinander abhängigen Individuen, die miteinander tanzen, gibt es keinen Tanz; wie jede andere gesellschaftliche Figuration ist eine Tanzfigur relativ unabhängig von den spezifischen Individuen, die sie hier und jetzt bilden, aber nicht von Individuen überhaupt.100
Im Gegensatz zu den Gesellschaftstänzen der aristokratischen Gesellschaft war freilich der bürgerliche Tanz auf weitgehende individuelle Autonomie ausgerichtet. Allerdings existierten Regeln, die einerseits die Autonomie aller Tanzpaare, andererseits aber auch deren Verschmelzung zu einem Ganzen ermöglichten, in dem sich die Individuen aber dennoch entfalten konnten. Der Cotillon, eine der beliebtesten Tanzformationen des – paradoxerweise so bürgerlichen101 – Zweiten Kaiserreiches, der in der Regel am Schluss eines Balles gebildet wurde, ist Ausdruck dieser schwierigen Verbindung von Individualismus und kollektiver Vorgabe. Immer wieder werden dabei neue Paare zusammengeführt, die einen kurzen Rundtanz, meist einen Walzer, tanzen. Dieser Walzer, der bürgerliche Tanz par excellence, erscheint nur auf den ersten Blick als ein von Regeln völlig befreites, geradezu hemmungsloses Drehen. Als er sich im ausgehenden 18. Jahrhundert in Frankreich durchzusetzen begann, gestaltete sich die französische Version sogar deutlich komplizierter als der Wiener Walzer. Es war nicht nur vorgeschrieben, auf Zehenspitzen zu tanzen, sondern auch Pirouetten zu schlagen und andere Grundfiguren der klassischen Ballsaaltänze einzuhalten.102 Der Bruch mit den Traditionen des Ancien Régimes erfolgte nicht, wie es die Revolutionäre gewünscht hatten, mit ihrer Auslöschung, sondern durch ihre Transformation. Mit dem gesellschaftlichen Siegeszug des Bürgertums wurde jedoch laut Norbert Elias „vieles von dem, was im Ursprung spezifisch höfisch und gewissermaßen unterscheidender Sozialcharakter der höfischen Aristokratie, dann auch der höfischen Bürgergruppe war, in einer immer intensiveren Ausbreitungsbewegung und ganz gewiß in bestimmter Weise umgebildet“.103 Außerdem kamen neue kulturelle Elemente hinzu, womit letztlich ein kulturelles Regelsystem geschaffen wurde, das zur Abgrenzung gegenüber der höfischen Welt dienen konnte.
Auch die französische „haute cuisine“ hatte sich zunächst in einem spezifisch höfischen Rahmen entwickelt. Bereits im 17. Jahrhundert wurden Ess- und Trinkexzesse sowohl in adeligen als auch bürgerlichen Kreisen durch eine Mäßigung an der Tafel abgelöst, von der „eleganten Schlichtheit“ bzw. vom „französischen Modell“. Alle Bereiche der Tischkultur wurden davon erfasst: Das System der Tischregeln verkomplizierte sich zunehmend, die Rezepte wurden verfeinert, Trinkgläser und Essgeschirr unterlagen einer Vereinheitlichung, aber auch die Ausstattung der Speisezimmer veränderte sich grundlegend. Im 18. Jahrhundert erlangte der Begriff des „régime alimentaire“ (Diät) in medizinischen Kreisen besondere Bedeutung, und auch Rousseau übernahm ihn in seinen Schriften, indem er von Mäßigung sprach und unverfälschte Nahrungsmittel empfahl.104 „Natürlichkeit“ und „Einfachheit“ wurden der Künstlichkeit gegenübergestellt.
Die Aufklärung dehnte diesen Gegensatz auf alle gesellschaftlichen Bereiche aus, etwa auch auf die Kleidungsgewohnheiten und die Köperpflege: Einengende Kleidung wurde kritisiert, reifenlose Röcke wurden favorisiert und während der Französischen Revolution gewannen fließende, an die Antike erinnernde Gewänder an Bedeutung.105 Ferner war der Begriff der „Sauberkeit“ nicht mehr nur an der Kleidung ablesbar, sondern betraf nun direkt den Körper. Die Haut sollte gleichsam von Schmutz „befreit“ werden, um „atmen“ und „transpirieren“ zu können. Damit in Verbindung wurde auch die Künstlichkeit des Parfums als Widerspruch zur Mentalität des Bürgertums betont, wobei hier vor allem die Praxis gemeint war, eindringliche Körpergerüche mit „Potpourris“ zu überdecken. Parfüms wurden nicht abgelehnt, wenn sie nicht betäubend und stark riechend, sondern nuanciert und verfeinert waren.106 Die Fähigkeit zur Differenzierung steht in Verbindung mit der „sensibilité“, der Empfindsamkeit, die der Aufklärer François Arnail de Jaucourt als Voraussetzung für soziales Handeln beschrieb: „[…] die Empfindsamkeit bringt den tugendhaften Menschen hervor. Die Empfindsamkeit ist die Mutter der Menschlichkeit und des Großmutes; sie fördert das Verdienst, unterstützt den Geist und hat die Überzeugung zur Folge.“107
Ohne Zweifel galt diese Empfindsamkeit auch als Voraussetzung für die Verfeinerung der Küche. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren etwa Grimond de la Reynière und Jean-Anthelme Brillant-Savarin, zwei Pioniere der französischen Gastronomie, von der Notwendigkeit eines feinen Geschmacks überzeugt. Und auch Urbain Dubois und Émile Bernard, deren „Cuisine Classique“ 1856 in der ersten Auflage erschien, empfahlen, Mahlzeiten zwar reich und luxuriös zu gestalten, aber auf Übermaß und Übertreibung zu verzichten.108 Der empfindsame „Connaisseur“ – nicht nur der Kunstliebhaber, sondern auch der Feinschmecker – setzte sich durch und sollte offen für neue kulinarische Entdeckungen sein. „Nun leben wir in einer Epoche“, schreibt Auguste Vitu 1890 in „Le Figaro“,
in der die Gourmets nicht mehr in allen Dingen warten wollen und gewohnt sind, sich nicht mehr nach der natürlichen Ordnung der Jahreszeiten zu bedienen, sondern nach dem unmittelbaren Anspruch ihres feinen Geschmacks. Unsere Väter gaben sich zufrieden, die Schoten im Frühling, die Kirschen im Sommer, den Gutedel [eine Tafeltraube bzw. Rebsorte zur Erzeugung leichter weißer Tischweine, Anm. d. V.] im Herbst zu essen. Der kulturelle Fortschritt, die schnelle Entwicklung der Kommunikation hat die Jahreszeiten verändert und die Breitengrade angenähert. Man serviert auf unserer Wintertafel Schoten, Spargel, Trauben und Erdbeeren. Die Treibhäuser sorgen dafür, ebenso der Süden Europas und das östliche Britisch-Indien und Burma […].109
Die damit verbundene ständige Verfeinerung des Geschmackes, die sowohl im Kunstsinn als auch im Rationalismus des Bürgertums, unter anderem in der Entstehung der Ernährungswissenschaft, begründet lag, verwandelte die „haute cuisine“ gleichsam zu einer „grande cuisine“. Dadurch kam es zu einer französischen Hegemonie bei den Handbüchern für Berufsköche, die der französischen Küche verstärkt zu internationalem Ruhm verhalf.110 So war etwa die belgische „grande bourgeoisie“ (Großbürgertum), für die im Übrigen ein Besuch von Paris ein kulturelles „Muss“ darstellte, im 19. Jahrhundert mehr an der französischen Küche als an lokalen belgischen Spezialitäten interessiert. Von den sechs angesehensten Restaurants in Brüssel wurden Ende des 19. Jahrhunderts vier von Franzosen geführt. „Paris war die Norm“, schreibt Peter Scholliers, „und es war eine große Ehre für die besten Restaurants von Brüssel, wenn sie sich mit jenen von Paris verglichen sahen.“111
Mit der Revolution und dem Sieg des Bürgertums über die Aristokratie war ein Wendepunkt in der Ess- und Trinkkultur eingetreten: Die professionelle Kochkunst trennte sich durch die Gründung von Restaurants zunehmend von der häuslichen, und die Präsentation der Mahlzeiten, sowohl die Reihenfolge als auch die Komposition der einzelnen Gänge, unterlag einem starken Wandlungsprozess. So wurde der so genannte „Service à la française“, der aus dem Ancien Régime stammte und zunächst von der bürgerlichen Gesellschaft übernommen worden war, im Laufe des 19. Jahrhunderts vom „Service à la russe“ abgelöst.112 Woher der „Service à la russe“ stammt, ist im Übrigen unbekannt. Die Legende erzählt, dass er erstmals beim russischen Botschafter Alexander Kurakin in Paris eingeführt worden sei.