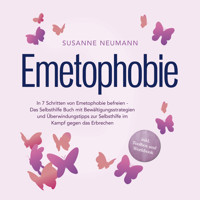11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der Sozialstaat Deutschland hat ausgedient, die Mittelschicht bricht weg, und der Niedriglohnsektor wächst. Immer mehr Menschen sind auf zwei oder drei Jobs angewiesen, um über die Runden zu kommen. Etwas läuft gehörig schief in diesem Land, und Susanne Neumann hat die Schwachstellen unseres Sozialsystems sehr gut erkannt. Aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte weiß sie genau, was schlechte Bezahlung und die Angst vor dem sozialen Abstieg bedeuten. In ihrem Buch zeigt sie anhand ihrer Lebensgeschichte, dass in allen gesellschaftlichen Bereichen soziale Ungerechtigkeit herrscht, mit katastrophalen Folgen für Deutschland. Susanne Neumann ist zum Sprachrohr all derer geworden, die von ihrer Arbeit kaum oder gar nicht leben können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber das BuchÜber die AutorinTitelImpressum1. »Warum bleibt ihr dann bei den Schwatten?« – Meine kleine Frage und ihre großen Folgen2. »Du wirst irgendwann als Putzfrau enden« – Meine schwierige Jugend und die Vorahnung meines Vaters3. »Im Papierkorb is’ noch Staub« – Mein neues Leben und ein berufliches Schlüsselerlebnis4. »Wenn deine Nummer gezogen wird, biste weg« – Meine späte Versöhnung und keine besonders rosigen Aussichten5. »Du gewöhnst dir ab, Wünsche zu haben« – Mein Fazit nach fast vier Jahrzehnten im NiedriglohnsektorÜber das Buch
Der Sozialstaat Deutschland hat ausgedient, die Mittelschicht bricht weg, und der Niedriglohnsektor wächst. Immer mehr Menschen sind auf zwei oder drei Jobs angewiesen, um über die Runden zu kommen. Etwas läuft gehörig schief in diesem Land, und Susanne Neumann hat die Schwachstellen unseres Sozialsystems sehr gut erkannt. Aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte weiß sie genau, was schlechte Bezahlung und die Angst vor dem sozialen Abstieg bedeuten. In ihrem Buch zeigt sie anhand ihrer Lebensgeschichte, dass in allen gesellschaftlichen Bereichen soziale Ungerechtigkeit herrscht, mit katastrophalen Folgen für Deutschland. Susanne Neumann ist zum Sprachrohr all derer geworden, die von ihrer Arbeit kaum oder gar nicht leben können.
Über die Autorin
Susanne »Susi« Neumann ist quasi über Nacht zum Star der SPD geworden. Die Reinigungskraft aus Gelsenkirchen trat erstmals Mitte April bei Anne Will auf. Bei der Wertekonferenz der SPD diskutierte sie dann mit Sigmar Gabriel über die Zukunft der Partei – und las dem SPD-Chef die Leviten. Sie erhebt die Stimme im Namen aller Arbeitnehmer, die von ihrer Arbeit kaum noch leben können und prangert das deutsche Sozialsystem scharf an. Sie selbst hat jahrzehntelang als Putzfrau gearbeitet und Kinder großgezogen, doch auch ihr droht nun in die Altersarmut abzurutschen.
BASTEI ENTERTAINMENT
Originalausgabe
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anne Büntig
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde
Titelfoto: © Manfred Esser, Bergisch Gladbach
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-3651-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
1.
»Warum bleibt ihr dann bei den Schwatten?« – Meine kleine Frage und ihre großen Folgen
Ehrlich gesagt verstand ich gar nicht, warum plötzlich der völlige Wahnsinn über mich hereinbrach. Ich hatte diese kurze Frage ausgesprochen, die meiner Ansicht nach vollkommen logisch war. Vorher hatte ich bereits eine ganze Menge anderer Dinge gesagt, die mir genauso logisch erschienen, und auch danach fuhr ich damit fort. Ich sagte zum Beispiel: »Man muss die Agenda 2010 endlich umkehren.« Oder: »Es kann nicht sein, dass Leiharbeit zu einem Zwei-Klassen-System führt, weil der eine Bandarbeiter mehr Stundenlohn bekommt als der Kollege direkt neben ihm.« Oder: »Wer immer nur einen befristeten Arbeitsvertrag kriegt, der kriegt auch keinen Mietvertrag und keinen Kredit.«
Das alles wusste ich aus eigener Erfahrung. Und ich sagte es, weil ich auf einer Bühne saß und vor mir ein Pult aufgebaut war, auf dem groß und breit das Wort »Gerechtigkeit« stand. Genau darum sollte es hier gehen – jedenfalls hatte die SPD mich zu dieser so genannten »Wertekonferenz Gerechtigkeit« in ihre Berliner Zentrale eingeladen. Also ging ich davon aus, dass vor allem dieses wichtige Thema hier behandelt wurde: »Gerechtigkeit«. Damit kannte ich mich nun wirklich aus, nach über 36 Jahren als Putzfrau. Genauer gesagt kannte ich mich mit dem Gegenteil davon aus: mit der ganzen Ungerechtigkeit, die es bei uns gab – in unserem Land im Allgemeinen und in meinem Job und dem Niedriglohnsektor im Besonderen.
Wer wie ich täglich von früh bis spät malochte und aus nächster Nähe mitbekam, wie schwer es manche fleißigen Kollegen inzwischen hatten, ihre Miete zu bezahlen oder für ihre Kinder etwas Anständiges zum Essen oder zum Anziehen zu kaufen; wer dabei zusah, wie ganz normale Menschen nach vielen Jahrzehnten übler Plackerei geradewegs auf die Altersarmut zusteuerten, der hatte in Sachen »Gerechtigkeit« schon ein bisschen was zu melden.
Die Zuhörer im Foyer des Willy-Brandt-Hauses schienen zu verstehen, was ich meinte. Denn jedes Mal, wenn ich mit einem meiner Sätze fertig war, klatschten sie. Das war zwar nicht meine Absicht gewesen, aber es machte mich natürlich stolz: Immerhin saßen im Publikum auch Leute, die ich bis dahin nur aus dem Fernsehen kannte. Manuela Schwesig zum Beispiel, die Bundesfamilienministerin. Und Albrecht Müller, der schon für Helmut Schmidt im Bonner Kanzleramt die Fäden gezogen hatte. Ich lag womöglich nicht ganz so falsch mit meinen Ausführungen, wenn sogar die junge Schwesig und der alte Müller mir zustimmten.
Nur der SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte anscheinend wenig Ahnung von »Gerechtigkeit«. Oder er hatte einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht. Er saß links neben mir und erzählte eine Menge Blödsinn. Er redete davon, dass er die SPD in Teilen für zu akademisiert halte und dass ihm das auf die Nerven ginge, obwohl er selbst bekanntermaßen Germanistik auf Lehramt studiert hatte. Er berichtete, dass er es schade finde, dass sich keine Betriebsräte aus den klassischen Arbeitervierteln mehr in den sozialdemokratischen Gremien engagierten und dass er jetzt selber in einer Gegend für Bessergestellte lebte. Und er verkündete, dass seine Partei die Regelung zur sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen eigentlich habe wieder abschaffen wollen, weil sie uns Arbeitnehmer vor allem im Dienstleistungssektor brutal benachteilige. Bloß, dass das leider nicht ginge, weil man ja mit der doofen CDU regieren müsse.
Daraufhin sagte ich eben diesen Satz: »Warum bleibt ihr dann bei den Schwatten1?«
Die Frage, die für die meisten Anwesenden in diesem Moment so lustig rüberkam, war mein bitterer Ernst. Ich fand schon die Bilanz der ersten Großen Koalition unter Angela Merkel ziemlich enttäuschend, was vor allem die Entwicklung am Arbeitsmarkt und das soziale Gleichgewicht in unserem Land anging. Nach vier in dieser Hinsicht wirklich verheerenden Jahren Schwarz-Gelb hoffte ich anfangs jedoch stark, dass in der neuen politischen Konstellation für die einkommensschwachen Menschen anständigere Bedingungen geschaffen werden konnten, dass weniger ältere Leute in die Armut rutschten und dass jenen Arbeitgebern, die ihre Mitarbeiter nach Strich und Faden ausnutzten und bei jeder Gelegenheit über den Tisch zogen, der Garaus gemacht werden würde. Aber leider täuschte ich mich!
Die Kürzungen bei der Unterstützung von Langzeitarbeitslosen wurden nicht zurückgenommen, wie das von der SPD noch im Wahlkampf lautstark gefordert worden war. Von der von Gabriel und seinen Parteifreunden viel bejubelten Rente mit 63 profitierten unterm Strich vor allem Gutverdiener und Männer. Das Mindestlohngesetz bot den Betrieben noch immer genug Schlupflöcher, um ihren Mitarbeitern am Monatsende sogar weniger Kohle in die Lohntüte stecken zu müssen als vorher. Stattdessen stritten sich die Sozen mit ihrem Koalitionspartner über solchen Quatsch wie die Pkw-Maut oder eine Kaufprämie für Elektroautos. Das musste man nicht verstehen.
Dabei schien ich längst nicht die Einzige zu sein, der das alles ein bisschen zu wenig Engagement war für eine Partei, die viele Jahrzehnte stolz darauf gewesen war, sich vorwiegend für die einfachen Leute einzusetzen. Dumm war daran, dass genau diese einfachen Leute, zu denen ich mich ebenfalls ganz ohne Gejammer zählte, vieles eben vollkommen anders sahen als die Funktionäre. Anders war es kaum zu erklären, dass die SPD seit Jahren in den Umfragen bei knapp 20 Prozent herumdümpelte. Das jedenfalls wusste ich. Und auch sonst kannte ich mich ein wenig mit Zahlen und Fakten aus. Das wiederum wusste Herr Gabriel offensichtlich nicht.
Dabei war ich exakt drei Wochen zuvor bei Anne Will in der ARD zu Gast gewesen. Der Titel der Sendung lautete »Heute kleiner Lohn, morgen Altersarmut – Versagt der Sozialstaat?«, und außer mir waren der Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung da, ein Journalist von der Frankfurter Allgemeinen, irgendein geschniegelter Jungunternehmer – und Hannelore Kraft. Ich saß da also in einer Runde mit lauter redegewandten, klugen Menschen, die ich allesamt nicht kannte, sowie einer sozialdemokratischen Ministerpräsidentin, die später versuchen sollte, sich auf meine Kosten zu profilieren.
Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was eine gewöhnliche Putzfrau aus Gelsenkirchen erst bei Anne Will im Fernsehen zu suchen hat und kurz darauf auf der Wertekonferenz der SPD in der Bundeshauptstadt. Genau dasselbe fragte ich mich natürlich auch, obwohl diese beiden Auftritte nicht einmal die ersten Male waren, dass ich mit dem ganz großen Politiktheater und seinen Darstellern in Berührung kam. Und deshalb will ich erstmal erklären, wie es dazu kommen konnte, dass jemand wie ich, für den sich im Normalfall rein gar niemand von den Wichtigen und Mächtigen interessiert, auf einmal vor ein paar Millionen Zuschauern ihre ehrliche Meinung loswerden durfte.
Ich hatte nie das Abitur gemacht, geschweige denn ein Studium absolviert. Und ich konnte mich sicherlich auch nicht so gewählt ausdrücken wie all die Lobbyisten, Funktionäre und Mandatsträger, bei denen die meisten Zuschauer nach zehn Minuten trotzdem geistig komplett abschalten, weil sie nicht mehr kapieren, worum es eigentlich geht. Ich war nur eine kleine Arbeiterin, die immer versucht hat, sich und ihre Familie einigermaßen über Wasser zu halten. Aber dafür besitze ich ’ne verdammt große Klappe, die ich nicht halten kann, wenn ungerechte Dinge in meinem Umfeld passieren.
Das war schon zu meiner Schulzeit so gewesen: Als einer meiner Lehrer auf dem Pausenhof rauchte, was für uns Schüler streng verboten war, machte ich beim Direktor Halligalli: Ich setzte mich mit Nachdruck dafür ein, dass auf dem Hof gleiches Recht für alle zu gelten habe – ganz egal, ob dann alle rauchen durften oder keiner. Am Ende durfte keiner mehr auf dem Hof rauchen. Später kämpfte ich in der Penne meiner Töchter dafür, dass die vorgesehenen Elternsprechstunden nicht ständig abgesagt werden, sondern endlich stattfinden. Ab einem gewissen Punkt in meinem Leben habe ich immer den Mund aufgemacht, auch wenn es kein anderer tat. Diese Eigenschaft führte irgendwann dazu, dass ich begann, mich neben meinem Job gewerkschaftlich zu engagieren.
Die Gewerkschaft, die für meine Belange zuständig war, war die IGBAU, was nicht nur für den Bau-Sektor stand, sondern genauer gesagt »Industriegewerkschaft Bauen – Agrar – Umwelt« bedeutete. Diese Gewerkschaft setzte sich nicht nur – wie ursprünglich von mir vermutet – für Dachdecker, Maler oder Betonmischer ein, sondern eben auch für Gebäudereiniger, wie meine Branche offiziell hieß. Genau genommen war mein Beruf nämlich nicht bloß ein bisschen Wisch-und-weg-Trallafitti2, sondern ein echter Handwerksberuf, zahlenmäßig sogar der größte in Deutschland: Jeder vierzigste hiesige Arbeitnehmer ist gegenwärtig in diesem Gebäudereiniger-Handwerk tätig. Das klingt erstmal ganz nett, tatsächlich jedoch arbeiten viele unserer knapp 860 000 Beschäftigten in einer Art modernem Sklavenhandel, dessen Arbeitsbedingungen oft unter aller Kanone sind. Und da konnte man doch nicht ruhig bleiben, wenn man das ganze Unrecht aus nächster Nähe mitbekam, das, was wir da unten ausbaden mussten, damit die da oben von ihren rund 16 Milliarden Euro Umsatz jährlich möglichst viel behalten konnten. Zumindest ich konnte das nicht, auch wenn mir das im Laufe meines Berufslebens eine Menge Ärger eingebracht hat.
In meinem Fall führte mich das Schicksal beziehungsweise der Putz-Job eines Tages direkt in das Gelsenkirchener Gewerkschaftshaus. Wie das genau zustande kam, dazu später mehr. Jedenfalls machte ich die Büros der örtlichen DGB-Offiziellen sauber, die der IG Metall-Kollegen und eben auch die Räume besagter IGBAU, die allesamt in dem grauen Kasten an der Overwegstraße untergebracht waren. Als ich dort anfing, herrschten draußen im Land die Zeiten der großen Arbeitskämpfe. Nahezu in allen Branchen wurde regelmäßig für mehr Geld und weniger Arbeit gestritten, begleitet von einer breiten Berichterstattung in der Presse.
Das Spiel ging jedes Mal so, dass die Gewerkschaften ihre Muckis zeigten und dicke Forderungen stellten, welche die Arbeitgeber natürlich empört ablehnten. Dann wurde gestreikt, und irgendwann traf man sich in irgendeinem Kongresshotel zu Schlichtungsgesprächen, die häufig mit einem Händedruck der Unterhändler vor der Tagesschau-Kamera und einem anständigen Ergebnis für die Arbeitnehmer endeten. Bei den Druckern wurden so Stück für Stück die schlimmen Arbeitsbedingungen verbessert, die Stahlindustrie führte stufenweise die 35-Stunden-Woche ein, und im öffentlichen Dienst gab es zum Teil zweistellige Lohnerhöhungen. Nur bei uns Gebäudereinigern tat sich in dieser Hinsicht nix.
Eine Zeitlang sah ich mir das mit an. Ich persönlich war nicht unzufrieden mit meiner Tätigkeit, aber erstens war mein Lohn schon immer sehr schmal. Und zweitens bekam ich jede Menge Schikanen mit, denen viele meiner Kolleginnen jeden Tag ausgesetzt waren. Rein statistisch gesehen waren zwar nur etwas mehr als die Hälfte der Gebäudereiniger Frauen. Weil unter diesen Sammelbegriff aber auch vorwiegend männliche Berufe wie Fensterputzer, Schädlingsbekämpfer oder Fassadenpfleger fielen, lag der Frauenanteil im reinen Putzbereich bei über 80 Prozent – verbunden mit einem recht hohen Ausländeranteil. Hier bei uns landeten also naturgemäß viele Menschen, die diese Arbeit nicht machen wollten, sondern machen mussten. Was es wiederum mit sich brachte, dass bei vielen von uns immer eine riesengroße Angst bestand, auch noch diese oftmals letzte Möglichkeit zu verlieren, wenigstens ein bisschen Kohle zu verdienen. Irgendeine andere, die den Job übernehmen würde, fand der Chef schließlich immer.
Diese traurige Tatsache zog auf der Arbeitgeberseite einige schwarze Schafe an. Obwohl es bei uns vordergründig um ein Höchstmaß an Sauberkeit ging, handelte es sich bei näherem Hinsehen um eine verdammt dreckige Branche, deren Konzerne mit allen fiesen Tricks und kleinen Schweinereien agierten, die man sich vorstellen konnte – oder besser gesagt: die man sich eigentlich nicht vorstellen mochte. Im Laufe der Jahrzehnte lernte ich Vorgesetzte kennen, die langjährigen Mitarbeiterinnen Auflösungsverträge vorlegten und diese in dem Glauben ließen, sie unterschrieben gerade ihren Urlaubsschein. Es gab Geldprämien, wenn man sich nicht von der Gewerkschaft anwerben ließ oder umgehend wieder dort austrat. Unverhohlene Drohungen, das Schüren von Furcht und Unsicherheit und alltägliche Provokationen waren ebenso an der Tagesordnung wie absolute Unzumutbarkeiten bei der Einteilung von Schichten – beispielsweise bei jungen Müttern, die ihre Kinder nicht mehr versorgen konnten, weil sie auf einmal frühmorgens und spätabends putzen sollten. Das alles führte dazu, dass gerade einmal jede achte Frau in diesem Berufszweig gewerkschaftlich engagiert war.
Also trat wenigstens ich mit meiner frechen Schnauze bei meinem Arbeitgeber in den Betriebsrat ein und begann, mich im Laufe der Jahre immer stärker für meine Mädels und ihre Rechte einzusetzen – was dummerweise bedeutete, mich bei den Chefs langsam, aber sicher so unbeliebt zu machen wie nur möglich. Einer der großen Vorteile dieser ehrenamtlichen Tätigkeit war allerdings, dass ich dadurch in den Genuss zahlreicher Fortbildungen kam. Die Verantwortlichen bei der IGBAU hatten meine große Klappe nämlich irgendwann auch bemerkt und schickten mich auf Seminare, auf denen es um Rhetorik ging oder Sprachführung und natürlich um das Verständnis der großen politischen Zusammenhänge. Ich mochte zwar nicht viel Schulbildung genossen haben, aber ich war schon immer ein politisch sehr interessierter Mensch. Also nahm ich die Angebote dankend an. Dadurch wurde zwar keine große Rednerin aus mir und auch keine Intellektuelle. Aber zumindest jemand, der selbstbewusst genug war, sich in einer Auseinandersetzung nicht mit Scheinargumenten oder Plattheiten abspeisen zu lassen, sondern dem Gesprächspartner stattdessen eigene Argumente entgegenzusetzen.
Das alles war kein Zuckerschlecken, weil ich stets vollschichtig gearbeitet habe. Während Otto Normalarbeitnehmer nach Feierabend in die Kneipe ging und sich auf ein oder zwei Pilsken mit seinen Kumpels traf und Brigitte Mustermann daheim das Abendessen für ihren Göttergatten und die gemeinsamen Racker zubereitete, bevor man sich gemeinsam auf die Couch setzte und Dallas oder den Denver-Clan glotzte, marschierte ich ins Gewerkschaftsbüro und kümmerte mich um den ganzen Schreibkram, den es dort zu erledigen galt. Die Wochenenden waren dann oft durch die vielen Kurse belegt. Die mangelnde Freizeit brachte es aber mit sich, dass ich mir innerhalb meiner Fachgruppe einen gewissen Namen machte und irgendwann sogar deren Vorsitzende wurde. Und auf einmal, im Herbst 2009, schlug meine große Stunde!
Es fanden wieder einmal endlose Tarifgespräche zwischen der IG Bau und den Arbeitgebern statt, die vom Bundesinnungsverband vertreten wurden. Die Parteien saßen sich schon seit Januar gegenüber, ohne sich irgendwie einigen zu können. Und wie in den Jahren zuvor beachtete die Öffentlichkeit kaum diese Verhandlungen, obwohl sich die Rahmenbedingungen für uns deutlich verschlechtert hatten. Nicht nur, weil die Bundesregierung durch veränderte Gesetze den großen Reinigungsfirmen noch mehr Schlupflöcher für ihre Gemeinheiten gegeben hatte. Sondern schlichtweg auch, weil uns die Wirtschaftskrise mit voller Härte traf: Wo nicht mehr produziert oder sonst wie gearbeitet wurde, da musste logischerweise auch nicht mehr geputzt werden. Und unterm Strich ging es ja »nur« um Menschen, die in unserer gesellschaftlichen Hierarchie sowieso ganz unten angesiedelt sind: um Menschen wie mich, die dafür sorgten, dass es für die zahllosen Hotelgäste, Büroangestellte, Ärzte, Lehrer, Supermarktkunden und viele andere mehr tagtäglich ordentlich und aufgeräumt aussah.
Auch deshalb gingen die Arbeitgeber damals sehr arrogant in die Verhandlungen und waren siegessicher, dass unsere Seite wie üblich über kurz oder lang einknicken und ihr Angebot für eine Lohnerhöhung annehmen würde. Die letzte überaus »großzügige« Geste des Entgegenkommens bedeutet umgerechnet 19 Cent mehr – was gerade mal den Gegenwert eines halben Brötchens beim Discounterbäcker darstellte. Das konnte freilich höchstens ein schlechter Witz sein angesichts der Tatsache, dass die meisten durchschnittlichen Stundenlöhne in den Zeiten vor dem gesetzlichen Mindestlohn nur bei mickrigen 6 Euro lagen. Doch unsere Lobby hielt sich auch innerhalb des großen DGB eher in Grenzen. Wer interessierte sich schon für ein paar kümmerliche Gebäudereiniger, wenn man an anderer Stelle den ganz dicken Aufschlag machen konnte, bei dem die Politik schnell an die Vernunft beider Seiten appellierte und die Bosse im TV ein Interview nach dem anderen abgeben konnten? Jedenfalls wurden die Gespräche im August ergebnislos abgebrochen, und zum 1. Oktober lief der bisherige Tarifvertrag aus.
Dann aber passierte Erstaunliches: Urplötzlich begann sich die Presse für uns zu interessieren – und unser bislang kaum beachtetes Anliegen wurde öffentlich. Immer mehr Medien sprangen auf den Zug auf und berichteten über die schwierigen Bedingungen, unter denen auch die meisten jener bemitleidenswerten Geschöpfe leiden mussten, die frühmorgens oder spätabends ihre Redaktionen saubermachten. Mancher Journalist kam nun sogar extra früher ins Büro und fragte mal bei der ihm bislang völlig unbekannten türkischen, bosnischen oder auch deutschen Arbeiterin nach, die seit Jahren seinen Papierkorb leerte, den Schreibtisch abwischte oder den Flur bohnerte. Es erschienen Artikel, die das 19-Cent-Angebot als »Frechheit« oder »Farce« bezeichneten und Reportagen über den schwierigen Alltag einer Putzfrau. Aus den bis dato weitgehend ignorierten Tarifverhandlungen wurde der »Aufstand der Unsichtbaren«.
Das gefiel mir. Wenn wir jetzt nur durchhielten, konnten wir diesmal vielleicht wirklich etwas Großes erreichen. Bei mir herrschte eine innere Aufbruchsstimmung. Die Schwierigkeit lag nur darin, möglichst viele meiner Gefährtinnen in die gleiche Gemütslage zu bringen, was aber einer wahren Herkulesaufgabe gleichkam. Erstens waren bei uns – wie schon gesagt – im Vergleich zu den meisten anderen Branchen ohnehin nur sehr wenige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewerkschaftlich organisiert. Und selbst von diesen paar Kollegen machten sich viele in die Buxe, dass ihr Arbeitsplatz bei einem Streik eher früher als später über die Wupper ging. Wie gesagt: Wenn’s darum ging, uns allen das Leben schwerzumachen, kannte die Kreativität der meisten Arbeitgeber keine Grenzen.
Vor diesem düsteren Hintergrund trommelte ich Tag und Nacht für eine Urabstimmung, die den Weg für einen Streik ebnen sollte. Ich führte nach meiner eigentlichen Arbeit mehr Gespräche als jede Angestellte von der Beschwerdestelle der Deutschen Bahn! Jede einzelne Arbeiterin musste ich geduldig davon überzeugen, dass für uns nun die Zeit gekommen sei, um Flagge zu zeigen und erstmals für unsere Belange zu kämpfen. Ich versuchte, meinen Mädels immer wieder Mut zu machen und behutsam ihre bestehenden Ängste abzubauen. Wenn wir jetzt wieder einknicken, dann würden wir es niemals schaffen – das spürte ich ganz deutlich. Wahrscheinlich würden die Arbeitsbedingungen dann noch katastrophaler werden. Nach unfassbar anstrengenden Wochen des endlosen Zuredens, in denen ich spätabends nicht mehr sprechen konnte, weil ich mir zuvor den Mund fusselig gequatscht hatte, geschah ein kleines Wunder: Die Urabstimmung wurde mit sagenhaften 96,7 Prozent Zustimmung angenommen. Wir Gebäudereiniger würden nun flächendeckend in den Ausstand treten, um gegen unzumutbare Zustände in den Firmen, Lohndumping und die immer stärker um sich greifende Auslagerung von Arbeitnehmern in eigens gegründete Leiharbeitsfirmen zu demonstrieren. Das war ein Ding! Bislang hatte diesen Schritt noch kein Putzfrauengeschwader gewagt.
Der Weg für den ersten unbefristeten Putz-Streik in der Geschichte der Bundesrepublik war folglich frei – und Susi Neumann hatte mit ihrer Beharrlichkeit einen nicht ganz unerheblichen Anteil daran. So doof sich das in diesem Zusammenhang anhören mag, aber ich war in diesem Augenblick richtig glücklich. Doch es gehörte zu den Eigenheiten meines Lebens, dass immer, wenn es bei mir mal richtig gut zu laufen schien, irgendwas dazwischenkam. In diesem Fall wollte ich gerade pflichtbewusst den Efeu herausreißen, der unverschämterweise unmittelbar vor einem wahrhaft historischen Streik die Fassade meines Arbeitsplatzes zuwucherte, als ich eine unbedachte Bewegung machte. Ich wusste nicht, wie mir geschah, aber mir knallte auf einmal eine Metallstange auf den Fuß.
Erst wurde mir schwarz vor Augen, dann schlagartig speiübel, und kurz darauf zitterte mein ganzer Körper. Ich fiel beinahe in Ohnmacht, aber ein paar Minuten später war der Spuk halbwegs vorbei. Also schüttelte ich mich, atmete tief durch und machte mich wieder an die Arbeit. Das Auftreten tat jetzt zwar höllisch weh, aber ich war mir sicher, dass diese Schmerzen von alleine wieder verschwinden würden.
Nach Feierabend schleppte ich mich umgehend ins Bett, um am nächsten Tag wieder fit für den Job und natürlich auch für unseren Arbeitskampf zu sein. Als ich so dalag, erschöpft an die Decke starrte und mein Fuß noch immer heftig vor sich hin pochte, warf ich sicherheitshalber doch mal einen kurzen Blick mein Bein entlang ganz nach unten. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden – in der vagen Hoffnung, dass am Morgen alles wieder gut sein würde, wie auch immer das funktionieren sollte. Doch leider konnte ich das nun ausschließen, denn mein Fuß war inzwischen ungefähr doppelt so groß wie normal. Um festzustellen, dass das Ding gebrochen war, dafür musste man kein Arzt sein!
»Tja, Schatz, dat is’ klar: Für dich ist der Streik vorbei«, sagte mein Mann Bernie zu mir und blickte mich mitleidig an. »Du hast gez ’nen Krankenschein.«
Nun war und ist das Arbeitskampfrecht eine komplizierte Angelegenheit. Klar war allerdings, dass ich es unter gar keinen Umständen riskieren konnte, keine Kohle mehr zu bekommen, sprich: keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu erhalten. So dicke hatten wir es leider nicht, zumal sich sowohl der Streik als auch die Heilung meines kaputten Mittelfußknochens über Wochen hinziehen konnte. Doch wenn es blöd lief, musste ich zur Wahrung meiner Ansprüche meinem Arbeitgeber gegenüber formell schnellstmöglich eine Beendigung meiner Teilnahme an jeglichen Protest-Aktionen erklären – und natürlich ein ärztliches Attest vorlegen. Damit säße ich dumm zu Hause herum, während meine Mädels dafür stritten, was im Grunde genommen ich ihnen mit eingebrockt hatte. Binnen einer Dreiviertelstunde telefonierte ich alles an Rechtsberatung ab, was die IGBAU zu bieten hatte und noch wach war. Danach hatte ich die erlösende Auskunft: Ich durfte weiterhin mitmachen.
Allerdings hatte ich nach meinem Besuch im Krankenhaus am nächsten Morgen einen fetten Gips, der auch noch mein Bein zierte, als ich ein paar Tage später meinen großen Auftritt im öffentlich-rechtlichen Frühstücksfernsehen hatte. Diese Einladung war zwar mal ’ne Hausnummer, aber meine Premiere als Fernsehgast war auch das nicht: Für Anne Will und Sandra Maischberger hatte ich nochmals einige Zeit zuvor in deren Sendungen über das Thema Mindestlohn zwei Mal die Quoten-Putzfrau gegeben.
In Erinnerung geblieben ist mir davon vor allem die Talkshow von Frau Will – auch, weil ich hier das allererste Mal in meinem Leben in einem Luxus-Hotel übernachten durfte: Die Produktionsfirma buchte mich damals ins »Regent« am Gendarmenmarkt ein. Das Hotel hatte wahrscheinlich mehr Sterne als der Große Wagen, und ich bin da in Jeans und T-Shirt eingelaufen wie zum Brötchenholen. Trotzdem wollte mir ein junger Mann in einem Frack den Koffer abnehmen, und im Badezimmer sah es aus wie in einem Kosmetiksalon, so viele kleine Fläschchen standen da rum. Meine Aufregung wollte sich bei diesem Empfang nicht legen, mir ging ganz schön der Stift. Vom opulenten Room-Service, der den anderen Gästen Leckereien unter silbernen Hauben auf die Zimmer brachte, bekam ich nichts mit. Ich bat lediglich um eine Kanne Kaffee, bevor mich der Fahrdienst abholte und zum Studio brachte. Generell hatte ich kein gutes Gefühl, in solch einem noblen Haus zu übernachten. Aus meiner beruflichen Praxis wusste ich, dass normalerweise auch dort, wo die Suiten 280 Euro und mehr kosteten, die Zimmermädchen gerade mal 1,70 Euro pro Raum bekamen. Aber das nur am Rande.
Meine Nervosität erreichte ihren Höhepunkt, als ich im Adlershof eintraf, wo sich die Aufnahmeräume von Anne Will befanden. Ich hatte einen Knoten im Hals und einen Doppelknoten im Magen. Doch beide Blockaden lösten sich beinahe wie von selbst, denn zu meinem großen Glück waren Günther Oettinger und Wolfgang Clement ebenfalls in der Sendung, zwei aufgeblasene Herren ganz nach meinem Geschmack. Der Oettinger guckte mich vorher in der Garderobe nicht mit dem Hintern an und tat dann in der Show so, als sei er mein bester Kumpel. Und von Clement hielt ich sowieso nix mehr, seit er sich seinen Abgang aus der Politik und den Austritt aus der SPD mit einem Dutzend Pöstchen hat vergolden lassen. Dabei war er einer der Architekten der »Agenda 2010« und hat dadurch die soziale Spaltung unserer Gesellschaft massiv vorangetrieben. »Wasser predigen und Wein saufen« war schon immer ein Charakterzug, den ich ebenso wenig leiden konnte wie Arroganz.
Wegen des Verhaltens dieser beiden Berufs-Talker war es mir möglich, auf einmal von »hypernervös« in den Angriffsmodus zu schalten. Vielleicht unterschätzten die mich auch einfach alle. Dass ich Flure wischte und Büros putzte, bedeutete jedoch noch lange nicht, dass ich doof war. Durch mein gewerkschaftliches Engagement kannte ich mich politisch recht gut aus und wusste auch um die schmutzigen Tricks, die seit Gerhard Schröders Arbeitsmarktreformen auf dem Rücken von Geringverdienern und Arbeitslosen ausgetragen wurden. Und wenn mir so ein Filzkopp wie Clement mit seinen statistischen Erfolgen daherkam, dann konterte ich eben mit Fakten: Ich wusste nur zu gut, dass jeder Arbeitslose, der in einer Umschulungsmaßnahme steckte, ebenso aus den offiziellen Zahlen herausgerechnet wurde wie Ein-Euro-Jobber, Aufstocker, chronisch Kranke oder ältere Menschen, die aufgrund ihrer Unvermittelbarkeit zwangverrentet wurden. Da konnte man auf die rund 2,6 Millionen offiziellen Arbeitslosen locker mal ein Milliönchen draufrechnen – die sogenannte »stille Reserve«, jene 300 000 Frustrierten, die sich vor lauter Enttäuschung gar nicht mehr registrieren ließen, noch gar nicht mit eingeschlossen.
Während der 60 Sendeminuten gab ich dem Clement also so gut wie möglich Kontra und beachtete den Oettinger einfach nicht weiter. Ich hatte unterm Strich ordentlich Redezeit und verkaufte mich offenbar gar nicht schlecht. Die Reaktionen auf meinen Einsatz jedenfalls waren sowohl vonseiten der Redaktion als auch von meinen Freunden und Bekannten, die sich per SMS bei mir meldeten, allesamt recht positiv. Nach meiner Rückkehr ins »Regent« schlief ich wirklich gut. Ob’s am superbequemen Bett lag oder daran, dass der ganze Druck von mir abgefallen war, konnte ich nicht abschließend beurteilen.