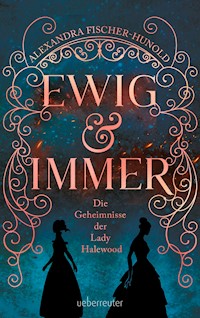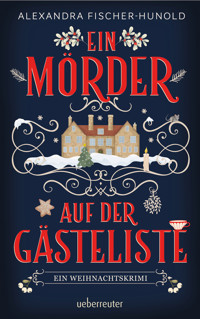14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ueberreuter Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine mörderisch gute Detektivgeschichte im Berlin der Kaiserzeit Die 17-jährige Florentine hat zwei große Leidenschaften: Medizin und Kriminologie! Da Frauen im wilhelminischen Zeitalter nicht studieren dürfen, schleicht sich die junge Fabrikantentochter bei jeder Gelegenheit in Männerkleidung in die Berliner Charité. Doch dann steht sie nicht im Obduktionssaal, sondern im Haus ihrer Cousine Charlotte plötzlich vor einer echten Leiche! Und damit auch vor ihrem ersten Fall: denn der Bräutigam wurde eindeutig ermordet! "Fräulein Florentines Gespür für Mord" ist eine mit Witz und Charme von Alexandra Fischer-Hunold erzählte Detektivgeschichte voller Emanzipation, die die Welt Bismarcks und Fontanes erfrischend modern zum Leben erweckt. - Charmanter Cosy-Krimi aus dem Berlin des 19. Jahrhunderts - Female Empowerment trifft auf eine patriarchale Welt - Mit einer witzigen, mutigen und modernen Protagonistin - Adel, Lovestory & verdeckte Ermittlungen - ein spannender historischer Krimi aus der Zeit des deutschen Kaiserreichs - Jugendbuch ab 12 für Fans von "Enola Holmes" und "Babylon Berlin" Eine Hochzeit und ein Todesfall! Mit Witz, Charme und Mut auf Spurensuche Es ist noch keine halbe Stunde her, da hat er gemeinsam mit seiner frisch gebackenen Braut die vierstöckige Hochzeitstorte angeschnitten. Und jetzt liegt er vor Florentine, die ihr Glück kaum fassen kann: ein unverhoffter Mordfall! Denn im Rücken des guten Amandus steckt ein Tortenmesser! Tot. Eindeutig! Doch unter welchen Umständen kam der alte Baron ums Leben? Und vor allem: Wer war der Mörder? Zusammen mit ihrem Hausmädchen Elise nimmt Florentine die Ermittlungen auf ... In diesem Cosy-Krimi ermittelt mit viel Humor, Einfallsreichtum und Tatkraft eine aufmüpfige junge Fabrikantentochter – und weiß sich in der patriarchalen Welt des Berlins im 19 Jahrhundert zu behaupten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts. Florentine Falkenberg, 17-jährige Tochter eines reichen Fabrikanten, hat eine große Leidenschaft: Medizin und Kriminologie. Weil sie als Frau nicht studieren darf, schleicht sie sich in Männerkleidung an die Charité, um den Vorlesungen zu lauschen. Doch dann steht sie nicht im Obduktionssaal, sondern im Haus ihrer Cousine Charlotte plötzlich vor einer echten Leiche!
Der Tote ist kein anderer als Charlottes frisch angetrauter Ehemann, Amandus Graf von Lauenburg. Pikant ist der Fall, da ausgerechnet Florentines Bruder heimlich in Charlotte verliebt ist und sich zum Zeitpunkt des Mords ganz in der Nähe befunden hat. Florentine sieht ihre Gelegenheit gekommen: Sie wird den wahren Schuldigen finden und ihre Familie von den schändlichen Gerüchten befreien!
Temporeicher und charmanter Krimi im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts!
Vollständige E-Book-Ausgabe der 2025 in der Ueberreuter Verlag GmbH, Berlin, erschienenen Buchausgabe
E-Book © Ueberreuter Verlag GmbH, Berlin 2025
ISBN 978-3-7641-9368-3
Printausgabe © Ueberreuter Verlag GmbH, Berlin 2025
ISBN 978-3-7641-7143-8
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden. Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Familien sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie das öffentliche Zugänglichmachen z. B. über das Internet.
Lektorat: Emily Hugins
Umschlag- und Innenillustrationen: Carolin Liepins
www.ueberreuter.de
Personenregister
Familie Falkenberg
Kommerzienrat Heinrich Falkenberg Gründer und Inhaber der Falkenberg Werke; strenges Familienoberhaupt mit Prinzipien
Gerda Falkenberg fügt sich klaglos in die Rolle der Dame der Gesellschaft und der demütigen Ehefrau
Leopold Falkenberg Student und Frohnatur
Florentine Falkenberg hat große Pläne und viele Geheimnisse; die Rechte der Frau liegen ihr genauso am Herzen wie das Wohl ihrer Familie
Josefine Falkenberg fantasiebegabter, kleiner, elfjähriger Wildfang
Elisabeth Baronin von Draglitz, geb. Falkenberg Nervensäge mit Standesdünkel
Ulrich Baron von Draglitz ihr leidgeprüfter Ehemann
Hausangestellte der Familie Falkenberg
Elise ist vom Land in die große Stadt gezogen, um als Dienstmädchen ihr Glück zu versuchen; sie ist schüchtern, zurückhaltend und loyal bis in die Fingerspitzen
Hanke auf seinen Vorteil bedachter Portier
Miss Bridgewater englische Gouvernante, die versucht, Josefine mit Strenge und Disziplin zu bändigen
Familie Dahlhoff
Geheimrat Waldemar Dahlhoff stolzer Brautvater
Therese Dahlhoff ebenso stolze Brautmutter und entfernte Cousine von Gerda Falkenberg
Hendrik Dahlhoff etwas übereifriger großer Bruder
Charlotte Dahlhoff verwitwete Gräfin von Lauenburg; ist die Wunschtochter von Florentines Eltern
Hausangestellte der Dahlhoffs
Tilda Mennecken geldgieriges Biest
Familie von Lauenburg
Amandus Graf von Lauenburg Bräutigam mit mehr als nur einem Geheimnis
Sophie Gräfin von Lauenburg seine fürsorgliche Schwester
Sonstige
Maximilian Winterfeld Zeitungsverleger und Leopolds bester Freund
Julius Trebbin reicher Erbe aus gutem Hause mit mysteriöser Vergangenheit
Kommissar Putlitz Polizist mit Vorurteilen
Alan Denbury britischer Geschäftsfreund von Heinrich Falkenberg
INHALT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Epilog
Anmerkung
1
Es ist vielleicht eine halbe Stunde her. Da hat er noch gemeinsam mit seiner frischgebackenen Braut, meiner Cousine Charlotte, die vierstöckige Hochzeitstorte angeschnitten. Und jetzt liegt er vor mir. Sein goldener Kneifer ist ihm beim Sturz von der Nase gerutscht und krachend auf den Marmorfliesen der Eingangshalle aufgeschlagen. Ein Spinnennetz aus Sprüngen überzieht die beiden Gläser. Um mich herum drängen sich nachströmende Gäste. Aus den Augenwinkeln sehe ich Charlotte. In Reisekleidung schreitet sie zögernd die breite Treppe hinunter. Ein paar Stufen über ihr steht ihr Bruder Hendrik. Er ist kalkweiß. Langsam wende ich meinen Blick wieder dem Toten zu. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Aber nicht etwa, weil ich so bestürzt bin (diese Gefühle dränge ich beiseite), sondern weil ich mein Glück kaum fassen kann. Denn im Rücken des guten Amandus steckt das Tortenmesser.
Als Tochter aus gutem Hause weiß ich selbstverständlich, was sich in so einer Situation gehört. Also simuliere ich einen bühnenreifen Ohnmachtsanfall. Mit einem erschöpften Seufzer lasse ich mich neben die Einstichstelle sinken. Ich muss Wunde und Messer untersuchen, bevor mich starke Arme hochheben. Mich auf das nächstbeste Sofa betten und mein Retter nach Riechsalz ruft.
Das Messer steckt ganz schön tief, denke ich gerade, als ich die Wunde blinzelnd überprüfe. Da geht ein Zucken durch Amandus’ Körper. Langsam dreht er seinen Kopf zu mir und schaut mich verwundert an. Er lebt. Lang genug, um mir mit gebrochener Stimme eine Botschaft ins Ohr zu flüstern. Dann haucht er seinen Odem aus.
Unauffällig lasse ich den Gegenstand in meinem Handtäschchen verschwinden, den er mir in der letzten Sekunde seines Lebens heimlich zugesteckt hat. Dann schließe ich die Augen und spiele wieder die Ohnmächtige.
Amandus Graf von Lauenburg ist ermordet worden.
Von wem? Warum? Ich werde es herausfinden.
Aber ich greife vor. Drehen wir die Uhr ein paar Stunden zurück. Zu dem Zeitpunkt, als ich …
… völlig außer Atem Leopolds Fahrrad in der Hofdurchfahrt an die Hauswand lehnte und die Schirmmütze tief ins Gesicht zog.
Verstohlen blickte ich zu den hinteren Fenstern der Beletage hinauf, in der meine Familie und ich wohnen. Ich war viel zu spät dran. Falls die Kirchturmuhr, an der ich auf meiner rasanten Fahrt von der Charité nach Hause vorbeigesaust war, richtig ging. Die hatte nämlich zwei Uhr geschlagen und schon um drei läuteten Charlottes Hochzeitsglocken. Ich konnte nur hoffen, dass Elise, unser Hausmädchen, mir den Rücken freigehalten hatte.
Für den Moment musste mich jeder zufällige Beobachter für Thomas halten. So heißt der Student, der mehrmals die Woche in der Wohnung über uns zum Nachhilfeunterricht erwartet wird. Deshalb würde Mama sich auch nicht darüber wundern, dass Thomas jetzt mit gesenktem Kopf durch die Haustür huschte. Kaum im Vestibül angekommen, riss ich mir die Mütze vom Kopf und schüttelte meine langen Locken. An so einem warmen Julitag taten mir die jungen Männer fast leid. Schließlich dienen mir die von Leopold geborgten langen Hosen, das Hemd, die Krawatte, Weste und das Jackett nur gelegentlich zur Tarnung. Er und seine Freunde müssen sich jeden Tag so kleiden. Aber kein falsches Mitgefühl. Dafür müssen sie sich nicht jeden Morgen in ein Korsett zwängen.
Gott sei Dank saß Hanke nicht in der Portiersloge. Das war der einzige Vorteil meiner Verspätung. Es war Samstag und Hank’sche Tradition, dass pünktlich um zwei Uhr sein Lieblingsessen auf dem Tisch stand. Der Geruch nach gebratenen Bouletten war mir schon beim Fahrradabstellen aus der Souterrainwohnung in die Nase gestiegen.
Wäre ich nicht in geheimer Mission unterwegs gewesen, wäre ich jetzt durch die doppelflügelige Tür mit den eleganten Glasornamenten gejagt, dann weiter die mit dem roten Teppich ausgelegte breite Marmortreppe in die erste Etage hinauf. Korrektur: Ich wäre selbstverständlich geschritten. Äußerst damenhaft und elegant. Denn das gehört sich so für eine Tochter aus gutem Hause. Und genau das ist es, was ich bin.
Weil besondere Umstände aber nun mal besondere Maßnahmen erfordern, schlüpfte ich durch die unscheinbare Seitentür zu meiner Linken. Dahinter führt nämlich ein langer, schmaler Korridor zur Dienstbotentreppe, deren steile Stufen sich in der Art eines Schneckenhauses in die Höhe schrauben. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend keuchte ich sie hoch. Dabei ließ ich unsere Küchentür in der ersten Etage genauso links liegen wie die von Professor Pauli im zweiten Stock. Mein Ziel war der Dachboden. Der rechte Bereich dient dem Personal beider Familien als Trockenboden und Waschraum. Aber mein Ziel lag linker Hand, dort, wo sich die Zimmer der Dienstboten befinden.
Ohne zu zögern, riss ich die Tür auf und schlüpfte in die kleine Kammer.
»Ich weiß, ich bin schrecklich spät dran. Der Professor hat überzogen und ich konnte mich nicht einfach so aus dem Hörsaal stehlen«, entschuldigte ich mich, kaum dass die Tür hinter mir ins Schloss gefallen war. Denn mir war völlig klar, dass die arme Elise meinetwegen auf höllenheißen Kohlen geschmort hatte. »Hat Mama die Migräneausrede geschluckt?«
Ächzend setzte ich mich auf den Boden, um Leopolds Schuhe aufzuschnüren. Damit ich in den Quadratlatschen meines Bruders laufen konnte, hatte ich sie mit alten Stofffetzen ausgestopft. Leider waren die so grob und rau wie Schmirgelpapier. Stöhnend zog ich meine wund gescheuerten Füße aus den Schuhen und spreizte meine steifen Zehen. Was für eine Wohltat!
Elise war zwar bei meinem Eintreten sofort von ihrem Bett hochgeschossen, aber gesagt hatte sie bisher kein einziges Wort. Sie stand einfach nur da, in ihrem langen schwarzen Kleid, über das sie die weiße Spitzenschürze gebunden hatte, und schaute auf mich herab.
»Die gnädige Frau hat sich sehr oft nach Ihrem Wohlbefinden erkundigt«, brach sie endlich das Schweigen. Von jedem ihrer Worte triefte die Angst wie der Morgentau von den Blütenblättern im Tiergarten.
»Ich mache es wieder gut!«, versprach ich ehrlich zerknirscht. Dabei zermarterte ich mir das Hirn auf der Suche nach einer Möglichkeit, mein Versprechen in die Tat umzusetzen. Und plötzlich hatte ich eine Idee. Die war richtig gut. Elise hatte eine große Schwäche, wie ich seit unserem gemeinsamen Ausflug in die Konditorei Hofstetter wusste, und die hieß: »Nougatpralinen?«
Elises grüne Augen wurden groß und rund. Ihr Mund öffnete sich. Und klappte wieder zu. Statt, wie ich gehofft hatte, ein freudiges »Oh!« auszurufen, schüttelte sie heftig den Kopf.
Das tat sie mit so viel Nachdruck, dass das weiße Häubchen auf ihrem Haar in bedenkliche Schieflage geriet.
»Mit Verlaub …«, setzte sie unsicher an.
»Frei von der Leber weg, Elise«, munterte ich sie auf.
Sie nickte und sog stoßweise die Luft ein. »Mit Verlaub und allem Respekt, was nutzen mir Ihre Pralinen, wenn die Gnädige uns auf die Schliche kommt und mich vor die Tür setzt?« Elises rundes Gesicht war sehr ernst geworden. »Jeden Tag strömen Hunderte Mädchen vom Land in die Stadt und suchen eine gute Anstellung, so wie ich sie bei Ihren Eltern gefunden habe. Die Arbeit hier ist ein Klacks gegen die Schinderei auf dem Bauernhof meiner Eltern. Das können Sie mir glauben, Fräulein Florentine. Noch nie habe ich ein eigenes Zimmer besessen. Meine Geschwister, meine Eltern und ich, wir haben zusammen in einem Raum geschlafen.« Betrübt senkte sie den Kopf und flüsterte schüchtern: »Ich will nicht wieder dorthin zurück. Ehrlich nicht. Auch wenn ich meine Eltern und meine Geschwister jeden Tag vermisse. Alle zehn.«
Ich schaute zu dem Häufchen Elend auf, das händeringend über mir stand, und erschrak vor mir selbst. Denn erst jetzt begriff ich, wie heiß die Kohlen, auf die ich sie gesetzt hatte, wirklich gewesen waren. Ich ließ meinen Blick durch das winzige Zimmer wandern. Bett, Kommode, Schrank, ein wackeliger Stuhl, ein kleiner halbblinder Spiegel und der geflochtene Weidenkorb, in dem sie bei ihrer Ankunft vor vier Wochen all ihre Habseligkeiten die Treppe hinaufgeschleppt hatte. Das und ein schmales Dachfenster, hinter dem der blaue Himmel über der verheißungsvollen Großstadt strahlte, wog für sie so viel mehr als alle Schätze des Kaiserreichs.
Und ich kam ihr mit Nougatpralinen! Ich schämte mich schrecklich. Wie egoistisch und rücksichtslos ich gewesen war! Mit einem entschuldigenden Lächeln rappelte ich mich hoch, trat vor Elise, rückte ihr Häubchen gerade und schloss sie in die Arme. »Du wirst nie wieder für mich lügen müssen.« Ein Seufzer der Erleichterung schüttelte Elises dünnen Körper. »Versprochen!«, setzte ich nach. »Nie, nie wieder. Und ich entschuldige mich von Herzen für die Sorgen, die ich dir bereitet habe. Ab sofort regele ich das anders. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber lass das mal meine Sorge sein.«
Später, denn jetzt musste ich mich endlich für Charlottes Hochzeit fertig machen.
»Haben Sie vielen Dank, gnädiges Fräulein.« Elise wand sich etwas unwohl aus meiner Umarmung. Aber sie wirkte erleichtert.
»Wo sind meine Sachen?« Eilig schlüpfte ich aus Weste und Hemd.
»Hier!« Elise machte einen Schritt zur Seite, um den Blick auf das Kopfende ihres Bettes freizugeben. Dort hatte sie alles fein säuberlich zurechtgelegt, was aus dem falschen Studenten Florian die Brautjungfer Florentine Falkenberg machen würde. Das lange hellblaue Kleid, mein schreckliches Korsett, nebst Unterkleid, das schlichte Täschchen, die zum Kleid passenden Handschuhe und die funkelnagelneuen Schuhe sowie die Rosen, die sie mir nach dem Hochstecken aufs Haar drapieren würde.
»Famos!«, rief ich und strampelte hektisch ein Hosenbein nach dem anderen von den Füßen.
»Ach, Fräulein Florentine, ich weiß, es geht mich ja nichts an!«, seufzte Elise und wandte sich zum Bett, um mir das Korsett anzureichen. »Aber warum verkleiden Sie sich immer wie ein Mann, bevor Sie sich aus dem Haus schleichen? Das würde mich doch mal interessieren.«
»Weil nur Männer an die Universität dürfen«, antwortete ich und schob hoch konzentriert die Zunge zwischen die Zähne. Diese verflixten Korsettösen. Nie wollten sie so wie ich!
Entsetzt schlug sich Elise die flachen Hände an die Wangen. »Sie besuchen die Universität? Das ist doch nicht erlaubt. Frauen und Bildung, das gehört auch nicht zusammen, gnädiges Fräulein.«
»Das ist eine Lüge, Elise«, keuchte ich und schloss endlich die letzte Öse. »Eine Lüge, die die Männer verbreiten.«
Ich kenne nur einen Mann, der Frauen als gleichwertig ansieht und der keine Angst vor ihrem Verstand hat. Maximilian Winterfeld. Verleger des Hauptstadt-Kuriers und Leopolds bester Freund. Auch wenn er ein paar Jahre älter ist als mein Bruder. Wir sind so etwas wie Geschäftspartner. Wovon er aber nichts ahnt. Genauso wenig wie von meiner heimlichen Schwärmerei für ihn. Die ist nämlich so heimlich, dass ich sie mir selbst nur sehr selten eingestehe. Denn ich habe andere Pläne mit meinem Leben, als es an einen Mann zu verschenken.
»Was die gnädige Frau nur sagen würde, wenn sie wüsste, was Sie treiben …!« Bekümmert schüttelte Elise den Kopf. Wie gut nur, dass sie nichts von meinen anderen Heimlichkeiten ahnte. Gustav und Schattenfeder sind mein Geheimnis. Mit ihren sechzehn Jahren ist Elise ein Jahr jünger als ich, vertritt aber noch altmodischere Ansichten als meine Großmutter. Um gegen so viel Obrigkeitshörigkeit anzukommen, brauche ich deutlich mehr Zeit als vier Wochen.
»Die gnädige Frau? Die würde erst mal nicht viel sagen. Sie würde nämlich in Ohnmacht fallen und nur eine ordentliche Portion Riechsalz würde sie wieder auf die Beine bringen. Und weil wir ihr das ersparen wollen, hilfst du mir jetzt bitte ganz rasch mit dem Kleid«, sagte ich und reckte die Arme über den Kopf.
Keine sieben Minuten später trat ich umgekleidet und blumengeschmückt auf der zugigen Dienstbotentreppe von einem Fuß auf den anderen. Mit angehaltenem Atem beobachtete ich, wie Elise auf Zehenspitzen durch die Küche bis zum Wohnungsflur huschte. Ihr Auftrag lautete, unauffällig zu überprüfen, ob die Luft rein war. Unsere Köchin und die Küchenmädchen kamen nur zu den Mahlzeiten ins Haus. Von dort drohte also keine Gefahr. Es war eine andere Sorge, die mich mit ziemlicher Verspätung mit kalten Fingern am Schlafittchen packte. Was, wenn meine todsicher geglaubte Migräne-Ausrede an Charlottes Hochzeitstag ihre Wirkkraft verloren hatte? Wenn der besondere Anlass meine Mutter dazu gebracht hatte, die gewohnte Zurückhaltung fahren zu lassen. Wenn sie gerade in diesem Moment meine Zimmertür öffnete und leise flüsternd sagte: »Ach, Kind, fühlst du dich immer noch nicht wohl? Papa und ich werden deine Abwesenheit entschuldigen.« So weit würde sie wahrscheinlich gar nicht kommen. Schätzungsweise nach dem dritten, spätestens nach dem fünften Wort würden ihr die Buchstaben im Halse stecken bleiben. Weil sie dann mein unberührtes Bett entdeckt hätte.
Ein eiskalter Schauer lief mir über den Rücken. Dann hörte ich Elise zischen: »Pscht. Schnell jetzt, Fräulein Florentine!«
Das musste sie mir nicht zweimal sagen.
Leise raschelte mein Kleid über den gefliesten Küchenboden. »Danke, Elise«, flüsterte ich im Vorbeihuschen und bog wie ein Blitz auf den mit edlem Parkett ausgelegten Flur ein. Im Trippellauf rauschte ich an der Speisekammer, dem Zimmer der Gouvernante und dem meiner kleinen Schwester Josefine vorbei. Gerade wollte ich meine Hand nach der Klinke zu meinem Zimmer ausstrecken, als ich hörte, wie sich eine andere Tür öffnete. Blitzschnell zog ich die Hand zurück.
»Ach, da bist du ja, mein Kind.« Im Schneckentempo drehte ich mich zu meiner Mutter um. »Ich wollte gerade nach dir sehen.«
»Wie lieb von dir, Mama!« Mein Herz hämmerte so wild gegen meine Rippen, dass ich schon befürchtete, es würde gleich mein Korsett sprengen.
»Ich hatte schon Sorge, wir müssten dich bei Charlotte und ihren Eltern entschuldigen. Umso erfreulicher, dass du wieder wohlauf bist.« Im Näherkommen musterte Mama mich unter der breiten Krempe ihres eleganten Sommerhuts, der wunderbar mit ihrem apricotfarbenen Kleid harmonierte. »Allerdings …« Verwundert zog sie die Augenbrauen zusammen. »… bist du immer noch beunruhigend blass um die Nase.«
Das musste der Schreck sein. Nie würde ich Elise erzählen, wie knapp sie dem Rausschmiss entgangen war.
»Ach, wirklich? Ich fühle mich aber wieder bestens.« Was die Wahrheit sein würde, sobald es mir gelungen war, meinen fliegenden Atem unter Kontrolle zu bringen.
Meine Mutter, Gerda Falkenberg, ist trotz ihrer vierzig Jahre immer noch wunderschön. Sie ist groß und schlank. Ihre Haut, die sie sorgsam vor der Sonne schützt, ist von vornehmer Blässe. Und in ihrem kastanienroten Haar verstecken sich bis zum heutigen Tag nur vereinzelte weiße Strähnen. Einige Leute behaupten, dass ich ihr ähnlich sehe. Was mich mit Stolz erfüllt. Neben der Haarfarbe und der sommersprossigen blassen Haut – Mama überpudert ihre Sommersprossen selbstverständlich; meine darf jeder sehen – haben wir die meerblauen Augen gemeinsam. Meistens schimmern die meiner Mutter voll Güte und Gelassenheit. Doch sie können auch ganz anders. Dann sticht ihr Blick geradezu und es ist, als würde sie direkt in meinen Kopf blicken und meine Gedanken lesen. So wie jetzt. Weshalb ich meine Augen schnell niederschlug. Ich liebe meine Mama von ganzem Herzen und sie zu belügen, ist schändlich, aber was sollte ich tun?
»Du siehst viel zu schön aus!« Mit ausgebreiteten Armen stürmte Josefine aus ihrem Zimmer und schlang sie um mich. Meine kleine Schwester ist meine Seelenverwandte, für die ich jederzeit durchs Feuer gehen würde. Aber ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr über ihr Erscheinen gefreut wie in diesem Moment. Sie warf den Kopf in den Nacken und strahlte mich an wie der Sonnenschein an einem Frühlingsmorgen. »Viel zu schön, Flo! Die Herren werden sich reihenweise in dich verlieben. Du wirst heiraten und dann lässt du mich allein. Genau wie Elisabeth.« Sie klappte ihren Mund zu und zog nachdenklich die Augenbrauen zusammen. »Na gut, ihr Auszug war zu verschmerzen. Jetzt muss sich der blöde Baron mit ihren Zickereien herumschlagen. Selbst schuld. Er hat sie sich schließlich ausgesucht.«
»Deine Ausdrucksweise, Josefine!« Betrübt schüttelte Mama den Kopf. »Außerdem redet man nicht so über seine große Schwester. Elisabeth hat eine hervorragende Partie gemacht und damit unserer Familie alle Ehre.«
Ehrlich, ich gab mir große Mühe, nicht zu kichern. Nur wenn Josefine so leicht verschmitzt die Schultern bis zu den Ohren hochschiebt und dabei die Mundwinkel verzieht, dann muss ich einfach in ihr Gekicher einstimmen. Unsere leidgeprüfte Mama streifte kopfschüttelnd ihre Seidenhandschuhe über die schlanken Finger. »Ihr seid albern. Alle beide. Und ungerecht. Wo ist überhaupt Miss Bridgewater? Sollst du nicht gerade Additionsaufgaben für sie rechnen?« Damit war für Mama alles Nötige gesagt und sie wandte sich zum Gehen. »Florentine, die Zeit läuft uns davon.«
»Ich komme sofort«, versprach ich. Doch erst musste ich Josefine noch einen dicken Kuss auf den blonden Scheitel drücken. »Und keine Sorge. Bevor ich heirate, bist du schon lange Großmutter!«
»Freut mich zu hören«, flüsterte Josefine mit einem zufriedenen Lächeln. Dann warf sie einen vorsichtigen Blick über den Flur und winkte mich zu sich herab. »Warst du heute wieder bei einer Leiche?«, wisperte sie in mein Ohr. Ich nickte. »Dachte ich es mir doch!«
Während Elise bisher nur die halbe Wahrheit über meine Ausflüge weiß, ist Josefine mir irgendwann auf die Schliche gekommen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Denn ihre Sensationslust bewahrt mich davor, dass sie mein Geheimnis ausplaudert. Schließlich ist ihr klar, dass ein falsches Wort von ihr die Quelle all der blutrünstigen Details für immer zum Versiegen bringen wird. Ein Risiko, das sie unter gar keinen Umständen eingehen will.
»Und? Natürlicher Tod oder war ein grausamer Mörder am Werk?« Ihre dunklen Augen loderten wie Feuer.
»Gift!«, hauchte ich vielsagend.
In Josefines anerkennenden Pfiff mischte sich ein energisches Schuhklackern.
»Die Bridgewater naht!« Alarmiert stolperte Josefine rückwärts auf die offen stehende Zimmertür zu. »Wenn du zurückkommst, erwarte ich einen ausführlichen Bericht. Über den Vergifteten und über die Hochzeit.«
»Bekommst du!«, versprach ich und eilte hinter meiner Mutter her, sodass ich nur wenige Wortfetzen von Miss Bridgewaters Schimpftirade mitbekam.
2
Diesmal flog ich die breite Marmortreppe hinunter, vergaß aber nicht, wie eine Dame dahinzuschreiten, kaum dass die Portiersloge in Sicht kam. Hanke war aber nicht auf seinem Posten. Wer jetzt denkt, er wäre noch mit seinen Bouletten beschäftigt gewesen, irrt. Durch die offene doppelflügelige Haustür konnte ich beobachten, wie er in der Toreinfahrt vor meinen Eltern katzbuckelte. Gefolgt von Leopold bestiegen sie die wartende Kutsche. Bei dem schönen Wetter hatte Papa sich für den offenen Landauer entschieden.
»Da kommt ja auch dat Fräulein Tochter«, begrüßte mich der Portier mit einer unterwürfigen Verbeugung, die mir auf ihre übertriebene Art äußerst unangenehm war. Seine listigen Augen hatten mich zwar nur kurz gestreift, bevor sie wachsam in den Hinterhof und dann zur Straße gehuscht waren, und trotzdem hätte er mein Aussehen bis auf das Arrangement jeder einzelnen Blume in meinem Haar ganz genau beschreiben können. Dessen war ich mir sicher. Hanke war jemand, vor dem ich mich in Acht nehmen musste. Er würde keine Sekunde zögern, sich bei meinem Vater lieb Kind zu machen.
»Is das nicht das Rad von dem jungen Herrn da an der Wand?« Hankes Bemerkung ließ mich erschrocken zusammenfahren.
Während ich mich neben ihn setzte, warf ich Leopold einen ängstlichen Blick zu. Natürlich war es sein Rad, nur wusste er nicht, dass ich es mir ausgeborgt hatte. Doch zu meinem Glück starrte Leopold völlig geistesabwesend vor sich hin und hatte nicht ein Wort von dem mit angehört, was Hanke gesagt hatte.
»Stellen Sie es doch einfach in der Remise unter, Hanke«, wies mein Vater ihn zu meiner Erleichterung an. Er fuhr sich mit dem Finger unter den engen Kragen seines schneeweißen Hemdes und rief unserem Kutscher zu: »Wir können dann los, Johann!«
Johann ließ die Peitsche knallen und die beiden Schimmel zogen an.
Es war bestimmt das erste Mal in meinem Leben, dass ich Leopold so schweigsam und vor allem so ernst erlebte. Normalerweise verhagelt ihm nichts und niemand die Petersilie. Papa wirkte auch ungewöhnlich angespannt. Gestern Abend hatte es zwischen den beiden einen heftigen Streit gegeben, von dem ich leider nicht ein Wort verstanden hatte. So wie es aussah, hatten sich die Wogen noch nicht geglättet und wahrscheinlich überließ Papa deshalb auch Mama die Konversation. Zu meinem Leidwesen drehte die sich ausschließlich um die Wahl von Charlottes Bräutigam. Mama betonte immer wieder, wie stolz unsere Tante Therese und unser Onkel Waldemar auf unsere Cousine sein mussten. Die streng genommen gar nicht unsere Cousine ist. Mama ist über sieben oder noch mehr Ecken mit Tante Therese verwandt. Zu weit entfernt, um zur engen Familie zu zählen. Und doch nah genug, um, was Mama angeht, neidisch auf den Schwiegersohn zu sein. Amandus Graf von Lauenburg ist mindestens doppelt so alt wie Charlotte, aber sehr vermögend und ein Mann der vornehmsten Berliner Gesellschaft. Mama geriet richtig ins Schwärmen darüber, dass Charlotte einem sehr vornehmen Haus in Berlin und einem Gut in Pommern vorstehen und große Verantwortung tragen würde. Gott sei es gepriesen und gepfiffen, hielt unsere Kutsche gerade in dem Moment vor der Kirche, in dem ich Mamas bohrenden Blick auf mir spürte und sie seufzte: »Wann werden dein Papa und ich wohl ebenso stolz auf dich sein können?«
»Niemals«, dachte ich, als Johann den Wagenschlag öffnete und meiner Mutter die behandschuhte Hand entgegenstreckte, um ihr hinauszuhelfen. Weil ich nicht Charlotte bin.
Damit mich keiner missversteht: Ich mag Charlotte. Sie ist lieb, einfühlsam, hilfsbereit und ein wirklich guter Mensch. Ich mag sie, weil man sie einfach mögen muss. Was meine Eltern an ihr so sehr schätzen, entlockt mir allerdings nicht mehr als ein müdes Gähnen. Von morgens bis abends tut sie nämlich nur die Dinge, die ihre Eltern, die Gesellschaft und sie selbst von ihr erwarten: Sticken, Musizieren, Briefe schreiben, leichte Konversation führen, sittsam sein und ihren Eltern Ehre und Freude bereiten. Zeit, in der ich mich lieber zur Charité stehle oder im Geheimen Artikel schreibe, die ich dann mit dem Pseudonym Schattenfeder signiere und in der Verkleidung des Botenjungen Gustav mit rasendem Herzen beim Hauptstadt-Kurier abgebe!
Es war zu erwarten gewesen, dass Charlotte eine gute Partie machen würde. Wenn ich jemals heiraten sollte, dann ganz bestimmt niemanden von diesen konformen Adeligen, Offizieren und Geschäftsmännern, die ich soeben von meinem erhöhten Standort aus der Kutsche in die Kirche strömen sah. Von denen würde auch niemand mit mir glücklich werden.
Trotzdem hatte ich einen ziemlichen Kloß im Hals, als ich wenig später als erste der vier Brautjungfern zu den feierlichen Klängen des Air von Johann Sebastian Bach durch das blumengeschmückte Kirchenschiff schritt. Wie wir es in den letzten Tagen geübt hatten, stellten wir uns immer zu zweit links und rechts neben dem Altar auf. Mein Platz war rechts vor der ersten Kirchenbank und damit konnte ich direkt auf das erschreckend schüttere hellblonde Haar von Amandus Graf von Lauenburg blicken. Im Cutaway, den Zwicker auf der Nase, wartete er auf seine Braut. Mich gruselte es regelrecht, als Charlotte in ihrem hochgeschlossenen Hochzeitskleid und dem Blumenkranz auf ihrem ebenholzfarbenen Haar am Arm ihres stolzen Vaters auf uns zuschritt.
Sie war doch viel zu schön und viel zu jung für den alten Mann.
Plötzlich hörte ich eine Stimme in meinem Rücken knarzen:
»Eigentlich wollte er ja ihre Mutter heiraten. Vor vielen, vielen Jahren.« Neugierig drehte ich meinen Kopf. Dabei hatte ich sowohl an der brüchigen Stimme als auch an der Lautstärke längst Charlottes schwerhörige Großmutter identifiziert. Von ihrem Platz auf der Kirchenbank sah sie mich mit rot geränderten Augen an. »Aber das habe ich nicht zugelassen«, posaunte sie so laut, dass es bestimmt auch der Letzte in der hintersten Ecke gehört hatte. »Einen Adelstitel erbt man, Ruhm und Ehre verdient man sich, und da hatte er noch einen weiten Weg vor sich.«
»Ist ja gut, Großmutter!« Charlottes älterer Bruder Hendrik, der wie alle anderen bei unserem Kircheneinzug aufgestanden war, setzte sich schnell neben sie und tätschelte beruhigend die Hand der alten Dame, deren Kopf nicht aufhören wollte zu nicken. Ein Schauder lief mir über den Rücken. Auch wenn ich das drohende Unheil noch nicht fassen konnte, ab diesem Moment wusste ich, dass es wie eine rabenschwarze Wolke über uns schwebte.
Charlottes Vater, Geheimrat Waldemar Dahlhoff, übergab seine Tochter an Amandus Graf von Lauenburg. Dann trat er zu den verklingenden Tönen der Kirchenorgel zwischen seine Frau Therese und Amandus’ Schwester. Sophie Gräfin von Lauenburg lächelte glücklich und tupfte sich immer wieder Tränen der Rührung von den Augen. Die Gemeinde nahm Platz, was ich auch gerne getan hätte, denn mittlerweile schmerzten meine wund gescheuerten Füße in den neuen Schuhen. Meine Eltern und mein Bruder saßen irgendwo in der Mitte des Kirchenschiffs. Das wusste ich, obwohl ich sie beim Einzug nicht gesehen hatte. Aber dafür hatte mir ab schätzungsweise Reihe sieben der tadelnde Blick meiner Schwester Elisabeth auf dem Rücken gebrannt. Innerlich wappnete ich mich schon mal gegen jedes »Du bist nicht im Rhythmus der Musik geschritten«- oder »Man sollte dir einen Stock auf den Rücken binden, damit du lernst, dich gerade zu halten«-Gemecker meiner großen Schwester.
Der Gedanke an ihr Gezeter hatte mich so abgelenkt, dass ich erst jetzt das unterschwellige Raunen registrierte. Irritiert schaute ich mich um. Da stand mein Bruder Leopold mitten in der Kirche und ließ den Kopf hängen. Was um alles in der Welt hatte er vor?
»Charlotte?«, hallte Leopolds tränenerstickte Stimme von den Kirchenmauern wider.
Augenblicklich erstarb das Gemurmel. Der Pastor brach mitten im Satz ab und alle Blicke, auch die von Charlotte und Amandus, richteten sich auf meinen unglücklichen Bruder.
»Tu das nicht! Wir lieben uns doch. Du wolltest auf mich warten, bis ich mit dem Studium fertig bin.«
Mir klappte der Unterkiefer herunter. Charlotte und Leopold? Irritiert schaute ich zwischen den beiden hin und her. Ich hasse es wirklich, wie Elisabeth zu klingen. Aber das war ja ein Skandal! Gott sei dank war Maximilian Winterfeld schon zur Stelle, um Leopold zum Hinsetzen zu bewegen. Meine Knie wurden weich. Ich bekam kaum noch Luft. Fragend schaute ich Charlotte an, doch sie hatte ihre Augen fest auf Leopold geheftet. Täuschte ich mich? Nein, die Bewegung war kaum wahrnehmbar gewesen und doch hatte sie kurz den Kopf geschüttelt.
»Aber, Charlotte, wir haben uns doch ewige …«
»Bitte entschuldigen Sie meinen Sohn«, fiel Papa ihm ins Wort. Es war ihm endlich gelungen, sich aus der Kirchenbank zu kämpfen. »Wir dachten, er sei von seiner schweren Grippe wieder genesen. Doch offensichtlich erleidet er gerade einen Rückfall. Das Fieber spricht aus ihm.«
Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Nachdem er sich kurz in Richtung Brautpaar und Pastor verneigt hatte, legte Papa einen Arm um Leopold und führte ihn aus der Kirche.
Von wegen Grippe und Fieberwahn. Leopold war bis über beide Ohren in Charlotte verliebt! Und sie? Mein Kopf flog zu ihr herum. Als wäre nichts geschehen, tastete sie nach Amandus’ Hand, lächelte und flüsterte ihm etwas zu. Er nickte und sprach ein paar Worte mit dem Pastor. Woraufhin der mit der Trauung einfach fortfuhr. So, als wäre nichts geschehen. Ganz im Gegensatz zur Hochzeitsgesellschaft, die wieder anfing zu tuscheln. Diesmal wie ein aufgebrachter Bienenstock.
Noch nicht mal ein Jahr war ich weg gewesen. In England, im Internat. Und schon passierten hinter meinem Rücken die erstaunlichsten Dinge. Ausgerechnet Charlotte? Wer hätte das gedacht? Wenn Leopold und sie ein heimliches Paar waren – und ich hatte keinen Anlass, an den Worten meines Bruders zu zweifeln –, dann verstand ich noch weniger, wie sie diesen alten Knacker heiraten konnte. Und überhaupt. Amandus Graf von Lauenburg hatte, soweit ich das beurteilen konnte, bei Leopolds unrühmlichen Auftritt nicht mal mit der Wimper gezuckt. Hätte er nicht vor Eifersucht rasen müssen? Hätte er ihm nicht sofort den Fehdehandschuh entgegenschleudern und ihn zum Duell fordern müssen?
Doch die Trauung schritt unaufhaltsam voran. Bald verließ Charlotte als frischgebackene Gräfin von Lauenburg am Arm ihres Mannes die Kirche. Der Organist haute tüchtig in die Tasten und auch ich ließ mich vom Hochzeitsmarsch aus der Kirche tragen. Eins stand fest: Heute Abend hatte ich ganz schön viel in mein Tagebuch zu schreiben.
Aus den Augenwinkeln registrierte ich, wie die von Lauenburg’sche Hochzeitskutsche davonfuhr. Sekunden später hielt dann unser Landauer vor der Kirche. Mit einem gezwungenen Lächeln entstieg ihm Papa, um Mama und mir sein Geleit anzubieten. Von Leopold war nichts zu sehen. Freundlich grüßte Papa in alle Richtungen. Und dann drang die Zeterstimme meiner Schwester Elisabeth an mein Ohr.
»Was hat Leopold sich nur dabei gedacht?« Am Arm ihres Mannes, Ulrich Baron von Draglitz, schritt sie betont aufrecht neben uns her. »Ich habe mich in Grund und Boden geschämt! Macht er sich auch nur die leiseste Vorstellung davon, wie sehr er uns, seine gesamte Familie, vor ganz Berlin zum Narren gemacht hat?«
»Contenance!«, wies Mama sie wispernd in ihre Schranken. Was eine freundliche Umschreibung war für: »Reiß dich zusammen! Wir sind nicht allein.«
Zum Glück hatte Ulrich mehr Grips zwischen den Ohren als meine Schwester, weshalb er meiner Mutter entschuldigend zunickte und seine aufgebrachte Frau an den übrigen Hochzeitsgästen vorbei zu ihrer Kutsche lotste. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel. Wenn wir die beiden in zehn Minuten in der Villa von Charlottes Eltern wiedersehen würden, hätte sich Elisabeths Blutdruck deutlich normalisiert. Und das hatten wir dann einzig und allein Ulrich zu verdanken. Weil er mit Engelszungen auf sie eingeredet und sie beruhigt haben würde. Der »blöde« Baron war nämlich gar nicht blöd, sondern das Beste, was Elisabeth und uns hätte passieren können. Was Josefine im Übrigen sehr gut wusste.
Nur, wo steckte Leopold? Ich verkniff mir die Frage, bis wir uns hinter Johann auf den Polstern unserer Kutsche niedergelassen hatten. Vorsorglich geduldete ich mich dann noch, bis die Hufe der Pferde über das Kopfsteinpflaster klapperten. Dann hielt ich es nicht länger aus. »Wo ist Leopold?«
»Ich habe ihn nach Hause gebracht und in seinem Zimmer eingeschlossen.« So wie Papa den Blick aus der Kutsche auf die vorbeiziehenden Häuser geheftet hatte, würde ich nicht mehr aus ihm herausbekommen. Jetzt nicht und später auch nicht. Dabei platzte ich fast vor Neugierde. Hatten meine Eltern von Leopolds Liebe zu Charlotte gewusst? Hatte Papa ihn deshalb letztes Jahr zum Studium so weit weg nach Heidelberg geschickt? War sie der Grund für den heftigen Streit gestern Abend gewesen?
Immer wieder spannten sich Papas Kiefer an, was ein sicheres Zeichen für den Grad seiner Verärgerung war. Wenn wir heute Abend nach Hause kamen, würde Leopold tüchtig die Leviten gelesen bekommen. So viel stand mal fest. Und um eine Strafe würde er auch nicht herumkommen. Mein armer Bruder!
»Und so lasst uns auf das Brautpaar anstoßen!« Charlottes Vater, Waldemar Dahlhoff, hatte sich am Kopfende der Festtafel erhoben. Er strahlte wie ein Honigkuchenpferd, als er mit seinem Champagnerglas erst dem Brautpaar, dann Amandus’ Schwester Sophie, seiner Frau Therese, seinem Sohn Hendrik und schließlich uns, der Hochzeitsgesellschaft, zuprostete.
»Auf das Brautpaar!«, scholl es vielstimmig durch den parkähnlichen Garten. Gläser klirrten.
Der Empfang und das wirklich köstliche Hochzeitsessen mitsamt den weniger spannenden Reden von Brautvater und Bräutigam lagen hinter uns. Gerade eben hatten Charlotte und Amandus die vierstöckige Hochzeitstorte angeschnitten. Dann waren die livrierten Diener ausgeschwärmt, um die Kuchenteller an den Tischen zu servieren.
Während des Empfangs hatten einige der Gäste meine Familie noch ziemlich schamlos beäugt und tuschelnd die Köpfe zusammengesteckt. Dabei war der Name Leopold Falkenberg mehrfach gefallen. Wir ignorierten diese Vorgänge, so gut wir es konnten. Selbst Elisabeth schaffte es, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ohne Frage Ulrichs Werk. Im Verlauf des zweiten Ganges hatte sich das offensichtliche Interesse an uns dann gelegt. Was ich mit großer Erleichterung bemerkte. Allerdings machte ich mir keine Illusionen. Leopold würde in der feinen Berliner Gesellschaft noch lange das Gesprächsthema bleiben.
Ein Diener stellte einen Kuchenteller auf dem blütenweißen Tischtuch vor mir ab und ein vorfreudiges Lächeln stahl sich auf mein Gesicht. Schokoladendunkel, buttergelb, sahnig und mit Kirschen: Donauwelle, mein absoluter Lieblingskuchen. Ich schaute auf. Als meine Augen Charlottes Blick trafen, nickte sie mir verschwörerisch zu.
»Wie schön, dass es Menschen gibt, die man mit so einfachen Dingen glücklich machen kann.« Die herablassende Bemerkung kam von dem Herrn auf dem Stuhl links neben mir. Julius Trebbin. Dickes, dunkelbraunes Haar. Tiefbraune Augen. Markantes, etwas spitzes Gesicht. Ein paar Jahre älter als Leopold, schätzte ich. So steinreich und aus so angesehener Familie, dass Mama mir von gegenüber aufmunternd zulächelte. Und das nicht zum ersten Mal an diesem Nachmittag. Ganz bestimmt wollte ich nicht, dass sie mir auch noch gegen das Schienbein trat. Deshalb tat ich zwei Dinge. Ich brachte meine Beine in Sicherheit und antwortete knapp: »In der Tat.«
Warum Charlotte sich bei der Wahl ihrer Hochzeitstorte für Donauwellen entschieden hatte, wusste ich. Denn die Leidenschaft für diesen Kuchen ist unsere einzige Gemeinsamkeit. Allerdings war mir völlig schleierhaft, warum sie mir diesen aufgeblasenen Wichtigtuer als Tischherrn angetan hatte. Zugegeben, Julius Trebbin war reich. Sehr reich sogar. Dabei wusste keiner, ob er das viele Geld überhaupt rechtmäßig erlangt hatte. Denn um ihn und die genauen Umstände, die ihn zum Erben gemacht hatten, rankte sich ein großes Geheimnis. Er war ein Lebemann, verprasste sein Geld mit vollen Händen. Einzig und allein für sein Amüsement. Wie man so hörte. Ich führte die Gabel zum Mund und kaute ausgiebig, um jedem weiteren Gespräch mit ihm aus dem Weg zu gehen.
»Mein guter Trebbin, Sie müssen unbedingt zum Tee zu uns kommen.« Bei den Worten meiner Mutter blieb mir der Kuchen im Halse stecken und ich musste ganz schrecklich husten. »Oder besser: Kommen Sie am Montagabend zu unserer Soirée«, setzte sie unbeeindruckt noch einen drauf. Wollte sie, dass ich erstickte?
Julius Trebbin neigte huldvoll den Kopf. »Es wird mir eine Ehre sein, gnädige Frau.«
Kurz wandte er den Blick in meine Richtung, um mir ein richtig unverschämtes Lächeln zuzuwerfen. Na, warte, Bürschchen!
»Gehen wir bald?«, wisperte ich meinem Vater leise ins Ohr.
»Das wäre nicht ratsam. Verlassen wir das Fest zu früh, könnte das als Flucht interpretiert werden, Florentine«, antwortete er, während er freundlich nach links grüßte und dabei über seinen gepflegten Oberlippenbart strich. »Nach dem, was dein Bruder sich heute geleistet hat, müssen wir bleiben, bis Charlotte und ihr Gemahl sich zur Hochzeitsreise aufmachen. Was bald der Fall sein dürfte.«
In der Tat verließen Charlotte und Amandus kurz darauf ihre Plätze, um sich in der oberen Etage umzukleiden. Danach würden sie sich von der Kutsche zum Bahnhof bringen lassen, um den Zug nach Pommern zu besteigen. Amandus wollte seiner Frau das Familiengut und die Ländereien präsentieren.
Papa lauschte andächtig auf die Worte der Dame rechts neben ihm, während Mama und Herr Trebbin sich angeregt über seine Pferdezucht unterhielten. Ein Thema, das mich als begeisterte Reiterin eigentlich auch interessierte. Allerdings nur dann, wenn der Eigentümer nicht so ein schrecklich selbstverliebter Wichtigtuer war. Also nutzte ich die Gunst der Stunde und vertrat mir im Garten ein wenig die Füße.
Die halbe Gesellschaft flanierte in Grüppchen oder einzeln an den blühenden Blumenbeeten vorbei. Ich war auf dem Weg zum Teich, um den Enten Guten Tag zu sagen, als plötzlich Musik in meinem Rücken ertönte. Wie elektrisiert wirbelte ich auf dem Absatz herum. Mehrere Fenster im ersten Stock der Villa standen weit offen. Dahinter, das wusste ich, befand sich das Musikzimmer mit dem großen Konzertflügel, den Hendrik spielte wie kein Zweiter. Unwillkürlich begann ich, mich zu der Musik im Takt zu wiegen. Vielleicht sollten wir doch länger bleiben. Zumindest auf zwei oder drei Tänze. Denn die Abreise des Brautpaars bedeutete noch lange nicht, dass das Fest vorüber sein würde. Ganz im Gegenteil.
Übermütig folgte ich dem Klang der Musik. Tanzte auf die offene Fenstertür zu.
Und dann ertönte der Schrei.
Damit sind wir wieder in der Gegenwart.
Ich liege auf den kalten Marmorfliesen neben Amandus’ Leiche. Wieder ertönt ein markerschütternder Schrei. Diesmal stößt ihn aber nicht Tilda aus, das Dienstmädchen, das uns alarmiert hat. Auch wenn es der Stimmlage nach zu urteilen erneut eine Frau ist, die schreit. Zu blöde, dass ich nicht einfach die Augen aufmachen kann. Zwei muskulöse Arme schieben sich unter mich und jemand hebt mich hoch. Ich spüre, wie Menschen vor uns zurückweichen. Mit geschlossenen Augen lausche ich auf Schritte, die uns unweigerlich zu dem dottergelben Sofa unterhalb der Treppe führen werden. Weit und breit gibt es nämlich kein anderes. Für einen Moment setzt mein Herzschlag aus. Wonach duftet dieser Mensch nur so gut? Irgendwie nach Vanille. Behutsam bettet er mich auf das mit Chintz bezogene Polster.
»Könnte ich Riechsalz bekommen?«
Die Frage hatte ich vorhergesehen, nicht aber, dass ausgerechnet Julius Trebbin sie stellen würde, während er neben mir kniet und mir Luft zufächelt. Kein Riechsalz der Welt könnte mich so schnell wieder auf die Füße bringen wie der Wunsch, von diesem Mann wegzukommen. Blitzschnell reiße ich die Augen auf und schwinge die Beine vom Sofa.
»Langsam, Fräulein Falkenberg. Denken Sie an Ihren Blutdruck.« Bereit, mich im Falle eines Falles aufzufangen, breitet Herr Trebbin schützend die Arme aus.
»Dem geht es bestens«, ist das, was ich ihm am liebsten antworten würde. Nur muss ich an meine Rolle denken. Und die sieht vor, dass ich mir jetzt seufzend den Handrücken an die Stirn halte, leichten Schwindel vortäusche und mit matter Stimme wispere: »Oh, ja, wie recht Sie haben. Ich sollte besser noch etwas sitzen bleiben. Wären Sie wohl so nett und würden meine Mutter holen?«
»Aber selbstverständlich!« Schon bin ich ihn los.
Neugierig versuche ich, zwischen den langen Kleidern und den vielen schwarzen Hosenbeinen hindurch noch einen Blick auf die Leiche zu werfen. Vergeblich. Irgendwer hat sie mit einem Tuch zugedeckt, sodass Amandus Graf von Lauenburg jetzt den grotesken Eindruck eines aufgespannten Zelts vermittelt. Die höchste Stelle bildet das Messer in seinem Rücken. Ein eiskalter Schauder schüttelt mich. Und dann wird mir doch noch blümerant. Scheinbar realisiere ich jetzt erst, dass da wirklich ein Mensch gewaltsam aus dem Leben gerissen worden ist.
Unter uns gesagt, bin ich deswegen auch sehr dankbar, als mein Vater nach nicht mal zwei Minuten gefolgt von Herrn Trebbin neben mich tritt. Er hilft mir auf und legt fürsorglich den Arm um meine Taille.
»Komm, mein Kind«, sagt er. »Das ist kein Anblick für eine Frau.«
»Aus diesem Grund habe ich mir auch erlaubt, Ihren Vater und nicht Ihre werte Frau Mama zu verständigen«, informiert mich Herr Trebbin mit einer Verbeugung.
Wie bitte? Ich spüre, wie mir das Blut in die Wangen schießt. Gut, mir ist speiübel und ich bin unleugbar eine Frau. Und trotzdem. Wenn ich mich so umgucke, entdecke ich ziemlich viele grün verfärbte Gesichter. Viele von ihnen tragen einen Oberlippenbart.
3
»Genau deswegen habe ich dich nach Heidelberg geschickt, Leopold. Damit dir beim Studium diese Flausen ausgetrieben werden.« Papa brüllt zwar nicht, aber dankenswerterweise redet er so laut auf Leopold ein, dass Josefine und ich im Vorzimmer jedes Wort aus dem Herrenzimmer verstehen können. »Ich habe dir schon vor einem Jahr gesagt, dass Charlottes Eltern sich einen gestandenen, weltgewandten Mann der Gesellschaft für ihre Tochter wünschen, und keinen, der noch grün hinter den Ohren ist.«
»Aber ich liebe Charlotte«, widerspricht Leopold trotzig. »Sie und ich gehören zusammen.«
»Auweia!« Josefines Augen werden riesengroß. Dass eines von uns Kindern unserem Vater Widerworte gibt, ist einfach zu unglaublich.
»Den Teufel tut ihr!«, donnert Papa. Vor meinem inneren Auge sehe ich, wie er vor einem der großen Fenster zu Leopold herumwirbelt, der wahrscheinlich auf dem Besucherstuhl vor Papas riesigem Schreibtisch aus Mahagoni sitzt. »All das ist nichts weiter als eine bedeutungslose Schwärmerei, in die du dich hineingesteigert hast. Charlotte ist ja Gott sei Dank rechtzeitig wieder vernünftig geworden. Machst du dir auch nur im Geringsten eine Vorstellung davon, wie sehr du unsere Familie mit deinem Auftritt in der Kirche blamiert hast? Hast du auch nur eine Sekunde an deine Mutter oder deine Schwestern gedacht? Oder an Charlotte? Ist dir auch nur ansatzweise bewusst, wie sehr du sie kompromittiert hast? Die Frau, die du angeblich so sehr liebst? Das hätte leicht in einer Satisfaktionsforderung enden können. Bist du dir dessen bewusst?«
»Ein Duell?« Verwirrt zieht Josefine die Nase kraus. »Aber die sind doch verboten!«
»Leider kümmert das nicht jeden«, antworte ich sachlich.
Bestürzt presst sich Josefine die Hand auf den Mund. »Dann hätten Amandus und Leopold aufeinander geschossen? Bei Morgengrauen? Einer von beiden hätte sterben können!«
Mein Magen krampft sich zusammen. Nein, nicht einer von beiden.
»Amandus war der bessere Schütze.« Meine Stimme ist so leise, dass ich sie selbst kaum hören kann. Oh, mein Gott! Die Vorstellung von einem blutüberströmten Leopold im taunassen Gras lässt mich frösteln. Und plötzlich werde ich richtig wütend auf ihn. Was für ein rücksichtsloser Idiot er doch ist! Wenn die Liebe aus einem normal denkenden Menschen so einen hirnverbrannten Trottel machen kann, dann ist dieser Zustand nichts für mich. Herzlichen Dank auch!
Mit angehaltenem Atem lausche ich auf Leopolds Antwort. Hoffentlich sorgen Papas Worte dafür, dass endlich der Groschen bei ihm fällt. Doch was folgt, ist Stille. Überfragte, verzweifelte Stille, ja, vielleicht sogar – wie ich hoffe – sehr schuldbewusste Stille, in die sich erst leise, dann immer deutlicher ein regelmäßiger, sehr entschlossener Rhythmus mischt. Erst denke ich, Papa gehe vor dem Kamin auf und ab, während er Leopold Zeit zum Nachdenken gibt. Doch dann zupft Josefine aufgeregt an meinem Brautjungfernkleid – noch hatte ich keine Gelegenheit, mich umzukleiden. »Die Bridgewater naht, um mich ins Bett zu stecken!« Mit flehentlich gefalteten Händen schaut meine kleine Schwester zu mir auf.