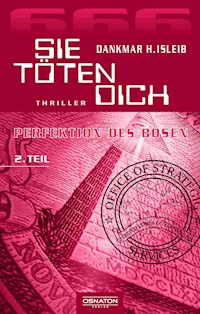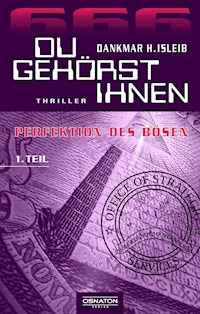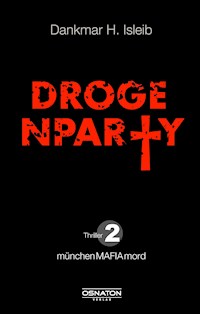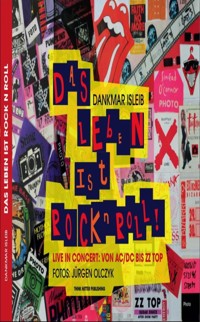6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Osnaton Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: münchenMAFIAmord
- Sprache: Deutsch
Schönes Schlamassel, in das der 'Doktor' da wieder reingerasselt ist. Privatdetektiv Daniel Richter, alias der 'Doktor', ist ja einiges gewöhnt. Aber das verschlägt selbst dem coolen Ex-LKAler die Sprache. Tatort: Singapur Freeport, ein Supersafe für Superreiche. Mitten in der riesigen Schatzkammer ein Toter, dem man einen halben Meter langen Holzpfahl in den Hintern gerammt hatte. Kein schöner Anblick. Die Ouvertüre eines Falles, der Richter um den ganzen Globus treibt. Auftraggeber ist der Münchener Werbeguru Jacob Folgmann. Ein schmieriger, geldgieriger, völlig skrupelloser Gangster, der mit Kunstfälschungen handelt. Die in Singapur beginnende Spurensuche führt über London nach Zürich und zurück nach München. Richter trifft auf Londoner Aristokraten mit exzellenten Mafia-Connections, einen ermordeten Kunstprofessor aus Zürich und die bulgarische Mafia, die überall ihre blutige Fährte hinterlässt. Ein gefährliches Spiel, auf das sich der 'Doktor' da einlässt. Und alles führt zu Jacob Folgmann … FREEPORT ist der vierte Band aus der Reihe "münchenMAFIAmord" um den gerechtigkeitsliebenden Privatermittler Daniel Richter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
DANKMAR H. ISLEIB
FREEPORT
THRILLER
münchenMAFIAmord
4
Inhalt
PROLOG
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Kapitel XXXVI
Kapitel XXXVII
Kapitel XXXVIII
Kapitel XXXIX
Kapitel XL
Kapitel XLI
Kapitel XLII
Kapitel XLIII
Kapitel XLIV
Kapitel XLV
Kapitel XLVI
PROLOG
ZU München empfinde ich inzwischen eine Hassliebe. Mit jedem Jahr meines Lebens in der Stadt werde ich unsicherer, ob es noch der Ort ist, an dem ich weiter leben möchte. Nun neigen wir Deutschen zwar ohnehin dazu, alles zuerst von der negativen Seite zu betrachten … Aber wenn man ein paar Monate woanders ist, im Ausland, im Urlaub, im Nach-Hochzeits-Wahn-Fieber, kommt man schon ins Grübeln. ‚Man‘ heißt in diesem Falle ich. Der letzte Fall hatte mich echt an meine Grenzen gebracht. Von mir aus können die Menschen machen, was sie wollen. Sie klauen, betrügen, morden ohnehin. Okay. Das gehört zum Menschsein. Leider. Daran habe ich mich fast gewöhnt. Wie heißt es im Alten Testament, Joel 1.4 (nach der Übersetzung Luthers)? „Was die Raupen übrig lassen, das fressen die Heuschrecken, und was die Heuschrecken übrig lassen, das fressen die Käfer, und was die Käfer übrig lassen, das frisst das Geschmeiß.“ Alles schön und gut. Aber Kinder, wehrlose Kinder, fast Babys, Jungs wie Mädchen vergewaltigen, auf grausamste Art töten und dann verbrennen?! Die das machen, nur ‚Geschmeiß‘?
Nein, unsagbar schlimmer.
Das hat wahrlich nichts mehr mit natürlichem, menschlichen Leben zu tun – und schon gar nicht mit Gerechtigkeit. Es ist einfach nur unvorstellbar abscheulich! Mich hat das Geschmeiß Jahre meines Lebens gekostet. Ja, ich bin schneller gealtert als erhofft. Meine Seele ist zutiefst verletzt worden. Regelmäßig, bei jedem neuen Job. Hätte ich nicht meine zwei Lieben, Anna und Fanny, an meiner Seite gehabt, ich wäre zum totalen Misanthropen konvertiert! Ehrlich!
Diesmal fiel es mir besonders schwer, wieder in den Alltag zurückzufinden. Mein Fehler war es, im Netz die News aus München zu verfolgen. Fast nur negative Schlagzeilen. Beim Surfen an nur einem einzigen Tag …
„Münchens teuerste Schweinshaxe: geklaut!“,
„Touristen-Boom setzt sich fort. München frohlockt!“,
„Anklage gegen Steckdosen-Sadist fast fertig!“,
„Einbrecher immer dreister – neue Methode bereitet der Polizei Sorgen“,
„Wohnungsnot in München wächst – Preise auf neuem Rekordhoch“,
„Münchens Quadratmeter kostet mittlerweile im Schnitt 10.140 Euro“,
„420.000 Euro Miete für zehn Personen“,
„Maskierter Audi-Fahrer rast in Radarfalle“,
„Bayerns Polizisten bekommen neue Hilfsmittel“,
„Garage zugeparkt: Frau meldet Mord am Ehemann“,
„In München leben immer mehr Reichsbürger“,
„Bronzesau vor dem ›Paulaner‹ im Tal versucht zu klauen – Diebe brechen ‚Resis‘ Huf ab“ (das Frontschwein beim Paulaner im Tal),
„BMW kauft sich offenbar für 800 Millionen Euro beim FC Bayern ein“
Das ist alles der reinste Wahnsinn, oder?! Ist der Fußball nun wirklich das Nonplusultra? Muss Wohnraum jedes Jahr teurer werden? Warum zahlt München für zehn ‚Abschiebehäftlinge‘ für deren Unterkunft am Münchener Flughafen pro Monat 420.000 Euro? Eine Monatsmiete von 42.000 Euro pro Person für ein Zimmer – das kann ich mir nicht leisten, echt! Wäre das Geld nicht besser im sozialen Wohnungsbau ausgegeben? Wer stoppt den Irrsinn? Und: Brauchen wir in München immer mehr Touristen – bahnt sich ein zweites Venedig an?
Armageddon in Minga?
Warum heißt es nicht mal: „Maskierter Reichsbürger brach sich das Bein beim Verzehr einer bei BMW für 800 Millionen Euro geklauten Schweinshax‘n?! …!“
I
FUCK! Mein Privatleben ist mir heilig! Erst recht an den Wochenenden. Das sollte sich in München doch inzwischen rumgesprochen haben! Warum begreifen das meine Klienten nicht? Gerade war ich mit Anna, Frau Fischer-Richter, meiner fast einzigen Frau, von meiner längst überfälligen Hochzeitsreise nach München zurückgekehrt, als mein Handy auch schon klingelte.
Freitagnachmittag.
Zu der Stunde, wo die sich affengeil findenden Typen im Designer-Outfit schon die erste Line reingezogen haben, dann angefixt den Straßenverkehr zur Mördermeile machen und die Tussis sich aufbrezeln – als stehe schon wieder eine völlig uninteressante Hochzeit im britischen Königshaus an –, um sich von irgendeinem der Gegelten mit Kohle erst ins XY einladen zu lassen, um ihm dann später, ganz unverbindlich, als Dankeschön, einen zu blasen.
Es war kurz nach 16:00 Uhr. Den Anrufer kannte ich. Stimmen sind etwas Einmaliges. Und diese erst …
Ich wollte es mir nicht leisten, den Mittelfinger zu heben und dem einen Korb zu geben. Klar, wir hatten geerbt, besser gesagt meine Anna, aber ich wollte nicht abhängig sein. Außerdem liebe ich irgendwie auch meinen Beruf. Na ja, was heißt schon ‚Beruf‘ – eher meinen Job. ‚Beruf‘ klingt in meinem Fall so nach Ärmelschoner, sterilem Büro und langweiligen Kollegen, die nur …
»Doktor, kommen Sie sofort zu mir. Sie wissen doch, wo ich wohne?! Es ist nur um die Ecke, okay?!«
»Klar doch. Heute wird das aber nichts. Ich bin gerade erst angekommen. Hochzeitsreise, Sie verstehen …?«
»Das ist gut so. Dann brauchen Sie gar nicht erst auspacken. In zehn Minuten bei mir. Ich verlasse mich auf Sie!«
Zack, der Oberarsch hatte aufgelegt, bevor ich die sauerstoffreiche Grünwalder Luft erneut einatmen konnte. Ging gar nicht darauf ein, was ich ihm gesagt hatte.
Was nun?
Fünf Milliarden gegen meine Faulheit.
Ein Mann, der schwebt. Ein Mann, der nicht geht, nicht schreitet – einer der schwebt!
Jesus oder Papst?
Wer kann schon auf Wasser latschen?
Wie kann ich dem Paroli bieten?
Was will der von mir?
»Anna, du kennst das schon. Der Folgmann hat gerade angerufen. Da scheint es was für mich zu tun zu geben. Ich gehe mal kurz rüber. Machst du uns bitte inzwischen einen Tee? Das wäre ganz lieb von dir! Es dauert nicht lange. Bin gleich zurück.«
Anna zeigte mir ihre Enttäuschung nicht, aber ihre Augen sagten, dass nicht der, der mich zwang zu ihm zu kommen der Oberarsch sei, sondern ich.
»Fanny, lass uns gehen!«
Der Mistkerl drehte nicht mal seine Lauscher zu mir. Der war noch immer stinkig. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht wollte er wieder zu der deutschen Wachtelhündin, dieser Rothaarigen mit dem seidigen Fell, die ihm auf Capri total die Schnauze verdreht hatte. Wir waren für ein paar Tage im ›Tiberio Palace‹ abgestiegen und diese dämliche Wachtel hatte meinen Tosa Inu völlig Gaga gemacht. Sie war der Stolz des Hotelbesitzers und ausgesprochen gepflegt. Die weinrote Wachtelhündin mit weißer Blesse und weißer Wamme lag im Foyer des Hotels auf dem schwarzen Marmor, hörte auf den Namen Lola und glotzte meinen Fanny an, als sei er der erste richtige Köter, den sie sieht. Eine Schönheit. Sie. Aber was wollte mein Riesenklotz mit dem zarten Wesen? Einem Schnüffelhund! Schnüffler bin doch ich, wenn ich dafür gut bezahlt werde, oder?!
»Fanny!«
Na endlich.
Er bequemte sich, seinen inzwischen auf etwa 85 Kilo abgemagerten Body gemächlich in Bewegung zu setzen, warf Anna einen Blick zu, der eigentlich mir galt und soviel sagte, wie … der kann mich mal …! und trottete hinter mir her, als sei ich ein armseliger Pudel mit Bommel, kahl rasiertem Hintern und riesiger Krone – und nicht die italienisch-deutsche Schönheit.
Ich klingelte und eine Asiatin öffnete mir. Bildschön und in traditioneller Kleidung ihres Landes. Sie begrüßte mich mit dem für die Region üblichen Wai. Das ‚Wai‘ ist das Verbeugen mit zusammengeführten Händen gegenüber dem zu Begrüßenden. Sie tat das formvollendet. Das heißt, sie zeigte mit ihrer Art der Begrüßung, dass sie die sozial niedriger gestellte Person sei, jünger und von großem Respekt mir gegenüber. Die Arme dicht am Körper, die Handflächen eng beieinander; sie berührten ihren Körper im Bereich des oberen Brustkorbs und das Heben und Senken der Hände geschah in einer flüssigen und langsamen Bewegung. Ich war mir nicht sicher, ob die Ehrerbietung mir galt oder aus Angst vor dem Folgmann erfolgte …
»Folgen Sie mir bitte, Herr Doktor Richter.«
Was für eine bezaubernde Stimme. Aus dem Singsang hätte man glatt einen Hitsong basteln können. War die hier wirklich nur als Türöffnerin angestellt? Oder war sie die Neue des Neureichen? Man munkelte, dass seine beträchtlich Jüngere, ihm Angetraute, des Öfteren den Hubschrauber oder einen Jet seiner Firma nahm, um kurz mal mit einem zweibeinigen Hengst in das Chalet der Familie in Davos-(am schönsten ist) zu fliegen, sich dort – sie war eigentlich ein wenig plump, hatte aber über die Jahre durchaus etwas von einer gut eingerittenen Stute vom Lande, was man nicht nur an ihren O-Beinen sah – gut durchvögeln zu lassen, um dann den Eitlen besser ertragen zu können.
»Bitte folgen Sie mir, Herr Doktor.«
Kein Hohn in der Stimme, kein Zynismus. „Herr Doktor“. Aus ihrem Mund klang das bewundernd. Vielleicht glaubte sie, mein Spitzname in der Branche wäre ein durch Universitätsabschluss erarbeiteter Titel … In dem Moment ging mir durch den Kopf, wie viele Politiker in Deutschland ein ‚Dr. Peinlich-Plagiat‘ in ihrem Namen trugen, von einem Karl Theo von Guttenberg über Annette Schavan, Jorgo Chatzimarkakis bis hin zu Silvana Koch-Mehrin – alles Betrüger …
Sein „Doktor“ kam mit einer leicht überzogenen, um nicht zu sagen starken Arroganz rüber, als er mich anrief. Aber auch Ärger und Nervosität konnte ich in seiner Stimme erkennen, die gewohnt ist, dass man ihr folgt. Nein, nicht folgt: pariert! Er glaubte allen Ernstes, dass er der tollste Mann in Grünwald, München, Bayern, Deutschland und Umgebung sei. Der „Herr Professor“, wie er sich gerne anreden ließ, obwohl er nie an einer Universität gelehrt hatte, und im Gegensatz zu mir – der ich gar keine, nicht mal eine gefälschte mein Eigen nannte – eine echte Doktorarbeit über irgendetwas total Unwichtiges geschrieben hatte, saß auf einem unglaublich hohen Thron. Das verwunderte mich nicht, war er doch eher – optisch betrachtet (und auch sonst?) – ein kleines Kerlchen …
Die asiatische Schönheit hatte mich in einen Salon geführt, der eher wie ein gut proportionierter und mit Kunst gefüllter Ausstellungsraum eines feinen Münchener Museums auf mich wirkte. Unwohnlich, aber es stank hier nach verdammt viel Kohle …
Ich erkannte einen Jeff Koons, einen Chagall und einen Gerhard Richter.
II
FORTKnox war gestern, ging es mir durch den Kopf, als ich das futuristische Foyer des ›Le Freeport‹ in Singapur betrat. Die Lasernetze, die das Gebäude von innen nach innen, von innen nach außen und von außen nach innen, von oben nach unten, von unten nach oben bewachten, waren Sekunden vorher ausgeschaltet worden. Meine beiden Begleiter schienen Experten für den Freeport zu sein. Jedenfalls waren wir drin, schneller als man sich eine Zigarette anzündet.
Passcode und Fingerabdruck-Scan.
Wow!
Der Singapur Freeport ist eine riesige Schatzkammer mit dicken Stahlwänden und -türen. Vibrationsdetektoren machen das Ganze selbst für Meisterdiebe praktisch unknackbar. Gehörten meine Begleiter zum Team des Freeports? Wie kommt ein Mann wie der ‚Schwebende‘ an diese Typen? Eine sicher sauwertvolle auf Hochglanz polierte riesige Stahlskulptur dominiert die beeindruckende Lobby. „Käfig ohne Grenzen“ nennt der Künstler die etwa 40 Meter lange und 30 Tonnen schwere Wabenstruktur, eine spiegelnde Schleife, die sich durch den ganzen Raum zieht. Dahinter verbirgt sich der schönste Tresor der Welt …
Man hatte mich erst vor wenigen Stunden kontaktiert. Folgmann hatte mir sein Apartment in Taipeh zur Verfügung gestellt. Er wollte jedes Aufsehen vermeiden und lehnte ein Hotel für mich ab. Zwei Männer standen vor meiner Tür im 8. Stock eines eleganten Wohnpalastes in Wenshan, der bevorzugten Wohngegend der Wohlhabenden in der Hauptstadt Taiwans, sagten nichts und doch alles. Ich zog meinen Parka über, nahm meine – immer reisebereite – Segeltuchtasche im Vorübergehen im Flur des luxuriösen Apartments auf und ging mit ihnen.
Wortlos.
Die Motoren der Cessna Citation 750X liefen bereits, als wir – drei Männer in Schwarz – die Maschine, die auf dem internationalen Flughafen ›Taiwan Taoyuan‹ auf uns wartete, betraten. Fünf Stunden später – noch immer war zwischen den Männern und mir kein einziges Wort gefallen, nur Fotos gingen durch unsere Hände und die Asiaten warfen mir bedeutungsvolle Blicke zu – landeten wir auf dem ›Changi Airport‹ in Singapur. Eine ebenfalls schwarze Tesla-Limousine wartete an der Gangway. Man hatte es offensichtlich eilig. Ich warf mir meinen schmutzig-grünen Parka über die Schulter, die Reisetasche. Andere hätten bei 34° Lufttemperatur und 98 Prozent Luftfeuchtigkeit geschwitzt, aber mir machte das nichts aus. Das letzte halbe Jahr hatten wir, Anna, Fanny und ich, fast nur in den Tropen verbracht und uns zum Abschluss, damit wir uns wieder akklimatisieren konnten, auf Capri noch ein paar Tage in einem Wellness-Paradies gegönnt. Mein Body war fitter als der von Jessica Biel und Lucy Liu – okay, das sind tolle Frauen, mein Versehen, sorry –, ich meine Jake Gyllenhaal und Matthew McConaughey zusammen!
Noch immer unbeeindruckt saß ich im Fonds des lautlos agierenden Tesla. Es waren nur knapp 1.800 Meter bis zur 32 Changi North Crescent, denn der ›Le Freeport‹ steht in der Freihandelszone des Flughafens. Ein Hochsicherheitslager der Superlative für Kunst und Wertgegenstände jeglicher Art. Nachdem ich mich noch während des Fluges – in einer von Folgmann für mich gecharterten Maschine; man gönnt sich ja sonst nichts – von München nach Taipeh so gut es ging über meinen Auftraggeber und seine Vorlieben schlaugemacht hatte, ahnte ich schon in etwa, worum es sich bei seinem ominösen Auftrag handeln könnte. Allerdings war ich irritiert, dass er mir als Ziel der Reise Taipeh angab. Gab es dort ein Museum, eine Galerie von Weltrang, die ich nicht auf dem Schirm hatte?
Es konnte sich eigentlich nur um Kunst handeln. Die sammelte Folgmann wie blöd. Das war unter den Sammlern, die nicht auf ein Milliönchen mehr oder weniger achten müssen, weltweit bekannt.
Und nun das!
Mir kam es wieder in den Sinn: Vor etwa zwei Jahren hatte ich zufällig im österreichischen Fernsehen einen interessanten Bericht über die wenigen Freeports mit der Spezialisierung auf Einlagerungen in Richtung teurer Kunstartikel gesehen. Es sind weltweit nur ein paar Logistikanlagen, die eine fachgerechte Lagerung und Verwahrung von Kunstwerken jeder Art und anderen extrem wertvollen Objekten in hochmodernen, biometrisch gesicherten Räumen und Stahlkammern bieten. Das, was dahinter steckt, hatten sich die Erfinder der Freeports sehr clever ausgedacht. Für die Dauer der Nutzung eines ‚Lagers‘ in den Freeports fallen keine Mehrwertsteuer, keine Zollgebühren an. Zudem sind alle darin erbrachten Dienstleistungen steuerfrei. Die Kunstgegenstände werden an einem quasi neutralen Ort eingesperrt, aber nicht weggesperrt. Sie verstehen? Ominöse Firmen, die meist in Steueroasen angesiedelt sind, mieten ‚Lagerraum‘ an, die diese ominösen Firmen – also Briefkastenfirmen – dann an die eigentlichen Mieter untervermieten. Verträge, die keiner einsehen kann. Freeports dieser Gattung sind letztlich Museen im Niemandsland. Die Museumsbesucher? Anwälte, Treuhänder, Superreiche. Die Kunstwerke können in den Freeports komplett zoll- und steuerfrei gehandelt werden, aber auch an private und staatliche Museen weltweit ausgeliehen und ausgestellt werden, ohne dass die Eigentümer die steuer- und zolltechnischen Vorteile einbüßen. Genf, Singapur, Peking, London und Luxemburg. Da stehen die Dinger und ich nun mitten in einem. Wow!
Die Freeports sind aufregender als Schatzinseln und die tollsten Frauen der Welt zusammen.
Wenn man denn auf Kunst und Kohle steht.
In der Dokumentation im TV sagte der Professor, der das alles bis ins letzte Detail recherchiert hatte, dass diese Freeports die cleverste Erfindung seit der des Wagenrads, der Glühlampe und der einarmigen Banditen wären: Cargo Crime und organisierte Kriminalität – das sei die eigentliche Bedeutung derartiger Logistikzentren. Eben steuerfreie Luxusoasen für die Kunstschätze von Superreichen. So sicher wie Fort Knox. Hier lagern on top Gold, Diamanten, edle Weine. Alles anonym, versteht sich. Es gibt für die Nutzung der Safes in den Freeports ein Werk von Codes und Regelwerken. Kryptographie und Datensicherheit – das gewährleisten die IT-Gurus der Bluechip-Sammler, die in grauer Vorzeit mal ihr Vermögen als Investment-Banker gemacht hatten und nun im Handel von Kunst ihre Ultima Ratio sehen. Für Außenstehende und eventuelle Kontrolleure von Finanzbehörden undurchschaubar.
Das heutige Wirtschaftsleben wird von globalen Lieferketten geprägt. Waren werden weltweit gehandelt, transportiert und gelagert, täglich und rund um die Uhr, ohne Pause: Kunstwerke für Museen, Galerien, Auktionshäuser oder Sammler, Edelmetalle, Uhren, Schmuck, Diamanten, Dokumente und andere Luxuswaren. Sammler, Kunsthändler, doch mehr noch Investoren, Museen, Banken, Vermögensverwalter und Investmentfonds, nutzen die Freeports für ihre undurchsichtigen, um nicht zu sagen blitzblanksauberschmutzigen Geschäfte …
Was ich jetzt zu sehen bekam, war selbst für mich ein heftiger Anblick, so dass mir der Atem stockte und ich sehr, sehr tief durchatmen musste, ohne dass meine stillen Begleiter das bemerkten: Auf dem stark glänzenden, anthrazitfarbenen Marmorboden lag der mir – durch die während des Fluges gezeigten Fotos und das kurze Dossier – nun auch namentlich bekannte Anwalt. Dunkelblauer Maßanzug, Savile Row, London, hoch geknöpfte Weste, ehemals blütenweißes Hemd, orangefarbene Hermes-Seidenkrawatte, leicht gelockert, die Anzughose bis zu den Knöcheln heruntergezogen. Man hatte ihm einen angespitzten, circa dreißig Zentimeter dicken und etwa einen halben Meter langen Holzpfahl in den Hintern geschoben. Nein, deutlicher: mit einem Vorschlaghammer in den Arsch getrieben. Bis sein Becken zerplatzt war.
Peng.
Unfein.
Scheiße. Pisse, Blut, Knochensplitter und die Reste einer vermutlich ehemals blütenweißen Unterhose.
Ebenfalls von der Savile Row.
Ein Ritualmord.
Das macht die Camorra mit ihren schwulen Freunden. Also mit denen, die sie verraten. Die nennt man auf Sizilien „schwul“. Aber auch in feineren Kreisen in der Schweiz war das Pfählen in diesem Bereich des menschlichen Körpers ein Zeichen besonderer Liebe, wie auch die Japaner der Sub-Organisationen der Yakuza nicht abgeneigt waren und sind, ihren allerliebsten Feinden den besonderen Beweis ihrer Zuneigung auf diese Weise zuteilwerden zu lassen. Ich war damit zum ersten und – bis heute – einzigen Mal konfrontiert worden, als ich noch für das Münchener LKA arbeitete und wir einen Fall internationaler Kriminalität – Geldwäsche, was sonst – zu bearbeiten hatten. Undercover beobachtete ich über Monate einen Münchener Anwalt, der auffällig viele Kontakte zu einem Kollegen Abogado in Spanien hatte. Der war ein ganz übler Typ. Völlig unauffällig, zart, sanft, leise in seinem Auftreten, schütteres Haar, korrekte Manieren, überaus höflich und zuvorkommend. Ein Mensch, von dem man glaubte, dass der keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Für seinen Job angeblich angemessen, aber letztlich doch zu aufgedonnert gekleidet, um seriös zu sein. Manikürte Finger- und Fußnägel, schweres Parfüm und auf mich total durch den Wind und zerfahren, dauernervös und eigentlich unsicher wirkend. Dabei war er ein wahnsinnig raffinierter Geldverschieber. Kein Wunder: Gibraltar ist von Marbella, dem Hot-Spot der Schönen und manchmal auch wirklich Reichen, nicht weit entfernt. Briefkastenfirmen gibt es in Gibraltar mehr als Tauben, die ständig die Straßen vollkacken, und Berberaffen, die den Touristen die Handtaschen aus der Hand reißen, um Fressbares zu ergattern. Der spanische Jung-Abogado verstand sein Handwerk. Bis wir ihn eines Morgens in seinem Haus in Nueva Andalucia, einem eleganten Stadtteil von Marbella, fanden, meine spanischen Kollegen und ich. Herr Abogado hatte sich mit den Falschen angelegt. Albanische Mafia. Der Señor Abogado sah damals identisch aus wie der Herr im feinen Zwirn eines Londoner Maßschneiders …
Gefickt.
Eine Warnung. An wen? Für wen, gegen wen?
Mein Auftraggeber? War er …? Was lief da ab? Das Gespräch in München-Grünwald verlief schon recht merkwürdig.
Ja, er kam in den Salon geschwebt. Das Schweben war auch notwendig, denn rein körperlich betrachtet ist der Typ kaum etwas höher als mein guter Fanny. Ohne sein lächerliches, arrogantes Schweben wären Fanny und er sich glatt auf Augenhöhe begegnet.
Fast …
Fanny hatte ich bewusst mitgeschleppt, obwohl der gedanklich nicht ganz bei der Sache war … Lady Lola lockte laufend …
Seine Majestät, ‚Professor‘ Dr. Folgmann der Einzigartige, übersah den Kampfhund geflissentlich, obwohl …
»Fliegen Sie sofort, und ich meine sofort, nach Taipeh. Hier ist die Adresse, zu der Sie dort fahren. Warten Sie in der Wohnung. Sie werden abgeholt. Das organisiere ich alles. Ich muss wissen, und ich meine, ich muss wissen, was dort gelaufen ist! Man wird Ihnen die notwendigen Informationen zukommen lassen. Schätze, mit dem Vorschuss sind Sie zufrieden.«
Herablassend.
Selbst Fanny bemerkte das und ließ seinerseits seine Lefzen mindestens ebenso herablassend hängen und zudem einen feinen, nicht hörbaren Furz in dem Wohnmuseum stehen, als die nicht mal eine Minute dauernde Audienz durch das ängstliche Davonschweben des ‚Schwebenden‘ abrupt beendet wurde.
Angst vor Fanny oder vor der Sache, über die er mir nichts sagte?
Das war es dann mit meinem für mich unbefriedigenden Kurzbesuch beim König der deutschen Werbeagenturen.
Folgmann hatte den ersten Laden mit 22 Angestellten von seinem Vater übernommen und binnen weniger Jahre mit dem Geld seines Alten und viel Cleverness weitere 17 Agenturen dazugekauft. Seit einer Dekade war er der Größte der Werbeindustrie, zumindest weltweit in Deutschland. Und auch sonst kannte man ihn. Seine primitiven, aber durchaus die Massen ansprechenden Slogans waren Kult geworden und er zum Milliardär. Inzwischen arbeiteten über 7.000 Fuzzis der Sprüche und der optischen wie akustischen Verblendungen für ihn. Worldwide in Bavaria und angrenzenden Gemeinden auf verschiedenen Kontinenten.
Klar, nicht nur mit Werbung, auch mit dem Handel von Grundstücken und dem Ankauf und Verkauf von Kunst scheffelte Jacob Folgmann Geld. Mit einem prall gefüllten Portemonnaie lassen sich mittelmäßige Gemälde günstig erwerben und mit sensationellen Gewinnen an Neureiche in aller Welt verscherbeln. Man muss nur für einen wahnsinnigen Hype sorgen. Geht, wenn man, ja, wenn man ein paar clevere Werbestrategen hat, die den durchschnittlichen Künstler zur außergewöhnlichen und bahnbrechenden Kunstfigur seiner Epoche hochstilisieren. Dazu gekaufte Gutachter und Galerien, die einen Run auf das eigentlich mittelmäßige oder minderwertige Zeugs auslösen und die bemalten Leinwände in Holzrahmen zu wahren Ikonen der Kunst werden lassen. Kunst als reines Anlageobjekt. Dann kaufen neureiche Russen, noch neureichere Chinesen, Koreaner, Inder, immerreiche Drogenbarone und andere ahnungslose Parvenus ‚große Kunst‘. Mit zweifelhaft erworbenem Reichtum nun noch reicher werden … Kunst ist neben Drogen zu einem der lukrativsten Geschäfte geworden. Drei Professoren angesagter Kunstakademien, die etwas Geheimnisvolles in das Gemälde „Zum Hinteren Vorhang“ hineingeheimnissen, eine Expertise von den führenden Kunstexperten des alten Europas – gegen gute Kohle auf die Schnelle angefertigt, der arme Herr Professor Dr. Dr. Kunst möchte ja auch ein Stück vom großen Kuchen abhaben – und schon hat man ein paar Millionen verdient. Ein riesiger Markt, was man so hört und liest. Der Kunstmarkt. Und große Museen helfen dabei. Denn wenn sie den ‚Künstler‘ B.E. Schiss ausstellen, dann verdreifachen sich die aufgerufenen Preise unverzüglich. Offizieller Umsatz: um die 60 Milliarden Dollar pro Jahr. Nimmt man den Schwarzmarkt, oh, Pardon, den inoffiziellen dazu, kommen noch mal 140 Milliarden dazu. Der Kunstmarkt …
Also die Kunst, überwiegend aus Scheiße Gold zu machen.
Die neuen Alchemisten …
Das war mir bekannt … Und auch, dass Folgmann diesem Erfolgsprinzip mannhaft folgsam folgen sollte. Günstig kaufen, mit hohem Gewinn weiterverkaufen. Kapitalismus pur.
Ging es darum?
Gesagt hatte er mir nichts.
Armleuchter bleibt Armleuchter.
Während seine Empfangsschönheit meinen Kampfhund ganz lässig übersehen hatte, als ich des ‚Schwebenden‘ Villa betrat, verhielt er sich so wie die deutsche Mutti, als sie Putin im Kreml besuchte und der seinen zahmen Dackel ganz nonchalant neben ihr sitzen ließ: von Furcht und Ekel angewidert. Mutti. Und nun auch der ‚Schwebende‘? Vielleicht war deshalb sein Statement so kurz und für meine von mir geforderte Recherche unbefriedigend ausgefallen …
„Ich muss wissen, und ich meine, ich muss wissen!, was dort gelaufen ist!“
Dass ich scheinbar so gelassen vor der auf besondere Weise geschändeten Leiche stand, verdankte ich meinem unerbittlichen Trainingspensum während der letzten Monate. Härte war mein Programm. Meine über alles geliebte Anna hatte einen gestählten Körper verdient, kein lasches Ei, so wie mein Auftraggeber es definitiv war. Und da ›Le Freeport‹ über eine hervorragende Klimaanlage verfügte, bildete sich nicht einmal der Ansatz einer Schweißperle auf meiner Stirn. … Talkin’ ‘bout hard times / Lord those hard times / Who knows better than I? … (Sie sprechen über harte Zeiten / Gott, diese harten Zeiten / Wer weiß das besser als ich …?)
Ray Charles wollte sich mit „Hard Times“ in ein paar graue Zellen von mir eingraben.
Zu spät.
Sie waren längst da.
III
IN der Kanzlei von Duke Adam-Archie Ashtenholm III, Lowndes Place, im Herzen von London-Belgravia, war seit etwa einer Stunde kein Laut zu hören, obwohl die Teilhaber der gediegenen Anwaltsfirma alle in ihren Büros saßen. Nun ja, es waren nur drei – und die gehörten zur Familie des Duke:
Sein Bruder Earl Byron-Blake Ashtenholm,
Adam-Archies uneheliche Tochter Lady Abigail-Annabelle,
sein Neffe Baron Edward Landress, der eigentliche Fuchs in der Kanzlei.
Abgebrochenes Kunststudium, da er schon nach zwei Jahren studentischer Mühen bemerkte, dass er kein Talent zur Malerei hatte. Er wurde dank seines Titels Assistent in der Londoner Galerie Weiß&Weiß. Baron Landress, einer, der jeden Galeristen, jedes renommierte Auktionshaus, jedes Museum für die malerischen Künste im In- und Ausland in- und auswendig kannte.
Eine Anwaltsgehilfin oder Sekretärin konnte man in der verschwiegenen und letztlich in London kaum bekannten Kanzlei nicht finden. In speziellen Kreisen allerdings waren der Duke und sein kleines, familiäres Team sehr wohl bekannt. Wenn sie ein mit echtem Goldrand gefasstes Visitenkärtchen an Klienten gaben, dann stand da nichts weiter als der Name drauf. Der Rest waren Verschwiegenheit und Mundpropaganda. Es gab auch kein Schild an der Tür „Duke Ashtenholm Solicitors“ oder Ähnliches. Nur eine Klingel.
Und nun Stille in der Kanzlei, warum nur …
IV
EIN völlig anderes Bild bot sich in Sofia. Hier residierte Dragomir. Am Stadtrand der Hauptstadt, am Fuße des Witoscha-Gebirges, hatte er sich seinen Palast gebaut, nein, erbauen lassen. Neureich und genauso geschmacklos, wie sich die Reichen und ganz Reichen, die, die sich Adelige nannten und nennen und zumeist durch Mord und Totschlag, Betrug und Ausbeutung, klassisches oder modernes Sklaventum vor Jahrhunderten zu ihrem in der Regel unrechtmäßig erworbenen Reichtum gekommen waren und sich ihre protzigen Schlösser, besonders auffällig seit der Renaissance, hinsetzen ließen. Nein, der Palast von Dragomir war nicht ganz so groß wie Versailles mit seinen 1.800 Zimmern und Hunderten von Nebengemächern und auch nicht aus der Renaissance, aber mindestens ebenso geschmacklos wie Schloss Neuschwanstein.
Dragomir?? Ja, nichts als Dragomir. Der hatte es sogar durchgesetzt, dass in seinem Pass nur DRAGOMIR stand. In Großbuchstaben. Wie bitte? Das lag daran, behaupteten die, die ihn bewunderten, dass er mit dem derzeitigen Präsidenten des Landes zur Schule gegangen sei. Der hätte das einfach so bestimmt. Няма дискусия (keine Diskussion)! Sie gingen hinter vorgehaltener Hand sogar so weit, sagten das allerdings nur zu ihren allerbesten Freunden – also jedem, den sie kannten –, dass der der eigentliche Boss der zwielichtigen Geschäfte sei und Dragomir bei ihm abliefern müsse … Was halt so in den Kreisen der besseren schlechten Gesellschaft alles geredet wird, wenn der Tag lang ist und die Nächte noch länger …
Dragomir saß mit drei seiner Kumpels – es war inzwischen zwei Uhr nachts und es lagen sieben Flaschen Wodka, drei Literflaschen Cola und acht Flaschen Rakija, alle leer, auf dem fleckigen Boden – auf goldeingefassten Samtsesseln und sie spielten Black Jack. Der einst teure Teppich – ein Ghom mit geringer Florhöhe und besonders hoher Knotendichte von 600 mal 1760 Knoten pro Quadratzoll, für den Dragomir vor zwei Jahren mehr als eine halbe Million Dollar hingeblättert hatte – könnte Geschichten von Besäufnissen und Sexorgien erzählen, aber er hielt sich vornehm zurück, anders als die Typen, die auf ihm herumtrampelten.
Begonnen hatte der Abend, wie üblich, mit dem Antrinken mit bulgarischem Zwetschgen-Sliwowitz/Rakija aus der Gegend von Elena. Diesmal war der Anlass ein besonderer.
»Für die Seele des Verstorbenen«, eröffnete Dragomir mit seinen Kumpanen den Abend. Sie tranken einen kräftigen Schluck Rakija und tropften dann ein paar Tropfen des edlen Schnapses auf den Boden, den edlen Ghom.
Und ein anderer setzte fort: »Gott soll für ihn sorgen.«
Dann schütteten sie wieder ein paar Tropfen auf den Boden, also den feinen Perser-Teppich, so wie es bei Hochzeiten und Todesfällen in einigen slawischen Ländern üblich ist, und schütteten sich die nächsten 100 Gramm mit Hochprozentigem erst in die Gläser, dann auf Kommando in ihre Kehlen. Nach der ersten Stunde waren die vier eigentlich schon mehr als gut abgefüllt. Gesprochen wurde wenig, um nicht zu sagen gar nichts, außer »Für die Seele …«, dann: »für die See …«, dann: »… für…«, » … «.
Man war längst zu Wodka übergegangen und hatte nebenher auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn, Dragomir, mit dem Spielen begonnen. Der Jüngste fungierte als Croupier und gerade hatte Dragomir, wer sonst, einen Siebener-Drilling präsentiert. Anlass, eine neue Flasche zu öffnen und noch mal kräftig einen zu heben. Ansonsten wusste keiner der Spielfreunde Dragomirs, weshalb sie eigentlich Toasts ausgesprochen hatten, und schon gar nicht, wem sie galten. Das war auch unwichtig, solange genügend zu saufen im Haus war. Drago war der Boss. Punkt.
Um zwei Uhr zwei klingelte das Handy von Dragomir. Er registrierte es nicht mal mehr richtig, stierte vor sich hin und lallte etwas Unverständliches in sich hinein.
»Das ist dein Handy, Drago!«
»Scheiße, das ist deines, du Hurensohn!«
»Nein – deins!«
Er fischte es vom Tisch, aber es gelang ihm erst mit dem dritten Anlauf, es auch zu treffen, denn er sah mehr als drei iPhones zwischen den Karten liegen …
»Ja!?«, brüllte er in das goldene Smartphone.
»Er ist nun auch da, wo er hingehört. Genau so, wie es dein Auftrag war!«
»Fick dich!«
Wen er damit meinte, ließ er offen. Schmiss sein Handy zurück auf den Tisch, traf ihn nicht. Das smarte Handy landete im Kamin. Zwischen den noch glühenden Holzresten. Der Jüngste spielte Held. Versuchte es rauszufischen, vergebens. Seine Hand erfreute sich nur mäßig an den Brandblasen, das goldene Handy verglühte langsam aber sicher. Die idiotische Rettung, die nach hinten losging: Der Junge nahm eine Flasche Sliwowitz, wollte damit die Glut löschen. Die Glut missverstand das und schon kam wieder richtig Feuer auf!
Dragomir befahl:
»Mach die da auf!«
Seine linke Hand deutete auf eine silberne Vitrine, in der eine riesige Fünf-Liter-Flasche Ruinart Rosé Champagner stand. Seine glasigen Augen lagen angeblich auf denen des jungen Croupiers, aber das war ein Irrtum …
V
»KOMM, noch einmal solltest du mir jetzt den Hengst machen! Los, ich will mehr, dein Schweif weiß doch sonst immer, wie er mich beglücken kann!« Tanja wischte sich in dem überheizten Chalet – der Kamin glaubte wohl, es wären schon 15° Celsius, minus – die Schweißperlen mit dem neben ihr liegenden und ziemlich zerrissenen seidenen Nichts von der Stirn, bäumte sich noch einmal auf und forderte ihren Lover vielsagend auf, es ihr zu „besorgen“, wie sie sich – total langweilig und eher abturnend – bieder ausdrückte.
Fantasie war nicht ihre Stärke.
Wie auch.
Sonst hätte sie sich nicht auf den ‚Schwebenden‘ eingelassen. Denn der war Langeweile pur. Der kannte nur sich, blöde Werbesprüche, Bilder, Zahlen und Macht. Bewunderte sich ständig im Spiegel und ihm ging schon in Gedanken fast einer ab, wenn wieder etwas Tolles über ihn in irgendeiner Gazette zu lesen war. Minderwertigkeitskomplexe. Lag es an seiner Körpergröße oder an seiner fast nicht mehr vorhandenen Manneskraft? Ihr war das alles scheißegal. Sie verpulverte sein Pulver und ließ es sich mit regelmäßig neuen Hengsten gutgehen.
Der Aufgeforderte übersah ihre durchaus reizvolle Stellung. Er hatte nur Augen für die SMS, die er gerade erhalten hatte. Ein fieses Grinsen überflog sein Gesicht. Das konnte Tanja nicht sehen, weil er ihr seinen behaarten Rücken zugewandt hatte. Sie blickte voll Gier auf seinen muskulösen Oberkörper und das Tattoo. Eigentlich waren es fünf. Fünf Sterne, die sich vom linken Schulterblatt bis zum rechten zogen. Natürlich wusste die Stute nicht, was die fünf Sterne bei der italienischen, aber auch der russischen und anderen Zweigstellen der Mafia im ehemaligen Ostblock bedeuteten. Sie war aufgeregt, Five-Star-First-Fuck-Hotel, ging es ihr durch den Kopf. Kann man so sagen! Wenn er noch eine Nummer schafft, dann bekommt er von mir das Gütesiegel der Luxusklasse, los, mach schon, mein Hengst …
Der dachte nicht daran, wusste aber seit der SMS, dass sie ihrem Ziel wieder ein Stück näher gekommen waren. Das erfüllte den Hengst nun doch mit Wollust, die er an seiner Stute austobte. Wenn auch nur für Sekunden.
Abgang pur.
Denn er hatte noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen …
VI
DASS die beiden Bodyguards in Schwarz nichts sagten, ging mir allmählich auf den Keks. Alles, was ich hier sah, passte irgendwie nicht zusammen. Der ‚Schwebende‘ schickte mich „sofort“ nach Taipeh, von dort weiter nach Singapur. Das Dossier, das mir die beiden Stummen nach dem Besteigen der Maschine überreichten, bestätigte mich in meiner Annahme, dass mich der kleine Große mit irgendwelchen Kunsttransaktionen in Verbindung bringen wollte. Ominös, denn ich bin kein Experte dafür. Und jetzt, gerade im ›Le Freeport‹ angekommen, führte man mir die Leiche eines einst lebendigen Mannes vor, der nicht länger als ein, zwei Stunden tot sein konnte. Die Körperstarre hatte noch nicht eingesetzt. Fragen über Fragen:
– Wusste Folgmann, als er mich beauftragte, dass es hier eine Leiche geben wird? Seit unserem Zusammentreffen und meiner Ankunft im ›Le Freeport‹ waren rund vierzig Stunden vergangen!
– Wie kann ein Toter dort liegen, ohne dass man das im modernen Fort Knox, dem bestbewachten Tresor der Welt, nicht mitbekommt!? Millisekunden nach dem Ereignis hätten Hundertschaften von …
– Wo waren die Security-Leute des Freeports? Wer hat die Elektronik abgeschaltet. Es gab doch mindestens ein halbes Dutzend ausgeklügelter miteinander agierender Sicherheitssysteme?!
– Wie konnte der Mord also unbemerkt geblieben sein!?
– Die Tötung durch ‚Pfählen‘ war ein eindeutiger Ritualmord der Mafia! Welcher!? Es gibt unzählige mafiöse Gesellschaften auf der Erde! Mir war das Pfählen auf diese Art bisher nur von der albanischen Mafia bekannt!
– Wer wollte wem ein Zeichen geben?
– War das Zufall, dass wir hier den Toten fanden?
– Auch für die Schweigsamen neben mir!?
– Arbeiteten die nur für den ‚Schwebenden‘?
– Was wollte Folgmann wirklich von mir!?
Fragen über Fragen … Worauf hatte ich mich eingelassen? War meine Geldgier auch schon größer als mein Verstand? Doktor, du solltest höllisch aufpassen. Lass hier alles stehen und liegen, schnapp dir deine fünf Sachen und flieg wieder nach Hause. Gib dem Folgmann seine Kohle zurück und sag ihm ins Gesicht, dass er ein riesiges Arschloch ist! Anna und Fanny werden es dir danken.
…
»So, Freunde. Des Schweigens genug! Jetzt sollten wir mal eure Zungen lockern, was haltet ihr davon?«
Viel zu lange hatte ich mich auf das Spiel der beiden Asiaten eingelassen. Erstaunt blickten sie in zwei kleine, schwarze, übereinanderliegende Löcher meiner Derringer Double Tap. Das ist eine geniale flache, doppelschüssige Pistole im gewohnten Derringer-Style. Tatsächlich ist die Double Tap ein sehr leichtes Schießeisen. Sie besteht ganz aus Titanium, Kaliber 9 mm. Ich hatte die Waffe problemlos in meinem Gepäck mit nach Asien gebracht. Im Griffstück befinden sich zur Reserve zwei weitere Patronen, aber ich war mir sicher, dass ich die nicht brauchen würde. Reine Vorsichtsmaßnahme. Dachte ich noch bis vor wenigen Sekunden. Mit meiner Attacke hatte ich die beiden Profis – Angestellte des Freeports oder Folgmanns, der Mafia oder für wen auch immer sie arbeiten mochten – ins Schleudern gebracht. Sie starrten auf die kleine Derringer, als wäre sie ein schon schön funkelnder Rohdiamant, den sie gerne hätten. Klar, mit Teilen davon konnte ich dienen, auch wenn die Diamanten sich als Kugeln entpuppen würden – auf einen Toten mehr oder weniger kam es in dieser Situation auch nicht mehr an. Vermutlich würde in wenigen Minuten trotz des nicht automatisch ausgelösten Alarms die bestens ausgebildete und ihren Verstand benutzende Singapur-Police hier eintrudeln, mich festnehmen und dann hätte ich höchstens ein paar Wochen Zeit, mich auf die Vollstreckung des Todesurteils wegen Mordes an einem mir eigentlich unbekannten britischen Anwalt vorzubereiten.
Der eine Stumme, der Blonde mit dem kurzgeschorenen Irokesenschnitt, machte eine dumme Bewegung. Während ich meine Waffe auf seinen schwarzhaarigen Kollegen gerichtet hatte, ließ er sich blitzschnell auf die linke Seite fallen und rollte ab. Eine Bewegung, die jeder Profi sofort erkennt und richtig deutet. Während des Fallens zog er dabei eine SIG Sauer P320 X-FIVE und begann sofort auf mich zu schießen. Ich hatte mich mit einem Hechtsprung hinter einen Teil der übergroßen Metallskulptur gerettet. Bevor ich dort ankam, hatte sich rein versehentlich aus meiner Double Tap ein Schuss gelöst und dem Schwarzhaarigen ein unschönes Loch in seinen asiatischen Schädel gebohrt. Ich zählte. 18 oder 21 Schuss? Shit, die SIG hat zwei unterschiedliche Magazine! Ich hatte bei dem Blondschopf bessere Schießqualitäten erwartet. Als ich glaubte, sein Magazin wäre leer, kam ich leider zu früh aus meiner Deckung hervor. Verzählt. Die Skulptur bekam eine neue Gravur, ich einen Tinnitus – Metall auf Metall macht Lärm, wenn es nur Millimeter neben deinem Ohr mit hoher Geschwindigkeit einschlägt – und der Blonde mischte sein Blond mit Rot.
Mir war klar, dass ich nur sehr wenig Zeit haben würde, den Raum der Kunst zu verlassen. Wetten, dass mindestens einhundert Kameras die Szenerie, spätestens seit der erste Schuss fiel, eingefangen hatten? Automatismen, die einsetzen, selbst wenn die beiden Asiaten vor unserem Betreten des geheimnisvollen Raumes die Überwachung lahmgelegt haben sollten, was ohnehin für mich ein Mysterium war, das zu lösen ich nicht bereit war. Ich zerrte dem Blonden den Schlüssel des Tesla aus seiner Jacke und saß auch schon in dem E-Mobil. Die lautlose Power beförderte mich in wenigen Sekunden zu der Maschine. Den vor sich hindösenden Piloten überraschte ich mit den Worten:
»Los. Starten. Sofort. Holen Sie sich die Freigabe vom Tower!«
Er war folgsam und keine zwei Minuten später hatten wir die Starterlaubnis und rollten auf die Startbahn. Aus ungefähr 400 Meter Höhe konnte ich beim Überfliegen des Freeports viele blaue, sich in Kreisform bewegende Lichter erkennen. Es war höchste Zeit, Singapur den Rücken zu kehren …
VII
DER ‚Schwebende‘ stand unter der Dusche. Ungewöhnlich aber wahr: Die Dusche war ringsherum verspiegelt. Eigentlich hätte man Marmor erwarten dürfen, aber nein, Spiegel. Nanobeschichtet, so dass nicht mal ein einziger Wassertropfen die Chance hatte, für einige Augenblicke an den Spiegeln zu verweilen. Sie tropften einfach ab und der Duschende konnte sich während des Reinigungsvorgangs problemlos von Kopf bis Fuß bewundern. Das machte ihn glücklich. Sagen wir: fast. Denn eigentlich gab es da nicht viel zu bewundern. Nein, er war nicht fett und konnte sogar noch ohne Hilfsmittel auf seinen Schniedelwutz blicken. Aber was er dort sah, war nicht berauschend. Selbst Viagra hätte ihm nicht viel genützt, denn sein viel zu hoher Blutdruck ließ es nicht mal zu, dass er zu Hilfsmitteln dieser Art hätte greifen können. Klar, er war immer noch heiß auf frisches Blut, aber seine Gelüste in die Tat umsetzen – keine Chance. Er wusste das und es machte ihn wütend. Erst letztens, bei einer Feier in seiner edlen Stadtwohnung in Schwabing, zu der er jede Menge Models eingeladen hatte, fiel ihm eine Brünette auf. Höchstens zwanzig Jahre. Kleine, spitze, unter einem Hauch von Chiffon sich abzeichnende Brüste erregten seine Aufmerksamkeit. Er wäre sehr happy gewesen, wenn ER sich erregt hätte. Er machte sie an. Dumm wie seine Werbeslogans auch der Anmachspruch, der selbst die ziemlich dämlich blickende Kleiderständerin – gendermäßig korrekt? – nicht auf Hochtouren brachte. Nichts tat sich. Die Brünette drehte sich einfach weg. Sein Ego unterhalb des Bauchnabels konnte sich ebenfalls nur wegdrehen …
Verdrossen trocknete er sich ab, streifte den seidenen Bademantel über, als es klingelte.
Er griff sich das Handy, das auf dem Sideboard des Waschtisches lag.
Mein Job ist beendet! Keine Diskussion. Aus und vorbei. Sie sind ein riesiges Arschloch. Ich fliege sofort zurück, bringe Ihnen Ihr mir großzügig überreichtes Honorar – wofür eigentlich? – wieder vorbei und das war’s. Auftrag erledigt. Die beiden Typen, die Sie mir an die Seite gestellt hatten, können Sie ebenfalls auf Dauer vergessen! Und natürlich den, den ich beschatten sollte.«
Folgmann erkannte die Stimme des Doktors. Aber bevor er etwas erwidern konnte, hatte der schon aufgelegt. Der schwebende in Seide gehüllte Milliardär hyperventilierte. Es war kurz nach sieben Uhr morgens, er musste zu einem wichtigen Termin nach Frankfurt fliegen, seine Frau Tanja war mal wieder verschollen. Angeblich wollte sie gestern mit einer seiner Privatmaschinen zu einer Freundin nach Hamburg fliegen. Rolando Villazón sang dort an der Oper den „Alfredo“ in Verdis „La Traviata“. Ja, sie war geflogen, aber mit dem Heli und er ahnte, dass sie in ihrem Chalet in Davos auf Vögeltour war. Nichts mit Oper. Die und Oper! Dass ich nicht lache! Ich weiß doch, wo sie ist. Mein schönes Chalet! Davos! Wo ich regelmäßig einmal im Jahr die Größen dieser Welt treffe, weil ich selbst ein Großer bin. Respektiert unter meinesgleichen. Und nun immer wieder das! Einem meiner Piloten musste ich eine hohe Abfindung zahlen und ihn feuern! Ich glaube, der hat es ihr auch besorgt und als sie seiner überdrüssig war, hat er sie an mich verpetzt!
Eigentlich war das dem ‚Schwebenden‘ egal, denn er schaffte es ohnehin nicht mehr, ihr weitere Kinder zu machen. Das selten stattgefundene Ereignis der Befruchtung lag Jahre zurück und sie war damals noch jung und knackig und er im Vollbesitz seiner Manneskraft. Immerhin hatte er es geschafft, ihr zwei Kinder zu machen, die einst sein Erbe antreten würden. Dennoch erschütterten ihre ‚Opernbesuche‘ immer wieder sein unermesslich großes Ego.