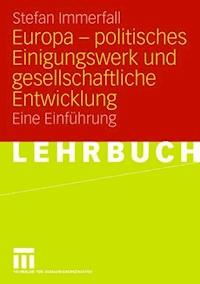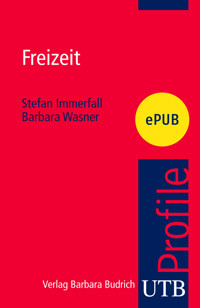
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: utb Profile
- Sprache: Deutsch
Freizeit prägt viele Lebensbereiche und spielt auch in zeitgenössischen Analysen eine immer bedeutendere Rolle. Die AutorInnen Stefan Immerfall und Barbara Wasner ermöglichen einen strukturierten Zugang zu diesem vielfältigen Themenfeld. Historische Entwicklungen oder die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung von Freizeit werden ebenso behandelt wie ihre Erlebnisqualität oder ihr Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
UTB 3446
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar Verlag Barbara Budrich · Opladen · Farmington Hills facultas.wuv · Wien Wilhelm Fink · München A. Francke Verlag · Tübingen und Basel Haupt Verlag · Bern · Stuttgart · Wien Julius Klinkhardt Verlagsbuchhandlung · Bad Heilbrunn Mohr Siebeck · Tübingen Nomos Verlagsgesellschaft · Baden-Baden Orell Füssli Verlag · Zürich Ernst Reinhardt Verlag · München · Basel Ferdinand Schöningh · Paderborn · München · Wien · Zürich Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart UVK Verlagsgesellschaft · Konstanz, mit UVK/Lucius · München Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen · Oakville vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Stefan Immerfall, Prof. Dr., Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Fachbereich Soziologie/Politikwissenschaft
Barbara Wasner, PD Dr., Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Fachbereich Soziologie/Politikwissenschaft
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detailliertere bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
© 2011 Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills www.budrich-verlag.de
ISBN: 978-3-8252-3446-1
ISBN 978-3-846-33446-1 (E-Book)
E-Book 978-3-8385-3446-6
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ausserhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Reihenkonzept und Umschlagentwurf: Alexandra Brand Umschlagumsetzung: Atelier Reichert, Stuttgart Satz: Susanne Albrecht-Rosenkranz, Leverkusen, [email protected]
Hinweis zur Zitierfähigkeit
Diese EPUB-Ausgabe ist zitierfähig. Um dies zu erreichen, ist jeweils der Beginn und das Ende jeder Seite gekennzeichnet. Bei Wörtern, die von einer zur nächsten Seite getrennt wurden, steht die Seitenzahl hinter dem im EPUB zusammengeschriebenen Wort.
Inhaltsverzeichnis
TitelImpressumHinweis zur ZitierfähigkeitWarum Freizeit?Freizeit im Profil
1 - Was ist Freizeit?
Das Problem mit der FreizeitFreizeit: „Produkt“ individueller SinnzuschreibungGrundprobleme der Freizeit- und TourismusforschungFreizeit – theoretische GrundpositionenFreizeit – gesellschaftliche EbenenLiteraturInternet
2 - Wie hat sich Freizeit entwickelt?
Einige geschichtliche AnmerkungenDer Aufstieg des MassenkonsumsLiteratur
3 - Wie ist Freizeit verteilt?
Theorien sozialer UngleichheitDie feinen Unterschiede (P. Bourdieu 1987)
Exkurs: Der Habitusbegriff bei Pierre Bourdieu
Soziale Milieus als Determinanten des FreizeitverhaltensGeschlecht als Determinante des FreizeitverhaltensAlter als Determinante des Freizeitverhaltens
JugendlicheSenioren
LiteraturInternet
4 - Wie wird Freizeit erlebt?
Freizeitqualität und ErlebnisparadoxDie ErlebnisgesellschaftLiteraturInternet
5 - Ausgewählte Bereiche des Freizeiterlebens: Sport und Tourismus
TourismusTheoretische AnsätzeDas Reiseverhalten der DeutschenSportTheoretische AnsätzeLiteraturInternet
6 - Aktuelle Entwicklungen
Individualisierung vs. StandardisierungNeue MedienFreizeit – Arbeit – Auflösung der GrenzenHeimwerkenEhrenamtLiteraturInternet
7 - Wirtschaftliche Effekte von Freizeit und Tourismus
FreizeitinfrastrukturFreizeitwirtschaftMikroökonomische EffekteMakroökonomische EffekteRegionale ökonomische EffekteLiteraturInternet
8 - Zukunft der Freizeit
Freizeitwissenschaft als Zukunftsforschung?WohlstandDemographieMedienFreizeitwissenschaft – gegenwärtiger Stellenwert, künftige HerausforderungenLiteratur
Serviceteil
Bachelor-Studiengänge in DeutschlandMaster-Studiengänge in Deutschland
Literatur
Auf Freizeit spezialisierte Zeitschriften:Forschungsinstitute im Bereich Freizeit und Tourismus:
PersonenregisterSachregister
Warum Freizeit?
Freizeit ist – jeder weiß es aus eigener Erfahrung – ein weites Feld. Zudem ist die Freizeitwissenschaft ein Forschungsgebiet, das sehr stark von anwendungsbezogener empirischer Forschung dominiert wird. Man könnte den geneigten Leser mit ZDF – Zahlen, Daten und vermeintlichen Fakten – geradezu „erschlagen“. Genau dies beabsichtigt dieses Buch nicht. Es sollen vielmehr Grundorientierungen gegeben werden, die es ermöglichen, die vielen Studien und Untersuchungen, Daten und Zahlen im Kontext zu verstehen. Insbesondere für Studierende in den verschiedenen Studiengängen des Freizeit-, Kultur- und Tourismusmanagement soll dieses Buch zur Einführung dienen. Es soll einen raschen Überblick über die Grundfragen der Freizeitwissenschaft und -soziologie bieten.
Im Rahmen einer kompakten Einführung1 erfordert dies natürlich eine radikale Begrenzung des Stoffes. Bei der Auswahl standen daher zwei Aspekte im Vordergrund: Zentralität und Aktualität.
Zentralität bedeutet, dass die bedeutsamsten Bereiche und Entwicklungen der Freizeit ausgewählt wurden. Eine Reihe – zweifellos interessanter – Studien wurden nicht berücksichtigt, weil sie zu spezifische Aspekte des Freizeitverhaltens behandeln. Beispielsweise findet sich kaum etwas zur sozialökologischen Freizeitforschung oder zu Erlebnis- und Konsumwelten.
Aktualität bezieht sich auf neuere Entwicklungen der Freizeit. Eine der prägenden Entwicklungen unserer Zeit ist der demographische Wandel, der zu einer zunehmenden Alterung der Gesellschaft führt. Diese Entwicklungstendenz wird in den verschiedenen Kapiteln des Buches immer wieder aufgegriffen. Ein wichtiger Trend ist auch die Entwicklung der Informationsgesellschaft und der entsprechenden Medien. Deren Bedeutung für die Freizeitgestaltung wird in einem eigenen Kapitel dargelegt.
Aktualität und Zentralität können in einem Widerspruch stehen. Die in den 90er Jahren mit großem Interesse aufgenommenen soziologischen Studien über die Rave- und Technokultur zum Beispiel sind
inzwischen für die Freizeitforschung nur noch von geringem Interesse. Auch wenn durch die Tragödie von Duisburg ein anderer Eindruck entstanden sein mag: Raves sind inzwischen kein Massenphänomen mehr, sondern nur noch Freizeitunterhaltung für eine sehr eingeschränkte Gruppe von Techno-Anhängern.
Jedes Kapitel enthält Hinweise auf vertiefende Literatur oder ausgewählte Links, durch die sich umfangreiche Datenbestände erschließen lassen. Im „Service-Teil“ im Anhang des Buches findet sich eine Liste von Forschungsinstituten, die sich mit Fragestellungen der Freizeitwissenschaft auseinandersetzen. Des Weiteren sind Studiengänge im Bereich der Freizeitwissenschaft aufgelistet. Für einen Hinweis auf eventuelle Auslassungen – oder sonstige Fingerzeige und Anmerkungen – sind die Autoren stets dankbar.
|8◄ ►9|
Freizeit im Profil
1
Was ist Freizeit?
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den „Problemen“ der Freizeit und jenen der Beschäftigung mit ihr. Zunächst wird die Begriffsbedeutung geklärt und der Stand der aktuellen Freizeit- und Tourismusforschung skizziert. Dabei wird die oft fehlende theoretische Fundierung als Hauptproblem deutlich. Deshalb werden in diesem Kapitel ausgewählte theoretische Grundpositionen dargelegt und die maßgeblichen gesellschaftlichen Bezugsebenen der Freizeit erläutert.
Das Problem mit der Freizeit
Freizeit ist die frei zur Verfügung stehende Zeit des Menschen. In der Freizeit haben wir keine Verpflichtungen, jedenfalls keine von außen auferlegten. Kein Wunder, dass sie mit vielerlei Erwartung verbunden ist, namentlich die einer befriedigenden Erfahrung. Wie also kann Freizeit zum „Problem“ werden?
Die Möglichkeit von Freizeit setzt voraus, dass die physischen und ökonomischen Notwendigkeiten gestillt sind. Erstere verweisen auf Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen oder Sexualität, letztere auf das Erfordernis, dass durch eigener oder fremder Hände Arbeit Nahrung, Kleidung und Wohnraum verfügbar sind. Freizeit wird daher gerne als Zeit, in der nicht (erwerbsmäßig) gearbeitet wird, definiert. Opaschowski (1996: 85-90) bezeichnet dies als „negativen Freizeitbegriff“. Dem steht ein „positiver Freizeitbegriff“ gegenüber, der Freizeit als selbstbestimmte Zeit betrachtet. So betrachtet bliebe die frei verfügbare Zeit stets eine knappe Ressource, da mit der Verkürzung der Erwerbsarbeit auch die Ansprüche an die Freizeit steigen (Müller-Wichmann 1985).
|9◄ ►10|
Beide Bestimmungen, der positive wie der negative Freizeitbegriff, können aber nicht befriedigen: Zum einen bietet Freizeit nur die Chance zur Selbstverwirklichung; ob, in welchem Ausmaß und unter welchen Umständen Menschen diese Chance ergreifen (können), ist eine empirische Frage. Genau deshalb kann Freizeit als „soziales Problem“ gesehen werden. Zum anderen darf arbeitsfreie Zeit nicht umstandslos mit frei verfügbarer Zeit gleichgesetzt werden. Opaschowski (2008: 34) ergänzt denn auch diese beiden Bereiche um die so genannte Obligationszeit. Obligationszeit ist weder Freizeit, da zweckgebunden, noch Arbeit. Zu den Beschäftigungen in der Obligationszeit zählen Haushalts- und Reparaturarbeiten, Einkäufe und Konsumentscheidungen, Behördengänge, Erledigungen und Besorgungen, familiäre und soziale Verpflichtungen, gemeinnützige Tätigkeiten und Freiwilligenarbeit.
Freizeit: „Produkt“ individueller Sinnzuschreibung
Betrachtet man diese Liste genauer, wird rasch klar, dass nicht jede Konsumentscheidung oder familiäre Verpflichtungen von allen als Pflicht außerhalb der Freizeit betrachtet wird. Für manche Menschen ist es nachgerade die erfüllendste Freizeitbeschäftigung überhaupt, Konsumentscheidungen zu treffen. Die gängige Bezeichnung für diese Freizeitbeschäftigung ist „Shoppen“. Ein anderes Beispiel für die Bedeutung der individuellen Sinnzuschreibung verschiedener Tätigkeiten zeigt sich beim Heimwerken. Diese Tätigkeit wird man dem Bereich der Haushalts- und Reparaturarbeiten zuordnen. Die zunehmende Bedeutung von „Do-it-yourself“ wird häufig auf gestiegene Handwerkerlöhne zurückgeführt (vgl. Opaschowski 2008: 55). Selber machen dient unter dieser Perspektive vor allem der Kostenersparnis. Dennoch kann die Heimwerkertätigkeit nicht ausschließlich unter dem Aspekt „time is money“ betrachtet werden. Denn die Tätigkeit spart nicht nur Geld, sondern ermöglicht auch das Ausleben von Kreativität und dem Empfinden, etwas Sinnvolles zu tun. Wie Anne Honer (1994) eindrucksvoll darstellt, ist Heimwerken vor allem dann eine beliebte Freizeitbeschäftigung, wenn man nicht vorhandene Schäden repariert, sondern wenn man die eigene Lebenswelt verschönert, besser gestaltet usw. Insofern dient das Heimwerken auch der sozialen Distinktion (zeigen, dass man außergewöhnliche Fähigkeiten hat, dass man seine Wohnung/sein Haus eigenwillig gestaltet, nicht wie andere „von der Stange“ lebt).
|10◄ ►11|
Zunehmend wird auch der Arbeitsbegriff auf verschiedenste Lebensbereiche ausgeweitet. Das allmähliche Abhandenkommen der klaren Grenzziehung zwischen Arbeit und Freizeit hat sich bereits in der Alltagssprache und -wahrnehmung manifestiert. So muss man nach einem Verlust „Trauerarbeit“ leisten, Zusammenleben erfordert ständige „Beziehungsarbeit“ usw. In den vergangenen Jahren bestimmte deshalb das Konzept der „Work-Life-Balance“ die Diskussion um die Freizeit. Dieser Begriff bezieht sich nicht nur im engeren Sinne auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern ganz allgemein auf die Verteilung von „Arbeitszeit“ und „Lebenszeit“.
Als zentrale Aspekte einer gelungenen Work-Life-Balance gelten: ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeits-, Familien- und Freizeitleben, das Wohlfühlen am Arbeitsplatz sowie Spaß am Beruf und außerhalb der Arbeit. Um diese Ziele zu erreichen, wird von vielen auch ein Verzicht auf einen Teil des Einkommens in Kauf genommen. Möglichkeiten, eine bessere Balance zwischen Arbeits- und Lebenszeit zu erreichen, sind Teilzeitarbeitsverhältnisse, Auszeiten (wie z. B. das sogenannte Sabbatical) oder flexible Arbeitszeitregelungen. Verbunden ist damit fast immer das so genannte „Downshifting“, also das „Herunterfahren“ von materiellen Ansprüchen. Auch diese Diskussion spiegelt das Aufweichen der Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit wider.
Somit lässt sich ein erstes Zwischenfazit ziehen: Was als Freizeit empfunden wird, hängt von der Erlebnisqualität des Freizeithandelns ab. Darauf werden wir wiederholt zurückkommen. Zunächst wenden wir uns aber weiteren wissenschaftlichen Zugängen zu.
Grundprobleme der Freizeit- und Tourismusforschung
Schon die bisherigen Hinweise unterstreichen, wie sehr Freizeit gesellschaftlich gerahmt ist. Dies wird in der aktuellen Freizeit- und Tourismusforschung nicht immer deutlich. Zwar stützt sie sich überwiegend auf empirische Forschungsergebnisse, doch werden die Daten überwiegend ohne Theoriebezug erhoben. Die Ursache für dieses Defizit besteht nicht darin, dass kein theoretischer Konsens gefunden werden könnte. Sie liegt vielmehr in der atheoretischen Zugangsweise überwiegend betriebswirtschaftlicher Provenienz. Freizeit- und Tourismus„analysen“ sind häufig Auftragsforschungen für die Anbieter von Freizeit- und Tourismusinfrastrukturen. Detailforschung steht somit im Vordergrund, |11◄ ►12|die Vergleichbarkeit von Ergebnissen ist aufgrund der fehlenden theoretischen Bezüge nicht gegeben.
Beispiel
Reiseanalyse
In ihrer Präsentation der Reiseanalyse gibt die FUR (Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e. V.) an, eine neutrale Interessensgemeinschaft der in- und ausländischen Nutzer von Tourismusforschung in Deutschland zu sein. Als Nutzer werden ein breites Spektrum von Unternehmen und Verbänden der Reisebranche, Spezialreiseveranstalter, Hotelketten, regionale, nationale und internationale Tourismusorganisationen, Ministerien und Verlage genannt. Dementsprechend ist auch das Fragenprogramm ausgerichtet. Es wird nach Reiseplänen, geplanten Reiseausgaben, Reisedauer, Anreiseverkehrsmitteln usw. gefragt.
Die Reiseanalyse wird alljährlich durchgeführt und Interessierten auf einschlägigen (Reise-)Messen präsentiert.
Die Ergebnisse sind für die Tourismusanbieter sicher insofern brauchbar, als dadurch Zielgruppen identifiziert und eine entsprechende Marketingplanung abgeleitet werden kann. Zur Entwicklung theoretischer Ansätze zur Erforschung des Tourismus kann sie jedoch nur wenig beitragen.
Aber auch die „offiziellen“ Statistiken, wie sie beispielsweise vom Statistischen Bundesamt oder den Landesämtern zur Verfügung gestellt werden, weisen zahlreiche Probleme auf. Im Hinblick auf die Reiseintensität innerhalb Deutschlands ist festzustellen, dass die Übernachtungszahlen nur in Betrieben mit mehr als neun Betten erfasst werden. Die Vielzahl kleinerer Betriebe wird damit nicht berücksichtigt. Damit wird eine Selektivität in Kauf genommen, die systematisch verzerrend wirkt: Diese Betriebe decken ein spezifisches Spektrum touristischer Angebote ab, z. B. den „Urlaub auf dem Bauernhof“. Diese Formen des touristischen Angebots bleiben damit unberücksichtigt und können in ihrer Quantität und Bedeutung nicht erfasst werden.
Das Problem fehlender theoretischer Bezüge gilt z. B. auch für die Zeitbudgetstudien, die vom Bundesamt für Statistik durchgeführt werden (in den Jahren 1991/92 und 2001/02). Dabei werden mit mehreren aufeinander abgestimmten Erhebungsinstrumenten (Haushaltsfragebogen, Personenfragebogen, Tagebücher) die Zeitaktivitäten der im Haushalt lebenden Personen ermittelt. Es ergibt sich jedoch eine Differenz|12◄ ►13|zwischen dem Anteil an Freizeit, der sich aus solchen Zeitbudgetstudien ergibt und der subjektiv geschätzten Dauer der Freizeit (Lüdtke 2001). Offenbar werden in den entsprechenden Zeitbudgetuntersuchungen auch solche Tätigkeiten zur Freizeit gerechnet, die subjektiv nicht als Freizeit gewertet werden. Hier treten wohl wiederum die oben geschilderten Probleme der Zurechnung auf.
Betrachtet man die britische und amerikanische Literatur zu „leisure studies“, so zeigt sich ein etwas anderes Bild. Hier wird Freizeit vor allem kultursoziologisch betrachtet. Die britische LSA (Leisure Studies Association) definiert sich selbst als multidisziplinäres Forum für Freizeitforscher. Dadurch wird Freizeit stärker mit anderen Aspekten des sozialen Lebens verknüpft als das gegenwärtig in Deutschland der Fall ist.
Freizeit – theoretische Grundpositionen
Wie Freizeit jeweils definiert wird, hängt selbstverständlich auch davon ab, in welchem theoretischen oder fachlichen Rahmen sie untersucht wird. Dabei ist festzustellen, dass die Freizeitwissenschaften ein zwar mittlerweile schon mehr als fünfzig Jahre alter, aber theoretisch noch immer wenig aufeinander aufbauender Forschungsbereich sind. Dies mag mit der Vielfalt der Zugänge zusammenhängen, die aus Soziologie, Psychologie, Anthropologie, Ökonomie, Politikwissenschaft, Geschichte, Geographie oder Kulturwissenschaft kommen (Freericks/Hartmann/ Stecker 2010; Rojak 2010: Vol. II). Zwar wird die interdisziplinäre Auseinandersetzung dem Gegenstand Freizeit als einem zentralen Lebensbereich mit vielfältig sich überschneidenden Handlungsfeldern gerecht; sie macht aber einen kumulativen Erkenntnisgewinn nicht leichter.
Die meisten Untersuchungen sind mikrosoziologischer bzw. sozialpsychologischer Provenienz, entwickeln aber nur selten entsprechende theoretische Konzeptionen. Betrachtet man in diesem Sinne Freizeit eher handlungsorientiert, kann sie begriffen werden als Summe der Handlungen, die in dieser Zeit durchgeführt werden. Dabei zeigt sich, dass sich der Stellenwert bestimmter Tätigkeiten im Laufe der Zeit verändert. So wurde beispielsweise früher Kochen oder Heimwerken als „notwendiges Übel“ erachtet, inzwischen haben diese Tätigkeiten eine Aufwertung erfahren; sie wurden zu einem medial überhöhten Lifestyle-Element, das auch im Fernsehen beste Quoten erzielt.
Betrachtet man Freizeit in funktionalistischer Perspektive, zeigen sich verschiedene Ansätze: Lange Zeit wurde die Funktion der Freizeit |13◄ ►14|(in Marx’ Tradition) als Zeit der Regeneration gesehen. Die Funktion der Freizeit bestand darin, die Arbeitskraft wiederherzustellen. Bereits in den 1920er Jahren wurden aber in den USA schon Arbeitszeitverkürzungen ökonomisch, nämlich mit der volkswirtschaftlich positiven Wirkung steigender Konsumausgaben begründet (Hunnicutt 2010: 291).