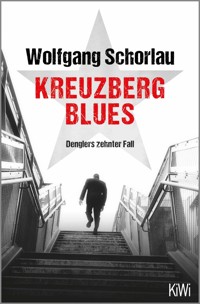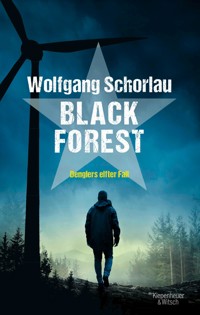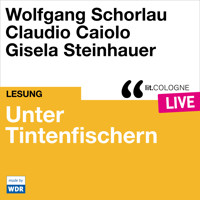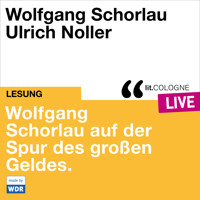9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Dengler ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
In seinem dritten Fall geht es für den Privatermittler Georg Dingler hinter die Kulissen der Macht: Tod im Bundestag. Georg Dengler ermittelt für die Familie der verstorbenen Abgeordneten und befindet sich plötzlich selbst in Gefahr. Es geht um Wasser – und um die Macht im Land. Angelika Schöllkopf erleidet am Rednerpult des Deutschen Bundestages einen Schwächeanfall. Sie stirbt vor laufender Kamera, bevor sie ihre Rede beginnen kann. Zwei Tage lang dominieren die Bilder ihres Todes die Medien, dann vergisst die Öffentlichkeit den Vorfall. Nur ihre Familie glaubt nicht an den plötzlichen Herztod. Sie beauftragt den Privatermittler Georg Dengler mit Nachforschungen. Dengler macht stutzig, dass das Manuskript der geplanten Rede verschwunden ist, und plötzlich befindet er sich inmitten eines globalen Machtkampfes großer Energiekonzerne. »Fremde Wasser« ist der dritte Band der erfolgreichen Georg-Dengler-Serie. Wieder begegnen wir dem trinkfesten Stuttgarter Privatermittler Georg Dengler, seiner schönen Nachbarin, der Diebin Olga, dem Freund und Horoskopschreiber Martin Klein und dem Künstler Mario, der diesmal einen gefährlichen Nebenjob annimmt. Wolfgang Schorlau hat die Methoden, mit denen sich deutsche und internationale Konzerne überall auf der Welt den Zugriff auf Wasserrechte sichern, intensiv recherchiert. Plötzlich befinden sich deutsche Städte im Fadenkreuz der Konzerninteressen. Schorlau blickt hinter die Kulissen der parlamentarischen Demokratie und zeigt, wie Politik wirklich gemacht wird – ein weiterhin brisanter und hochaktueller politischer Krimi zur Klimakrise und drohenden Wasserknappheit. Alle Fälle von Georg Dengler: - Die blaue Liste - Das dunkle Schweigen - Fremde Wasser - Brennende Kälte - Das München-Komplott - Die letzte Flucht - Am zwölften Tag - Die schützende Hand - Der große Plan - Kreuzberg Blues - Black ForestDie Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Ähnliche
Wolfgang Schorlau
Fremde Wasser
Denglers dritter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Wolfgang Schorlau
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Wolfgang Schorlau
Wolfgang Schorlau lebt und arbeitet als freier Autor in Stuttgart. Neben den acht »Dengler«-Krimis »Die blaue Liste« (KiWi 870), »Das dunkle Schweigen« (KiWi 918), »Fremde Wasser« (KiWi 964), »Brennende Kälte« (KiWi 1026), »Das München-Komplott« (KiWi 1114), »Die letzte Flucht« (KiWi 1239), »Am zwölften Tag« (KiWi 1337) und »Die schützende Hand« hat er die Romane »Sommer am Bosporus« (KiWi 844) und »Rebellen« (KiWi 1399) veröffentlicht und den Band »Stuttgart 21. Die Argumente« (KiWi 1212) herausgegeben. 2006 wurde er mit dem Deutschen Krimipreis und 2012 mit dem Stuttgarter Krimipreis ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die Abgeordnete Angelika Schöllkopf stirbt vor laufenden Kameras am Rednerpult des Bundestages. Doch ihre Großmutter glaubt nicht an einen natürlichen Tod. Sie beauftragt Georg Dengler mit den Ermittlungen. Und plötzlich befindet sich der Privatdetektiv inmitten des globalen Kampfes um das wichtigste Lebensmittel: Wasser.
»Wasser wird bei künftigen Verteilungskriegen eine zentrale Rolle spielen. Schorlau hat das in seinem brisanten Politthriller höchst spannend thematisiert.« Hamburger Abendblatt
»Einer der intelligentesten und authentischsten Politthriller, den die deutsche Autorenschaft derzeit zu bieten hat.« Stuttgarter Zeitung
»Als ziemlich regelmäßiger Krimileser habe ich selten einen so rundum hervorragenden deutschen Krimi gelesen.« Rezzo Schlauch, Parl. Staatssekretär a.D.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Prolog
Erster Teil
Ein neuer Auftrag
Videosequenz bellgard1.mpg
Hauptversammlung
Antonius
Stefan C. Crommschröder
G-G’
Bausachen
Videosequenz bellgard2.mpg
Schlechte Laune
Noch einige Informationen
Heidelberg
15 Prozent
Paradiesvogel
Nachrufe
Videosequenz bellgard3.mpg
Olgas Blässe
Blues
Kalter Wind
Bruder und Schwester
Londoner Wasser
Kieler Wasser
Gerne mit Damen
Legenden
Durchbruch in einem minder schweren Fall
Auf der Fahrt
Zweiter Teil
Berlin, Charité
Hamburger Wasser
Der Witwer
Videosequenz bellgard4.mpg
Auf dem Flur
Münsteraner Wasser
Es ist die Wahrheit
Routineermittlungen
Wasserschlacht
Noch einmal Berlin
Kälte
Spurensuche
Anruf vom BKA
Videosequenz bellgard5.mpg
Angriff
Unruhige Nacht
Berliner Wasser
Dritter Teil
Nummern
Verbindungen
Es ist nicht belanglos
Der IMSI-Catcher
Schlechte Nachrichten
Abgefangen
Die Suche geht weiter
Irene
Verdammt müde
Das 20-Milliarden-Euro-Spiel
Schlagzeilen
Panik
Nachfassen
Telefonate
Im Präsidium
Videosequenz Bellgard6.mpg
Olga stellt etwas an
Vernehmung
Risotto
Verlorene Schlacht
Gescheitert
Videosequenz 7
Epilog
Anhang
Nachwort
Leseprobe »Black Forest«
Meinen Freiburger Freunden:
Murmel, Löpf, Otel, Detsch und allen anderen
Höchste Güte ist wie das Wasser.
Des Wassers Güte ist es,
allen Wesen zu nützen ohne Streit.
Laotse
Prolog
Berlin, Reichstag, März 2006
In diesem Jahr wollte es nicht Frühling werden.
Angelika Schöllkopf, Bundestagsabgeordnete der konservativen Regierungspartei, saß missmutig an ihrem Schreibtisch und sah dem Regen zu, der gegen das Fenster trommelte. Draußen rüttelte der Wind an den Verstrebungen der Jalousien, als wolle er das Parlament stürmen.
Ihr ging es nicht gut.
Seit dem Aufstehen quälte sie ein schmerzhafter Druck im Brustkorb. Ein Gefühl der Enge machte ihr Angst. Sie schob beides auf die Rede, die sie in einer halben Stunde im Plenum halten würde. Es war nicht ihre erste Bundestagsrede, aber ihre wichtigste. Sie war beunruhigt. Ihr Blick suchte den Bildschirm, der oben auf dem Bücherregal aus dunklem Kirschholz stand. Das Parlamentsfernsehen übertrug die laufende Debatte. Den Ton hatte sie abgedreht, und das Bild zeigte einen liberalen Kollegen, der wie ein fetter Barsch stumm den Mund öffnete und wieder schloss. Dann streifte die Kamera durch die leeren Reihen. Viel Publikum würde sie nicht haben. Sie sah den Fraktionsvorsitzenden, der mit sturem Blick in Akten blätterte und so tat, als höre er der Rede des Abgeordneten der Opposition nicht zu.
Rituale, dachte sie. Sie geben Sicherheit.
Der Druck in ihrer Brust wurde heftiger. Ihr war, als läge im Inneren ihres Bustkorbes ein Gummireifen, der langsam aufgeblasen wurde und nach außen drängte. Eine Panikattacke erfasste sie, doch sie zwang sich zur Ruhe. Sie atmete heftig, aber das Gefühl, jemand drehe ihr langsam, aber systematisch die Luft ab, steigerte sich.
Das Telefon klingelte. Sie wollte nicht abnehmen, dachte dann aber, es könne der Fraktionsgeschäftsführer sein, der sie zu ihrem Auftritt im Plenum rief.
Sie nahm den Hörer ab.
»Schöllkopf.«
Am anderen Ende der Leitung meldete sich niemand. Sie hörte Straßengeräusche.
»Hallo?«
»Spreche ich mit Angelika Schöllkopf, der Abgeordneten?«, fragte eine Männerstimme.
»Ja.«
Die Verbindung brach ab.
Sicher ein Journalist, dachte sie. Ein ausgedehnter Schmerz bohrte sich in ihre Schulterblätter.
Mit der Rechten musste sie sich aufstützen, als sie aufstand, um zu dem Waschbecken am anderen Ende ihres Büros zu gehen. Sie betrachtete ihr Gesicht im Spiegel. Blass und fahl. Sie griff zu ihrer Schminktasche. Legte Concealer, Puder und Rouge auf. Es strengte sie an. Aber nun sah sie besser aus. Das Telefon klingelte erneut.
Sie nahm ab.
»Ich komme«, sagte sie.
Noch ein Blick zum Fernseher. Eine Abgeordnete der Grünen sprach schnell und hob nun die Hände mit einer pathetischen Geste, als stände sie vor Tausenden auf dem Marktplatz und nicht vor einem fast leeren Plenarsaal. Die übliche Methode, interessante Fernsehbilder zu erzeugen, die es dann bis in die Tagesschau schaffen.
Niemand erwartete etwas Besonderes. Heute war Freitag, die Sitzungswoche ging zu Ende, und viele Abgeordnete waren schon abgereist. Über alle Gesetze, die heute verabschiedet wurden, war bereits in den Ausschüssen abgestimmt worden. Parlamentarische Alltagsarbeit. Nichts Aufregendes. Auf der Regierungsbank saß nur der Akten lesende Innenminister und in den hinteren Bänken drei oder vier Staatssekretäre.
Sie verzog ihr Gesicht zu einem Lächeln, aber es wirkte gequält. Der Reifen in ihrer Brust dehnte sich weiter.
Langsam einatmen. Tief durch die Nase einatmen.
Ihr Bauch hob sich. Sie machte alles genau so, wie der Yogalehrer es ihr beigebracht hatte.
Ausatmen. Langsam ausatmen. Durch den Mund. Augen schließen.
Noch ehe ihre Lungen die verbrauchte Luft ausgestoßen hatten, wusste sie, dass ihr das bewusste Atmen nicht helfen würde. Sie konnte sich nicht konzentrieren. Das Herz. Es schlug mit wuchtigem Trommeln gegen die Brust. Sie hatte Angst.
Gottserbärmliche Angst.
Es wird Zeit.
Ob das Make-up halten wird?
Sie straffte sich, nahm die beiden Blätter, auf denen sie ihre Rede notiert hatte, und verließ das Büro.
Mit dem Aufzug fuhr die Abgeordnete Angelika Schöllkopf in die Halle des Paul-Löbe-Hauses. Heute hatte sie kein Auge für die Schönheit der Halle, die Eleganz des Gebäudes, die jeden Besucher die Größe des umbauten Raumes vergessen ließ. Vor einem der zylinderförmigen Ausschussräume ließ sie sich in einen der schwarzen Ledersessel sinken und ruhte sich für einen kurzen Moment aus. Der Kollege Keetenheuve von der anderen Partei kam ihr entgegen, ins Gespräch vertieft mit Korodin vom eigenen Lager. Keetenheuve winkte ihr zu. Sie verzog das Gesicht. Es sollte freundlich wirken, aber sie wusste nicht, ob ihr das gelang. Sie mochte Keetenheuve.
Auch so ein aussterbender Dinosaurier, schade, dass wir nicht mehr von seiner Sorte haben.
Die rote Lampe an der Deckenuhr leuchtete jäh auf. Die Abgeordneten wurden zur Abstimmung gerufen. Mühsam stützte sie sich ab und stand wieder auf. Sie ging durch den Tunnel hinüber ins Herz des Bundestages. Sie beachtete nicht die sorgfältig freigelegten und restaurierten Inschriften der russischen Rotarmisten, mit denen sie sich an den Wänden des Reichstages verewigt hatten, als sie das Gebäude im Mai 1945 gestürmt hatten. Auf der Plenarsaalebene blieb sie noch einmal stehen. Sie hob die Hand zu einer Geste, als könne sie den Gummireifen in ihrer Brust abstreifen. Mit einem Mal wusste sie nicht mehr, ob ihre Kräfte reichen würden.
In ihrem Innern war nun ein Dröhnen, das alle äußeren Geräusche übertönte: das Gespräch zweier Parlamentsmitarbeiter, die Stimme des Präsidenten, die aus dem Plenarsaal drang und mit der er nun den nächsten Tagesordnungspunkt aufrief, die soundsovielte Änderung des Gesetzes zur Beschränkung des Wettbewerbs, und die erregte Diskussion zweier Journalisten, die sich in den schwarzen Ledercouchs der Lobby fläzten.
Sie betrat den Plenarsaal durch den Osteingang. Vorbei an den fünf weißen Stehkabinen, die bei Wahlen aufgestellt werden und die sie immer an Beichtstühle erinnerten.
»Geht es Ihnen nicht gut, Frau Schöllkopf?«, fragte Korf, der alte Saaldiener, der so verknittert aussah, als habe er schon Adenauer die Türen aufgehalten.
Mir geht es beschissen.
Einen Augenblick nur blieb sie stehen, berührte kurz den Arm des alten Mannes im schwarzen Frack.
»Geht schon, Korf, geht schon. Muss ja.«
»Ich rufe den Tagesordnungspunkt 16 auf. Neuregelung des Paragraphen 103 a, alte Fassung des Gesetzes zur Beschränkung des Wettbewerbs. Das Wort erteile ich der Kollegin Schöllkopf«, sagte der Präsident.
Einige der Abgeordneten drehten sich um. Sie sah die gerunzelte Stirn des Fraktionsvorsitzenden. Seine Missbilligung schlug ihr entgegen. Er mochte sie nicht.
Gleich wirst du mich noch weniger mögen.
Sie ging nun zwischen den leeren Stühlen der Abgeordneten hinunter.
Kopf hoch.
Nur in den ersten drei Reihen des Plenums saßen Abgeordnete. Sie sah mäßig neugierige Blicke.
»Wie siehst du denn wieder aus?«, zischte ihr ein Kollege aus der eigenen Fraktion zu.
Der Reifen ist voll aufgeblasen. Er drückt von innen gegen ihren Brustkorb, und sie muss um jeden Atemzug kämpfen. Eine eiserne Faust presst sich in ihr Kreuz, eine eiserne Faust mit Nägeln gespickt, ein Morgenstern. Der Druck erfüllt nun ihren ganzen Oberkörper und die Arme. Noch nie in ihrem Leben hat sie eine solche Angst gehabt.
Ihr Herz schlägt, als wolle es durch Brust und Hals ins Freie.
Jetzt hat sie die Fläche vor dem Rednerpult erreicht. Sie sieht das Gesicht des Bundestagspräsidenten, und es kommt ihr vor, als habe er es zu einer höhnischen Fratze verzogen.
Sie geht noch drei Schritte, dann lässt sie die beiden Blätter ihrer Rede fallen.
»Frau Kollegin, ist Ihnen nicht gut?« Sie hört die Stimme des Präsidenten wie aus weiter Ferne.
Der Saal ist so groß.
Verwundert dreht sie sich um. Das weiße Licht, das durch die Kuppel fällt, erschien ihr noch nie so hell. Und die Paukenschläge! Merkwürdig. Noch nie hat sie diese wuchtigen Paukenschläge im Plenarsaal gehört.
Im gleichen Rhythmus wie mein Herzschlag.
Sie merkt nicht, wie sie langsam zusammensinkt. Sie hört nicht, wie der Präsident nach einem Arzt ruft. Sie hört nicht den gehässigen Kommentar eines Kollegen, da habe wieder mal jemand zu viel gesoffen.
»Die Sitzung ist unterbrochen«, ist der letzte Satz, den sie hört. Sie denkt noch: Es stimmt nicht, es gibt keinen rückwärtslaufenden Lebensfilm. Die Enttäuschung darüber ist die letzte ihres Lebens.
Dann ist es vorbei.
Erster Teil
Ein neuer Auftrag
Das Foto zeigte seine Frau auf dem Rücken liegend, die Augen geschlossen und den Mund geöffnet. Ihre Beine hatte sie gespreizt, sodass der Kerl im Anzug gerade dazwischenpasste, Hose und Unterhose nur so weit heruntergezogen, wie es notwendig war. Die Frau trug eine sommerliche Bluse. Der Rock war hochgerutscht, er lag wie ein Gürtel um ihre Taille. Man sah einen weißen Strumpfhalter auf der Haut ihres Oberschenkels.
Körner stieß ein Knurren aus, wie Georg Dengler es aus keiner menschlichen Kehle je gehört hatte und das eher zu einem angeschossenen Bären gepasst hätte als zu seinem Klienten.
Auf dem zweiten Foto, nur Sekunden nach dem ersten geschossen, streckte die Frau beide Beine in die Luft. Mit ihrem rechten Arm hielt sie den Mann im Anzug umschlungen, drückte ihn zu sich heran, ihre linke Hand ruhte auf seiner Schulter. Der Mann trug noch immer seinen Hut und weiße Boxershorts mit braunen Streifen.
Der Ton, den Körner nun ausstieß, klang nicht mehr nach einem Bären, sondern glich dem Fiepen eines zu Tode erschrockenen Welpen.
Auf dem dritten Bild saß das Paar auf der Wiese in einer kleinen Waldlichtung. Der Mann hatte ein Glas Rotwein in der Hand. Körners Frau stützte sich mit der rechten Hand auf dem Boden ab und sah ihn verträumt an.
Wieder fiepte Körner auf diese unmenschliche Art. Er steckte das Bild unter den Stapel mit den Fotografien, die er in der Hand hielt, und betrachtete die nächste Aufnahme.
Die Gesichtszüge des Mannes waren gut zu erkennen. Er trug noch immer seinen Hut, hatte jedoch den Krawattenknoten gelockert. Er kniete hinter Körners Frau und nahm sie von hinten. Sie sah genau in die Kamera, und ihr Gesicht vermittelte hoch konzentrierte Aufmerksamkeit, so als lausche sie einer Symphonie von Mahler.
Von Körner kam nun kein Geräusch mehr. Er betrachtete das Bild. Ließ es zu Boden fallen. Betrachtete das nächste. Dann das nächste. Und noch eins. Immer schneller arbeitete er sich durch den Stapel von Fotos, den Georg Dengler ihm gegeben hatte. Dann warf er sie in die Luft und drehte sich um. Er ging zum Fenster und starrte hinunter auf die Wagnerstraße. Zweimal schlug er mit der Faust gegen die Wand und griff in die Holzjalousie, die Georg Dengler erst am Mittwoch hatte anbringen lassen, zog daran und stieß erneut dieses Fiepen aus.
»Lassen Sie es gut sein, Körner«, sagte Dengler, »lassen Sie Ihre Wut nicht an meiner Jalousie aus.«
Er erhob sich von seinem Schreibtischstuhl und öffnete den Schrank hinter sich. Hier verwahrte er immer eine Flasche guten Cognacs – für Fälle wie diese. Mit zwei Gläsern in der Hand ging er zu Körner hinüber, dessen rechte Hand sich noch immer in der Jalousie vergraben hatte. Dengler stellte ein Glas ab und löste vorsichtig Körners Finger aus den Holzlamellen.
»Gran Canaria? Auf Gran Canaria war sie?«, fragte Körner, und Dengler nickte. Seine Frau hatte ihm gesagt, sie fahre für einige Tage zu ihrer Schwester nach Bochum. Körner atmete schwer. Dann tranken die beiden Männer.
Eine halbe Stunde später stieß Georg Dengler die Tür zum Basta auf. Er ging an der Bar vorbei und setzte sich an den Tisch am Fenster, an dem bereits sein Freund und Nachbar Martin Klein saß, der sich über einige bedruckte Blätter beugte und mit einem Kugelschreiber hin und wieder einzelne Textpassagen korrigierte.
»Na, wie hat dein Klient auf die amourösen Fotos seiner Frau reagiert?«, fragte Klein und sah Dengler über seine Brille hinweg an, die ihm auf der Nase ziemlich weit nach unten gerutscht war. Mit einer schnellen Bewegung schob er sie zurück.
»Er warf sie im Büro umher, schlug gegen die Wand und verkrallte sich dann in meine neuen Jalousien.«
»Hmm. Wie in einem Film …«
Klein runzelte die Stirn und schien nachzudenken.
Der kahlköpfige Kellner brachte Georg Dengler einen doppelten Espresso und stellte ein Glas mit warmer Milch daneben. Dengler dankte ihm mit einem Kopfnicken. Langsam schüttete er einen Schluck Milch in den Espresso und rührte um. Er überdachte noch einmal diesen Fall.
Sein Auftrag war erledigt. Punktgenau erledigt. Körner hatte seiner Frau nicht vertraut und wollte wissen, ob sie einen Liebhaber hatte. Nun wusste er es. Sie hatte ihrem Mann die Lügengeschichte des Besuchs bei der Schwester in Bochum erzählt, tatsächlich war sie aber auf Gran Canaria gewesen. Bereits auf dem Hinflug hatte neben ihr der Kerl gesessen, der beim Sex nicht einmal den Hut abnahm. Dengler hatte dieselbe Maschine genommen. Später waren die beiden so miteinander beschäftigt, dass sie Dengler nicht bemerkten, der aus 20 Meter Entfernung fotografierte. Er hatte seinen Job gut gemacht. Genau das in Erfahrung gebracht, was sein Klient wissen wollte. Mit Fotos dokumentiert. Er hätte mit sich zufrieden sein können. Doch stattdessen fühlte er sich leer.
Er trank einen Schluck Espresso. Der heiße Kaffee tat ihm gut. Doch die Niedergeschlagenheit verflog nicht. Er sah zu Klein hinüber, in der Hoffnung, der könne seine Trübsal verjagen. Doch Martin Klein beugte sich bereits wieder über seinen Text, überflog die Zeilen, und Dengler konnte sehen, wie die Augen seines Freundes an manchen Stellen verweilten. Der Kugelschreiber näherte sich dem Blatt Papier und strich hier ein Wort durch, fügte dort eine Ergänzung ein oder vermerkte am Rand geheimnisvolle Zeichen, die Dengler wie Hieroglyphen erschienen.
Plötzlich überkam Dengler eine Woge hässlichen Neids auf seinen Freund. Auch er würde gerne so selbstvergessen und konzentriert arbeiten, ohne die Selbstzweifel, die ihn immer öfter quälten.
Missmutig schaute er auf die Uhr.
Gleich kommt die nächste Klientin. Wieder Fotos, wieder zerbrechende Illusionen?
Er trank den Kaffee aus, stand auf, ließ den erstaunt aufblickenden Martin Klein ohne Gruß zurück, zahlte an der Bar und ging wieder in sein Büro im ersten Stock.
»Plong.«
Die alte Dame stieß den Stock auf den Boden.
»Bitte setzen Sie sich doch«, sagte Georg Dengler.
Sie sah ihn missbilligend an.
»Unterbrechen Sie mich nicht, junger Mann.«
Sie beäugte misstrauisch den Stuhl vor Denglers Schreibtisch, als prüfe sie, ob sie sich diesem alten Holzding anvertrauen könne.
Dengler wiederholte die Einladung mit einer Armbewegung.
Sie trug schwarze Handschuhe, sehr dünn und sehr vornehm. Vorsichtig fuhr sie mit dem Zeigefinger die Lehne entlang und hob dann die Fingerspitze gegen das Licht, das durch das Fenster in Denglers Büro fiel.
Jetzt bläst sie den Staub von ihrem Finger.
Sie tat es nicht. Der Stuhl schien den Test bestanden zu haben. Dengler seufzte. Sie setzte sich. Den dunkelbraunen, fast schwarz polierten und mit einer eisernen Spitze versehenen Gehstock stellte sie mit einer bedächtigen Bewegung zwischen ihre Beine und stützte sich mit beiden Händen darauf. Den Kopf hielt sie aufrecht. Zwei braune Augen musterten Georg Dengler, und darin stand etwas Nachsichtiges, gerade so, als hätte sie eben einem Lakaien Weisungen erteilt und sei sich nun nicht sicher, ob dieser ihre Wünsche auch vollständig begriffen habe.
»Bitte erzählen Sie mir Ihre Geschichte noch einmal der Reihe nach«, sagte Dengler und zog sein schwarzes Notizbuch aus der Innentasche seines Jacketts.
Die alte Frau holte tief Luft.
»Sie hatte kein schwaches Herz«, sagte sie schließlich, »niemand in unserer Familie hatte je ein schwaches Herz. Und Angelika auch nicht.«
Sie machte eine Pause und starrte ihn unverwandt an.
Dengler wartete. Die Spitze seines Füllers ruhte erwartungsvoll über dem Papier. Er wusste nicht, was er schreiben sollte. Da die Frau jedoch weiter schwieg, schrieb er: Kein schwaches Herz.
»Erzählen Sie der Reihe nach«, sagte er ruhig, und dann sah er, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten.
Videosequenz bellgard1.mpg
»… weiß nicht, woher der Kunde meine Telefonnummer hat, aber er hat sie, und er drohte mir, mich auffliegen zu lassen. Zum ersten Mal, seit ich diesen Job mache, werde ich bedroht. Wahrscheinlich ist Schumacher vom Verband die undichte Stelle. Den werde ich mir noch zur Brust nehmen.
Diese Aufnahmen hier sind meine Lebensversicherung. Ich werde sie versteckt ins Netz stellen. Sollte ich das Verzeichnis, in dem diese Videodateien gelagert sind, eine gewisse Zeit nicht aufrufen, wird der automatische Schutz aufgelöst, und die Videosequenzen werden öffentlich im Netz stehen, frei zugänglich für jedermann. Und da werden einige staunen, was aus dem Dr. Norbert Bellgard geworden ist, auf dem sie alle herumgehackt haben.
Also, ich heiße Dr. Norbert Bellgard, bin ehemaliger Kardiologe, bekannt durch den Herzklappenskandal, den die Spürhunde von der AOK angezettelt hatten und wegen dem ich meine Zulassung verlor. Ich erinnere mich noch gut, wie die Polizisten mich morgens um fünf aus dem Bett klingelten. So etwas vergisst man nicht so leicht. Ich hatte mir nichts vorzuwerfen. Ich habe mir bis heute nichts vorzuwerfen. Ich glaubte, die Herzklappen aus China seien genauso gut wie die deutschen. Ich dachte das wirklich. Reinen Herzens.
Wenn die Krankenkasse in aller Ruhe auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte: Dr. Bellgard, wir wissen, Sie verwenden die billigeren chinesischen Herzklappen. Sie vertreiben sie auch an andere Kollegen. Es gibt da gewisse Probleme, es gab drei Todesfälle, dann hätte ich doch mit mir reden lassen, ich wollte doch niemandem etwas zuleide tun. Dann hätte man das ausbügeln können, aber so … Gleich mit der Polizei eine Hausdurchsuchung, wie bei einem Terroristen?
Das war damals eine schwere Zeit für mich. Die Presse, Annette, die mich verließ, dazu das Gefühl, das Oberschwein der Nation zu sein, dabei, und das sag ich hier noch einmal, ahnte ich nicht, dass die chinesischen Dinger nicht so sauber arbeiten, ich meine, die kopieren doch sonst alles so sauber, die Chinesen, wieso dann nicht auch Herzklappen.
Hätte man damals mit mir geredet, in aller Ruhe, wäre alles wieder gut geworden, und eine Menge Leute würden heute noch leben.«
Hauptversammlung
Stefan C. Crommschröder kneift die Augen zusammen. Er wundert sich, dann steigt Ärger in ihm auf und schließlich – wieder einmal – Bewunderung. Woher nimmt sie den Mut, hier zu erscheinen? Und woher den Stolz, so aufrecht dazustehen?
Er hat sie lange nicht mehr gesehen. Ein Jahr? Zwei Jahre? Keine Ahnung. Zum Schluss einer der üblichen Kräche. Dann Funkstille. Er merkt nicht, dass er lächelt. Für einen Augenblick vergisst er die Kamera, die die Mitglieder des Vorstandes überlebensgroß auf die Leinwand hinter ihm zeichnet.
Dr. Landmann, der Aufsichtsratsvorsitzende, im ganzen Konzern gefürchtet wegen seines entsetzlichen Mundgeruchs, gibt ihr Mikro frei. Die Kameras fangen ihr Bild ein. Sie sieht gut aus.
»Meine Frage geht an Dr. Stefan Crommschröder«, sagt sie.
Natürlich. Das war zu erwarten.
Immerhin nennt sie ihn nicht Steff.
Alle Augen am Vorstandstisch richten sich auf ihn. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende schaut zu ihm. Crommschröder atmet langsam aus und blickt wieder auf das andere Ende der Halle. Er unterdrückt den Impuls, sich die Augen zu reiben. Aber es gibt keinen Zweifel. Die Frau, die dort vor dem Mikrophon steht, ist Karin. Seine Schwester.
»Herr Dr. Crommschröder«, sagt sie nun, und ihre Stimme klingt völlig ruhig und trotz der zahlreichen Lautsprecher nahezu vertraut. »Sagen Sie mir: Was ist das für ein Gefühl? Überall, wo Ihr Unternehmen tätig wird, sind die Menschen beunruhigt, sie schließen sich zu Bürgerinitiativen zusammen, es gibt Demonstrationen, und sie wehren sich gegen Ihre Firmenpolitik. Überall auf der Welt. Wie geht es Ihnen dabei?«
Crommschröder hasst sie im gleichen Augenblick. Er hasst dieses Argument. Es markiert ihn wie ein Brandzeichen. Joseph Waldner, der einzige Österreicher im Vorstand, bringt es bei jeder denkbaren Gelegenheit vor: Dr. Crommschröder ist sehr erfolgreich, aber er bringt die halbe Welt gegen uns auf. Unser Image leidet unter seinen Methoden.
Karin tritt nicht ab, wie die Fragesteller vor ihr, sondern sie bleibt vor dem Mikrophon stehen. Crommschröder kneift erneut die Augen zusammen, um sie auf der gegenüberliegenden Seite der Kongresshalle besser zu sehen.
Dr. Landmann schlägt mit der linken Hand auf den weißen Knopf, der ihr Saalmikrophon abschaltet. Crommschröder sieht, dass er wütend ist. Landmann nestelt an seinem Mikro. Er verabscheut die kritischen Kleinaktionäre, die auf Hauptversammlungen unbequeme Fragen stellen.
»Liebe Frau … Sie haben sich leider nicht vorgestellt«, sagt er, »unsere Geschäftsordnung sieht Fragen nach der Befindlichkeit der Vorstandsmitglieder nicht vor. Wir befinden uns hier auf einer Hauptversammlung und nicht in einer therapeutischen Veranstaltung. Die Herren sollen lediglich unseren Wohlstand mehren. Wenn sie sich dabei gut fühlen – umso besser.«
Crommschröder weiß nicht, was ihn reitet. Er steht auf und gibt Landmann ein Handzeichen. Er will reden. Vielleicht weiß er, dass sie sich von Landmann nicht so leicht abfertigen lassen wird. Mit einigen schnellen Schritten steht er am Rednerpult. Er wartet. Aus den Augenwinkeln erkennt er, dass die Kamera seine Gestalt eingefangen hat und auf die Leinwand hinter ihm projiziert. Er wartet noch einige Sekunden. Bis es still ist in der Halle. Er ist Profi. Er weiß, wie man sich ein Auditorium unterwirft. Er genießt es, dass auch seine Kollegen vom Vorstandstisch zu ihm herüberschauen. Dr. Kieslow, der Vorstandssprecher, sieht ihn nachdenklich an. Joseph Waldner, sein Konkurrent, der den Geschäftsbereich Energiewirtschaft führt, spielt mit einem Kugelschreiber. Soll er ruhig nervös werden, dieser Österreicher mit seinem Wiener Schmäh.
Nun herrscht gespannte Ruhe in der Halle. 3000 Aktionäre sehen aufmerksam zu ihm auf. Erst dann redet er.
»Liebe Aktionärin«, sagt Crommschröder, »meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Frage der verehrten Fragestellerin wurde eine Feststellung transportiert, der ich widersprechen muss. Die Geschäftstätigkeit des Geschäftsbereichs Wasser ist sehr erfolgreich. Obwohl wir das jüngste Kind in der Reihe der Geschäftsbereiche des VED-Konzerns sind. Gleichwohl gebe ich zu, dass es hin und wieder Missverständnisse und Sorgen in einigen Regionen gibt, in denen die Bevölkerung von den lokalen Behörden nicht ausreichend über die Verbesserungen der Wasserversorgung unterrichtet wird, die nach der Übernahme der Geschäfte durch die VED regelmäßig erfolgen. Wir haben deshalb eigens eine Task Force ins Leben gerufen, deren Aufgabe in nichts anderem besteht, als unsere Neukunden zu informieren. Vertrauensverhältnisse herzustellen. Eine sehr erfolgreiche Truppe, die …«
Er sieht, wie sich am anderen Ende der Halle ihr Arm hebt.
»Ja, bitte«, sagt er und kassiert den wütenden Blick von Landmann. Der gibt mit einer unwilligen Bewegung das Saalmikrophon frei.
»Gilt das auch für Cochabamba?«, fragt sie. Und jeder in der Halle kann es hören.
Crommschröder wird blass. Für eine Sekunde, nein, nur für den Bruchteil einer Sekunde verliert er die Fassung. Woher weiß sie von Cochabamba? Das Projekt hat die höchste Geheimhaltungsstufe im Konzern. Er sieht, dass Kieslow mit offenem Mund in die Kameras starrt, als habe er soeben einen debilen Anfall erlitten. Waldner lächelt still vor sich hin und spielt weiter mit seinem Kugelschreiber.
Das zahl ich dir heim, Schwesterherz, das zahle ich dir heim, denkt Crommschröder und gewinnt seine Fassung zurück.
»Das gilt selbstverständlich für den gesamten Geschäftsbereich Wasserwirtschaft«, sagt er und verlässt das Rednerpult. Beifall brandet auf.
»Die nächste Frage bitte«, hört er Dr. Landmann sagen, als er sich wieder setzt.
Er muss mit ihr reden.
Antonius
»Die alte Dame ist der festen Überzeugung, dass der Tod ihrer Enkelin keine natürliche Ursache hat«, sagte Georg Dengler.
Am frühen Nachmittag saßen Georg und Olga im Basta. Er hatte sich einen doppelten Espresso bestellt, sie nippte an ihrem schwarzen Tee und hörte ihm aufmerksam zu.
»Sie hat keinerlei Hinweise, die diese Überzeugung stützen – es ist nur eine Vermutung. Ihre Vermutung.«
Der Tod der Bundestagsabgeordneten Angelika Schöllkopf im Plenum des Bundestags hatte für einen Tag die Schlagzeilen beherrscht. Der Spiegel veröffentlichte eine zweiteilige Artikelserie über die Arbeitsbelastung von Abgeordneten, eine Idee, die der Stern dann aufgriff. Einige Fernsehmagazine folgten mit Sendungen über den Herzinfarkt, von dem immer mehr Menschen betroffen seien. Das war’s dann. Nun war der Tod von Angelika Schöllkopf kein Medienthema mehr.
Olga runzelte die Stirn: »Eine Vermutung?«
»Bestenfalls.«
»Wo wohnt sie?«
»In Berlin.«
»Berlin? Wie kommt sie dann auf dich?«
»Ich sei ihr empfohlen worden, hat sie gesagt. Sie hat hier in Stuttgart ein Zimmer genommen. Im Hotel Sauer.«
»Georg, endlich hast du mal einen spannenden Fall«, sagte Martin Klein, der sich zu ihnen gesetzt hatte.
»Vielleicht was für deinen Kriminalroman?«, fragte Olga etwas spöttisch.
»Jedenfalls spannender als all der Erbschaftskram, als untreue Ehefrauen und diese langweiligen Mietsachen.«
Georg Dengler betrachtete seinen Freund. Die weiß gewordenen Schnurrbarthaare standen ab und schienen zu vibrieren. Klein wirkte angespannt und nervös. Seine Finger bewegten sich an der Tischkante entlang, als spielten sie auf einem unsichtbaren Flügel eine komplizierte Sonate.
»Ich weiß noch nicht, ob ich den Fall annehmen werde«, sagte Dengler schließlich.
Klein verdrehte die Augen.
»Jetzt hast du mal einen interessanten Fall, und dann zögerst du?«
Er schüttelte den Kopf.
Martin Klein, sein Freund und Nachbar, mit dem er Tür an Tür wohnte, schrieb Horoskope für Tageszeitungen und für Frauenzeitschriften. Aufmunternde, kleine Horoskope für die Tageszeitungen, die meist wöchentlich erscheinenden Frauenzeitschriften räumten ihm ein paar Zeilen mehr ein.
Seltsam, dachte Dengler, ich habe Martin nie gefragt, ob er an Astrologie glaubt. Ohne dass die beiden Freunde je darüber gesprochen hatten, ging Dengler stillschweigend davon aus, dass Martin Klein nichts von Horoskopen und Astrologie hielt. Es passte einfach nicht zu ihm. Er wirkte aufgeklärt und vernünftig, eher der Wissenschaft zugeneigt als der Esoterik. Aber sicher bin ich nicht, dachte Dengler. Obwohl ich Martin täglich sehe, weiß ich doch wenig über ihn.
Vor einigen Jahren, als er seinen ersten Fall bearbeitete, war Denglers Büro und Wohnung heimlich durchsucht worden. Damals verdächtigte er Martin zu Unrecht, der unbekannte Schnüffler gewesen zu sein. Das tut mir heute noch leid, dachte er. Er hatte Klein seinerzeit überprüft und herausgefunden, dass dieser zwei Kriminalromane veröffentlicht hatte. Leider machte der Verlag bald nach Erscheinen des zweiten Krimis Pleite, und beide Bücher waren nicht mehr lieferbar. Später, als sie Freunde wurden, erzählte ihm Klein, dass er fast alle seine Ersparnisse in diese beiden Romane gesteckt habe. Vier Jahre habe er an ihnen gearbeitet. Und da sei er froh gewesen, den Job mit den Horoskopen zu bekommen.
Doch Kleins heimliche Leidenschaft galt immer noch den Kriminalromanen. Einen Kriminalroman zu schreiben, sagte Klein einmal zu Dengler und Olga, sei das größte Glück auf Erden. Sich ein Verbrechen auszudenken, eine Geschichte zu konstruieren, Figuren zu erfinden … Dann das Schreiben selbst. Wenn man eine gute Szene geschrieben habe, sei dies das beste Gefühl, das er kenne. Nur mit Sex vergleichbar, fügte er schmunzelnd hinzu, aber daran könne er sich in seinem Alter nur noch unklar erinnern.
Hin und wieder zog Klein seinen Freund Georg damit auf, dass dessen Fälle für einen guten Krimi einfach nicht taugten. Und machte dabei immer die gleiche wegwerfende Handbewegung. Aber insgeheim, da war sich Dengler sicher, wartete Klein noch immer auf den ganz besonderen Fall, den er zu einem Kriminalroman verarbeiten konnte.
»Warum willst du den Fall nicht annehmen?«, fragte Olga.
Georg Dengler blickte zu Olga, die ihn anlächelte.
Diese Frau ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist.
Seit seinem letzten größeren Fall waren sie ein Paar. Trotzdem gab es Themen, über die er nichts wusste und über die sie nicht sprach. Sie schwieg, sooft er sie auch fragte. Ihre Kindheit in Rumänien – er wusste, dass sie sehr arm und nicht bei ihren Eltern aufgewachsen war. Als Kind war ihr der Zeigefinger der rechten Hand gedehnt und gezogen worden, bis er genauso lang wie ihr Mittelfinger war. Gleich große Zeige- und Mittelfinger sind ein strategischer Vorteil, wenn man in die Jackett- und Hosentaschen anderer Leute greift.
Olga hat mir nie erzählt, wie lange sie in ihrer Kindheit als Diebin arbeiten musste. Sie hat mir auch nie, außer einer kurzen Bemerkung, von der Ehe erzählt, zu der sie als Mädchen gezwungen worden war.
Und doch hatte Olga diese schwierigen Jahre offenbar ohne Schäden hinter sich gebracht. Nur manchmal wälzte sie sich schwer im Schlaf. Dann legte Georg ihr eine Hand auf die Stirn, und sofort atmete sie wieder ruhig und gleichmäßig.
Olga lebte, so schien es Dengler, frei und unbeschwert. Sie kannte keine Finanzprobleme. Wenn ihr Geld knapp wurde, spazierte sie ein- oder zweimal durch die Lobby eines großen Hotels – und schon reichte es wieder für die nächsten Monate. Jetzt arbeitete sie nur auf eigene Rechnung. Den Leuten, denen ich Geld stehle, tut das nicht weh, sagte sie zu Georg. Mache dir keine Sorgen! Sie erzählte Dengler nie, wann sie loszog, manchmal verschwand sie für zwei oder drei Tage. Und nie wurde sie geschnappt.
Während Klein sich über den Einzug eines privaten Ermittlers in das Haus gefreut hatte, hatte Georgs Erscheinen die schöne Olga beunruhigt. Es dauerte lange, bis sie mit ihm überhaupt ein Wort sprach. Doch als sie merkte, dass er, der Expolizist, sie in Ruhe ließ, half sie ihm sogar. Seinen ersten Fall hätte er ohne sie nicht lösen können. Und bei seinem zweiten großen Fall war sie ständig an seiner Seite.
All das bedachte Dengler in Sekundenbruchteilen, bevor er ihr antwortete: »Es ist in diesem Fall äußerst schwierig, an die nötigen Informationen zu kommen, außerdem habe ich im Augenblick einiges zu tun.«
Das stimmte. Nach der harten Zeit, in der Dengler jeden Fall annehmen musste, um sich über Wasser zu halten, hatte sich die Auftragslage gebessert. Mittlerweile war sein Minus auf dem Konto geschmolzen, und nun hegte er die kühne Hoffnung, es könne sich in einigen Monaten sogar in ein Plus verwandeln.
»Wie würdest du denn vorgehen? Ich meine – nur mal angenommen, du nimmst den Auftrag an?«, fragte Klein.
»Die klassische Methode – Motiv, Tatwaffe, Tatort. An diesen drei Tatmerkmalen würde ich ansetzen, aber das ist in diesem Fall besonders schwierig.«
»Warum?«
»Es gibt keine Tatwaffe, keine erkennbare zumindest. Die Frau geht zum Rednerpult und will eine Rede halten. Dann erleidet sie eine Herzattacke und stirbt. Wenn man den Medien glauben darf: an Erschöpfung oder Überlastung. Also keine Tatwaffe, die mich zu einem Täter führen könnte. Keine sichtbare, jedenfalls. Auch die Leiche hilft mir nicht weiter.«
Er sah das fragende Gesicht Kleins.
»Sie ist schon beerdigt. Und den Tatort? Den dürfte ich nicht einmal betreten.«
»Warum nicht?«
»Den Plenarsaal des Bundestages dürfen nur Abgeordnete oder Saaldiener betreten, nicht einmal Angestellte des Bundestages dürfen hinein.«
»Woher weißt du das alles?«, fragte Olga.
»Wahrscheinlich hat er in Gemeinschaftskunde aufgepasst«, sagte Klein.
»Falsch«, sagte Dengler, »ich hab im Bundestag angerufen und mich erkundigt. Bevor ich einen Auftrag annehme oder ablehne, will ich die äußeren Umstände kennen. Mittlerweile dürften jedoch am Tatort, wenn man ihn denn überhaupt so nennen kann, keine Spuren mehr zu sehen sein. Das ist alles schon zwei Wochen her.«
Martin Klein machte sich hastig einige Notizen.
»Bleibt die Frage nach dem Motiv«, sagte er dann und zog mit dem Kugelschreiber eine Linie unter das bisher Geschriebene.
»Konnte die Großmutter einen Anhaltspunkt für ein Motiv liefern?«, fragte Olga.
»Nein. Konnte sie nicht. Ihr einziges Argument ist ein medizinisches: In ihrer Familie hatte noch nie jemand ein schwaches Herz. Ich habe ihr gesagt, dass in ihrer Familie wahrscheinlich auch noch niemand den Belastungen eines Abgeordnetenberufs ausgesetzt war.«
»Und?«
»Was und?«
»Was hat sie daraufhin gesagt?«
»Sie habe den Heiligen Antonius gebeten, dass er ihr helfe. Ich solle in seinem Namen der Sache nachgehen.«
»Den Heiligen Antonius?«
Martin Klein blickte perplex von seinen Aufzeichnungen auf.
»Ja, sie sprach vom Heiligen Antonius und dass sie zuvor eigens an einer Kirche vorbeigefahren sei, Geld gespendet und ihn um Unterstützung gebeten habe: Er solle den Privatermittler dazu bringen, den Tod ihrer Enkelin aufzuklären.«
»Sie lieferte also kein überzeugendes Mordmotiv?«
»Nein.«
»Ich möchte diese Frau kennenlernen«, sagte Olga plötzlich.
Dengler und Klein sahen sie erstaunt an.
Olga wandte den Blick zu Boden, so als schämte sie sich, und Dengler schien es, als errötete sie.
Dann sagte sie leise: »Der Heilige Antonius hat bei mir noch etwas gut – ich bin ihm noch etwas schuldig.«
Sie blickte auf und sah in die fragenden Gesichter der beiden Männer.
»In der schwierigsten Phase meines Lebens hat mich der Heilige Antonius begleitet und letztlich auch gerettet. Ohne ihn wäre ich tot. Ich möchte diese Frau kennenlernen, bitte!«
Sie sah Dengler offen und ernst an.
»Sicher. Ich rufe sie an«, sagte er.
Dann trank er seinen Espresso aus.
»Ich muss noch arbeiten«, sagte er und ging.
Auf dem Weg zur Treppe stellte er fest, dass seine schlechte Laune verflogen war.
Stefan C. Crommschröder
Stefan C. Crommschröder wird am 18. März 1960 in Stuttgart geboren, nur anderthalb Jahre nach seiner Schwester Karin. In dieser Stadt ist es für das weitere Fortkommen von Vorteil, an einem der Hänge zur Welt gekommen zu sein, und zumindest in dieser Hinsicht hat er Glück. Das Haus seiner Eltern steht in der Nähe des Bismarckturms, oben am Killesberg, in jener eleganten und mit einem Anflug von falscher Bescheidenheit als »Halbhöhe« benannten Wohngegend, dem Dach der Stadt, wie ein Liedermacher diese Gegend einmal genannt hat.
Die Ehe seiner Eltern ist, aus seiner heutigen Sicht, kaum mehr als die Vereinigung sechs großer Mietshäuser unten im Stuttgarter Kessel, deren Mieter bereits zum Zeitpunkt von Crommschröders Geburt dafür gesorgt hatten, dass die Familie ein beachtliches Vermögen auf der Bank hat. Zweimal im Jahr zieht seine Mutter den immer gleichen alten braunen Rock und eine unförmige Joppe aus derbem Stoff an, dazu bindet sie ein Kopftuch um. Dann inspiziert sie den familiären Immobilienbesitz im Westen. Das sind die einzigen Anlässe, bei denen sie nicht ihren Daimler aus der Garage holt, sondern mit der Straßenbahn in die Stadt fährt.
Jedes Mal kommt sie kopfschüttelnd zurück, klagt über die verantwortungslosen Mieter, die sie durch ihre Unachtsamkeit in den Ruin treiben und die die Gutmütigkeit der Familie schamlos ausnutzen würden. So prägt sich dem kleinen Stefan schon früh die Überzeugung ein, dass Mieter eine geheimnisvoll minderwertige und rücksichtslose Spezies von Menschen seien; Menschen, die seine Mutter abwechselnd »Zigeuner« oder »Gauner« nennt.
Bevor die Mutter jedoch zu ihrer Inspektionsreise ins unbekannte Mieterland aufbricht, schließt sie sich im zweiten Stock in dem kleinen Büro ein, in dem ein Schreibtisch aus Holz mit einer knatternden elektrischen Rechenmaschine steht. Dort erstellt sie auf dünnen Bögen mit Durchschlagpapier handschriftliche Listen für die Mieter, auf die sie mit klarer und großer Schrift »Nebenkosten« schreibt und auf denen sie mit einem hölzernen Lineal Tabellen zeichnet, in deren Spalten sie die Forderungen für Wasser-, Elektrizität-, Heizung-, Müll- und Verwaltungskosten einträgt.
In diesen Tagen bekommt das Gesicht seiner Mutter einen sonderbar spitzen Ausdruck, etwas Mausartiges und Verhuschtes, etwas, vor dem sich Stefan und Karin schon als Kinder fürchten. Sie dürfen die Mutter in diesen Tagen nicht stören, sie hören durch die verschlossene Tür das Rattern der Rechenmaschine und das pausenlose Schimpfen der Mutter über die Mieter, die ihr diese Arbeit nicht im Geringsten danken würden.
Erst nach ihrem Tode, als Crommschröder ihre Unterlagen sichtet und überprüft, stellt er fest, dass diese Abrechnungen fast nie stimmten, manchmal betrog sie die Mieter nur um einige Mark, oft waren die Abrechnungen jedoch doppelt so hoch wie die tatsächlichen Kosten. Auf diese Weise hatte seine Mutter beträchtliche Rücklagen gebildet.
Crommschröders Vater ist Beamter. Er arbeitet im Kultusministerium unten im Kessel, wird dann, als Stefan schon zwölf Jahre alt ist, ins Staatsministerium befördert. Über die konkrete Tätigkeit des Vaters können sich weder der Junge noch seine Schwester ein genaues Bild machen. Auch heute, nachdem sein Vater nun schon viele Jahre tot ist, weiß Crommschröder nichts über dessen genauen Aufgabenbereich.
Die Geburt der Tochter ist für den Vater eine große Enttäuschung. Umso größer sind die Erwartungen, die er in den nachgeborenen Sohn setzt.
Von den Erziehungsmaximen seines Vaters bleibt Crommschröder die wichtigste unvergessen: Immer besser sein als die anderen.
Wenn du immer besser bist als die anderen, kann dir im Leben nichts passieren.
In den unterschiedlichsten Variationen erfolgt diese Mahnung: In der Klasse muss für alle klar sein, dass du besser bist als dein Banknachbar.
Der Vater hat ein System von Belohnung und Bestrafung entwickelt, das nicht einfach gute Noten belohnt, wie das andere Väter tun. Belohnt wird Stefan nur, wenn seine Arbeiten besser sind als der Klassendurchschnitt. In den ersten beiden Jahren am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium ruft der Vater nach einer Klassenarbeit regelmäßig die Lehrer an, um die Durchschnittsnote zu erfahren. Stefan ist das peinlich, den Lehrern lästig. Sie schreiben schon bald in Stefans Heft nicht nur seine individuelle Note, sondern, um den väterlichen Anrufen zu entgehen, auch die Durchschnittsnote in Klammern dazu. Das ist sein Maß.
Hin und wieder erscheinen Freunde aus Vaters rotarischem Club zum Essen, ein Ereignis, das bei Mutter und Kindern gleichermaßen gefürchtet ist. An diesen Abenden muss alles besser sein, als es die Gäste erwarten: das Essen ausgefallener, der Wein edler, die Kerzen zahlreicher, die Tochter braver, der Sohn sauberer, die Mutter charmanter, aufmerksamer und liebevoller, die Wohnung exklusiver, die Zigarren teuerer, die Musik gedämpfter.
Am Tag danach führt der Hausherr die nicht minder gefürchtete »Manöverkritik« mit der Familie durch. Es hagelt Beurteilungen für Betragen von Frau und Kindern, Küche und Weinkeller (für den allein er zuständig ist und der daher immer erstklassig benotet wird).
Alles soziale Lernen vollzieht sich bei Stefan C. Crommschröder unter dem Druck der Konkurrenz. Das »Du musst besser sein als andere« ist die Erziehungsmaxime seiner Kindheit. Ohne Chance auf freie Wahl hat er schon mit zehn Jahren dieses Prinzip völlig verinnerlicht. Wo immer er in Zukunft auftreten wird, schaut er sich nach jemandem um, dem er beweisen muss, dass er der Bessere ist.
Gleichzeitig hat seine frühe Kindheit auch etwas Behütetes. Als Kind kann er sich nicht vorstellen, dass es Familien gibt, die keine zwei Daimler in der Garage stehen haben, oder dass es Mütter gibt, die dienstags nicht nach München fahren, um auf dem Viktualienmarkt einzukaufen. Dort oben auf der Halbhöhe, dem Killesberg, kennt man es nicht anders.
Karin, seine ältere Schwester, wird vom Vater allein deshalb weitgehend missachtet, weil sie ein Mädchen ist. Vom Verhalten der Tochter hat der Vater keine genaue Vorstellung. Das Weibliche irritiert ihn ohnehin mehr, als dass es ihn erfreut, und so genügt es, wenn Karin fröhlich, sauber und zurückhaltend erscheint – äußere Attitüden, die sie sich antrainiert, um dann von allen unbemerkt ihr eigenes Innenleben zu entdecken und zu formen und die Welt auch außerhalb der Halbhöhe zu erkunden.