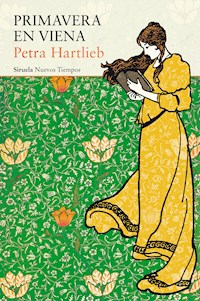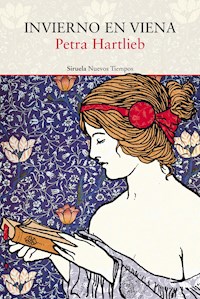14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Es ist Kommissarin Alma Oberkoflers erste Woche in Wien, und schon hat sie einen toten Politiker am Hals. Max Langwieser: jung, konservativ, aufstrebend, Minister und bester Freund des Kanzlers, hat sich den Schädel an seinem Designerglastisch aufgeschlagen. Der Fall sorgt für einiges Aufsehen und bereitet Alma Kopfschmerzen. Denn von der einzigen potenziellen Zeugin, seiner Verlobten Jessica, fehlt jede Spur. Die sitzt derweil in ihrem roten MINI-Cabriolet und weiß nur eins: Sie muss weg, weg, weg. Wie ihr Leben innerhalb weniger Tage derart dramatisch den Bach runtergehen konnte, weiß sie dagegen nicht. Warum sie in ihrer Panik Max’ Laptop eingesteckt hat, könnte sie im Nachhinein auch nicht mehr so genau sagen. Zum Glück hat sie oft genug Tatort geschaut, um zu wissen, wie man eine Zeit lang untertaucht. Vielleicht kommt sie ja doch noch lebend aus der Nummer raus. Unbestechlich gut: Petra Hartlieb blickt tief in die politische Seele Österreichs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Es ist Kommissarin Alma Oberkoflers erste Woche in Wien, und schon hat sie einen toten Politiker am Hals. Max Langwieser: jung, konservativ, aufstrebend, Minister und bester Freund des Kanzlers, hat sich den Schädel an seinem Designerglastisch aufgeschlagen. Der Fall sorgt für einiges Aufsehen und bereitet Alma Kopfschmerzen. Denn von der einzigen potenziellen Zeugin, seiner Verlobten Jessica, fehlt jede Spur.
Die sitzt derweil in ihrem roten MINI-Cabriolet und weiß nur eins: Sie muss weg, weg, weg. Wie ihr Leben innerhalb weniger Tage derart dramatisch den Bach runtergehen konnte, weiß sie dagegen nicht. Warum sie in ihrer Panik Max’ Laptop eingesteckt hat, könnte sie im Nachhinein auch nicht mehr so genau sagen. Zum Glück hat sie oft genug Tatort geschaut, um zu wissen, wie man eine Zeit lang untertaucht. Sie muss nur mal durchschnaufen. Vielleicht kommt sie dann ja doch noch lebend aus der Nummer raus.
Unbestechlich gut: Petra Hartlieb blickt tief in die politische Seele Österreichs.
© Pamela Rußmann
Petra Hartlieb wurde 1967 in München geboren und ist in Oberösterreich aufgewachsen. Sie studierte Psychologie und Geschichte und arbeitete danach als Pressereferentin sowie als Literaturkritikerin in Wien und Hamburg. 2004 übernahm sie eine Wiener Traditionsbuchhandlung. Davon erzählen ihre Bestseller ›Meine wundervolle Buchhandlung‹ (2014) und ›Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung‹ (2020). Bei DuMont erschienen außerdem ›Wenn es Frühling wird in Wien‹ (2018), ›Sommer in Wien‹ (2019) und ›Herbst in Wien‹ (2021).
Petra Hartlieb
Freunderlwirtschaft
Kriminalroman
Von Petra Hartlieb sind bei DuMont außerdem erschienen:
Meine wundervolle Buchhandlung
Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung
Wenn es Frühling wird in Wien
Sommer in Wien
Herbst in Wien
E-Book 2024
© 2024 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagmotiv: © Vasif Bagirov/iStockphoto
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1049-0
www.dumont-buchverlag.de
Die einzige Überlebende
Juni 1992, Linz
Alma wurde gegen neun Uhr wach, lag in ihrem Bett und horchte in die Stille, die über dem Haus lag. Kein Geräusch war zu hören, kein Klappern des Geschirrs, kein lautes Mozart-Violinkonzert, mit dem der Vater am Wochenende versuchte, die Töchter aus dem Bett zu scheuchen. Kein Geruch nach Kaffee und Toast, und als nach einer Viertelstunde noch immer niemand zum Frühstück rief, stellte Alma sich vor, ein schreckliches Unglück wäre über die Menschheit hereingebrochen, und sie wäre die einzige Überlebende auf Erden. Oder aber ihre Familie wäre entführt worden, und aus irgendeinem Grund hätte man sie vergessen, und sie konnte nun tun und lassen, was sie wollte, obwohl sie erst zwölf Jahre alt war. Alma liebte solche Tagträume. Was würde sie tun, wenn sie völlig ungestört wäre? Zunächst würde sie zwei Weißbrotscheiben dick mit Nougatcreme bestreichen und sich damit vor den Fernseher setzen. Keiner würde sich über Krümel oder Schokoflecken auf dem Sofa beschweren, ihr Vater würde keinen Vortrag über Karies halten, und sie könnte stundenlang im Schlafanzug vor der Glotze sitzen. Aber nein, das war kindisch, wäre sie wirklich die einzig Überlebende, würde sie sich selbstverständlich aufmachen, die Welt zu retten oder zumindest Spuren von Leben zu finden.
Aber was, wenn nur ihre Eltern weg wären? Dann würde sie wohl in ein Heim kommen oder zu Opa und Oma nach Tirol, obwohl die wahrscheinlich viel zu alt wären, um ein Kind aufzuziehen. Ihre eigenen Eltern waren ja schon ziemlich alt!
Vielleicht könnte sie dann mit Maria hier wohnen, die große Schwester war ja fast schon volljährig. War das erlaubt? Nun stand Alma doch auf, ging über den schmalen Flur ins Zimmer ihrer Schwester. Obwohl Maria ihr vor einem Jahr strikt verboten hatte, ohne anzuklopfen einzutreten, öffnete Alma leise die Tür. Die Vorhänge waren nicht zugezogen, und die Sonne knallte durch das Fenster in ein perfekt aufgeräumtes Zimmer, leerer Schreibtisch, kein Kleiderhaufen auf dem Teppich. Auf dem Bett lag die faltenlose Tagesdecke, die Kuscheltiere saßen in einer ordentlichen Reihe am Kopfende und schienen Alma anzusehen. Hier hatte heute Nacht niemand geschlafen.
Alma dachte an den heftigen Streit, den Mutti gestern Nachmittag mit Maria gehabt hatte. Wieder einmal ging es um die Pflichten im Haushalt, um Sauberkeit und Ordnung und darum, dass Maria sich ihren Abend in die Haare würde schmieren können, wenn ihr Zimmer in so einem Zustand war. Danach hatte ihre große Schwester wütend und dadurch anscheinend höchst effizient ihr Reich in einen Top-Zustand versetzt. Hatte aufgeräumt und gesaugt, das Bett frisch bezogen und es mit der Tagesdecke bedeckt. Nicht mal eine Stunde hatte sie dafür gebraucht, und als sie fertig gewesen war, hatte sie sich an den oberen Treppenabsatz gestellt und gebrüllt: »Oberbefehlshaber Sturmbannführer, fertig zur Zimmerabnahme!«
Die Mutter war seufzend die Stiegen raufgegangen und hatte einen Blick durch die Tür geworfen. »Na siehst du, Maria. Geht doch«, hatte sie gemurmelt. »Um Mitternacht bist du daheim. Verstanden?«
»Jawohl, Herr Sturmbannführer! Ich wiederhole: Mitternacht.«
Alma wusste bisher nicht, dass es die Gesichtsfarbe »grau« gab. In ihrem großen Buntstiftkasten gab es einige Schattierungen rosa und eine Farbe, die war mit »Hautfarben« beschriftet. In der Straßenbahn sah man auch öfter Menschen mit dunkler Hautfarbe, und als sie kleiner gewesen war, hatte sie sie angestarrt, bis die Mutter ihr einen unsanften Stoß gab.
Nun saß Dorit Oberkofler mit grauem Gesicht am Küchentisch. Sie trug einen Bademantel über ihrem Nachthemd, obwohl es im Haus warm war. Ihre Hände lagen nebeneinander auf der Tischplatte, und als sie Alma bemerkte, riss sie den Kopf herum und sprang auf: »Weißt du was? Hat sie dir erzählt, wo sie hingegangen ist?«
»Wer?«
»Na, deine Schwester!«
»Ja, sie wollte zu Sabine. Videos schauen. Warum? Was ist denn los?«
»Sie ist nicht da.« Die Mutter stieß den Satz hervor, und es lag so viel Angst in ihrer Stimme, dass Alma augenblicklich zu weinen begann. »Wie, sie ist nicht da? Hat sie bei Sabine übernachtet?«
»Da ist sie nicht! Vati hat schon angerufen.« Die Mutter hatte Alma bei den Schultern gepackt und schüttelte sie. »Wenn du was weißt … du musst es uns sagen!«
»Aber ich weiß nichts. Wo ist denn Vati?«
»Im Wohnzimmer. Am Telefon. Er ruft alle Freundinnen an.«
Vom Rest des Tages wusste Alma nicht mehr viel. Es war wie ein Traum, immer wenn sie versuchte, sich genauer zu erinnern, verschwamm alles. Sie saß mit den Eltern im Wohnzimmer, ihr Vater hatte die gesamte Klassenliste abtelefoniert, niemand wusste, wo Maria steckte oder am Abend gewesen war.
Ihre beste Freundin Sabine hatte unter heftigem Weinen gestanden, dass sie gar nicht bei ihr gewesen sei, es auch gar nicht vorgehabt habe. Sie habe nur als Alibi herhalten sollen.
»Und du weißt nicht, wohin sie wollte?« Der Vater sprach leise, die Kiefer fest zusammengepresst, eine Haarsträhne hing ihm ins verschwitzte Gesicht. Alma beobachtete ihn, seine leise Stimme war unheimlich, und sie wünschte, er würde ins Telefon brüllen wie sonst auch, wenn er wütend war.
Stattdessen warf er das Telefon auf die Kommode, strich sich die Haare aus der Stirn und vergrub das Gesicht in den Händen.
»Hans! Was ist? Was sagt die Sabine?« Die Mutter legte den Arm um seine Schulter, eine Geste des Trostes, dabei war ihr Gesicht ebenfalls vor Angst verzerrt.
»Sabine sagt was von einem Freund. Einen, den sie nicht kennt. Und Maria wollte mit ihm auf ein Feuerwehrfest, irgendwo außerhalb.«
»Was machen wir jetzt?«
»Wir rufen die Polizei.«
Der Vater saß kerzengerade auf dem Sofa, die Mutter hatte sich im großen Lesesessel mit untergeschlagenen Beinen zusammengefaltet, und Alma hatte das Gefühl zu ersticken. Niemand sagte ein Wort. Alma beobachtete die Staubpartikel, die im Sonnenlicht durchs Wohnzimmer schwebten, und ihr fiel auf, dass die Blätter des großen Gummibaums von einer grauen Schicht bedeckt waren. Von draußen drangen die Stimmen der Nachbarskinder hinein, sie warfen einen Ball gegen das Garagentor und zählten dabei laut mit. Die Eltern, die sich sonst immer über den Lärm der Kinder beschwerten, schienen es nicht wahrzunehmen. Niemand hob den Kopf, als Alma aufstand, um in ihr Zimmer zu gehen.
Dann endlich begann die Suche nach Maria. Zunächst eher zögerlich, die Polizei war davon überzeugt, dass sie abgehauen war und spätestens in ein paar Tagen wieder vor der Tür stehen würde. Doch Alma spürte, dass das nicht stimmte. Nie würde ihre große Schwester verschwinden, ohne ihr Bescheid zu sagen. Und warum auch? In zwei Wochen war die Matura vorbei, Maria wurde im August achtzehn, und dann konnte sie tun, was sie wollte. Warum sollte sie jetzt weglaufen?
»Ich kann nicht in die Schule gehen«, sagte Alma, als ihre Mutter am Montag um sieben Uhr früh die Vorhänge aufzog. Maria war seit sechsunddreißig Stunden verschwunden.
»Bist du krank?« Die Mutter legte Alma die Hand auf die Stirn. »Fieber hast du jedenfalls keines.« Als Alma sich zur Wand drehte und die Decke über den Kopf zog, verließ die Mutter das Zimmer, ohne auf einem Schulbesuch zu bestehen.
In dieser Position verbrachte die Zwölfjährige den Großteil der nächsten Tage und verfolgte die Ereignisse zu Hause wie durch eine Nebelwand. Die Eltern telefonierten sich immer wieder durch Marias gesamten Freundeskreis, doch niemand wusste etwas über den ominösen Freund, von dem Sabine erzählt hatte. Der Vater kopierte Zettel mit Marias Foto und hängte sie mithilfe der Nachbarn im gesamten Viertel auf, und als in den Lokalnachrichten ein Aufruf nach Hinweisen aus der Bevölkerung gesendet wurde, saß Alma zwischen den Eltern auf dem Sofa vor dem Fernseher. Der Mutter rannen die Tränen übers Gesicht, und der Vater presste seine Kiefer so fest zusammen, dass man es knirschen hörte, nur Alma saß unbeweglich zwischen ihnen und fühlte sich wie gelähmt.
In den nächsten Tagen herrschte im Hause Oberkofler hektische Betriebsamkeit. Polizisten gingen aus und ein, der Vater fuhr mit dem Auto immer wieder die Umgebung ab, während die Mutter das Telefon bewachte.
Alma lag die meiste Zeit in ihrem Bett und döste vor sich hin. Niemals zuvor hatte der Vater erlaubt, dass seine Töchter tagsüber im Bett lagen, doch nun war alles anders, die Eltern schienen ihre zweite Tochter komplett vergessen zu haben.
Eines Nachmittags klopfte es zaghaft an ihre Zimmertür, die Mutter schob den Kopf durch den Spalt. »Alma?«
»Was ist?« Alma tat, als würde sie mit irgendetwas auf dem Schreibtisch beschäftigt sein, in Wirklichkeit hatte sie einfach nur aus dem Fenster gestarrt.
»Da ist jemand, der dich sprechen will.« Sie öffnete die Tür, trat zur Seite und ließ die Frau eintreten.
»Ich bin Chefinspektor Susanne Kramer. Darf ich reinkommen?« Und zu Almas Mutter gewandt sagte sie: »Ich würde gerne kurz allein mit Ihrer Tochter sprechen.«
Frau Oberkofler zog die Tür von außen zu, und Alma stand vom Stuhl auf, setzte sich aufs Bett.
»Haben Sie meine Schwester gefunden?« Sie umschlang die Knie mit ihren Armen.
»Nein, leider. Deshalb wollte ich mit dir reden.«
Die Frau trug helle, weite Jeans und ein gestreiftes T-Shirt, die blonden Haare hatte sie zu einem dicken Zopf geflochten. Sie sah nicht aus wie eine Polizistin, eher so, wie Alma sich eine Schwedin vorstellte, ein Model aus dem Ikea-Katalog.
»Glaubst du, dass Maria weggelaufen ist?« Susanne Kramer hatte sich zu ihr auf die Bettkante gesetzt, und Alma rutschte ein wenig an die Wand.
»Niemals ist die weggelaufen. Warum denn auch? Sie war ja eh schon fast weg.«
»Wie meinst du das?«
»Na ja, Maria hat sich schon alles ganz genau überlegt. Wollte im Sommer zum Studieren nach Wien ziehen. Ich glaube, sie hatte sogar schon mit zwei Freundinnen ausgemacht, in eine WG zu ziehen.«
»Und deine Eltern?«
»Na, die waren natürlich dagegen. Das ist Maria aber egal. Die macht immer, was sie will.«
»Hast du eine Idee, wo sie am Samstagabend hingegangen sein könnte?«
»Ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat einen Freund.«
»Warum glaubst du das?«
»Ich weiß auch nicht. Sie ist viel fortgegangen in letzter Zeit, und früher hat sie mir immer erzählt, wohin sie geht.«
»Und an diesem Abend? Wusstest du, dass sie gar nicht zu Sabine wollte?«
»Das dachte ich mir schon.«
»Was dachtest du dir schon?«
»Na, dass sie nicht zur Sabine wollte …«
»Warum dachtest du das?«
»Sie hat sich so schön angezogen. Und geschminkt.«
»Hast du sie gefragt?«
»Ja, ich hab sie ein bisschen verarscht und so was Ähnliches gesagt wie: Wow, machst du dich jetzt für die Bine schön?«
»Und? Sie hat wirklich nichts erzählt?«
»Nein! Sie ist ganz grantig geworden und hat mich aus dem Zimmer geschmissen.«
»Hast du eine Idee, wo sie sein könnte?«
»Nein. Sie?«
»Leider nicht.«
»Sie werden sie finden, oder?«
»Alma, ich weiß es nicht. Erzähl mir doch noch mal ein bisschen von ihrem Verhältnis zu euren Eltern. Wie ist denn das?«
»Na ja, nicht so gut. Der Papa ist recht streng. Maria hat ihn manchmal einen alten Nazi genannt.«
»Ich frag dich jetzt was, und die Antwort bleibt unter uns. Okay?«
»Okay?« Alma zog den Kopf noch ein wenig weiter zwischen die Schultern.
»Könnte dein Papa deiner Schwester etwas getan haben? Oder vielleicht auch dir?«
»Wie meinen Sie das? Was getan?«
»Na ja, irgendwas, was ihr nicht wollt?«
»Ich hab ja schon gesagt, dass er sehr streng ist. Er schimpft viel, und manchmal hat er Maria auch in ihrem Zimmer eingesperrt.«
»Sonst noch was?«
»Früher hat er ihr manchmal eine Ohrfeige gegeben. Und mir auch.«
»Früher?«
»Ja, Maria hat irgendwann zurückgeboxt. Seitdem macht er das nicht mehr.«
»Sonst nichts?«
»Nein, sonst nichts.«
»Schau mal, hier ist meine Karte, okay? Da steht meine Telefonnummer drauf, du kannst mich jederzeit anrufen. Wenn dir etwas einfällt, aber auch, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Verstanden?«
»Verstanden.« Alma legte die Karte unter das Kopfkissen und blieb unbeweglich sitzen, als die Polizistin das Zimmer verließ.
Es ist besser, du gehst jetzt
Nach ein paar Wochen fielen die Eltern mehr oder weniger in ihren Alltag zurück. Der Vater verschwand um acht Uhr morgens in Anzug und Krawatte in seine Zahnarztpraxis, und die Mutter begann das ohnehin makellose Haus von oben bis unten zu putzen, das Telefon nahm sie in jedes Zimmer mit.
Der jährliche Adria-Urlaub wurde abgesagt, den Versuch, Alma in ein Pfadfinderlager zu verfrachten, hatte diese erfolgreich abgewehrt, und so verbrachte sie die großen Ferien auf der Terrasse oder lag auf dem Bett. Stundenlang hielt sie sich in Marias Zimmer auf, las in den Büchern der großen Schwester. Manches verstand sie nicht, und manches war so gruselig, dass sie nachts nicht schlafen konnte. Und die CD von Wolfgang Ambros, die in Marias Stereoanlage steckte, spielte sie Hunderte Male ab, obwohl sie sich vor Kurzem noch über Marias Musikgeschmack lustig gemacht hatte.
Als es an der Tür klingelte, reagierte Alma zunächst nicht, doch wer auch immer davorstand, blieb hartnäckig, also öffnete sie.
»Hallo, Alma. Wie geht es dir?« Die Polizistin sah müde aus.
»Geht so.«
»Sind deine Eltern da?«
»Nein. Papa ist in der Praxis und Mama Tante Herta besuchen. Die kommt aber bald. Wollen Sie reinkommen und warten?«
»Nein danke. Sagst du ihnen, dass sie mich anrufen sollen?«
»Ja, mach ich. Gibt es was Neues?«
»Sag ihnen einfach, sie sollen sich rasch bei mir melden.«
Ein Spaziergänger hatte den Körper im Wald gefunden, besser gesagt sein Hund, den er unerlaubt von der Leine gelassen hatte und der im Dickicht verschwunden war. Der Schäferhund gab seltsam hohe Laute von sich, und als sein Besitzer sich durchs Gestrüpp gekämpft hatte, saß das Tier vor einem halb verscharrten Körper. Die Farbe des T-Shirts konnte man kaum noch erkennen, und der Rock war zerrissen, doch die Polizei hatte sofort den dringenden Verdacht, dass es sich bei der Leiche um die seit zwei Monaten abgängige Maria Oberkofler handelte.
Sie lag inmitten eines Waldstücks, ungefähr zehn Kilometer nördlich von Linz. Eine kleine Schotterstraße führte zu einer Lichtung, anscheinend war sie da mit dem Auto hingebracht worden. Reifenabdrücke konnte man keine mehr sichten, zu oft hatte es in den letzten Wochen geregnet, aber an Stellen, wo der Weg fast zugewachsen war, waren Zweige und Farne abgeknickt. Dann war der Körper noch ungefähr fünfzig Meter ins Innere des Waldes gezogen worden. Auf der Stirn hatte sie eine Platzwunde, und die Schädeldecke am Hinterkopf war gesprungen. Vermutlich war sie auf einen großen Stein gestürzt und hatte sich dabei die tödliche Verletzung zugezogen. Ob sie Alkohol im Blut hatte oder unter dem Einfluss von Drogen stand, konnte man nach so langer Zeit nicht mehr feststellen. Unter den Fingernägeln hatte sie Blut und Hautpartikel, es war augenscheinlich, dass das Mädchen in einen Kampf verwickelt gewesen war. Sie war nicht vergewaltigt worden, hatte aber Hämatome an den Oberschenkeln und im Brustbereich.
Alma wusste im Nachhinein nicht mehr, wie all diese Informationen in ihren Kopf gekommen waren, weder ihre Eltern noch die Polizei hatten Details erzählt. Vermutlich hatte sie an Türen gelauscht, heimlich Zeitungsartikel gelesen oder sich vieles nur ausgedacht, aber sie wusste alles über ihre tote Schwester. Und sah sie jede Nacht deutlich vor sich, halb nackt mit blutverklebtem Haar, leeren Augenhöhlen, die Augäpfel längst von Tieren gefressen, und aus der Mundhöhle krochen Würmer und Maden.
Die Mutter blieb eine Woche lang im Bett, den Haushalt führte Tante Herta. Hin und wieder hörte Alma ein lautes Schluchzen aus dem elterlichen Schlafzimmer, ein Klagen wie von einem verwundeten Tier. Der Vater ging jeden Tag in seine Praxis, so als wäre nichts geschehen. Tante Herta stellte Alma das Essen hin, setzte sich schweigend zu ihr, und manchmal strich sie ihr seufzend übers Haar. Niemand im Haus nahm den Namen der toten Tochter in den Mund, und keiner sprach mit Alma. An das Begräbnis hatte sie keinerlei Erinnerung, vermutlich hatte ihr der Vater ein starkes Beruhigungsmittel verabreicht.
Drei Tage bevor die Schule wieder anfing, fand Alma die Visitenkarte der Polizistin auf ihrem Nachtkästchen. Darauf war die Adresse der Polizeidienststelle. Alma wusste, wo das war, und ohne jemandem Bescheid zu geben, holte sie ihr Fahrrad aus der Garage und fuhr die steile Straße den Froschberg runter.
»Womit kann ich helfen, junge Dame? Hast du deine Eltern verloren?« Der Polizist am Eingang sah sie neugierig an. Alma ärgerte sich. Sie war zwar klein für ihr Alter, trotzdem sah sie nicht aus wie ein verloren gegangenes Kind.
»Ich möchte bitte zu Frau Kramer.«
»Ja, und wer bist du?«
»Mein Name ist Alma Oberkofler. Ich bin die Schwester eines Mordopfers.« Dieser Satz fühlte sich seltsam an, Schwester eines Mordopfers, so hatte sie noch nie jemand genannt, das hatte sie noch nie ausgesprochen.
»Und was willst du von Frau Inspektor Kramer?«
»Ich muss mit jemandem reden.«
Sie musste lange warten. Irgendwann kam ein Polizist, lächelte ihr zu und fragte, ob sie etwas zu trinken wolle. Als sie höflich ablehnte, brachte er ihr trotzdem einen Pappbecher mit Kakao.
»Entschuldige, dass du so lange warten musstest, ich …« Die Polizistin sah älter aus, als Alma sie in Erinnerung hatte, ihr Zopf war unordentlich, und sie wirkte, als hätte sie lange nicht geschlafen.
»Das ist kein Problem. Es macht mir nichts aus, wenn ich warten muss.« Alma wusste nicht, wohin sie ihren Kakaobecher stellen sollte, und blickte sich um.
»Komm mit in mein Büro. Was kann ich denn für dich tun?«
Und dann erzählte Alma, dass niemand mit ihr über ihre tote Schwester Maria sprach, dass die Eltern so taten, als wäre nichts passiert, und dass sie das einfach nicht aushalten könnte. Susanne Kramer sah sie lange aus ihren müden Augen an, dann sagte sie: »Du bist ein kluges Mädchen. Und du hast deine Schwester sehr gern gehabt, oder?«
»Ja, und deswegen muss ich wissen, was passiert ist.«
»Das kann ich dir leider nicht genau sagen.«
»Aber wie ist sie in diesen Wald gekommen? Wo ist der, der mit dem Auto gefahren ist? Mit wem hat sie gekämpft?« Alma war aufgesprungen und hatte dabei den Pappbecher umgestoßen. Der Kakao lief über den Schreibtisch, die Polizistin holte ein paar Taschentücher aus der Schublade und begann ruhig, die Flecken aufzuwischen. »Das macht nichts! Mach dir keine Sorgen, das ist nur Schmierpapier. Ich glaube, es ist besser, du gehst jetzt nach Hause. Ich kann dir leider nicht mehr sagen. Und ich kann deine Schwester auch nicht mehr lebendig machen.«
Wie wenn jemand die Luft aus ihr rausgelassen hätte, sank Alma wieder auf den Stuhl. »Aber … der Typ, bei dem sie im Auto saß, man muss doch wissen, wer das war?«, stieß Alma hervor.
»Kein Aber. Glaub mir, es ist besser so. Weißt du, was? Ich lass dich von einem Kollegen im Streifenwagen heimbringen.«
»Nicht nötig. Ich bin mit dem Fahrrad da«, sagte Alma, sprang auf und rannte aus dem Zimmer. Die Tür warf sie mit einem lauten Knall zu.
Ein guter Beruf
Vier Jahre später
»Ich will Polizistin werden.«
Alma war sechzehn, als sie diesen Satz beim sonntäglichen Frühstück laut aussprach. Ein einfacher Satz aus vier Wörtern, trotzdem hatte sie ihn in Gedanken tagelang ausprobiert. Verschiedene Arten der Betonung, andere Wörter versucht. Nun klang er schroff und etwas atemlos, und die Reaktion der Eltern war schlichtweg enttäuschend. Der Vater steckte die Stoffserviette in den Kragen seines Oberhemdes und köpfte mit einer schwungvollen Bewegung sein Ei, die Mutter hob eine Augenbraue und sagte: »Wie oft haben wir dir schon gesagt, dass ich will hässlich ist. Es heißt: Ich möchte.«
»Ja, Mutti, ich weiß. Es gibt aber einen Unterschied zwischen ich will und ich möchte. Und ich will Polizistin werden.«
»Papperlapapp.« Nun wandte sich auch der Vater von seinem Frühstücksei ab und lächelte Alma an. »Du übernimmst meine Praxis, das ist doch schon alles ausgemacht. Polizistin. Ts, was ist das denn für ein Beruf!«
»Ein ziemlich guter Beruf. Ich habe mir schon alles rausgesucht: Nach der Matura bewerbe ich mich an der Polizeischule.«
»Und dann gehst du Strafzettel verteilen oder was?«, schnaubte der Vater und massakrierte seine Semmel.
»Was ist so schlecht daran, Strafzettel zu verteilen?«
Der Vater lächelte mitleidig, faltete die Stoffserviette und verließ den Frühstückstisch. Die Mutter blickte Alma vorwurfsvoll an. »War das wirklich notwendig?«
»Irgendwann musste ich es ihm ja sagen, oder?«
»Das ist doch nicht dein Ernst, Alma. Wer will denn Polizist werden?« Die Mutter begann mit hektischen Bewegungen, den Tisch abzuräumen.
»Ich, Mama. Ich will Polizistin werden.«
Nach diesem Gespräch wurde das große Haus am Linzer Froschberg zu vermintem Gebiet. Hans Oberkofler unternahm noch ein paar Versuche, seine Tochter umzustimmen, doch Almas Entschluss stand fest, und sie ließ sich weder durch gutes Zureden noch von der Drohung, sie nach der Schule nicht mehr zu finanzieren, beeindrucken.
Als er realisiert hatte, dass Almas Berufswunsch nicht nur eine pubertäre Laune, sondern bitterer Ernst war, sprach Hans Oberkopfler nur noch das Nötigste mit seiner Tochter. Sie begegneten sich oft tagelang nicht, außer es ließ sich nicht vermeiden. Ja, Alma dachte nicht im Traum daran nachzugeben. Diese letzten zwei Jahre würde sie es hier aushalten. Irgendwann bezog sie das verlassene Zimmer ihrer toten Schwester, es war größer als ihr eigenes und lag im ersten Stock, und die Eltern nahmen es schweigend zur Kenntnis. Hier zog sie sich zurück, wenn sie nicht in der Schule oder beim Sport war. Der Vater arbeitete noch mehr als sonst, und die gemeinsamen Mahlzeiten wurden meist schweigend eingenommen. Im Herbst schrieb sich Alma in einem Karateverein ein und ging manchmal bis zu dreimal die Woche trainieren. Die Mutter huschte zwischen den verfeindeten Parteien hin und her und versuchte, wenigstens ein bisschen Normalität aufrechtzuerhalten.
Der Postlerschlüssel
So einen Zentralschlüssel dürfte er gar nicht besitzen. Schließlich konnte man heute einfach klingeln, es gab inzwischen überall eine Gegensprechanlage. Nicht so wie früher, als in Wien die Haustüren um neun Uhr abgesperrt wurden. Wenn man keinen Telefonanschluss hatte, gab es nach 21Uhr keine Chance mehr auf Besuch, daran konnte sich Manfred noch sehr gut erinnern. An dieses Gefühl der Einsamkeit, wenn man allein in seiner Bude saß und wusste, es konnte niemand mehr vorbeikommen. Wahrscheinlich verbrachte er deswegen die meisten Nächte noch immer im Hexenkeller in der Nähe seiner kleinen Wohnung. Da an der Theke war man wenigstens nie allein.
Irgendwann hatte ihm sein Freund Peter diese Schlüsselkarte gegeben, Postlerschlüssel hieß das immer noch, obwohl es an den meisten Adressen längst kein Schlüssel mehr war, sondern eine Magnetkarte. Ein Glücksfall für ihn, denn oft genug waren Klingeln defekt oder die Leute öffneten einfach nicht. So wie jetzt.
Türnummer 14, und natürlich war der Lift ebenfalls nur mit Schlüssel zu benutzen. Ausschließlich für Hausbewohner. Auch dafür müsste es einen Zentralschlüssel geben, dachte Manfred und stieg die Treppen hoch. In jedem Stock befanden sich jeweils zwei Wohnungstüren; er rechnete sich aus, dass er wieder mal bis unters Dach musste, um seine Lieferung abzugeben. Für seine sechsundfünfzig Jahre war er immer noch fit, nur wenn er zu schnell die Treppen stieg, spürte er seine Lunge. Er mochte es nicht, wenn er der Kundschaft heftig schnaufend gegenüberstand, deswegen ging er immer langsam und gleichmäßig. Es war die letzte Wohnung, dem Altbau aus der Gründerzeit hatte man gleich zwei Stockwerke draufgesetzt, und auf den oberen Etagen gab es jeweils nur noch eine Wohnungstür. Natürlich war kein Name auf dem Klingelschild, lediglich eine verschnörkelte 14 zeigte, dass er richtig war.
Er klingelte erneut, wartete, dann drückte er noch mal länger auf den Knopf. Keine Reaktion. Mein Gott, wie er das hasste! Es passierte nicht oft, ärgerte ihn aber jedes Mal maßlos. Warum bestellten die Leute etwas zu essen und waren dann nicht zu Hause? Wahrscheinlich hatte der Kunde von unterwegs geordert – den Leuten konnte es ja nicht schnell genug gehen – und war noch nicht zu Hause. Und seine Wartezeit bezahlte wieder einmal niemand. Falls überhaupt jemand kam. Keine Lieferung – kein Trinkgeld. Er holte das Handy aus der Jackentasche, wollte noch mal Auftraggeber und Adresse überprüfen. Vielleicht hatte er sich in der Hausnummer geirrt oder war doch im falschen Stockwerk. Dann erst bemerkte er, dass die Wohnungstür einen Spalt offen stand.
Eine Leiche im Achten
»Wir haben einen bedenklichen Todesfall.«
Robert Kolonja legte nachdrücklich den Hörer aufs Telefon, streckte seinen Rücken durch und seufzte tief. Gerade war er dabei gewesen, den PC runterzufahren und seine Stifte in der oberen Schreibtischschublade zu verstauen, als er den Anruf vom Journaldienst entgegennahm. Alma Oberkofler kam von der Toilette zurück und wischte sich ihre feuchten Hände an den Jeans ab. Es war ihr vierter regulärer Arbeitstag, auch sie wollte gerade das Büro verlassen.
»Na, das ging ja flott. Was wissen wir?«
Zum 1.April hatte Alma Oberkofler den Job in der Wiener Mordgruppe angetreten und ihr Büro bezogen, seit vier Tagen war sie alleinverantwortlich. Die letzten zwei Wochen hatte sie an der Seite ihrer Vorgängerin Anna Habel verbracht, zum Glück gab es keinen aktuellen Fall. Gemeinsam waren sie alte Akten durchgegangen, Habel hatte sie über offizielle und inoffizielle Strukturen im Büro aufgeklärt und darüber, in welchen Lokalen in fußläufiger Nähe man den besten Mittagstisch bekam. Die beiden Frauen hatten sich auf Anhieb verstanden, und Alma Oberkofler wunderte sich, dass Anna Habel als schwierig galt. Sie fand sie umgänglich und freundlich, auch wenn man sie definitiv nicht als charmant bezeichnen konnte. Aber Anna Habel kam wie sie aus Oberösterreich, da war man eben nicht charmant. Nun zog die Kollegin also nach Berlin, und Alma übernahm ihre Stelle.
»Eine Leiche im Achten. Männlich, keines natürlichen Todes gestorben. Fuhrmanngasse.«
»Ok, dann wollen wir mal.« Alma stand auf und warf ihrem Kollegen einen aufmunternden Blick zu. Oder soll ich den Babic mitnehmen?«
»Nein, passt schon«, brummte Kolonja und nahm seine Glock aus dem Waffenschrank.
Mit Anna Habels Dienststelle hatte sie nicht nur deren Schreibtisch übernommen, sondern auch die beiden Kollegen, Robert Kolonja und Tarik Babic. Die beiden hätten unterschiedlicher nicht sein können: Kolonja stand knapp vor der Pensionierung und war im Kopf schon mehr in seinem Schrebergarten als im Büro, wohingegen Tarik Babic erst seit zwei Monaten in der Abteilung war. Die Sicherheitsakademie hatte er mit Bestnoten abgeschlossen, seinen Dienst als Streifenpolizist abgearbeitet und selbstverständlich die E2a-Prüfung abgelegt. Nun war er fünfundzwanzig, saß am Schreibtisch der Abteilung Leib und Leben und träumte von spektakulären Fällen.
Anna Habel hatte sie gewarnt: »Vor dem musst du dich in Acht nehmen, das ist ein kleiner Streber. Sobald der sich sicher fühlt, sägt er an deinem Sessel.«
Zu ihr war der junge Kollege bemüht freundlich, aber Alma verstand, was ihre Kollegin meinte. Babic war immer der Erste im Büro und der Letzte, der nach Hause ging. Stets wirkte er schwer beschäftigt, auch wenn sich die Arbeit gerade in Grenzen hielt.
»Babic, du hältst hier die Stellung, ich fahr mit der Oberkofler … ääh … Verzeihung, mit der Frau Chefinspektor zum Tatort«, rief Kolonja seinem jungen Kollegen zu, und es schien fast, als würde ihn das anspornen.
»Kann ich nicht mit? Ich fahr gern!« Babic hob den Kopf und schaute die beiden erwartungsvoll an.
»Nein danke, Herr Kollege, wir melden uns, sobald wir vor Ort sind und Infos haben. Bleiben Sie erreichbar«, entschied Alma. Dabei fiel ihr wieder auf, wie seltsam es war, dass sie Kolonja duzte und mit dem jungen Kollegen per »Herr Babic« war. Als Anna Habel ihr die beiden vorgestellt hatte, schüttelte Robert Kolonja ihre Hand und begrüßte sie mit den Worten: »Servus, ich bin der Robert Kolonja, kannst gern Kolonja zu mir sagen«, während sich der junge Kollege mit einem schmallippigen »Tarik Babic, freut mich« vorstellte.
»Jawohl, selbstverständlich«, hörte sie ihn beim Verlassen des Büros leise sagen.
In der Fuhrmanngasse war bereits großes Aufgebot. Zwei Streifenwagen, das Auto der Spurensicherung und ein Rettungswagen versperrten die schmale Gasse, und einer der uniformierten Kollegen hatte sich an der Ecke Josefstädter Straße/Fuhrmanngasse postiert, um den Verkehr umzuleiten. Hinter der Polizeiabsperrung standen die üblichen Schaulustigen.
Kolonja grüßte einen jungen Uniformierten, der zur Seite trat und ihm die Tür aufhielt.
»Moment, gnä’ Frau. Hier können’S jetzt nicht rein.« Alma war ein paar Meter hinter Kolonja, und der Streifenpolizist stellte sich ihr in den Weg.
»Geh, Weinmeister, das ist die neue Chefin«, lachte Kolonja. »Darf ich vorstellen, Alma Oberkofler, seit ersten April macht sie den Job von der Habel.«
»Entschuldigen Sie bitte, Frau Chefinspektor! Herzlich willkommen. Das Opfer befindet sich auf der ersten Etage des Dachgeschosses, Türnummer 14.«
»Wurde die Identität bereits festgestellt?« Alma nickte ihm kurz zu und bemühte sich um einen sachlichen Ton.
»Ja, hat man Ihnen das nicht gesagt?«
»Was denn?«
»Na, es ist die Wohnung von Max Langwieser.«
»Der Max Langwieser?«
»Jawohl, der Max Langwieser.«
»Und ist er auch das Opfer?«
»Ich fürchte, ja.«
Kolonja war nach fünf Stockwerken ziemlich außer Atem und blieb am Treppenabsatz vor der Türnummer 14 stehen. Er stützte seine Hände auf die Knie, beugte sich heftig atmend vornüber und murmelte: »Na servus. Wenn das wirklich der Minister ist, dann beginnt jetzt eine schwierige Zeit.«
Obwohl Alma sofort ein Bild des jungen Politikers vor ihrem geistigen Auge hatte, fiel ihr nicht ein, welchem Ressort er vorstand. Die letzte Regierungsumbildung war noch nicht lange her, ständig gab es Veränderungen, irgendwann war sie ausgestiegen. Nur Innenminister war er nicht, das wusste sie mit Sicherheit.
Eine Kollegin von der Spurensicherung überreichte ihnen an der Tür die Plastiküberzieher für Schuhe und Haare und führte sie in einen lichtdurchfluteten Vorraum.
»Hallo, ich bin Barbara Führer. Babsi. Sie müssen die neue Anna Habel sein!«
Barbara Führer war groß und schlank, und aus ihrem weißen Schutzanzug leuchteten die blauesten Augen, die Alma je gesehen hatte. Sie fand sie auf Anhieb sympathisch.
»Hallo, freut mich. Ich bin Alma Oberkofler. Gerne Alma«, hörte sie sich sagen und wunderte sich über sich selbst. Normalerweise blieb sie in beruflichen Zusammenhängen lieber beim Sie, wenn man sich nicht gerade ein Büro teilte. Aber diese junge Frau blickte ihr so freundlich entgegen, da wäre es ihr fast absurd vorgekommen, sie beim Nachnamen anzusprechen.
»Was haben wir?«
»Leiche, männlich. Todeszeitpunkt ist noch nicht lange her. Höchstens zwei Stunden, vielleicht weniger. Tod durch stumpfe Kopfverletzung, anders gesagt, der junge Mann ist vermutlich gegen einen scharfkantigen Glastisch gefallen. Ob ihm das ganz allein gelungen ist, müssen wir erst rausfinden.«
Die Leiterin der Spurensicherung führte sie in ein großes, spärlich eingerichtetes Wohnzimmer: zwei große graue, rechtwinkelig zueinander stehende Sofas, mittig ein niedriger Tisch aus Glas. Und auf dem sandfarbenen Teppich dazwischen lag der Tote auf dem Rücken, den Blick starr nach oben gegen die Decke gerichtet, ein Bein unnatürlich verdreht. Nun fiel es Alma wieder ein: Max Langwieser war Minister für Landwirtschaft und Tourismus. Ein etwas unscheinbarer junger Mann, Alma erinnerte sich an seine roten Backen, er sah ein wenig aus, als käme er direkt vom Bauernhof oder von der Skipiste. Diese Wangen waren nun blass und eingefallen.
»Warum liegt der so? So liegt man doch nicht, wenn man fällt!«
»Ein Essenslieferant hat ihn gefunden. Und der hat vorbildlich gecheckt, ob man noch erste Hilfe leisten kann. Dabei hat er ihn umgedreht.«
»Wo ist der?« Alma blickte sich um.
»Sitzt mit den Kollegen in der Küche.«
»Könnte es ein Unfall gewesen sein?«
»Theoretisch schon. Aber warum sollte jemand einfach so gegen einen Tisch fallen? Gestürzt in der eigenen Wohnung?«
»Alkohol? Drogen?«
»Meine liebe Kollegin. Wir sind zwar toll, aber keine Zauberer! Gib mir zwei Stunden. Aber siehst du das?« Barbara Führer zeigte auf ein paar blaue Flecken am rechten Arm. »Sieht aus, als hätte ihn jemand fest gepackt. Die sind aber definitiv älter.«
»Wie alt?«
»Na, du bist ja eine ganz Ungeduldige«, Babsi schenkte ihr einen blitzblauen Augenaufschlag. »Nicht sehr alt, aber auch nicht ganz frisch. Vielleicht ein paar Tage.«
Ein Polizist kam aus einer der hinteren Türen in den Raum und grüßte militärisch. »Guten Abend, Frau Chefinspektor, Herr Kolonja. In der Küche sitzt Manfred Maurer, ein Bote von Food & Bike. Er hat den Toten gefunden, um … warten Sie«, er blickte auf seinen kleinen Notizblock, »19:15Uhr. Laut seiner Aussage stand die Tür offen, und weil niemand auf sein Klingeln reagiert hat, ist er rein. Wir haben ihn vernommen und seine Personalien aufgenommen. Er ist schon recht ungeduldig, würde gerne nach Hause gehen.«
»Ich rede kurz mit ihm, dann kann er gehen. Er hat wohl nichts damit zu tun.«
»Ja, ich dachte nur … wir halten ihn noch ein wenig auf. Wegen der Presse. Ich mein, weil der Tote ja …«, sagte der uniformierte Kollege.
Na servus, dachte Alma und straffte die Schultern. Ihr erster Fall im neuen Job, und dann musste es gleich ein hochrangiger Politiker sein.
»Danke, das haben Sie gut gemacht.« Mit diesen Worten ließ Alma den Polizisten stehen.
Ein untersetzter, grauhaariger Herr mit Schnauzer saß am Küchentisch und blickte ihr ostentativ schlecht gelaunt entgegen. Manfred Maurer sah nicht aus wie der typische Botenfahrer. Alma scannte kurz die Küche. Auch die sah aus wie aus einem Möbelkatalog. Und zwar nicht von einem der Möbelhäuser, in denen Alma unlängst ihre Bücherregale besorgt hatte.
»Guten Tag. Manfred Maurer?«
»Ja, der bin ich. Das habe ich aber Ihrem Kollegen auch schon gesagt. Und alles andere auch. Kann ich jetzt gehen?«
»Ja, sofort. Ist alles in Ordnung? Brauchen Sie psychologische Betreuung?«
»Wieso?« Maurer sah sie an, als würde er an ihrem Verstand zweifeln.
»Na ja, schließlich haben Sie gerade einen Toten gefunden.«
»Ich hab zehn Jahre als Sanitäter gearbeitet. Da müssen Sie schon mehr auffahren, dass ich einen Psychologen brauche.«
»Und warum jetzt als Essensauslieferer?«
»Ich wüsste nicht, warum ich Ihnen das erzählen sollte.«
»Natürlich nicht. Entschuldigen Sie, es hat mich einfach interessiert.«
»Schon okay.«
Die Kommissarin zog einen der Stühle heran und setzte sich an den Tisch. »Ich weiß, Sie haben schon mit meinem Kollegen gesprochen, aber würden Sie es mir auch noch mal erzählen? Bitte.« Sie lächelte ihn freundlich an, und er lehnte sich zurück.
»Ich hab geklingelt, einmal, zweimal. Keine Reaktion. Dann hab ich bemerkt, die Tür steht offen. Also hab ich sie ein wenig weiter aufgemacht und gerufen.«
»Und? Haben Sie etwas gehört? Ein Geräusch?«
»Nein. Nichts. Ich weiß auch nicht, warum ich rein bin. Wahrscheinlich war ich neugierig, wie so einer wohnt.«
»Was meinen Sie?«
»Wie? Sie wissen doch, wer das ist, oder?« Er deutete mit dem Kopf in Richtung Wohnzimmer.
»Ja, und Sie wussten es auch?«
»Zuerst nicht. Ich schau mir ja meistens nur die Straßennamen und Hausnummern an. Aber als sich keiner gerührt hat, hab ich noch mal auf den Namen geschaut, und da ist es mir dann aufgefallen.«
»Und dann?«
Manfred Maurer verdrehte die Augen. »Erst bin ich ins Vorzimmer und hab gerufen. Nachdem sich immer noch nichts rührte, bin ich ein Stück weiter rein. Ich dachte, der regt sich sicher auf, wenn ich nicht liefere. Das war ziemlich teures Sushi.«
»Sie haben einfach eine fremde Wohnung betreten? Noch dazu, wo Sie gewusst haben, dass es die eines Ministers ist?«
»Ach, jetzt hören Sie doch auf! Sie wollen doch nicht sagen, dass ich etwas damit zu tun habe?«
»Natürlich nicht, ich versuche nur zu verstehen, warum Sie so gehandelt haben.« Alma schob ihm sein unberührtes Glas Wasser hin und nickte ihm zu. »Da, trinken Sie einen Schluck.«
»Sie werden mir das eh nicht glauben. Aber ich hab gespürt, dass da was nicht stimmt.«
»Wie meinen Sie das?«
»Na ja, ich hab ja gesagt, dass ich viele Jahre Sanitäter war. Da hab ich auch immer gespürt, wenn wir zu spät gekommen sind.«
»Dann waren Sie wahrscheinlich ein guter Sanitäter. Einer mit Gefühl.«
»Mag sein. Jedenfalls hab ich von da hinten«, er nickte wieder in Richtung Wohnzimmer, »leise Musik gehört. Und da lag er.«
»Was genau haben Sie gesehen? Beschreiben Sie bitte jedes Detail!«
»Ein großes Wohnzimmer mit teuren Möbeln. Und auf diesem hellen Teppich lag ein Körper, das war der einzige Farbfleck in diesem Raum. Zwischen Sofa und Couchtisch, seltsam verdreht, mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache. Ich hab gar nicht darüber nachgedacht, es war wie ein Reflex: Ich bin hin, hab ihn umgedreht und seinen Puls gefühlt. Da war aber nichts mehr. Die Musik war übrigens Mozart, Klaviersonaten, das kenne ich, hat meine Ex ständig gehört.«
»Und dann?«
»Na, dann hab ich mich aufs Sofa gesetzt und die Polizei angerufen. Aber das hab ich wirklich alles schon dem Kollegen erzählt.«
»Haben Sie im Treppenhaus etwas gesehen oder gehört? Ist Ihnen jemand begegnet?«
»Nein, niemand.«
»Wie sind Sie ins Stiegenhaus gekommen? Der Tote wird ja nicht auf den Türöffner gedrückt haben?«
»Ich habe so eine Karte, mit der man die Haustür aufmachen kann.« Er rutschte ein wenig nervös auf seinem Stuhl hin und her, und als Alma nicht reagierte, sagte er: »Ich weiß es, das ist nicht ganz legal. Aber es erleichtert mein Leben sehr.«
»Haben Sie unten vor dem Haus jemanden gesehen?«
»Na ja, da waren mehrere Leute, ich mein, das ist ja eine belebte Gegend, da sind immer viele unterwegs.« Manfred Maurer blickte nachdenklich an die Decke, schien sich ernsthaft um seine Erinnerung zu bemühen und schüttelte dann den Kopf. »Mir ist ein Audi aufgefallen auf der anderen Straßenseite, Sie wissen schon, so ein fetter SUV, der fast nicht in die Parkspur passt. Da saß einer drinnen und hat telefoniert.«
»Können Sie den beschreiben?«
»Nein. Ich hab ihn nur kurz gesehen, als er das Fenster runtergelassen und einen Zigarettenstummel rausgeworfen hat.«
»Kennzeichen?«
»Nein. Ich merk mir doch nicht die Kennzeichen irgendwelcher Autos.«
»Okay. Sie können jetzt gehen. Wenn Ihnen noch mehr einfällt, dann rufen Sie sofort an, vielleicht laden wir Sie auch ein, und Sie müssen sich ein paar Fotos anschauen. Ein Kollege wird Sie an den Journalisten unten vorbeischleusen. Und, Herr Maurer, es wäre schön, wenn Sie nicht mit der Presse reden würden.«
»Warum sollte ich?«
»Na ja, immerhin ist der Tote ja kein Unbekannter.«
»Da müssen Sie keine Angst haben, Frau Inspektor, ich halt mich da raus. Politik interessiert mich schon lange nicht mehr.«
Er stand auf, stellte sein Wasserglas auf die fleckenlose Spüle, rückte den Stuhl an den Tisch und blickte sich dann unschlüssig um. »Was mach ich jetzt mit dem Sushi?«
»Zurückbringen?«, schlug Alma vor.
»Die schmeißen es bloß weg. Wär schade drum. Ich lass es Ihnen da, es ist vom besten Japaner der Stadt. Sie haben sicher eine lange Nacht, dann haben Sie wenigstens eine ordentliche Mahlzeit.«
Als der Essenslieferant weg war, ging Alma zurück ins Wohnzimmer. Neben der Tür war nun der Beamte, der vorher unten an der Haustür gestanden hatte, sein Blick war auf einen unsichtbaren Punkt an der Wand gegenüber gerichtet.
»Wir schauen uns mal um, bevor es hier so voll ist, dass wir nicht mehr durchkommen. Schicke Wohnung, oder?« Alma betrachtete nachdenklich den großen Fernseher und überlegte kurz, ob die weiße Wand auf der gegenüberliegenden Seite mit einem großen Bild besser aussehen würde. Konnten sich die Bewohner einfach noch nicht für eines entscheiden, oder war diese Leere gewollt?
»Kommt ihr mal?« Die Stimme von Barbara Führer kam aus dem hinteren Teil der Wohnung, und Robert Kolonja und Alma Oberkofler machten sich auf die Suche nach der Kollegin.
Barbara Führer war im Badezimmer, auch dieser Raum wirkte unbenutzt, nahezu steril. Hellgraue Steinfliesen, ein Spiegel ging über die gesamte Breitseite, ein quaderförmiges weißes Waschbecken. Alma sah auf einen Blick, dass die Utensilien auf dem schmalen Bord einer Frau zuzuordnen waren. Make-up, Schminkpinsel, mehrere Lippenstifte. In einem Glas eine einzelne Zahnbürste. Gerade als sie ihre Beobachtung mit Kolonja teilen wollte, hielt ihr Barbara Führer einen kleinen Mülleimer vor die Nase. Und darin befanden sich, neben gebrauchten Abschminkpads und Wattestäbchen, braun gefärbte Taschentücher.
»Blut?«, fragte sie.
»Yep. Und zwar ziemlich viel. Und auch wenn ich es noch nicht untersucht habe, fresse ich einen Besen, wenn es das vom Herrn Minister ist. Es ist auch schon älter.« Sie packte alles in einen Plastiksack, in den anderen kam die Zahnbürste. »Wohnt noch jemand hier?«
»Keine Ahnung, aber ich nehme es an. Langwieser sah nicht so aus, als hätte er sich jeden Morgen geschminkt.«
Kolonja zog sein Handy aus der Hosentasche. »Herr Babic? Sind Sie noch im Büro? Gut. Können Sie bitte nachschauen, wer an der Adresse des Fundorts alles gemeldet ist?« Eine kurze Pause, dann bedeckte er sein Telefon kurz mit der Hand. »Hat er schon«, flüsterte er. »Hm, ja, okay. Moment, ich schreib es mir auf.« Kolonja zog sein Notizbuch hervor und wollte sich am Rand des Waschbeckens aufstützen, doch Babsi Führer scheuchte ihn weg. »Spinnst du? Wir haben hier noch keine Spuren aufgenommen.«
Er hockte sich hin, legte den Notizblock auf sein Knie und kritzelte ein paar Namen. »Gut, danke! Halten Sie die Stellung, das könnte eine lange Nacht werden. Wir melden uns.«
»Und? Wer wohnt hier?« Alma blickte ihm neugierig über die Schulter.
»Also: Max Langwieser kennen wir ja schon, er wohnt hier seit ungefähr einem Jahr. Eigentumswohnung.«
»Nicht schlecht!« Babsi Führer pfiff durch die Zähne. »Augen auf bei der Jobwahl.«
»Ebenfalls hier gemeldet seit 1.Juli vergangenen Jahres«, Kolonja blickte auf seinen Zettel, »Jessica Pollauer, geboren 5.9.1995 in Oberwart. Arbeitet in der Presseabteilung des Wirtschaftsministeriums. Eine Mobilnummer hab ich auch.«
»Her damit! Ich ruf sie an.«
Alma tippte die Nummer in ihr Handy und schaltete den Lautsprecher an. Die Mobilbox sprang sofort an: »Hier ist die Mobilbox von Jessica Pollauer. Ich kann Ihren Anruf momentan nicht entgegennehmen, rufe aber gerne zurück.«
»Frau Pollauer? Guten Tag. Hier ist Alma Oberkofler, Landeskriminalamt Wien. Ich bitte umgehend um einen Rückruf.«
»Tja, und jetzt?« Kolonja blickte sich ratlos um. Was machen wir jetzt? Das ist ja nicht irgendwer.«
»Ich nehme an, in spätestens zehn Minuten haben hier alle wichtigen Kollegen ihren Auftritt«, antwortete Alma. »Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, der Chef vom BVT und sicher noch ein paar andere, die wir noch gar nicht kennen.«
»Heißt das BVT jetzt nicht Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst?«
»Ja, aber das macht es auch nicht weniger mühsam.«
Da hörten sie auch schon Stimmen, und wie auf ein Stichwort betraten alle gleichzeitig die Wohnung; es war ein wenig wie auf einer Theaterbühne: Die Kollegen der Tatortgruppe, die begannen, Fotos aufzunehmen, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, gefolgt von einem großen, breitschultrigen Herrn, dessen dunkles Haar nach hinten gegelt war und der aussah, als würde er jede freie Minute für den Ironman trainieren. Er streckte Alma die Hand hin, drückte sie fest und stellte sich vor. »Guten Abend, Frau Kollegin. Freut mich, dass wir uns kennenlernen, wenn auch die Umstände eher unerfreulich sind. Ich bin David Blumauer, Leiter der DSN, Sie wissen schon, das ist das neue BVT. Was haben wir denn?«
Alma fasste die dürftigen Informationen zusammen, und als ihr Blick auf Kolonja fiel, sah sie die große Müdigkeit in seinen Augen, er wirkte, als würde er am liebsten jetzt sofort in den vorzeitigen Ruhestand gehen.
»Oberste Priorität ist es, die Dame des Hauses zu finden, vielleicht meldet sie sich ja noch«, kommentierte Blumauer und warf einen kurzen Blick auf den toten Minister.
Schließlich kam auch noch der Beamte der MA 15, um den Tod offiziell festzustellen. Er kniete sich vor den reglosen Körper, fühlte den Puls, legte ein Stethoskop auf den Brustkorb und stand unter ostentativem Stöhnen wieder auf. »Die vorgefundene Person weist mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen auf«, schrieb er in ein Formular, das er umständlich aus einer Aktentasche gezogen hatte, stempelte es ab und setzte eine Unterschrift darunter. Dann tippte er sich an die Stirn, deutete eine Verbeugung an und verschwand mit den Worten: »Meine Damen, der Tote steht zu Ihrer Verfügung. Auf Wiedersehen.«
Ein kaputtes Handy und ein Haufen Bargeld
Jessica fuhr die Triester Straße stadtauswärts, vorbei an Tankstellen, Fast-Food-Restaurants und Hochhäusern. Für sie war das hier wie ein Zwischenreich, ein Ort, der aus Zeit und Raum gefallen zu sein schien, und immer wenn sie diese Strecke fuhr, hatte sie das Gefühl, nicht in Wien zu sein. Das empfand sie aber nur, wenn sie die Stadt verließ, beim Zurückkommen war sie immer voller Freude und Erwartung. Zumindest früher, als sie noch studiert hatte, konnte sie es gar nicht erwarten, wenn sie nach einem Besuch in ihrem Heimatort wieder zurück in ihr »Erwachsenenleben« kam, doch seit ein paar Monaten legte sich immer öfter dieses Stressgefühl auf ihre Brust, wenn sie nach einem Wochenende bei den Eltern im Burgenland wieder zurückfuhr. Immer öfter sehnte sie sich nach der Ruhe in ihrem Heimatdorf und hatte dann sofort ein schlechtes Gewissen: Sie war noch jung, stand am Anfang ihrer Karriere, wie konnte ihr da jetzt schon alles manchmal zu viel sein? So hatte sie auch heute Abend automatisch die Südautobahn angesteuert, nachdem sie fluchtartig ihre Wohnung verlassen hatte. Den direkten Weg zu ihren Eltern.
Erst an der Shopping City Süd, das riesige Einkaufszentrum und somit das Paradies ihrer Jugend, wurde der dichte Verkehr weniger, und Jessica fuhr am rechten Fahrstreifen exakt hundert Stundenkilometer. Das Handy, das neben ihr auf dem Beifahrersitz lag, klingelte seit dem Matzleinsdorfer Platz in regelmäßigen Abständen, dazwischen meldeten unterschiedliche Signaltöne das Eintreffen von SMS und Whatsapps. Jessica fuhr weiter.
Niemals wieder würde sie den Anblick des leblosen Körpers vergessen, den unnatürlich verdrehten Arm, die grellroten Blutflecken, die auf dem hellen Teppich wie eines dieser modernen Gemälde wirkten, über die Max sich immer lustig gemacht hatte. Er sah so … so tot aus. Oder hatte er doch noch gelebt?
Am nächsten Schild, das sie passierte, stand: »Traiskirchen 10 km«. Traiskirchen war in ihrer Kindheit einfach nur ein Ort gewesen, in dem der Vater eine gute und günstige Autowerkstatt kannte, doch seit über fünf Jahren hatte der Ortsname für sie eine andere Bedeutung. Die eines überfüllten Flüchtlingsheims, das sie zwar nie von innen gesehen hatte, das in ihrer Vorstellung aber ungefähr so schlimm aussah wie ein Gefängnis in einer amerikanischen Netflix-Serie. Wie hieß die Freundin noch gleich, mit der sie damals nach Traiskirchen gefahren war? Valeria? Valentina? Wann eigentlich war die aus ihrem Leben verschwunden? Damals waren sie ganz eng gewesen, und nachdem sie in den Fernsehnachrichten die Bilder aus dem Flüchtlingsheim gesehen hatten, packten sie am nächsten Tag ihr kleines Auto mit Decken, Kinderkleidern und Hygieneartikeln voll und fuhren einfach los. In das Innere des Geländes ließ man sie nicht, sie mussten ihre Spenden an der Mauer ausladen, und Jessica erinnerte sich an die Männer, die versuchten, die Hilfsgüter aus dem Auto zu zerren. Und da waren diese zwei Kinder, direkt hinter dem Zaun, vielleicht vier, fünf Jahre alt, Jessica kannte sich mit Kindern nicht so gut aus. Sie standen da und schauten mit großen Augen zu ihr herüber, das Mädchen hatte dunkle, dicke Zöpfe, das wusste sie noch, und der Junge trug eine viel zu große Trainingsjacke, auf der Bayern München stand. Und dann hob der Junge die Hand und winkte ihr zu, und das Mädchen streckte seinen Arm durch die Zaunstäbe wie ein kleiner Affe im Zoo. Hübsch waren sie und gleichzeitig so armselig. Eines Abends, sie hatten ein paar Gläser Wein getrunken, hatte sie Max von dieser Fahrt nach Traiskirchen erzählt, von diesem Gefühl der Ohnmacht und von den beiden Kindern. Er hatte aufgelacht: »Ach, du bist so naiv, Jess. Damals sind so große Fehler gemacht worden, man hätte diese Leute niemals über die Grenze lassen dürfen.«
»Ja, aber was hätte man denn mit ihnen machen sollen? Es waren Flüchtlinge, sie hatten nichts außer dem, was sie tragen konnten! Ich hab es selbst gesehen!« Die Bilder der jungen Männer, die sich damals drohend vor Valeria/Valentina und ihr aufgebaut und in ihrer hart klingenden Sprache die Sachen aus dem Kofferraum eingefordert hatten, schob sie bei diesem Gespräch mit Max rasch weg.
»Ja, eh! Aber nicht nur. Schau doch mal, was wir uns mit diesen Massen ins Land geholt haben«, sagte Max damals und nahm noch einen großen Schluck Wein. »Afghanen, die mit Heroin dealen, Syrer, die für den IS arbeiten, und Kinder, die kein Wort Deutsch können und mit Kopftuch in unseren Schulen sitzen. Ist es das, was wir wollen?«
Dann kamen irgendwann die Tränen. Nicht einfach nur Tränen, es war mehr ein hysterisches Schluchzen, das direkt aus ihrer Kehle drang. Hatte sie bis hierher das Gefühl gehabt, das Auto einigermaßen im Griff zu haben, blickte sie nun auf ihre zitternden Hände und wunderte sich selbst, wie man so Auto fahren konnte. Als ein Schild einen Parkplatz in 500Metern ankündigte, trat sie auf die Bremse und fuhr von der Autobahn, stellte den Motor ab, legte den Kopf auf das Lenkrad und versuchte, ihre Atmung unter Kontrolle zu bringen.
Als Studentin hatte sie manchmal geraucht, immer nur, wenn sie zu viel getrunken hatte, und nie hatte es ihr wirklich geschmeckt. Jetzt hätte sie gerne geraucht. Sie würde sich da auf diese mit Graffiti vollgeschmierte Bank setzen, eine Zigarette aus der Packung nehmen und in die Nacht rauchen. Helfen würde es nicht, aber vielleicht würde es sie beruhigen.
Welch Ironie der Geschichte, dass sie nun gerade in der Nähe von Traiskirchen auf einem Autobahnparkplatz saß und überlegte, wie ihr Leben weitergehen sollte. Eine Fluchtgeschichte der anderen Art.
Sie wählte die Kurzwahl der Sprachbox und hielt sich das Handy ans Ohr.
Die erste Nachricht war von Max und mehrere Stunden alt: »Hallo Jess. Ich bin am Weg nach Hause. Hab Sushi bestellt von einem wirklich guten Japaner. Bussi, bis gleich.«
Die zweite Nachricht war von einer unbekannten Nummer, eine freundliche Männerstimme, die sie beim Namen nannte und klang, als würden sie sich gut kennen. »Hi Jess. Das war wirklich keine gute Idee, das musst du doch selber zugeben. Oder? Noch kannst du dich für ein gutes Leben entscheiden. Du bist doch ein kluges Mädchen, oder?«
Sie drückte auf die Zwei, um die Nachricht noch einmal abzuhören, konzentrierte sich. Kannte sie die Stimme? Die dritte Nachricht klang sachlich: »Frau Pollauer? Guten Tag. Hier ist Alma Oberkofler, Landeskriminalamt Wien. Ich bitte umgehend um einen Rückruf unter dieser Nummer.« Jessica öffnete die SMS: Meldest du dich bitte? Geh an dein verdammtes Telefon. Wir können doch über alles reden, und weglaufen ist keine Lösung.
Wie lange sie auf diesem Parkplatz im Auto gesessen und immer wieder diese Nachrichten abgehört hatte, konnte sie später nicht mehr rekonstruieren. Sie beobachtete mehrere Lkws, die in die Bucht fuhren und wieder verschwanden, einen weißen Volvo, aus dem ein Mann ausstieg und in gut sichtbarer Entfernung in die Büsche pinkelte, und als er ein paar Schritte auf ihr Auto zukam, bekam sie plötzlich keine Luft mehr. Er hatte sie gar nicht gesehen, stieg wieder in sein Auto, doch Jessica brauchte lange, um ihre Atmung wieder unter Kontrolle zu bekommen.
Und dann war es ihr völlig klar: Sie konnte nicht zu ihren Eltern fahren, schließlich würde man sie da als Erstes vermuten. Jessica scrollte durch die Kontakte und schrieb sich die Handynummer ihrer Mutter auf einen kleinen Zettel. Dann stieg sie aus dem Auto, betrachtete ein wenig wehmütig das Telefon und warf es mit aller Kraft auf den Asphalt. Sie verspürte einen fast körperlichen Schmerz, als sie das Display brechen sah, wann war sie das letzte Mal länger als zehn Minuten von ihrem Mobiltelefon getrennt gewesen? Fast tausend Euro hatte das Ding gekostet, na gut, es wurde eh vom Ministerium bezahlt, aber trotzdem. Sie setzte sich wieder auf den Fahrersitz, startete den Motor und fuhr mit dem linken Vorderreifen über das iPhone. Jessica bildete sich ein, es knirschen zu hören.
Nun begann ihr Verstand zu arbeiten. Geld. Sie brauchte Bargeld. Schließlich hatte sie genug Krimis gelesen und genug Sonntagabende Tatort geschaut, um zu wissen, dass die Spuren immer über das Handy oder über die Kartenzahlungen und Geldabhebungen liefen. In ihrem Portemonnaie befanden sich fast 1800Euro, die Buchhaltung hatte ihr die letzte Spesenabrechnung am Vormittag bar ausgezahlt. Doch wenn sie wirklich einige Zeit von der Bildfläche verschwinden musste, würde sie damit nicht auskommen.
Die nächste Ausfahrt war Bad Vöslau, sie würde es wohl schaffen, ohne Google Maps die Innenstadt zu finden, auch das Navi hatte sie nicht in Betrieb genommen. Wie viel Bargeld konnte man vom Geldautomaten abheben? Jessica erinnerte sich, dass es im Foyer der eigenen Bank bedeutend mehr war.
Der Ortskern war wie ausgestorben, und sie fuhr die wenigen Straßen ab, und da, mitten am Stadtplatz, prangte das schwarz-gelbe Logo ihrer Hausbank, ein tröstliches Licht in der Dunkelheit. Neben ihrem eigenen Konto hatten Max und sie ein gemeinsames, von dem Miete und Betriebskosten und Einkäufe für den Haushalt abgebucht wurden, Jessica wusste den Kontostand nicht, sie würde auf jeden Fall versuchen, von beiden das Maximum abzuheben.
Ein paar Minuten später hatte sie 9000Euro mehr in der Tasche, jede der Karten hatte exakt 4500
Krautrouladen
Die Leiche war abtransportiert worden, und Babsi Führer hatte grünes Licht für die Spurensicherung gegeben. Alma versuchte die vielen Menschen auszublenden, die an allen Ecken der Wohnung fotografierten, Fingerabdrücke nahmen, Schränke und Schubladen öffneten, als könnte sich da drinnen jemand verstecken, und ging langsam durch die Wohnung. Kolonja schickte sie zurück ins Büro, irgendjemand musste sich schließlich um den aufgeregten Polizeipräsidenten kümmern, den sie nach einigen Diskussionen aus einer Opernvorstellung hatten rausholen lassen. »Fahr du schon mal vor und beschwichtige den Präsidenten. Sag ihm, es gebe keinen Verdacht auf einen terroristischen Akt. Nichts. Nada. Sonst fahren die gleich das ganz große Programm auf.«
»Was machst du noch hier?«
»Ich schau mich um. Nur so. Überall meine Nase ein bisschen reinstecken, solange die Spuren noch frisch sind.«
»Passt. Unser netter Kollege macht sich auch schon auf den Heimweg, er nickte mit Kopf in Richtung des gut gebauten Staatsschutzchefs, der ein wenig unschlüssig im geräumigen Vorzimmer stand. Ich lass dir auf jeden Fall den Weinmeister da, der kann dich dann mit zurücknehmen.«
»Okay. Und bitte versucht, diese Frau zu finden. Elternhaus, Liebhaber, beste Freundin, die muss ja irgendwo sein. Wartet auf jeden Fall im Büro, du und der Babic. Ich brauch nicht lange.«
Kolonja sah sie traurig an. »Heute hätte meine Frau Krautrouladen gemacht. Mein Lieblingsessen.«
»Die schmecken eh aufgewärmt am besten«, lachte Alma, doch da fiel ihr ihre eigene Verabredung ein, eine Essenseinladung bei ihrer neuen Nachbarin Julia. Die hatte sie komplett vergessen.
Ihr Telefon zeigte zwei Anrufe in Abwesenheit, vor zehn Minuten der Präsident, gut, der konnte warten, bis Kolonja da war, und eine unbekannte Nummer, wahrscheinlich irgendein Journalist, schließlich war die Polizeiabsperrung vor dem Haus nicht zu übersehen. Oder die Presse war gleich von einem der Streifenkollegen verständigt worden, ein Leck gab es immer irgendwo.
Julia hatte nicht angerufen, und trotz des schlechten Gewissens war Alma fast ein wenig beleidigt. Sie schrieb eine Whatsapp: Sorry, echten Toten als Einstand … kann nicht weg. Sei nicht böse, melde mich morgen. Gute Nacht.
Unmittelbar darauf kamen ein Zwinkersmiley und ein Daumen hoch und danach noch ein Satz: Kein Problem, Gulasch ist eh aufgewärmt am besten.
»Frau Kollegin?« Der Ironman war doch noch mal ins Wohnzimmer zurückgekommen und räusperte sich. »Ich werde dann mal aufbrechen, okay? Sie haben ja alles im Griff.«
»Klar, kein Problem. Ich bin hier auch gleich fertig.«
David Blumauer überreichte ihr eine Visitenkarte. »Ich bin jederzeit erreichbar. Wenn Sie etwas Neues haben, rufen Sie bitte sofort an.«
»Jawohl.«
»Ich melde mich morgen früh! Oder ein Kollege.«
Ohne Verabschiedung ging er am Polizisten an der Tür vorbei und verschwand im Treppenhaus.
Alma lächelte den Beamten an. Der verzog keine Miene.
»Ich brauch auch nicht mehr lange. Zehn Minuten, okay? Könnten Sie mich nachher in die Kaserne bringen? Wie war doch gleich ihr Name, Herr Kollege?«
»Weinmeister, Frau Chefinspektor. Selbstverständlich steh ich zu Ihrer Verfügung.«
Alma Oberkofler schlenderte zwischen den Kollegen von der Spurensicherung durch die Räume. Wer lebte hier? Wie lebte man hier? War es eine Schlafwohnung, oder wurden hier auch Partys gefeiert? Wurde gekocht, geliebt, getrunken? Lebte man hier überhaupt, oder war es mehr ein Steuerabschreibungsobjekt? Was konnte so eine Wohnung kosten? Frisch renoviert, mindestens hundertfünfzig Quadratmeter groß, mit Blick über den 8. Bezirk? Zwei Millionen? Alma wusste es nicht.
Sie begann im Vorzimmer, das bis auf ein bescheiden gefülltes Bücherregal so gut wie leer war. An der Garderobe hingen eine Jeansjacke und ein grauer Mantel, davor stand ein Paar Laufschuhe auf einer Kokosmatte. Eine Tür führte ins Wohnzimmer, den Raum, in dem Langwieser gefunden worden war. Zwei Schlafzimmer, dahinter jeweils ein Bad, alles verbunden durch einen Schrankraum, der wohl als Ankleidezimmer diente. Auf der einen Seite hingen Hemden, nach Farben sortiert, von weiß über zartes rosa, hellblau bis hin zu einem kräftigen Ultramarin. Mit ein klein wenig Abstand drei karierte Flanellhemden, als würden sie sich schämen, mit den anderen auf einer Stange zu hängen. Die Anzüge sahen nicht aus, als würden sie vom Billig-Textilanbieter stammen, die gefalteten Unterhosen und gerollten Socken in den Schubladen überraschten Alma nicht mehr. Hier lebte ein Ordnungsfanatiker.
Die andere Seite des Ankleidezimmers war eindeutig der weibliche Teil. Auch hier dominierten Business-Kostüme in gedeckten Farben, wurden aber immer wieder von bunten Blusen oder Pullovern gestört, die wie hingemalte Farbtupfer wirkten. Diese Seite war bei Weitem nicht so ordentlich wie jene des männlichen Mitbewohners. Nichts war nach Farben sortiert, ein Kleid war halb vom Bügel runtergerutscht, und eine rote Bluse lag auf dem Boden. Eine Lade war halb herausgezogen, und BHs und Slips lagen durcheinander. Entweder lebte da jemand sein anarchisches Ich als Opposition zum Ordnungsfanatiker gegenüber aus, oder aber die Person hatte es sehr eilig gehabt.
Je länger sich Alma in der Wohnung aufhielt, desto weniger hatte sie das Gefühl, dass hier wirklich jemand gelebt hatte. Also, natürlich hatte man hier geschlafen, geduscht und Zähne geputzt und vielleicht sogar manchmal gekocht, aber trotzdem sah es aus wie in einer Musterwohnung. Nichts lag rum, alles wirkte drapiert, die aufgefächerten Magazine auf dem Sideboard, ein paar Briefe auf einer Anrichte, selbst die benutzte Espressotasse auf der Spüle sah aus wie eine Installation.
»Gehen Sie doch auch mal durch die Wohnung, Herr Weinmeister«, forderte sie den Beamten auf, der immer noch schweigend an der Tür stand. »Und dann sagen Sie mir, was Ihnen auffällt.«
»Ich weiß nicht, soll ich nicht hier stehen bleiben und aufpassen?«