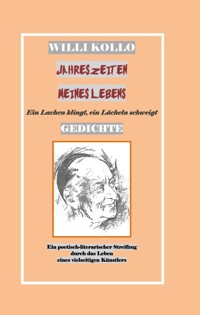24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lau Verlag & Handel KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Werk von Willi Kollo bezieht sich auf die Aufzeichnungen des Schweizers Henri de Catt, Privatsekretär und enger Vertrauter Friedrich II., der dem Preußenkönig während des Siebenjährigen Krieges (1756-1763) als Vorleser diente. Willi Kollo übersetzte diese Aufzeichnungen aus dem Französischen und verarbeitete sie zu einem Buch über Friedrich den Großen im Siebenjährigen Krieg. Wer die Memoiren de Catts und seine Gespräche mit Friedrich II. kennt, glaubt, mit ihnen ist ein Wunder geschehen. Der Verfasser erweckt den Menschen und die Persönlichkeit Friedrich des Großen zum Leben und macht dem Leser dessen Gedanken und Motivation zur Führung des Siebenjährigen Krieges verständlich. Dem Leser wird der Eindruck vermittelt, Friedrich selber zu sehen, hört ihn sprechen, sieht ihn gehen, jetzt, eben erst, in diesen Tagen. Selten ist von handelnden Personen, deren Namen und Taten wie ein sich entfernender Donner noch über Jahrhunderte nachhallen, ein so unmittelbar nahes, intimes, tief menschliches Bild, im Zeitpunkt ihrer Unternehmungen, gezeichnet worden. Hier sehen wir keinen "Helden", sondern einen immer leidenden, oft nahezu zusammenbrechenden, verzagenden und hoffenden, immer aber sich selbst in der Hand behaltenen Menschen. Wir sehen ihn unmittelbar Entscheidungen fällen, Irrtümer begehen, Gefahren missachten, seine eigene Kraft überschätzen, angreifen, geschlagen werden, halb vernichtet, enttäuscht, verzweifelt, erfolgreich, Bitterkeit der Tränen und heißer Spott dicht beieinander -, alles andere als ein Held: ein Mensch. Dies alles wüssten wir auch heute noch nicht von ihm, hätte sein Vorleser Henri de Catt nicht alles getreu aufgezeichnet. Die Erinnerungen de Catts begeben sich unmittelbar in das Zentrum des Geschehens. Sie waren, als er sie niederschrieb, noch heiß von Leben. Sie hatten sich eben erst ereignet. Sie unterlagen nicht der Kritik und Sichtung des Königs. Daher sind sie ein Dokument von unschätzbarem Wert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 704
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Willi Kollo
Friedrich der Große
Die Kunst zu überleben
Willi Kollo
Friedrich der Große
Die Kunst zu überleben
Von den Inhabern des Urheberrechts zum 25. Todestag von Willi Kollo herausgegebene, überarbeitete Fassung der Originalausgabe von 1970 »Der Krieg geht morgen weiter – Die Kunst zu überleben«.
Bibliografische Informationder Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diesePublikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-941400-36-8eISBN 978-3-95768-145-41. Auflage 2014© 2014 Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek/MünchenInternet: www.lau-verlag.de
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigungund Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form(durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren)ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziertoder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert,verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Atelier Versen, Bad AiblingTitelillustration: Steffen Faust, BerlinSatz und Layout: Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek
Inhalt
Zeittafel des Siebenjährigen Krieges
Vorwort
Erste Begegnung
1758
1759
1760
1761
1762
1763
Zum Autor
Zeittafel des Siebenjährigen Krieges
1756
29. August
Beginn des Siebenjährigen Krieges mit der Überschreitung der sächsischen Grenze durch die preußische Armee. Rückzug und Verschanzung der sächsischen Armee unter dem Kommando des sächsischen Feldmarschalls Friedrich August Graf von Rutowski auf einer Lagerstellung um die Festung Königstein. Einschließung der sächsischen Armee bei Pirna.
01. Oktober
Schlacht bei Lobositz in Böhmen: Erster Waffengang des dritten Schlesischen Krieges. Die Schlacht endete mit einem preußischen Sieg Friedrich II. über das österreichische Entsatzheer unter Feldmarschall Maximilian Ulysses Graf von Browne.
14. Oktober
Besetzung Sachsens durch preußische Truppen nach der Kapitulation der sächsischen Armee bei Pirna.
1757
06. Mai
Schlacht bei Prag in Böhmen. Preußischer Sieg über die Österreicher unter dem Oberbefehl des Prinzen Karl Alexander von Lothringen. Generalfeldmarschall Curt Christoph Graf von Schwerin fällt auf preußischer Seite.
18. Juni
Schlacht bei Kolin in Böhmen. Erster Sieg der Österreicher unter Feldmarschall Leopold Joseph Graf von Daun. Aufhebung der Belagerung von Prag und Rückzug der preußischen Armee nach Sachsen.
30. August
Schlacht bei Groß-Jägersdorf in Ostpreußen. Der zur Verteidignung Ostpreußens abgestellte Generalfeldmarschall Johann von Lehwaldt unterliegt mit seinen verfügbaren preußischen Truppen der zahlenmäßigen Übermacht der russischen Armee unter Stepan Fjodorowitsch Graf Apraxin.
07. September
Schlacht von Moys in Sachsen. Der österreichische General Franz Leopold von Nádasdy schlägt die preußische Vorhut unter General von Winterfeldt, der tödlich verwundet wird.
05. November
Schlacht bei Roßbach in Sachsen. Preußischer Sieg unter König Friedrich II. über die Franzosen unter dem Prinzen von Soubise und den koalierenden Reichstruppen unter dem Kommando von Joseph Friedrich Prinz von Sachsen-Hildburghausen.
22. November
Schlacht von Breslau in Schlesien. Sieg der österreichischen Hauptarmee unter Prinz Karl Alexander von Lothringen über preußische Truppen unter August Wilhelm Herzog von Bevern. Nach Einnahme der Festungen Schweidnitz und Breslau befindet sich Schlesien weitgehend wieder in österreichischer Hand.
05. Dezember
Schlacht bei Leuthen in Schlesien. Entscheidender Sieg der preußischen Hauptarmee unter König Friedrich II. über die österreichische Armee, die vom Prinzen Karl Alexander von Lothringen, dem Bruder des Kaisers, zur Rückeroberung Schlesiens kommandiert wurde.
1758
13. März
Henri de Catt trifft in Breslau ein. Beginn der Tagebuchaufzeichnungen.
29. April – 01. Juli
Preußische Truppen überschreiten die Grenze nach Mähren und belagern Olmütz. Durch den Überfall auf den Versorgungskonvoi bei Domstadl am 30. Juni geht das Hauptkontingent des Nachschubs an Munition und Verpflegung, der den Fortbestand der Belagerung sichern sollte, verloren. Friedrich II. hebt am 01. Juli die Belagerung von Olmütz auf und tritt einen Tag später den Rückmarsch nach Böhmen an.
25. August
Schlacht bei Zorndorf in Westpommern. Friedrich II. siegt über die russische Hauptarmee unter dem Oberkommando des Grafen Wilhelm von Fermor. Graf Fermor weicht daraufhin bis November langsam in ein Feldlager bei Landsberg an der Warthe zurück. Friedrich II. zieht mit seinen Truppen nach Süden Richtung Sachsen, um seine beiden von der österreichischen Hauptarmee bedrohten Armeekorps zu unterstützen.
14. Oktober
Schlacht bei Hochkirch in Sachsen. Das preußische Heer unter Friedrich II. wird nachts im Feldlager von Feldmarschall Graf von Daun überfallen und geschlagen.
1759
23. Juli
Preußen war seit dem Winter 1758/59 zu einer erneuten Offensive nicht mehr in der Lage. Die Russen und Österreicher versuchen eine Vereinigung ihrer Armeen zu erreichen, um Preußen gemeinsam zu schlagen. Generalleutnant Carl Heinrich von Wedel hat den Befehl, den russischen Vormarsch aufzuhalten. Dabei kommt es zu der Schlacht bei Kay, die mit einem Sieg der Russen unter dem Befehl des Feldmarschalls Pjotr Semjonowitsch Graf Saltykow endet.
12. August
Nach der Schlacht bei Kay kam es zur Vereinigung der russischen und österreichischen Armeen östlich von Frankfurt/Oder und zur Schlacht bei Kunersdorf. Friedrich II. wird von einer russisch-österreichischen Koalitionsarmee geschlagen, wodurch der Weg ins preußische Kerngebiet nach Berlin offen steht. Ihre Uneinigkeit verhindert eine Ausnutzung des Sieges. Saltykow zieht sich mit seinen Truppen über die Oder zurück.
20. November
Gefecht von Maxen in Sachsen. Preußische Niederlage unter Generalleutnant Friedrich August von Finck gegen österreichische Truppen unter Feldmarschall von Daun, die mit der vollständigen Niederlage des preußischen Korps von 15 000 Mann endet.
1760
23. Juni
Schlacht bei Landeshut in Schlesien. Ein preußisches Armeekorps unter dem Kommando des Generals de la Motte Fouqué wird vom österreichischen Feldzeugmeister Gideon Ernst Freiherr von Laudon geschlagen.
15. August
Schlacht bei Liegnitz in Schlesien. Preußische Truppen unter dem Befehl des Königs Friedrich II. besiegt ein österreichisches Heer unter der Führung Laudons. Russische und österreichische Abteilungen bedrohen die Mark Brandenburg, besetzen und plündern Berlin.
03. November
Schlacht bei Torgau in Sachsen. Friedrich II. besiegt Feldmarschall von Daun.
1761
Friedrich II. zieht sich im Sommer in eine verschanzte Lagerstellung gegen die anrückenden und sich vereinigenden Österreicher und Russen bei Bunzelwitz zurück.
30. September
Die Österreicher unter Laudon nehmen die wichtige Festung Schweidnitz in Schlesien ein.
05. Oktober
Der englische Premierminister William Pitt wird gestürzt. Das preußisch-britische Bündnis wird aufgekündigt. Die jährlichen Subsidienzahlungen in Höhe von 4 Millionen Reichstalern an Preußen werden eingestellt.
16. Dezember
In Hinterpommern wird Kolberg von den Russen erobert. Damit fällt ein wichtiger Hafen für den Nachschub in die Hände des Gegners.
1762
05. Januar
Die russische Zarin Elisabeth Petrowna, die als Ziel der russisch-österreichischen Allianz die Niederwerfung Preußens verfolgte, stirbt. Thronfolger wird Peter III. aus dem Hause Holstein-Gottorf, ein Verehrer Friedrichs II.
05. Mai
Unterzeichnung eines Friedens- und Freundschaftsvertrages mit Rußland in St. Petersburg, dem sich Schweden am 22. Mai anschließt.
20. Juni
Ende der Aufzeichnungen de Catts – Weiterführung des Buches bis zum Ende des Siebenjährigen Krieges und bis zur Rückkehr Friedrich des Großen nach Berlin durch Willi Kollo anhand von wissenschaftlichen Aufzeichnungen.
21. Juli
Schlacht bei Burkersdorf. Friedrich II. greift die hochgelegene Lagerstellung der Österreicher an und besiegt die österreichische Armee unter Feldmarschall von Daun. Nach dem Sturz und der Ermordung von Peter III. und Auflösung des Bündnisses durch Katharina II., versteht es Friedrich, die russischen Truppen, die sich aus dem Gefecht heraushalten sollen, mit in die Gefechtsaufstellung einzubinden. Marschall von Daun muss seine Stellung und die Festung Schweidnitz aufgeben und sich auf die böhmische Grenze zurückziehen.
29. Oktober
Schlacht bei Freiberg. Prinz Heinrich siegt über ein um Reichstruppen verstärktes Armeekorps der Österreicher. Mit dieser letzten großen Schlacht war der Feldzug in Sachsen beendet.
1763
15. Februar
Ende des Siebenjährigen Krieges. Friedensverhandlungen in Hubertusburg führen zu einer Regelung über den Status quo ante zwischen Preußen, Österreich und Sachsen.
Vorwort
Der österreichische Außenminister Wenzel Anton Graf von Kaunitz schloss im Auftrag der Kaiserin Maria Theresia ein Bündnis mit Frankreich gegen Preußen, dem Sachsen, Russland und Schweden beitraten, um die am 28. Juli 1742 im »Frieden von Berlin« an Preußen gefallenen schlesischen Gebiete zurückzuerobern. Dies veranlasste Friedrich II. am 1. September 1756 im sächsischen Pirna einzumarschieren, um mit einem Präventivschlag diesem Plan zuvorzukommen, woraus der »Siebenjährige Krieg« entstand.
Das Wort des Freiherrn vom Stein »weil wir sterben müssen, sollen wir mutig sein« behält seinen Klang, wohin immer sich auch die Welt bewegt. Mutlos können wir nicht leben und Lebensangst ist ein schlechter Ratgeber, weil sie Sterbensangst ist. Politik ist Risiko. Kein Politiker, welcher Nation auch immer, kann große Politik machen, bezieht er diese Philosophie in sein Kalkül nicht ein.
Friedrich II., der Große, tat es. Er rechnete im Siebenjährigen Krieg fast täglich mit den Giftampullen, die er bei sich trug. Er war, um mit Egon Friedell zu sprechen, »physiologisch minderwertig wie alle Genies«. Von Haus aus zart und sensibel, hasste er den Krieg, weil er die Kultur vergötterte. Das hinderte ihn nicht daran, ihn zu führen und zwar solange, bis er sein Ziel erreichte, seinem Volk die Möglichkeit zu schaffen, zu leben, statt bloß unter den Habsburgern zu existieren.
Als Kronprinz – ein halbes Kind noch – befand sich Friedrich 1730, nach der Hinrichtung seines Freundes Hans Hermann von Katte, der er beizuwohnen hatte, und mit dem er vor seinem Vater nach England fliehen wollte, in einer lebensgefährlichen Lage. Besonders deutlich wird dies, wenn man weiß, dass nach dem Tode seines Vaters und des Generals von Grumbkow, dem engsten Berater und Vertrauensmann des verstorbenen Königs, herauskam, dass General von Grumbkow ein von Wien bezahlter Spion und Zwischenträger war, der Wien mehrfach auf die gefährlichen Ansichten und Absichten des Kronprinzen hingewiesen und vor dem Kriegsgericht den Kopf des Kronprinzen gefordert hatte. Es war also eine hochgewagte, antik dramatische Rebellion, die Kronprinz Friedrich gegen die »Obrigkeit«, seinen cholerischen Vater, Friedrich Wilhelm I., geübt hat.
Der Vater Friedrichs, der Golem seiner Kindheit, war die Dominante in seinen Träumen. Ihn fürchtete er noch als siegreicher Feldherr. Vor ihm rechtfertigte er sich noch immer mit all seinen Taten. Sein Vater hielt ihn für einen »Fallott«, einen Versager, der nicht zum König taugte, und Friedrich wusste, dass er damit nicht Unrecht hatte. Dieser »Fallott« steckte tief in ihm. Aber die grausame Furcht vor dem Vater, der ihm die ungeheure Last Preußen aufgebürdet hatte, riss ihn empor auf die Stufe des Genies. Friedrich Wilhelm I. hinterließ seinem Sohn eine Armee von 80 000 Mann, die ihm der einzige Ausweg schien, in der europäischen Politik ein Mitspracherecht zu erhalten, um den arroganten Demütigungen des Wiener Hofes und der Habsburgischen Expansion in Richtung Preußen zu entrinnen. Wenn der Vater auch seinen »lieben Herrn Nachfolger« testamentarisch bat, ja keinen Krieg vom Zaun zu brechen, so erwartete er in Wahrheit gerade dies von ihm.
Der »friderizianische Krieg« war ein Vermächtnis seines Vaters. Er packte seinem viel zarteren, musischen Sohn dieses Schicksal auf, wie der preußische Grenadier Gewehr, Munition und Gepäck zu schleppen hatte. Der Vater zerschlug dabei eine sehr feine Seele, so, wie man kostbares Porzellan zerschlägt. Sie bestand nur noch aus einzelnen Bruchstücken, die Friedrich sein Leben lang nicht mehr zusammen bekam, sodass er ein Drittes mit aller Macht »zusammenfügen« musste, nämlich Preußen.
Deshalb war die »Anordnung« seines Neffen und Thronfolgers, Friedrich Wilhelm II., des dicken Rosenkreuzers, ihn in der Gruft der Potsdamer Garnisonskirche neben seinem Vater beizusetzen, statt, wie testamentarisch von Friedrich II. verfügt, unter dem offenen Himmel Sanssoucis, bei seinen Hunden, eine Herzensroheit ohnegleichen, eine tintenschwarze Taktlosigkeit, beschämend ahnungslos und unwissend. Friedrich hatte seinen Vater gehasst, die Gruft in seinen Träumen gefürchtet. Die Trennung vom Vater war Friedrich trotz Testament und europäischer Autorität selbst im Tod nicht gelungen. Auferstanden im Großneffen, zog der Vater ihn in die Gruft zu sich zurück, gehorsam neben sich.
Nachfolgende Generationen warfen Friedrich II. vor, er habe weder Lessing noch Goethe in seiner Zeit gekannt. Doch, er kannte sie, aber er machte sich nichts aus ihnen. Das Beste von Lessing, »Minna von Barnhelm«, hat er nicht mehr lesen können. Was konnte ihm Goethes ekstatischer »Werther« bedeuten, ihm, der Voltaire verehrte? Er war durch seinen Geschmack »Racine, Corneille und die antiken Dramatiker« so sehr an die Form gebunden, an die Einheit von Raum und Zeit, dass er die shakespeareschen Naturalismen Goethes in »Goetz von Berlichingen« nicht mehr zu würdigen vermochte. Friedrichs eigentliche und hoch befreiende Tat für die deutschen Autoren bestand nicht darin, dass er sie las oder nicht las. Sie bestand darin, dass er seinen Stern über Deutschland aufgehen ließ und in das glänzende Licht seiner Taten tauchte, nachdem es seit 1648 in tiefster Finsternis gelegen hatte, nach dem harten Willen Richelieus, der Frankreich sonst nicht hätte zur Weltmacht bringen können. Der Dreißigjährige Krieg hatte Deutschland um 100 Jahre zurückgeworfen. Seine Künstler darbten. Seit Friedrich sprach man wieder von ihnen. Man interessierte sich neuerdings für das, was sie zu sagen und zu schreiben hatten. Es war Friedrich, der den Dreißigjährigen Krieg beendete und bei Roßbach den scheinbar unbesiegbaren Glanz Frankreichs ad absurdum führte.
Friedrich der Große war in seinen wenigen privaten Stunden heiter, leise, sehr höflich, diskussionsfreudig, witzig, bis zur Albernheit skurril. Hier liegt die ewige Quelle des Genies: das Naive. Die Unschuld des Genies ist ebenso groß wie sein Raffinement. Er war pedantisch genau, ein Pfennigfuchser. Was er tat, überlegte er mit Akribie, bezüglich aller seiner Folgen. Er war fleißig. Spottlustig. Von einer sehr geistigen Eitelkeit, nicht aber einer äußeren. Er ließ sich gehen. Wie konnte es auch anders sein, wenn er sich in Schweiß, Fieber, Koliken und Hämorrhoiden-Anfällen stundenlang schlaflos auf seinem Lager gewälzt hatte, um dann, drei Uhr morgens, aufzustehen, und, noch immer nass am Körper, eine Tasse Kaffee hastig schlürfend, aufs Pferd zu steigen, im Schneegestöber auf Erkundung auszureiten. Wer macht da wohl noch große Toilette?
Dies alles wüssten wir auch heute noch nicht von ihm, hätte sein Vorleser Henri de Catt nicht alles getreu aufgezeichnet. Die Erinnerungen de Catts begeben sich unmittelbar in das Zentrum des Geschehens. Sie waren, als er sie niederschrieb, noch heiß von Leben. Sie hatten sich eben erst ereignet. Sie unterlagen nicht der Kritik und Sichtung des Königs. Daher sind sie ein Dokument von unschätzbarem Wert.
Selten ist von handelnden Personen, deren Namen und Taten wie ein sich entfernender Donner noch über Jahrhunderte nachhallen, ein so unmittelbar nahes, intimes, tief menschliches Bild, im Zeitpunkt ihrer Unternehmungen gezeichnet worden. Hier sehen wir keinen »Helden«, sondern einen immer leidenden, oft nahezu zusammenbrechenden, verzagenden und hoffenden, immer aber sich selbst in der Hand behaltenden Menschen. Wir sehen ihn unmittelbar Entscheidungen fällen, Irrtümer begehen, Gefahren missachten, seine eigene Kraft überschätzen, angreifen, geschlagen werden, halb vernichtet, enttäuscht, verzweifelt, erfolgreich, Bitterkeit der Tränen und heißer Spott dicht beieinander –, alles andere als ein Held: ein Mensch.
In den Original-Erinnerungen de Catts fehlt aber sozusagen die ganze »Kulisse«. Man sieht weder Vorder- noch Hintergrund. Der König spricht, aber er bewegt sich nicht. Kurz gesagt, es fehlt dem Kriegstheater, von dem der König oft spricht, die gesamte Inszenierung, auf die sich Friedrich selber so meisterhaft verstand, nicht aber sein Vorleser. Der Verfasser hat diese Nachinszenierung insoweit besorgt, wie sie sich aus des Königs Äußerungen zwingend ergibt. Da durch Breslau, das Winterquartier, Truppenteile marschiert, geritten und Transportwagen gerumpelt sein müssen, lässt der Verfasser dies alles geschehen. Aus der Summe solcher Auslassungen und Hinzufügungen erst ergibt sich »Leben«, vor diesem Leben erst ersteht die Person des Königs.
Man muss schon ein wenig Zeus gleichen, um aus dem eigenen Haupt einen neuen Friedrich entspringen zu lassen wie weiland Pallas Athene. Man muss ihn mit einem neuen Frühling, Sommer, Herbst und Winter umgeben und alle die Menschen, mit denen er lebte, neu erschaffen. Selbst ihre Worte muss man neu sprechen, ihre Tränen neu weinen, ihren längst erloschenen Kummer neu empfinden. Wir lesen in de Catts Erinnerungen, der König habe an einem bestimmten Tag aus einem bestimmten Gram heraus geweint. Wir lesen es. Wir wissen es. Aber wir weinen nicht mit. Dichtung muss uns den alten Gram so nahe rücken, ihn so sehr zu unserem Gram machen, dass wir mit ihm weinen, dass wir mit Friedrich lachen, spotten, zittern und uns mit ihm fürchten.
Man sollte die Zeit nicht vergessen, in der es erlebt und in der es niedergeschrieben worden ist. Es waren die Tage, in denen »Werther« wegen seiner Empfindsamkeit zu einem Weltschlager wurde, in der es zum guten Ton gehörte, zu seufzen, zu stöhnen und gerötete Augenlider zu haben.
De Catt gibt zu, dass er Vorgänge bei Kämpfen, Verfolgungen oder Schlachten nicht immer aus eigenem Erleben darstellen konnte, weil er schließlich über seinen eigenen Gesichtskreis nicht hinausschauen konnte, selbst wenn er anwesend war, und dass er sich nachträglich an die besseren Kenntnisse führender Männer gehalten habe. Hier stehen aber heute Quellen zur Verfügung, die uns ein so genaues Wissen vermitteln, wie es selbst dem König noch nicht zugänglich war. Der Verfasser konnte hier also das offensichtlich Falsche oder Fehlerhafte so darstellen, wie es sich im Kampf wirklich begeben hatte. Die innere Wahrheit der Vorgänge ist allein entscheidend, und diese ist an keiner Stelle verletzt, wohl aber hier und da verdeutlicht worden.
Ebenso relativ wie das, was wir Wahrheit nennen, ist das, was wir als Wirklichkeit anerkennen. Goethe nannte deshalb seine Erinnerungen »Dichtung und Wahrheit«. Historiker nannten auch die Aufzeichnungen de Catts »eine Mischung aus Wahrheit und Dichtung«. Umso weniger kann dieses Buch etwas anderes sein. Was aber ist Wirklichkeit? Auch Stimmen derer, die wir noch zu ihren Lebzeiten umjubelten, sind, ein paar Jahre nach ihrem Ableben, nur Stimmen von Toten. Um sie herum ist kein Leben mehr. Es ist, als sei der Gürtel von Sauerstoff der sie umgab, einer Sprühwolke gleich, entwichen.
Die Erinnerungen de Catts brechen im Juni 1762 ab, als nach dem Tod der Zarin Elisabeth I. – durch einen russischen Emissär – die ersten Kontakte zwischen Zar Peter III. und Friedrich II. erfolgen, die den allgemeinen Frieden einleiten. Der Verfasser zog es vor, die Erinnerungen anhand der so reich vorliegenden historischen Kenntnisse bis zu dem Tag und der Stunde fortzusetzen, an dem der König nach Berlin heimkehrt, sein Schloss betritt und dort zu Abend isst, um sich dann, nach sieben Jahren, zum ersten Mal in das eigene Bett zu legen, ohne befürchten zu müssen, durch irgendeine aufregende Kriegsmeldung herausgescheucht zu werden.
»Die Kunst zu überleben«. Nichts anderes als diese Kunst hat Friedrich sieben Jahre lang geübt, in der er schließlich Meister wurde, Meister des Überdauerns seiner Leiden. Er hat nicht »gesiegt«, er hat »überlebt«. Warum hat er überlebt? Weil er nicht bereit war, die Vision, die ihm Leben für sein Volk verhieß, zu verleugnen. Die einzige Seinsmöglichkeit eines Menschen liegt in seinem Traum. Wer nicht mehr träumt, stirbt.
Die ihn lieben, sehen ihn als den letzten Reiterkönig – wie in den Kriegstagen – einsam und in der Morgenfrühe durch die Geschichte reiten, ein Kundschafter, mit scharfen Augen ausspähend nach dem ewigen großen Feind der Menschheit, den immer von neuem es zu stellen und zu besiegen gilt: das Schicksal. Die anderen, die weit hinter ihm langsam und zögernd folgen, können ihn nur schwer erkennen und ausmachen, denn er reitet wie immer, einsam im Nebel, von ihm zur Hälfte eingehüllt.
Willi Kollo
Erste Begegnung
Der König von Preußen besichtigte 1755 seine in Wesel stationierten Regimenter. Noch wusste niemand, dass sie schon ein Jahr später Sachsens Grenze überschreiten und in den Siebenjährigen Krieg marschieren würden. Nach der Inspektion fiel ihm ein, sich im benachbarten Holland umzusehen. Er nahm dazu seinen Kammerdiener mit, den er übrigens während des Krieges zu Festungshaft verurteilte, und einen Oberst der Pioniertruppen, Johann Friedrich von Balbi. Zu dieser Zeit war der König durch seine Siege in zwei schlesischen Kriegen bereits weltberühmt. Seine Bildnisse waren jedermann bekannt. Um Holland inkognito durchstreifen zu können, machte er sich den Spaß, sich für den »Ersten Kapellmeister Seiner Majestät, des Königs von Polen« auszugeben, als welcher er einen eleganten zimtfarbenen Tuchrock anzog und eine riesige runde Perücke aufsetzte. Zu Späßen und Mystifikationen war er zu jener Zeit immer aufgelegt.
Wie er mir später lachend erzählte, hatte er in Amsterdam eine Begegnung mit einem dort sehr bekannten, wohlhabenden Kaufmann, der über eine Galerie seltener und kostbarer Bilder verfügte, die den für Kunst immer aufgeschlossen König neugierig machten. Er begab sich mit seinen Begleitern dorthin. Dem Kaufmann wurde der »Erste Kapellmeister des Königs von Polen« gemeldet. Mit Höflichkeit begrüßte er ihn, wurde aber alsbald gewahr, wer sein Besucher wirklich war. Vielleicht fürchtete er internationale Komplikationen, jedenfalls sagte er dem König, als dieser sich ihm unter seinem Inkognito vorgestellt hatte:
»Ergebenster Diener, Herr Kapellmeister! Unglücklicherweise muss ich in dringenden Geschäften fort, sodass ich Ihnen meine Bilder nicht zeigen kann. Vielleicht ist es Ihnen möglich, später noch einmal vorzusprechen.«
Der König sah ihn durchdringend an. Weder konnte er sich ihm zu erkennen geben, noch konnte er, als König, noch einmal »später vorsprechen«. Es blieb ihm als »Erster Kapellmeister« seiner polnischen Majestät nichts weiter übrig, als den Rückzug anzutreten, was er immer ungern tat. Gewiss haben beide Eulenspiegel einander sarkastisch angelächelt.
Danach bestieg der König einen Kanalschlepperkahn nach Utrecht, dessen geräumige Kajüte er wegen des stürmischen Wetters mietete. Auch ich war auf diesem Kahn nach Utrecht unterwegs, hielt mich aber draußen an der Reling auf. Der König, den ich nicht kannte, ließ mich durch Oberst von Balbi höflich zu sich bitten. Ich würde in der Kajüte besser geschützt sein. Das Erste, was mir an ihm auffiel, waren seine großen Augen. Er empfing mich:
»Bonjour, Monsieur. Sie werden hier besser aufgehoben sein. Wie ist Ihr Name?«
Er sprach französisch, was ich, in der französischen Schweiz geboren, beherrschte. Deutsch sprach ich nicht.
Ich empfand erst viel später, dass hier einer jener merkwürdigen Zufälle waltete, deren sich das Schicksal oft bedient, um zwei Menschen zueinander zu führen, deren Gedanken und Empfindungen in vieler Hinsicht übereinstimmen. Wie sollte ich auf den Gedanken kommen, dass ich später an seiner Seite, während er seine schweren Niederlagen erlitt und schließlich doch triumphierte, ein Zeuge der Geschichte sein würde.
Ich teilte ihm mit, dass ich in Utrecht bei Professor Wesseling, einer Kapazität auf dem Gebiet des Staatsrechts, Philosophie und Geschichte zu studieren wünschte. Sein Gesicht nahm einen geringschätzigen Ausdruck an:
»Ah, diese Geschichtsprofessoren, das sind alles Kleinkrämer und Ignoranten!« Als er meine Betroffenheit sah, setzte er sogleich hinzu: »Vielleicht macht Wesseling, von dem man viel reden hört, eine Ausnahme. Wenigstens nennt er sich nicht, nach der neuesten Mode, Wellenius, um sich, wie viele seiner Kollegen, ein antikes Mäntelchen umzuhängen.«
Er kam auf Christian Wolff zu sprechen, den sein Vater – ich erfuhr es erst später – wegen seiner atheistisch-skeptischen Lehren von der Universität Halle a. d. Saale hatte relegieren lassen und den Friedrich 1740 vollständig rehabilitierte und von Marburg wieder nach Halle zurückholte. Seine Philosophie »vom zureichenden Grund«, sein »Satz vom Widerspruch« und seine Lehre von der »prästabilisierten Harmonie«, unmittelbar auf Leibniz zurückgehend, hatte auf den König tiefen Eindruck gemacht.
Von Holland sagte er, dass er dieses Land nicht weiter kenne, aber er sprach über seine Regierung und deren Politik mit so großer Sachkenntnis und Informiertheit, dass ich staunen musste, dies aus dem Munde des »Ersten Kapellmeisters des Königs von Polen« zu vernehmen. Meine Überraschung bemerkend, setzte er sogleich lächelnd hinzu, dass er von Politik nichts verstehe; man müsse gut lügen können, wenn man sich auf dies Gebiet begeben wolle, und das läge seinem Wesen nicht. Im Gegensatz zu seinen Versicherungen machte er jedoch so überaus witzige und boshafte Äußerungen über die meisten europäischen Politiker, ihre Souveräne und Länder, dass ich mich doch wunderte, einen »Ersten Kapellmeister des Königs von Polen« auf so vielen verschiedenen Gebieten höchst bewandert zu sehen.
Er sagte: »Ich habe mich schon früh für das alles interessiert, worüber meine Eltern gar nicht glücklich waren. Jedoch studierte ich nachts und heimlich, sodass ich sie über meine wahren Absichten täuschen konnte.«
Während unser Boot sich Utrecht näherte und den Hafen ansteuerte, verschwieg ich ihm, wie verwirrt ich über seine schillernde Persönlichkeit war. Gewiss hatte er meine Skepsis bemerkt, denn ein belustigter Ausdruck lag ständig über seinen Zügen. Als wir das Schiff verließen, lud er mich ein, später mit ihm zu Abend zu essen, was nicht lange dauern würde, da er noch nachts weiterführe. Zu meinem Bedauern musste ich absagen.
Seine Begleiter, was mir erst später auffiel, hatten die ganze Zeit über respektvoll geschwiegen und nur hin und wieder ein Lächeln gezeigt. Ich zerbrach mir, wieder allein, den Kopf über den »König von Polen«, der wahrhaftig über ein großes Arsenal hochbegabter Köpfe verfügen müsste, wenn er einen solchen Mann zu seinem »Ersten Kapellmeister« machte. Bald ersah ich aus den Zeitungen, wer mein Gesprächspartner auf dem Kanalschlepperkahn gewesen war, zumal man sich erzählte, er habe seine Eulenspiegeleien selbst auf dem Weg nach Arnheim, nachts über seine Grenze gehend, fortgesetzt. Er und seine Begleiter fuhren in einem Wagen, von einem Gepäckwagen gefolgt. Kurz vor der Grenze setzte sich der König zu seiner Bagage und hieß Oberst von Balbi, in seinem Wagen Platz zu nehmen, denn er befürchtete, dass er an der Grenze eine der vielen Huldigungen entgegennehmen müsse, die seine Geduld oft strapazierten. An der Grenze, in tiefer Nacht, hatten sich bereits Untertanen, Magistrat und Geistlichkeit versammelt, die nun Oberst von Balbi bei Fackellicht als den »Retter der protestantischen Christenheit« feierten, so, dass dieser nicht nur in des Großen Friedrich Kutsche, sondern unmittelbar neben Luther und Gustav Adolf von Schweden zu sitzen kam.
Hinter ihm, auf dem Gepäckwagen, amüsierte sich der König »königlich«. Sechs Wochen später erhielt ich ein Kabinettsschreiben aus Potsdam, mit dem Seine Majestät mir mitteilen ließ, dass Sie an der Unterhaltung mit mir Gefallen gefunden hatte; wenn ich den Reisenden, der mich auf dem Kanalschlepperkahn »an der Nase herumzuführen« versucht habe, wiedersehen wollte, so würden Sie mich mit Freuden in Ihrer Residenz begrüßen. Ich möchte die Bedingungen nennen, unter denen das geschehen könnte. Ich antwortete sogleich und versicherte dem König des tiefen Eindrucks, den er auf mich gemacht hatte. Wen würde ich lieber zum Herrn meines Schicksals machen als ihn? Er antwortete alsbald, und ich machte alles zu meiner Abreise fertig. Da griff wiederum das Schicksal ein. Ich wurde krank. Die Ärzte prognostizierten eine lange Dauer. In diesem Zustand konnte ich an eine Reise nicht denken. Der König hatte Verständnis dafür und wünschte mir baldige Genesung. Sobald diese eingetreten sei, solle ich mich melden.
Ich war nicht wenig überrascht, als er 1757, zwei Jahre nach unserer seltsamen Begegnung, aus seinem Hauptquartier an mich schreiben ließ, ob es mir nun möglich sei, Anfang März 1758 zu ihm zu stoßen. Er, der eine Welt in äußerste Bewegung gesetzt hatte, Schlachten schlug, die jedermann in Emphase versetzte, zu Begeisterung oder Widerspruch, immer aber zu Teilnahme führten, dachte meiner, eines jungen Studenten aus Utrecht. Mein Herz klopfte, als ich ihn wissen ließ, dass ich mich im Frühjahr 1758 zu ihm begeben würde.
1758
13. März 1758, Breslau
Derzeitiges königliches Hauptquartier war Schlesiens Hauptstadt Breslau. Die Stadt glich einem Hexenkessel, in dem man überall auf die Truppen des Königs von Preußen stieß. Bagagewagen, Feldküchen, Haubitzen, Munitionswagen, Marketendereien rasselten Tag und Nacht über das holprige Pflaster, als ich in meinem Hotel ankam, wo mir ein Kurier alsbald ein Schreiben des königlichen Kabinetts zustellte. Man befahl mich in das Schloss, von dem aus der König residierte. Zum zweiten Mal stand ich vor ihm. Kaum konnte ich die Erschütterung verbergen, als ich ihn so verändert sah. Das war nicht mehr der lächelnde Reisende im zimtfarbenen Tuchrock, mit der riesigen Perücke, der ehemals extravagante Mann von Welt, der so heiter und funkelnd zu plaudern verstand und sozusagen den Frieden mit sich führte. Nun stand er, nicht mehr gepflegt und mit Geschmack gekleidet, in einer verstaubten Generalsuniform vor mir, an der ein Knopf fehlte und die salopp und leger an ihm herunterhing. Er, der damals von zwar nicht großer, aber fast fülliger Statur war, mit gesundem Teint, stand jetzt abgemagert vor mir, mit Schatten unter den Augen und auf den bleichen Wangen. Man sah ihm die unerhörten Anstrengungen an, die der Krieg ihm bereits abverlangt hatte. Die Schlaflosigkeit und tiefen Sorgen, die ihn heruntergezogen hatten. Er bemerkte sofort meine Empfindungen und fragte mit seiner höflich leisen Stimme:
»Nun, würden Sie mich wiedererkannt haben, stünde jetzt nicht der König von Preußen vor Ihnen?«
»Sofort, Sire!«
»Woran?«
»An Ihren Augen, Sire!«
Er schwieg, dann sah er auf und sagte: »Es ist ein Hundeleben. Ich bin heruntergekommen. Ich muss mich um alles kümmern, niemand kümmert sich um mich.«
Stammelnd erwiderte ich: »Noch mehr als über Ihre großen Siege, Sire, staunt alle Welt über die Energie, mit der Eure Majestät sich den unfassbaren Strapazen gewachsen zeigen.«
Er zuckte mit den Achseln.
»Was bleibt mir übrig? Meine Feinde diktieren mein Schicksal; ich versuche, ihre Diktate hier und da ein wenig zu korrigieren.«
Er lächelte, dann ging er an einen Tisch, auf dem seine berühmte Flöte unter vielen Papieren lag, eine Tabatiere tauchte unter Dokumenten und Zeichnungen des Königs auf, die seine taktischen Überlegungen zum Gegenstand hatten. Er ging auf und ab:
»Ich wünsche, dass Sie mich so viel wie möglich begleiten. Mitunter wird es sich nicht machen lassen. Es ist schwierig, einen Krieg zu führen, wenn man keinerlei Anregungen hat. Mein getreuer Marquis d’Argens, einer der feinsten Köpfe, ist zu mir nach Breslau gekommen. Aber das Leben hier ist nichts für ihn. Sein Körper hält dem nicht stand. Er bildet sich die meisten Leiden ein, einige hat er auch. Darunter leiden die Gespräche. Seine Frau ist bei ihm. Meine Offiziere und Generäle verstehen ihr Handwerk, aber sie sind mit den wichtigsten Dingen beschäftigt.« Er blieb stehen und sah mich beim Sprechen kaum an, als sagte er es zu sich selber: »Mehr als Sprechen benötige ich – Aufrichtigkeit. Anstand. Die Lüge ist überall. Ich begegne ihr auf Schritt und Tritt. Undankbarkeit, Betrug und Verrat sind mein tägliches Brot. Man könnte an den Menschen verzweifeln, gäbe es nicht immer wieder einige unter ihnen, um derentwillen man den anderen ihre Scheußlichkeit verzeiht.«
Da er schwieg, erinnerte ich ihn leise an die Treue seiner Soldaten, ihre unerhörte Tapferkeit, ihre Verzichte und Entsagungen, die sie alle in seinem Namen leisteten. Er sagte nichts. Dann drehte er sich zu mir und sah mich direkt an: »Selbstverständlich habe ich Erkundigungen über Sie einziehen lassen. – Sie entsprechen dem Bild, das ich mir von Ihnen gemacht habe. Mein Kabinettssekretär Eichel sagte mir, Sie wünschten in die Schweiz zu reisen?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!