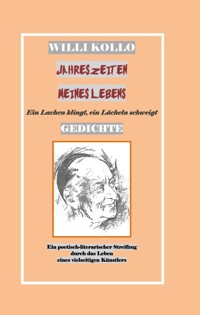9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn ein Autor, Textdichter, Komponist, Pianist, Liedersänger und Kabarettist seine Lebenserinnerungen schreibt, kann man sich auf pointierte Aussagen freuen. Wenn zudem das Wirken seines als Komponist und Dirigent nicht weniger berühmten Vaters Walter (1878-1940) aus der Zeit der Jahrhundertwende bis in den Zweiten Weltkrieg mit allem was politisch und kulturell hineinspielt, Gegenstand ist, wird das Buch ein einzigartiges Zeitdokument. Willi Kollo (1904-1988) hat seiner Tochter, der Musikverlegerin und Künstleragentin Marguerite Kollo, umfangreiche Aufzeichnungen hinterlassen. Mit Bild-Dokumenten, hilfreichen Begriffserklärungen und einem Namensregister, welches die Funktionen und Lebensdaten der genannten Personen liefert, wird das Buch zu einem Standardwerk. Walter Kollo wurde Operettenkomponist –, in Erinnerung bleiben seine vielen Lieder und Operetten wie "Drei alte Schachteln" und "Wie einst im Mai". In Anekdoten wird die Kunstszene Berlins beschrieben und auf die fördernden Kontakte Walters, die meist jüdischen Autoren und Theaterintendanten und die vielen berühmten Künstler dieser Zeit eingegangen. Walter Kollodzieyski hatte 1902 mit dem Wagemut der Jugend den Sprung in das kochende Meer der Reichshauptstadt gewagt. Königsberg, Warschau, das waren alles Städte, aber Berlin war mehr, war ein Begriff. Berlin, das war die gewaltige Zentrifuge, die alles magnetisch an sich riss, es auspresste, ein paar Mal durch den Wolf drehte, und was nicht genug Schwergewicht besaß, wieder an die Peripherie versprühte, wo es verkümmern und untergehen mochte.... Willi Kollo verbrachte seine drei ersten Lebensjahre bei seiner Großmutter in Ostpreußen, spielte "im Sarg der Großmutter", weil sein Vater sich in Berlin verwirklichen musste und seine Mutter als "Tingeltangelsängerin" immer unterwegs war. Seine Leiden in den Berliner Schulen, später in einem Internat, die geprägt waren von gewalttätigen Erziehungsmethoden, aber auch mit seltenen Freund- und Liebschaften, schildert er eindringlich. Der Erste Weltkrieg brachte traurige Abschiede, den "Film als neue Weltmacht", die Einquartierung von Soldaten – und unwahrscheinlichen Erfolg mit dem Stück "Immer feste druff", dessen Titel sich angeblich bezog auf einen Ausspruch des damals so beliebten Kronprinzen Wilhelm von Preußen. Die Schilderung der 1920er Jahre und der Nazizeit gerieten zum eindrücklichsten Kapitel und lesen sich wie ein Roman. Wir erfahren hier von der Art und Weise, wie beide, Vater und Sohn, sich unter größten Anstrengungen der politischen Vereinnahmung entziehen konnten sowie von der Willi Kollo eigenen schlagfertigen Rechtfertigung vor der britischen Entnazifizierungsbehörde. Eine Leserin schrieb: Anlässlich Ihrer Lesung habe ich mir das Buch mit den Erinnerungen Ihres Vaters gekauft und habe es vor ein paar Minuten ausgelesen. Das Buch wurde von Seite zu Seite und von Kapitel zu Kapitel spannender!!! Es hat mich sehr berührt; ich habe nicht nur etwas über die Familie Kollo erfahren, sondern auch über das persönliche und politische Umfeld dieser Jahre. Man kann nur jeden ermuntern, sich dieses Buch vorzunehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
WILLI KOLLO
„Vergangenes
ist nicht vergessen…“
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Im Sarg meiner Großmutter
Willis Geburt in Königsberg und seine Ankunft im Berlin des Jahres 1907
„Ich bin also gar nicht wirklich Kollo.“
Herkunft der Familie
Erste Lieder und erste Liebe
Walters Anfänge in Königsberg und Stettin
In der Kaiserstadt Berlin
Walter und Maries Ankunft in Berlin – Erste Erfolge
Berliner Sommernachtstraum
Berliner Theaterleben – Zeiten des Friedens
Zwischen Skylla und Charybdis
Eheprobleme der Eltern und musikalische Anfänge des kleinen Willi
Nicht nur schöne Aussicht auf die Hamburger Alster
Walters erstes eigenes Theater und Willis sensible Kindheitserfahrungen
Mit dem Rohrstock hinaus ins Leben
Willis erste, grausame Schuljahre
Immer feste druff!
Der Erste Weltkrieg
Walter Kollo auf der Höhe seiner Kunst
Die tolle Komtess und Drei alte Schachteln
„Herr Baron von 44“
Willis Schulzeit im Internat in Blankenburg am Harz – Ende des Ersten Weltkrieges
„Als ich dieses Stück gemacht, habe ich nur an dich gedacht“
Noch ein Theater – von Walter für Alice Hechy
Entdeckung eines jungen literarischen Talents
Willis berufliche Anfänge
Die zwanziger Jahre, wild und leichtsinnig
Kabarett, Theater, Film – und der Schwanengesang der Weimarer Republik
„Alle Feuer dieser Welt“
Machtergreifung
„Mein Engel geht schweigend neben mir“
Willi Kollo und die Nagis
Zur alten Liebe
Nach dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg
ERGÄNZUNG DES KÜNSTLERISCHEN LEBENSLAUFES DES AUTORS WILLI KOLLO
Wie es weiterging. Die zweite Hälfte eines erfolgreichen Künstlerlebens
Erklärendes Nachwort von Marguerite Kollo
Begriffserklärungen
Namensregister
Vergangenes ist nicht vergessen
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Namensregister
Vergangenes ist nicht vergessen
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
Vorwort
von Willi Kollo
Man hat mir oft angetragen, ich solle über das Leben meines Vaters, des Berliner Operetten-Komponisten Walter Kollo, schreiben. Wie könnte ich das, außer, ich schriebe über mich. Ich kannte ihn nur als einen, allerdings gravierenden Bestandteil meines eigenen Daseins. Darüber kann ich Authentisches berichten. Was vor mir war, das kann ich nur wissen aus gelegentlich hingeworfenen Worten anderer, die plötzlich wie Wetterleuchten die Vergangenheit erhellten; aus Fragen, die ich meinen Eltern stellte und auf die ich lakonische, ungeduldige, ironische, jedenfalls meist unzureichende oder gar keine Antworten bekam, denn sie waren ausschließlich mit ihrer Gegenwart beschäftigt. – Über seinen Vater zu schreiben, welch arrogantes Unterfangen! Überhaupt über irgendeinen Menschen zu schreiben, auszusagen, zu vermuten, gar zu urteilen! Ebenso gut kann man es unternehmen, das Meer in seiner Hand zu halten. Wie viele Strömungen bewegen einen Menschen von innen und ebenso unübersehbar vielfältig von außen, bis er wird, was er wird; bis er ist, was er ist!
Wie ich aber meinen Vater sah in Bezug auf mich, wie er mir erschien, erscheinen musste, welche Wirkung er auf mein Dasein ausübte und wie er daher wohl auch wirklich war –. darüber kann ich schreiben und will es tun. Ob das Bild allerdings dem neugierigen Leser gefällt, ob er es sich so oder anders erwartet hat, dafür kann ich keinen Garantieschein bieten. Ich könnte höchstens versichern, dass ich ihm näher war als andere und dass ich genug kritischen, aber auch liebevollen Blick besaß, besitze, um sagen zu können: so war er wohl.
Trotz der langen Zeit, die vergangen ist, ist in mir noch immer alles sehr aktuell. Weil überhaupt alles, Gutes und Schlechtes, seit meiner Kindheit in mir aktuell geblieben ist, wie in einem Gefrierfach, oder besser: in einem Thermostat, der die spezifische Wärme bewahrt. Es wird mir heute „Beleidigungslust“ vorgeworfen. Vielleicht ist das richtig. Aber es dürfte auch zu begreifen sein, wenn man mein Leben, meine Kindheit, meine Jugend kennt. Es ist die Beleidigungslust eines Menschen, den Peter Sachse in einem Programmheft des Charlott als „sanften Chansonnier am Flügel“ beschrieb. Als ich Kind war, kam mir der begründete Verdacht, es könne sich bei den Erwachsenen um ziemlich suspekte Exemplare handeln. Eine klare Ansicht fiel mir schwer, dazu verbargen sie ihre Miserabilitäten zu geschickt. Heute ist das einfacher, denn die Menschheit, von sich selber überwältigt, bekennt sich selbst dazu. Aus dieser Quelle stammte diese meine Beleidigungslust, die Lust zu sagen, wofür man den Anderen hält. Es kann nur dabei bleiben, denn dergleichen gewöhnt man sich schwerer ab als das Rauchen. Es war ja auch „Beleidigungslust zu hohen Preisen“.
Man liest schon aus dem Beginn heraus, dass es sich hier um ein Buch nicht ohne „Bissigkeit“ handelt und dass ich das Berliner Gras nicht über meinen Vater wachsen zu lassen gedenke. „Wenn über einem Trümmerhaufen schon lange Gras gewachsen ist, kommt sicher ein Kamel gelaufen, das alles wieder runterfrisst.“ (Wilhelm Busch)
Wie dem Lesenden, so kommt vor allem auch dem Schreibenden mehr als einmal der Gedanke: Soll man das alles erzählen? Kann man es erzählen? Um diese Frage zu klären, schreibt man. Es gäbe sonst keinen Anlass. Es werden viele Romane geschrieben, in denen die „Wahrheit“ je nach künstlerischem Vermögen hart oder liebenswürdig abgemildert dargestellt wird. Stets bleibt es ein Roman. Ein gelebtes Leben, durchsetzt von den vielen Menschen, die gelacht, geirrt und gelitten haben, die über Namenlosigkeit hinaus auch „einen Namen“ hatten, ein solches Buch ist etwas anderes, wie ich finde Darstellenswertes.
Die Menschen, von denen dieses Buch handelt, sind fast alle tot. Mehr, sie sind „schon lange tot“. Das Leben hat sein eigenes Zeitmaß. Von einem bestimmten Abschnitt an, wird es Geschichte, mit all dem, was in ihm geschah. Ich selber – ich spüre es – bin mit dem, was ich darin repräsentiere, Geschichte. Es ist nicht nur mein Leben, das ich erzähle, es ist ein wesentlicher Teil des Lebens der anderen; es ist mit ihnen abgeschlossen. Über ihren Gräbern weht der Wind, erheben sich neue Frühlinge; wo der Leierkastenmann auf Hinterhöfen über sie hinwegspielte, rast nun, dunkel und schneller als der Schall eines Düsenflugzeugs, das Vergessen.
Man kann und man soll erzählen, was so lange her ist, was zu Geschichte, was längst eine Geschichte geworden ist, damit Vergangenes möglichst nicht vergessen werden kann.
Auch gibt es im Übrigen in meinem fortgeschrittenen Alter keinen Grund, nicht die Wahrheit zu schreiben; auch keinen Grund, die Wahrheit nicht zu schreiben. Falls man überhaupt zum Schreiben noch Lust – seine einzige Motivation – verspürt. Ich denke da an die drei Stufen Tucholskys:
Die erste heißt: reden – überzeugen, gewinnen wollen;
die zweite: schreiben – die ewige Einrede ausschließen;
die dritte: schweigen.
Wer noch biographisch denkt, ist noch nicht völlig weise.
Das Geburtsdatum meines Vaters Walter Kollo wird in biographischen Quellen unterschiedlich angegeben. Vielleicht sollte ein Buch über ihn damit beginnen, weil es für seine Persönlichkeit überaus bezeichnend ist. Ich entsinne mich, monatelang auf seinem Schreibtisch Anfragen des Brockhaus und anderer Verlage herumliegen gesehen zu haben; dann waren es Mahnungen in sehr höflichem Ton; bald wurden es eindringliche Bitten, und schließlich brachten die Anfragenden ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass er nicht zu bewegen war, seine Daten und Personalien kurz anzugeben, wobei sie nicht unterließen, auf seine namhaften Kollegen hinzuweisen; Lincke, Lehár oder auch Künneke, die sämtlich ihren biographischen Verpflichtungen „unverzüglich nachgekommen“ seien. Es interessierte ihn nicht. Ich glaube nicht, dass er sich jemals einen längeren als kurzen Gedanken darüber gemacht hat, was sein werde, wenn er nicht mehr sein wird. Die Nachwelt ging ihn nichts an. Er hielt sich nicht für jemanden, der Anspruch auf Nachruhm hat. Er lebte in seinen Tagen; für sie schrieb er; sie stellte er dar, und zwar, wie man noch sehen wird, durchaus „kulturhistorisch“. Wer sich die Mühe machen wollte, würde aus seinen Kompositionen unfehlbar den Charakter der Zeitabschnitte erkennen, in denen sie entstanden. „Untern Linden, untern Linden gehen spazier’n die Mägdelein“ klingt anders als „Solang noch Untern Linden die alten Bäume blüh’n“, in dem schon etwas Trotziges, Protestierendes, etwas Überleben-Wollendes klingt, denn das eine wurde vor, das andere nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben.
Meines Vaters Phänomen liegt darin, alles erreicht zu haben, was er an keinem Tag seines Lebens bewusst gewollt hatte.
Die wahre Fruchtbarkeit „will“ nicht, sondern sie streut achtlos und wie zufällig den Samen hierhin und dorthin, unbekümmert darum, welches Korn tragen und welches verderben wird. In summa hatte er am Ende seines Lebens ein musikalisches Bühnenwerk hinterlassen, das sich auch vor Meistern sehen lassen kann; er hat die GEMA, eine der mächtigsten sozialen Institutionen auf dem Gebiet der Kunst, an der Richard Strauss, Carl Orff und die kleinen Schlagermacher gleichermaßen Anteil haben, wesentlich mitbegründet, denn ohne seine unerhörte Popularität hätte sie unmöglich so schnell und breit Fuß fassen können. Schließlich trägt eine Straße in Berlin seinen Namen. Die Direktoren Meinhard und Bernauer haben niemals bestritten, dass sie Strindberg, Wedekind und Bernard Shaw nicht im Theater in der Königgrätzer Straße hätten aufführen können, wenn sie sich nicht aus den vollen Kassen des Berliner Theaters hätten bedienen können, die ihnen dank der zündenden Musik Walter Kollos jahrzehntelang zur Verfügung standen. Wohl hatte er exzellente Autoren an ihnen, die nicht zum kleinsten Teil zu den großen Erfolgen beigetragen hatten, aber die Zeit ist ein „Fingerhakeln“, in dem mein Vater sich schließlich als der Stärkste erwiesen hat. Die Stücke zu seinen Kompositionen sind fast alle untergegangen, geblieben ist, was er geschaffen hat: Musik.
Das Werk meines Vaters und sein Name, wie seine Legende, wuchsen noch über seinen Tod hinaus, wovon dieses Buch hier Zeugnis gibt, und ließ vieles und viele hinter sich, die einmal mit ihm gelebt und um die Palme gerungen hatten.
Der es vielleicht am wenigsten unter ihnen gewollt hatte, dem wurde sie gereicht.
Hier will ich nun endlich beginnen, was ich mir vorgenommen hatte, zu erzählen: meines Vaters und meine Geschichte, im Rahmen unserer gemeinsamen Zeit.
Im Sarg meiner Großmutter
Willis Geburt in Königsberg und seine Ankunft im Berlin des Jahres 1907
Ich wurde im Tragheimer Ausbau, einer neu entstandenen Siedlung am Rande Königsbergs, im Elternhaus meiner Mutter geboren. Meine Eltern sollte ich erst drei Jahre später kennen lernen. Als ich am 28. April 1904 das Licht der Welt erblickte, war ich noch blind und konnte mir von meiner Mutter kein Bild machen. Als ich langsam meine Umgebung zu erkennen begann, war sie fort. Nach Posen hin, wo sie in einem Gesangs-Etablissement, kurz „Tingeltangel“ genannt, ein Engagement absolvierte.
Ich wurde in der kleinen Kirche in Tragheim getauft. Das Kirchenregister enthält die Namen Richard Wagners und Minna Planers, die dort, während einer abenteuerlichen Reise, geheiratet hatten. Es war wohl das erste Mal, dass die Namen Kollo und Wagner in Nachbarschaft gerieten.
Der erste Mensch, den ich wahrnahm, der meinen Sinnen ersten Geruch und erstes Geräusch vermittelte, war meine Groß-mutter, meiner Mutter Mutter. Wie auf einer verdunkelten und unscharf gewordenen Fotografie sehe ich sie, meine geliebte Großmutter, um mich, ein Kind von drei Jahren, herumhuschen und arbeiten. Ich höre noch heute das Rauschen ihres grauen Rocks, wenn sie an mir vorbeistreifte. Ich sehe noch heute ihr freundlich-zärtliches Lächeln, wenn sie von ihrer Nähmaschine zu mir herüber blickte. Ich spielte in einer Ecke des einzigen Raumes. Ich kannte niemanden, ich sah nur sie, hörte nur sie, liebte nur sie. Es waren meine glücklichsten, weil behütetsten Jahre. Ich wurde geliebt.
Meine Großmutter war eine Lillian Gish der 1880er Jahre. Ihr einfach gerahmtes Bild zeigt unter schlichtem Madonnenscheitel ein Mädchengesicht, süß, zart, fromm; die Hände sanft gefaltet in den Schoß gelegt. Kleine, schmale, verarbeitete Hände, die viel im Leben hatten tun müssen. Diese zarte und so sanfte Person hatte mit ihrem gebrechlichen Körper acht Kinder zur Welt bringen, sie hatte sie allein versorgen und aufziehen müssen. Acht kräftige, gesunde, sogar schöne, teils recht ungebärdige Kinder, die sie allein zu bewältigen hatte. Vier davon gingen nach ihr, sie waren still und sanft. Die vier anderen, darunter an der Spitze als die älteste meine Mutter, gingen nach meinem vitalen und jähzornigen Großvater.
In meiner Erinnerung war die Hervorstechendste von den Geschwistern meiner Mutter Tante Grethe. Sie war sehr viel jünger als meine Mutter und kam von meiner Großmutter her. Sie hatte ein wunderbares Gesicht mit zartester Haut, in deren Alabaster nur wenige, ganz blasse Sommersprossen sich abzeichneten. Sie hatte tiefblaue, ins Grünliche gehende Augen von einer inneren Reinheit wie ein Waldsee, der, umschlossen vom Grün des ihn umgebenden Laubes, gefährliche Schwermut in sich birgt. Ich habe diese meine junge Tante Grethe immer wie eine Skulptur angestaunt, so schweigend war alles an ihr. Ihr Lächeln war sanft und traurig. Man konnte mit ihr nicht sprechen wie sonst mit irgendeinem Menschen. Sie stand stets wie hinter Glas. Unzugänglich und nur in sich selber atmend. Eine tiefe Einsamkeit war um sie und es war mit Händen zu greifen, dass sie auf Erden nichts zu suchen und nichts zu finden haben würde. Ihre Schönheit war von der Art, die kein Mann zu begehren wagte.
Sie ging als Erzieherin in einen Königsberger Haushalt. Ein dort ein- und ausgehender Freund des Hauses, wohlhabend, tüchtig und unaufrichtig, verlobte sich mit ihr. Sie sah in ihm den Menschen, der sie herausführen würde, aus ihrem großen Eingesperrtsein, in die Welt. Er war all ihre Hoffnung nach außen. Als sie erfuhr, dass er mit der Hausfrau ein Liebesverhältnis hatte und sich mit ihrer gemeinsamen Verlobung nur gegen das Misstrauen des Gatten, seines Freundes, abzuschirmen gedacht hatte, entzog sie sich diesem so tief gemeinen Betrug auf die edelste Art. Sie nahm Gift und starb lautlos, ohne je zu irgendeinem der Ihren ein Wort des Auflehnens, der Klage, des Hilfeverlangens gesagt zu haben.
Man begrub sie ohne Schmerz, aber in schweigender Trauer.
Alle diese einfachen Menschen, die ihre Brüder und Schwestern waren, fühlten, dass hier etwas Besonderes geschehen war. Dass sie tief begründet aus einer Welt gegangen war, die ihr nichts zu bieten hatte und ihr nie etwas zu bieten gehabt haben würde. Sie war zu schön, zu sanft, um – nicht wahr zu sein.
Grethe –
Mein Schicksal zeigte von Anfang an sichtbares Vergnügen am Dramatischen und so sehe ich noch die kleine Arbeiterstube vor mir, in der meine Großmutter, es muss schon stark in der Dämmerung gewesen sein, da die Dunkelheit vordrang, bei einer Näharbeit saß, von einer Petroleumlampe beleuchtet. Plötzlich blickte sie auf. Ein fremder Mensch stand in der Tür, durch die man das Haus unmittelbar von der Straße her betreten konnte. Das Haus lag fernab von allem. Meine Großmutter fragte den Fremden, was er wolle. Er antwortete nicht. Über dem Raum lagerte plötzlich eine unheimliche Spannung, eine sich schnell verdichtende Angst. Kinder sind starke Empfänger. Jede Empfindung desjenigen, unter dessen Schutz sie gestellt sind, teilt sich ihnen mit aller Intensität mit.
So kann ich mich heute noch des Gefühls des Grauens entsinnen, das meine einsame Großmutter erfasst haben muss. Ich hörte ihr Herzklopfen. Einen in der Dämmerung schweigend dastehenden und nicht antwortenden Fremden würde jedermann als unmittelbare Gefahr ansehen. Es war die Zeit, in der noch überall die Legende von Jack the Ripper lebendig war, mochte dieser auch in London gemordet haben. Damals war die Welt noch klein. Ein Mörder reichte hin, um die Frauen in aller Welt in die Furcht zu versetzen, ihm zu begegnen. Diese Angst mag auch meine Großmutter erfasst haben. Ich sehe noch heute vor mir, wie sie die Petroleumlampe entschlossen in die Hand nahm, einen Augenblick lang zögernd innehielt, wie um dem Fremden ein Ultimatum zu stellen. Dann schleuderte sie die brennende Lampe, von Energie erfüllt, diese kleine Person, in die Richtung der Tür. Die Lampe verlöschte im Aufschlagen. Der Fremde war fort. Meine Großmutter sammelte kniend die Scherben in ihren Rock.
Acht Kinder hatte sie und einen gewalttätigen Mann. In dieser Stunde war niemand neben ihr.
Meine Großmutter starb, knapp fünfzig Jahre alt, verbraucht, missbraucht, und wohl auch misshandelt. Man fand nach ihrem Tode ein Heft mit Gedichten, die sie heimlich geschrieben hatte. Mögen sie keinen literarischen Wert gehabt haben, so zeigt doch ihr Vorhandensein, einem wie grausamen Schicksal diese zarte, mädchenhafte Frau anheim gegeben war.
Von ihr schreibe ich mich her. Nicht meiner Mutter oder meinem Vater fühle ich mich im Innersten verwandt, sondern dieser Großmutter.
Als meine Mutter, erst nach ihrem Tode, kam, um mich zu holen, fand sie die Stube leer. Es stand nur der Sarg darin. Ich saß spielend zu Füßen meiner Großmutter. Ich war über einen Stuhl hinauf in den Sarg geklettert. In ihre Nähe.
Dort spielte ich mit meinen Sachen. Sie war immer still gewesen, hatte nur hier und da ein Wort gesprochen. Für mich war sie nicht tot, sie war ja da. Sie war der einzige Mensch gewesen, der immer um mich war, mich angezogen und entkleidet und geküsst hatte. Nun schlief sie. Ich war still, damit ich sie nicht störte.
So fand mich meine Mutter. Eine Fremde. Ich sah sie groß an, um ihr zu bedeuten, dass meine Großmutter schliefe. Aber sie riss mich entsetzt aus dem Sarg, viel zu hastig, viel zu wild. Er wurde geschlossen, damit ich nie mehr darin spielen könnte.
Als sie mich später bei der Hand nahm und ich, adrett angezogen, trippelnd das niedrige kleine Arbeiterzimmer meiner Kindheit verließ, hatte ich dieser Art von großmütterlicher Liebe für immer den Rücken gekehrt.
Wir fuhren noch nachts in einem Bummelzug nach Berlin, der an jeder Station anhielt. Wie ich die Furcht meiner Großmutter bedrohlich gespürt hatte, so drang an mich nun die steigende Nervosität meiner Mutter heran, die mit mir allein im Coupé saß, mit glühendem Gesicht und unsteten Augen, und Angst hatte, es könnte irgendjemand dazu steigen und uns etwas antun. Sie rief den Schaffner, der sich, da sie eine sehr hübsche Frau war, zu uns setzte und beruhigend mit uns sprach. Dann erhob er sich, versprach, nach jeder Station nach uns sehen zu wollen, und verschloss die Tür nach draußen. Er riegelte das Coupé so ab, dass auch aus dem übrigen Zug niemand unser Abteil betreten konnte. Der ganze Zug war nahezu leer.
So fuhr er endlich im Zielbahnhof ein. Ich war, übermüdet und erregt von der unbeherrschten Hektik meiner Mutter, eingeschlafen. Als ich erwachte, war ich in Berlin. Morgens um 5 Uhr, 1907.
Willi Kollo, 1907
Der Mann, von dem meine Mutter sagte, dass er mein „Papa“ sei, sagte lächelnd: „Da bist du ja!“ Er strich mir über das Haar, tätschelte mir leicht die Wangen und ging in ein anderes Zimmer. Daraus ertönte anschließend Musik. Ein Klang wie silberner Harfenton, wie aus Himmelssphären, bannte mich. Es war Klavier, was ich erstmals hörte. Meine Mutter sagte, das sei Papa, der da spiele. Er sei ein Komponist. Was das war, wusste ich nicht, aber ich traf, ahnungsvoll kombinierend, das Richtige. Mir schien, dass mein Papa ein netter Mann war. Seine Hand war warm gewesen. Er strahlte Ruhe aus und Leichtigkeit und Scherz. Ich zog ihn, ohne dass ich es noch wusste, meiner aufgeregten Mutter vor, und es blieb so.
Ich war mit meiner Mutter in Berlin angekommen. Noch schien ich es gut getroffen zu haben.
„Tante Wulff“, die Dame des Hauses, bei der ich nun mit meinen Eltern in Berlin in der Potsdamer Straße 54 wohnte, war meiner Großmutter so ähnlich, als wollte mir das Schicksal den Übergang leicht machen. Auch sie trug einen Madonnenscheitel, auch sie war klein und zierlich, auch sie war zärtlich und freundlich, freilich auf viel flottere, beschwingtere Weise als meine still hin und her huschende, schweigend hantierende Großmutter. Die Tochter des Hauses, Franziska, berlinisch „Fränze“ genannt, war eine lustige Person. „Onkel Wulff“ mit seinem großen Schnauzbart erwies sich als sanft und freundlich. Wenn er allabendlich auf den Glockenschlag pünktlich nach Haus kam, brachte ich ihm, einem kleinen Hund ähnlich, die großen Flauschpantoffeln, die er behaglich anzog, um dann seine Brille aufzusetzen und nach der Zeitung zu greifen. Inzwischen bewunderte ich draußen im Korridor die große Ledertasche, die er bei Tage umhatte und in der er, wie ich hörte, unerhörte Summen betreute. Darüber hing seine Firmenmütze mit der blanken Messingaufschrift und dem spiegel-blanken Sonnenschild.
Übrigens war auch meine Mutter, die ich ja nun erst kennen gelernt hatte, offensichtlich eine lustige, lebhafte Person, denn wo immer sie eintrat, dort wurde schnell gelacht, sodass ich mitlachte, ob ich nun die Worte verstand oder nicht. Sie ging immer wie der Wind daher, war hier und da und alles in allem war sie zu schnell, als dass ich einen warmen Blick oder ein zärtliches Wort hätte abbekommen können. Aber das machte noch nichts. Sie war ja meine „Mutti“ und die Kühle, die von ihr ausging, gehörte eben zu ihr.
Im Haus in der Potsdamer Straße 54 lag unten ein Schuh-geschäft und neben einem Korsettgeschäft eine Filiale der Kaffee-Firma „Zuntz sel. Witwe“.
Ich zerbrach mir den Kopf über die Firmierung und hielt die schlanke Verkäuferin, die zu mir stets so freundlich war, für Frau Zuntz persönlich. Sie trug stets eine in reichen Jabots auslaufende schwarze Seidenbluse mit einem zarten Gaze-Kragen, der von Fischbeinstäbchen gehalten wurde. Als ich meinen Papa fragte, wieso sie „Zuntz selige Witwe“ heiße, erklärte er mir das derart, dass ich für die Zukunft Humor erfahren durfte. Der alte Herr Zuntz, sagte er, sei gestorben und habe seiner Frau alles an Geld, an Kaffee und Filialen hinterlassen, was er zuvor besaß. Er sei schon recht alt gewesen und habe seine Frau, die Witwe, oft daran gehindert, so lustig zu sein, wie sie es verdient hätte. Da er nun gestorben und sie im Besitz seines ganzen Reichtums sei, noch dazu allein und frei, in einer Welt voll hübscher junger Männer, sei es ganz natürlich, dass sie darüber als Witwe selig sei. Um das allen zu zeigen, nenne sie sich darum „Zuntz sel. Witwe“. Das leuchtete mir ein. Ich muss sagen, dass es mir bis heute eingeleuchtet hat. Wenn es auch später plausiblere Erklärungen gab, so halte ich doch auch jetzt noch die meines Vaters für die plausibelste.
Potsdamer Str. 54, Filiale A. Zuntz sel. Witwe
Wie ein riesiger Regenbogen stand zu dieser Zeit die Kunst über Deutschland und wie dieser schillerte sie in vielen Farben. Nicht nur wuchsen aus den Inszenierungen Otto Brahms und Max Reinhardts bedeutende Schauspieler überall wie Pilze aus dem Boden, als hätten sie nur auf ein geheimes Zeichen gewartet; auch der Roman, der in Deutschland spät, mit Fontane erst, eingesetzt hatte, wurde durch den jungen Thomas Mann sogleich zu seinen äußersten Möglichkeiten geführt.
Eine weitere Farbe des Regenbogens war die Operette. Von Wien aus hatte Lehárs Die lustige Witwe einen Siegeszug durch die Welt angetreten. Die damalige politische Lage war gut karikiert mit dem Attaché Danilo, der eine reiche Dollarwitwe unbedingt heiraten sollte, bloß weil sonst ein montenegrinischer Staat in Finanznot untergehen würde. Die Verhältnisse auf dem Balkan zeichneten sich darin vergnüglich ab. „Lippen schweigen, ’s flüstern Geigen“ und „Heut geh’ ich ins Maxim, da bin ich sehr intim“ beherrschten die Tanzorchester der Welt und „Vilja, o Vilja, du Waldmägdelein“ die Kehlen der Sängerinnen; es ist heute sehr bemerkenswert, dass das Libretto der berühmten Operette durchaus nicht „in der Luft hing“, sondern in der damaligen Wirklichkeit angesiedelt war. Je weiter wir uns nach den Ersten Weltkrieg von dieser Wirklichkeit entfernt haben, desto mehr musste auch diese Operette ihre Magie verlieren, um schließlich nur noch von der Musik zu leben. Spätere Autoren haben nicht begriffen, dass der Erfolg eines Stückes ausschließlich darin liegt, dass es die jeweilige Wirklichkeit so unterhaltend wie möglich zeichnet. Schließlich ist das Medium Operette an dieser mangelnden Einsicht fast zugrunde gegangen.
Oskar Straus holte zu einem Gegenschlag gegen Lehár aus und feierte mit seinem Walzertraum Triumphe. Auch hier war der Leutnant Niki, der die bezaubernde Geigerin Franzi aus Standesgründen nicht heiraten durfte, ein Abbild des alten Wien. „Leise, ganz leise klingt’s durch den Raum“ wurde zu einer internationalen Melodie.
Trotz der großen Wiener Erfolge kristallisierte sich jedoch heraus, dass Berlin die entscheidende Uraufführungsstadt geworden war. In Wien begann sozusagen das „erste Gerede“ um einen Erfolg. Man sprach dort so lange von ihm, bis man es in Berlin vernahm; aber erst die in Berlin stattfindende Aufführung war das Siegel unter das Dokument des Welterfolgs. Von Berlin aus ging es nach London, New York, Paris und bis nach Tokio.
Das galt auch für die großen Dramatiker der Zeit, mochten es nun Strindberg, Ibsen, Wedekind und Hamsun oder später Shaw sein. Die Zeit war reif. Das deutsche Theater, das sich mit der Neuberin auf den Weg gemacht hatte, das über Mozart, Weber, Goethe, Schiller, Kleist und Grabbe ein weites Reich der Kunst und Literatur begründet hatte, schickte sich an, zum Deutschen Theater in der Schumannstraße Berlins zu werden, und wie ein Schiff sich majestätisch zum Meer hin begibt, geleitet und begleitet von einem zahllosen Gewimmel kleinerer Schiffe, Boote, Barkassen, Jollen, alle farbig und bunt bewimpelt, so machte sich auch hier ein Rattenschwanz von Begabungen auf den Weg, eine Zukunft mit sich auszufüllen, sie zu erfüllen.
Das Schiff zum Meer hin hieß Max Reinhardt. Ein junger Jude, der entschlossen war, hier sein Glück zu machen. Es war genau der Punkt, an dem sich das deutsche Geistesleben anschickte, seine höchsten Höhen zu erklimmen.
Dazu gehörten Thomas Mann und Heinrich Mann, Hauptmann und Sudermann, es gehörten auch Liebermann und Lovis Corinth dazu.
Daneben waren es die Meinhard und Bernauer, die Barnowsky und Saltenburg, die Haller und Charell, die Eckersberg, Orska, Triesch und Thimig, die Moissi, Bassermann, Wegener, Jannings und Krauss; die Wassmann, Diegelmann und Jessner und Fehling, die Thielscher, Massary, Giampietro; die Sternheim und Hasenclever; die Richard Strauss und Hofmannsthal; die Kálmán, Gilbert und Kollo; ein Berliner Konfektionär ließ Stoffe und Modelle liegen und schrieb stattdessen „Erst kamen die Blusen, die Kleider“: Rudolf Nelson; sie alle, die mit Reinhardts Flaggschiff dem Meer zustrebten, dem Meer der Zukunft, das sie durchpflügen sollten, Bug- und Heckwellen verschiedener Farben aufrauschen lassend, und in dem sie sich, jedes in anderer Richtung kreuzend, verlieren sollten, auf Nimmerwiedersehen, Legenden aber hinter sich lassend, eine staunende Bewunderung, für noch viele Jahre. Es war ein Fliegenschwarm von Talenten. Paul Lincke, mit seinem bereits weltweiten Erfolg, schwebte wie ein Jupiter, angehimmelt, über ihnen.
Sie waren damals alle jung. Noch keiner von ihnen war arriviert, sie befanden sich alle noch im Stadium der Träume; sie planten, wagten und entwarfen; sie „drängelten zur Kasse“; sie wollten „hoch hinaus“; sie „machten von sich reden“, auf die eine oder sonst auf die andere Art. Alle diese jungen Menschen ritten, ohne es zu wissen, auf der Woge des Lebens, von ihr dahin und dorthin geworfen, aber wohin sie auch purzelten, sie fielen immer weich, nämlich mitten ins Glück. Das lag ganz gewiss an ihren Talenten, vor allem aber an der Zeit. Auf ihr ritten sie ihren fabelhaften Teufelsritt. Sie ist die Urheberin ihrer Legende.
Es war ein Phänomen. Kaufmännisch Gebildete nannten es „eine gute Konjunktur“.
Und es berührt mich, dass meinem Vater das Schicksal zuteil wurde, die meisten von ihnen musikalisch lebendig zu überdauern.
Man trifft ihn wenig in Chroniken und Analysen.
Er ist nur selten eine Ziffer oder ein Sternchen in Nachschlagewerken. Er wirkt stattdessen noch immer mitten im Leben, und jeder wird mit von seinen Klängen gefärbt. Ich meine, dass dies ein bemerkenswertes Schicksal ist.
„Ich bin also gar nicht wirklich Kollo.“
Herkunft der Familie
Mein Vater wurde als Walter Elimar Kollodzieyski am 28. Januar 1878 in Neidenburg in Ostpreußen geboren. Neidenburg ist ein kleines Städtchen mit großem Kopfsteinpflaster, über das zu jener Zeit die schweren Bauernwagen noch knarrend hinweg-polterten. Die Stadt wurde im Ersten Weltkrieg zerstört, wie im Zweiten Weltkrieg alle unsere Städte. Sie wurde zwei Mal wieder aufgebaut. Hierher nach Neidenburg hatte es irgendwann einmal einen Herrn Kollodzieyski mit dem Vornamen Johann, der 1795 im ostpreußischen Wartenburg geboren wurde, verschlagen; dieser hatte ein „Marjellche“ namens Anna zur Frau genommen und sich vollkommen eingedeutscht. Bis auf den Namen, der auch in meinem und meiner Kinder Pässen noch so verzeichnet steht. Der Sohn von Johann wurde Carolus getauft, Carl genannt und war der Vater von Walter.
Man hat mir oftmals, auch amtlich, nahegelegt, unseren etwas schwer auszusprechenden Namen doch in „Kollo“ zu ändern, aber eine merkwürdige abergläubische Scheu hat mich bis heute davon abgehalten, es zu tun. Begründen könnte ich es nicht.
Wie weltstädtisch übrigens Neidenburg doch gewesen sein muss, habe ich immer gespürt, wenn in Berlin und auch anderswo einer sagte: „Ach, Sie heißen gar nicht Kollo?“, und mich dann meistens anblickte, als hätte ich ihm etwas sehr Kostbares unterschlagen, als sei ich ganz besonders suspekt, als sei ich „also gar kein richtiger Deutscher?“ Man fühlt sich plötzlich ganz elend, ausgestoßen.
Alles, was wir je geschrieben haben, haben wir, mein Vater und ich, sozusagen betrügerisch geschrieben. „Es ist also gar nicht von Ihnen?“ Den Neidenburgern war es völlig klar, dass Kollodzieyskis auch Menschen sind, jedoch in Berlin und anderswo, wo die Leute in besonderem Maße durch Bildung verblödet sind, herrschte ein Vorurteil, das in etwa dahin ging, überall in der Welt müssten die Menschen, sei es in Hinterindien, in Vorderasien, in Mittelafrika, Krause, Lehmann, Schmidt, Bechstein, Murkelwitz, Lindenbaum oder so ähnlich heißen; andernfalls würden sie dem Zweifel begegnen: „Ach, Sie sind ja gar kein richtiger Hinterinder?“
Über nichts sind die Deutschen im Ausland, in Katalonien etwa, mehr erstaunt, als dass dort kein Senor Lehmann, selten auch eine Senora Murkelwitz anzutreffen sind; das heißt dort genauso, bloß eben auf Spanisch. Murkelwitz war übrigens immer schwierig zu übersetzen, wobei die Schwierigkeit bei Witz noch nicht einmal so erheblich, bei Murkel jedoch kaum zu bewältigen war.
Ich bin also gar nicht wirklich Kollo.
Mein Vater entstammt einer Familie, die man nach der Sitte damaliger Zeit als eine gute und als eine wohlhabende bezeichnen kann. Sein Vater Carl hatte geschaffen, was wir heute als KettenLäden oder Konsumgeschäfte bezeichnen würden. Der Besitz eines Landgutes im Wert von damals etwa dreihunderttausend Goldmark war der sichtbare Ertrag seiner Tätigkeit. Carl war schon relativ alt, als mein Vater, der einzige Sohn seiner zweiten Frau, zur Welt kam.
Carl hatte am 27. März 1873 Charlotte Hedwig Elise Senger, meine Großmutter, geheiratet. Sie war am 5. August 1843 in Rhein in Ostpreußen geboren worden.
Ihr Vater Ernst Gustav Michael Senger besaß in Neidenburg eine „Medizinal-Apotheke“, und dessen Frau Louise, die Mutter von Hedwig, war die Tochter des „Kreisphysikus“ Dr. Schwarz. Die Mutter des „Medizinal-Apothekers“ Senger war eine geborene Regine Elisabeth Koselowska gewesen, vermutlich auch slawischer Herkunft; ob polnischer oder russischer lässt sich schwer sagen, denn die Deutschen unbekannter Zahl suchten damals ihr Glück in Russland, und umgekehrt ließen sich russische Bürger im deutschen Ostpreußen nieder; aber auch zwischen Polen und Deutschland gab es ständige Bewegung, denn dort oben herrschte Friede, seit Napoleon seinen Rückzug über die Beresina hatte antreten müssen.
Meine Großmutter Hedwig war eine zarte, elegante und kühle Dame, nicht schön zu nennen, aber attraktiv, der Typ der eleganten Polin. Eine Tochter namens Grethe, die sie neben ihrem einzigen Sohn Walter zur Welt gebracht hatte, starb früh.
Die Familie Kollodzieyski, 1885, V.l.n.r.: Vater Carl, Stiefbruder Friedrich/Fritz, Walter, Mutter Hedwig, Schwester Grethe
Mein Vater trug die unverkennbaren Züge eines „späten Kindes“, denn meine Großmutter war 31 Jahre alt, mein Großvater 46, als sie heirateten; er kam erst 5 Jahre danach zur Welt, was zu dieser Zeit als späte Geburt angesehen wurde.
Vielleicht rührt es daher, dass mein Vater, körperlich zart, stark nur in seiner spirituellen Musikbegabung war. Er hatte viel von dem, was man „alte Familie“ nennt, und schließlich starb er ziemlich jung, aber seine Musik kam hoch zu Jahren. Mein Großvater Carl sieht auf alten vergilbten Fotos aus wie Dostojewski, dem er aber sonst wenig glich und der tragischerweise von wirtschaftlichen Dingen bedeutend weniger verstanden hatte als mein Großvater, der immerhin bei seinem Hinscheiden die bereits genannten Kolonialwarenläden in Neidenburg, Allenstein und Insterburg und auch das schöne Landgut hinterließ. Als er das alles durch Bienenfleiß erreicht hatte, starb er. Dostojewski hinterließ nur Bücher, die mein Großvater ganz nebenbei geführt hatte und bei deren Durchsicht er seinen Geist aufgegeben hat. Auch wieder anders als Dostojewski, sodass erhebliche Unterschiede spürbar werden.
Kolonialwarenladen der Familie Kollodzieyski in Neidengburg
Es gab da noch aus erster Ehe den Stiefbruder meines Vaters, Friedrich, genannt Fritz. Er war eher laut, prahlerisch und neigte zur Übertreibung. Alles, was uns von ihm geblieben ist, ist ein Foto, auf dem er in stolzer Haltung, im Frack mit kostbarer Pelzmütze, umhangen von einem schweren Pelzmantel, wie man ihn damals auf ostpreußischen Rittergütern trug, zu bestaunen ist. Fritz hatte also den Zug ins Große, war aber sonst eine wenig glückliche Figur. Er erbte das Landgut meines Großvaters Carl, ging mit der Sonne schlafen, stand aber leider nicht mit ihr auf, was am Ende das Gegenteil eines „fröhlichen Landmanns“, wie ihn Schumann musikalisch gesehen hatte, ergibt.
Hatte mein Großvater Carl einen zweizipflig verlaufenden langen Bart, so hatte mein Onkel Fritz eine ebenso lange Nase. Man begeht keine Bilderfälschung, wenn man behauptet, dass er durchaus kein schöner Mann gewesen ist, mein Stiefonkel Friedrich Kollodzieyski. Er war groß, hager, vorn ziemlich eingefallen, der Kopf steckte in breiten, hageren Schultern, ohne erst einen Umweg über den Hals zu machen. Das Hervorstechendste an ihm war diese riesige Nase, die fortwährend schnüffelte und immer etwas hochzuziehen hatte.
Ich nannte ihn den „Onkel Nanuuu“, weil er auf unnachahmliche Weise zu allem, was man ihm nahe brachte, sein Erstaunen in dem sehr breit und ostpreußisch trompeteten „Nanuuu!?“ ausdrückte, wobei das zweite um eine Terz tiefer erklang und damit das erreicht wurde, was man heute einen Hawaii-Effekt nennen würde. „Nanuuu!?“ sagte er zum ganzen Leben und er war auch tief berechtigt dazu. Es lag darin ein Höchstmaß an persönlicher Verwunderung, also Verständnislosigkeit, bei ebenso großer Gleichgültigkeit.
War der „Alte Fritz“ vormals jung auf die Welt gekommen, einmal mit Anmut Kronprinz gewesen und erst in anstrengenden Feldzügen sichtlich vergreist, so war mein Onkel ohne viel Federlesens gleich als alter Fritz auf die Welt gekommen, und Cyrano de Bergerac hätte bei seinem Erscheinen alle Inferioritätskomplexe fallen gelassen. Diesen äußeren Mangel glich mein Onkel durch eine großartige Herrenhaftigkeit wieder aus, durch ein Auftreten, das ihm neidlos über Neidenburg hinaus den Titel „Graf Kollodzieyski“ verschaffte, den er erst bei gänzlichem Vermögensschwund ablegte. So steht er also im Rahmen vor mir. Ich konnte dieses Bild niemals betrachten, ohne innerlich den Hut abzunehmen.
Stiefbruder Fritz um 1900
Von dem, was mein Großvater hinterließ, bekam mein Vater Walter gar nichts, mein Stiefonkel Fritz alles. Er hat denn auch die schöne Hinterlassenschaft meines Großvaters Carl schnell verwirtschaftet. Zwischen den Halbbrüdern Walter und Friedrich gab es wohl wenig Zuneigung, weil Fritz, der an sich praktischere und erstgeborene Sohn, gewiss zielsicher auf das Erbe hingearbeitet hatte, mein Vater Walter aber, das schwarze Schaf der Familie, der „ausgerechnet Künstler“ werden wollte, schließlich so gut wie enterbt wurde. Mein Vater sprach darüber niemals, aber stets nahm er seinem Stiefbruder gegenüber, wenn dieser ihn in Berlin besuchte, eine kühle Haltung ein. Er hinderte ihn nicht daran, ihn zu besuchen, überließ ihn aber in Berlin sich selber – und uns –, ohne sich viel um ihn zu kümmern. Und so sehe ich denn meinen Onkel Fritz, ganz das Gegenteil meines Vaters, dürr und hoch aufgeschossen, mit dieser riesigen und stets etwas tropfenden rötlichen Nase, im Dunkeln unseres Berliner Esszimmers sitzen und in breitem ostpreußischen Dialekt hohe Töne von sich geben, deren unfreiwillige Opfer meine Mutter und auch ich waren. Insbesondere sehe ich ihn 1916 oder 1917 dort sitzen, weil es bei seinem Bruder Walter wohl bedeutend besser zu essen gab als bei ihm zu Haus.
Fritz war das, was man heute einen „Heimkrieger“ nennt. Er saß zur Zeit des Ersten Weltkrieges vor einer überdimensionalen Generalstabskarte, die unseren ganzen riesigen Esstisch bedeckte, hatte mehrere Schächtelchen mit kleinen farbigen Fähnchen, die man aufstecken konnte und die die Farben aller Nationen trugen. In den meisten Schachteln waren die nationalen Symbole der Staaten enthalten, die gegen uns waren, und ich bekam damit einen konkreten Begriff, dass eigentlich alle gegen Deutschland waren. Deutschland selber hatte samt den ihm verbündeten Mitmächten in einer kleinen Schachtel Platz gefunden. Als später Österreich und die anderen Verbündeten uns „verraten“ hatten, schmiss mein Onkel sie aus der gemeinsamen Schachtel kurzerhand heraus, ohne Rücksicht darauf, ob Deutschland sie eines Tages noch werde brauchen können.
Man weiß, dass Heimarbeit oft bessere und solidere Ergebnisse liefert als die rein mechanische von Mammutbetrieben.
In Schlesien war die Klöppelspitzen- und Spielzeugindustrie ein Weltbegriff von „Heimarbeit“ geworden und so ist es kein Wunder, dass mein Onkel Fritz in unserem Berliner Esszimmer in Heimarbeit den Krieg gewann, den der Kaiser in so viel größeren Verhältnissen leider verloren hatte. Fritz nahm wenig Notiz davon, ob die deutschen Heere in Frankreich und auch anderswo große Räume aufgeben und zurückfluten mussten. Sah man seine Weltkarte daraufhin an, so standen die deutschen Armeen immer noch da, wo sie bereits geschlagen worden waren. Er nahm es nicht zur Kenntnis, überzeugt davon, dass sie sehr bald wieder die alten Positionen bezogen haben würden, das Wort Hitlers vorwegnehmend: „Wo der deutsche Soldat steht, da kommt kein anderer mehr hin.“ – womit er Recht hatte, denn als die anderen sämtlich dahin kamen, stand der deutsche Soldat dort auch nicht mehr.
Vielleicht aber lag in diesem meinem Onkel Fritz, so skurril und unglücklich konstruiert, doch ein Hauch von Genialität, die sich, verkannt und heimatlos, als „Zug ins Große“ manifestierte: er war einer der ersten, die ein Automobil fuhren, und es existiert eine Aufnahme von 1908 oder 1910, die ihn zünftig mit Auto-mütze und Windbrille zeigt. Als einer der ersten kam er auch auf die Idee, eine groß angelegte Reparaturwerkstatt zu eröffnen. Wie rapide sich auch die Automobilindustrie entwickelte, für meinen Onkel entwickelte sie sich immer noch zu langsam, und er war pleite, ehe jemand auf den Gedanken kam, sein Auto bei ihm reparieren zu lassen.
Ach, mein lieber, dürrer, prahlhänsiger Onkel Fritz – vielleicht hattest du nicht wenig von Hamsuns „August, der Weltumsegler“. Du warst ein Anreger, aber du kamst zu früh und du gingst daher zu früh.
Es war wohl ein komisches und doch ein tief trauriges Stück Leben. Gott hatte ihn so geschaffen. Vielleicht wäre er besser gelungen, wenn er seine Wünsche zu sich selber hätte äußern dürfen – mein Onkel „Nanuuu“.
Er hat nichts hinterlassen als eine Frau, die Lehrerin war, ein Pincenez, d.h. einen Kneifer mit Schnur, trug und im Kino an der Kasse gesessen hatte. Sie hatte alle seine Wahnideen willig-unwillig mitgemacht. Er hat ihr nichts hinterlassen als drei Kinder, die sich dann in einem mühsamen Leben durchbringen mussten.
Die Ehe meiner Großeltern wurde wohl nicht aus Liebe geschlossen, sondern seine Wohlhabenheit wird die Grundlage zu beider Vereinbarung gewesen sein. Aber im Rahmen dieser Voraussetzung war Hedwig, meine Großmutter, eine gute, vornehme und haushälterische Frau. Mit ihren kühlen grauen Augen hatte sie die Angestellten unter ihrer Kontrolle. Und als mein Großvater Carl starb, pflegte sie ihn zuverlässig.
Walter Kollos Eltern Hedwig und Carl, ca. 1875
Wie ich erst sehr viel später, lange nach dem Tod meines Vaters, erfuhr, ging die Familie Senger auf einen gewissen Kowalewski zurück, der es zum Bürgermeister von Thorn und in Gneisenaus Generalstab 1812/13 zum Generalleutnant gebracht hatte. Bei Inspektionen oder Besuchen der königlichen Familie in Ost- und Westpreußen, auch während der Flucht vor Napoleon, war es sein Haus, das sie aufnahm.
Es heißt, dass die Kowalewskis polnischem Adel entstammten. Sie hatten während des Dreißigjährigen Krieges, völlig verarmt, ihre aristokratische Herkunft verborgen, weil es Grafen schlecht anstand, ohne Mittel zu sein. Ob die Geschichte wahr ist, entzieht sich meiner Kenntnis, es ist auch nicht so wichtig. Die Haltung meiner Großmutter Hedwig jedoch würde sich sehr gut mit ihr vertragen haben.
In Berlin hatte ein Cousin von ihr als Baumeister an der Erstehung des Anhalter Bahnhofs mitgewirkt.
Auch die Musik spukte im Blut dieser Familie, Größeres ankündigend, herum. Meiner klavierbegabten Großmutter Hedwig war einer ihrer Onkel vorangegangen, der in Allenstein oder Insterburg eine Apotheke besessen hatte; eine Goldgrube, wie man sagt. Dieser Onkel hatte eine Leidenschaft. Nicht das Geld, auch nicht rezeptpflichtige Mixturen, die er einem Provisor überließ. Er spielte eine Geige, die er liebte. Er träumte auf dieser Violine, Kadenzen verströmend, von einem lohnenderen Leben. Während sein Provisor nicht nur die Provisionen, sondern auch die Apothekersgattin selbst einstrich, überließ er ihnen alles und verschwand eines Nachts, wie Fedja im Lebenden Leichnam. Er hatte alles zurückgelassen. Er hatte nichts mitgenommen außer – seiner Geige. Nie mehr ward er gesehen. Nie mehr hatte irgendwer einen Geigenton von ihm vernommen. Der Musik zuliebe war er im Untergrund des Lebens verschwunden.
Mir scheint es ein starkes Indiz für das Vorhandensein leidenschaftlicher Talente in unserem Blut.
Meine Großmutter heiratete nach dem Tode Carl Kollodzieyskis im Jahr 1897 einen höheren polnischen Staatsbeamten und hieß seitdem Hedwig Stachorra.
In diesem Familienrahmen wuchs mein Vater auf, gut gekleidet, stets frisch gewaschen und wohlbehütet. Wollte er einmal nicht in die Schule, wurde er schlagartig krank. Diese Flucht in die Krankheit behielt er sein Leben lang, gleich einer diplomatischen Finesse, bei, mit ihr löste er alle Schwierigkeiten. Aber endlich, als die Krankheit ihn nicht mehr hinreichend vor den ihn überwältigenden Problemen abschirmen konnte, wurde es eine Flucht in den Tod. Ich fürchte, er merkte erst ganz kurz zuvor, als es kein Zurück mehr gab, dass er diesmal mit seinem Manöver zu weit gegangen war. Er kam niemals auf den Gedanken, zu kämpfen.
Wir waren voneinander sehr verschieden. Ich ging immer, und bis zum heutigen Tage, mitten in die Gefahr hinein. Ich meine, man begegnet dem Leben nirgends, wenn man sich ihm nicht entgegen stellt. Aber wer hat Recht?
Als mein Vater ein junger Mann war, erhoben sich die Fragen, die in einem Künstlerleben schon obligat geworden sind: Es kam zum Zusammenstoß zwischen bürgerlicher „Planwirtschaft“ und dem leidenschaftlich zur Selbstbewährung, zur Persönlichkeit, zur Freiheit drängenden künstlerischen Temperament. Mein Großvater hatte gewiss seine beiden so verschieden gearteten Söhne in seine Pläne einkalkuliert. So wurde auch Walter nach dem Besuch des Gymnasiums im nahe gelegenen Osterode und des Friedrichs-Kollegiums in Königsberg kurz in eine kaufmännische Lehre geschickt, die sehr schnell seine völlige Ungeeignetheit für eine so herkömmliche Laufbahn aufzeigte. Es wird meine Großmutter gewesen sein, die ihrem Mann klar zu machen versuchte, dass Walter ein starkes musikalisches Talent habe, und sehr zögernd wird mein Großvater Carl eingewilligt haben, dass „Walterchen“ nach Sondershausen in Thüringen auf das Musikkonservatorium gehen dürfe.
Carl strich ihn aus seinen unternehmerischen Gedanken und setzte in seinem Testament seinen erstgeborenen Sohn Fritz zum Erben ein. Einem angehenden Künstler wollte er denn doch nicht die von ihm mühsam geschaffenen Werte vermachen. Und Recht hatte er. Zwar „vermachte“ Fritz in Windeseile das ihm Vermachte, während mein Vater sich sein eigenes Vermögen erst schuf – aber das „vermachte“ er dann ebenfalls, sodass eine Gesamtschuld von etwa 400.000 RM sozusagen das einzige Kapital war, mit dem wir nach seinem Tode „rechnen“ konnten. – So weit war es aber noch lange nicht.
Mein Vater Walter wurde also auf das Konservatorium nach Sondershausen in Thüringen geschickt, wo er mit Fleiß und Begabung Kompositionslehre, Harmonik und Kontrapunkt sowie Dirigieren studierte. Als Spezialfach hatte er Kirchenmusik erwählt. Sein Instrument wurde das Klavier, das er bis zu seinem Tode mit hinreißendem Anschlag und einer bezaubernd leichten Hand wirklich gemeistert hat. Bach, Mozart und Lortzing waren seine Leib- und Magenkomponisten, und der „strenge Satz“ zeigt sich mit seiner großen Klarheit und Durchsichtigkeit denn auch in allen seinen Klavierauszügen.
Er war ein erstklassiger, sowohl sauberer, wie auch leidenschaftlich temperamentvoller Dirigent. Als er einmal ein fremdes Orchester zu dirigieren hatte, das ihn auf die Probe zu stellen gedachte, ließ er die Musiker geduldig eine Weile lang so falsch spielen, wie sie wünschten. Dann klopfte er ab und sagte liebenswürdig, jedoch mit größter Klarheit: „Meine Herren, ich habe Sie nun eine Zeit lang spielen lassen, wie Sie wollten. Von nun an spielen Sie bitte, wie ich will.“ Das Orchester spielte von da an wie „ein Mann“.
Er besaß Autorität und Strenge, ohne jemals auch nur eine Spur aggressiv zu werden. Von daher verbreitete sich die Legende seiner „großen Liebenswürdigkeit“. Das Wort Legende bedeutet nicht, dass das von ihr Verbreitete nicht wahr sei. Im Gegenteil, eine Legende entsteht erst kraft einer tieferen, fundamentalen Wahrheit. Ob man liebenswürdig sein kann und zugleich auch wahr, ist eine andere Frage.
Ich gelte nicht als liebenswürdig, denn ich habe ein Hobby, das es verhindert, eines, das gefährlich ist: die Wahrheit. Sie erscheint mir interessanter als – Liebenswürdigkeit. Ob ich persönlich „in Wahrheit“ liebenswürdig bin oder nicht, diese Frage beantwortet das, was ich in meinem künstlerischen Schaffen geschrieben habe, denn niemand kann über seinen Charakter hinweg Künstler sein. Was man schreibt, ist immer „wahr“, insoweit es über die Verfassung des Verfassers untrüglich Auskunft gibt. –
1917 starb meines Vaters Mutter, jetzt Hedwig Stachorra. Ich weinte, als ich die Nachricht bekam. Warum weinte ich? Sie hatte mir nicht besonders nahe gestanden. Eine stolze, kalte Dame. Wenn sie mich angesehen hatte, hatte in ihren Augen niemals Wärme gelegen, eher etwas wie Indignation. Nach ihrer Meinung hätte „ihr Walter“ eine ganz andere Partie machen müssen.
Wenn wir bei ihr in Königsberg zu Besuch waren, hatte ich von ihr kaum etwas anderes gehört als: „Fass das nicht an, Jungchen!“ Sie hatte auf ihren Kommoden und Konsolen Porzellan über Porzellan stehen. Nippes, wie man es früher nannte. Figürchen, die mit dem Kopf nickten, feistbäuchige Buddhas, Rokokokavaliere und Tänzerinnen, Löwen, Pferde und Hunde. Welchem Kind juckte es da nicht in den Fingern? Aber ehe ich etwas in die Hand nehmen konnte, erschreckte mich schon ihr „Fass das nicht an, Jungchen!“ Mitunter sprang sie auch aus dem Gespräch mit meiner Mutter auf und kam mit rauschender Seide auf mich zu, um mir irgendetwas mit kühler Hand zu entwinden.
Ich habe mir lange den Kopf darüber zerbrochen, weshalb mein Vater seiner Mutter so sichtbare Reserviertheit entgegen ge-bracht hat. Sie war ja nicht nur seine leibliche Mutter, sie hatte auch dafür gesorgt, dass er seinen Weg machen konnte. Zwar hatte sie von ihm eine andere Karriere erhofft, nichts so „Leichtes“. Aber das konnte sie unmöglich trennen. Als er das Konservatorium besuchen wollte, verfügte sie über keine Mittel, die sie dazu hätte beisteuern können. Carl Kollodzieyski hatte die Musik-Laufbahn entschieden abgelehnt. Sie musste einen Kompromiss mit ihm schließen. Er sollte das gesamte Studium bezahlen, dafür würde ihr Sohn auf seinen Erbanteil verzichten. So hoch veranschlagte sie die Musik und die Begabung ihres Kindes. Darauf war Carl Kollodzieyski eingegangen. Jedenfalls kann nur darin der tiefere Grund der Zurückhaltung meines Vaters zu suchen sein. Er konnte nicht vergessen, dass sie auf sein Erbe verzichtet hatte. Dass sich allein darauf sein Weg, sein Name, sein Ruhm und seine Existenz aufgebaut hatten, das schlug er in den Wind.
In einer alten ostpreußischen Zeitung fand ich einmal einen Bericht über das pianistische Können Hedwig Stachorras, meiner Großmutter. Und daneben schrieb die Korrespondentin, die meine Großmutter wohl zu einem Interview besucht hatte: „Auf einer kleinen Bank stand ihr Enkelkind und dirigierte sein Orchester, das nur in seiner Phantasie bestand. Immerhin war das musikalische Temperament, das er bereits geerbt hatte, unüberhörbar. Nicht wie sein Vater dirigierte er Operette, sondern, es seiner Großmutter gleichtuend, Sinfonisches – aus Kindermund.“
Dieser Enkel war ich.
Erste Lieder und erste Liebe
Walters Anfänge in Königsberg und Stettin
1898, nach Abschluss seines Studiums in Sondershausen, erhielt mein Vater durch Vermittlung seiner in Königsberg lebenden Verwandten, der Familie Schwarz, die dort eine Bank hatte, bald eine Anstellung als Korrepetitor unter dem Dirigenten Ohnesorg im Luisen-Theater. Man spielte das Allerneueste von Paul Lincke, Frau Luna, aber wohl auch Lortzings Waffenschmied. Mein Vater kam dort nicht zum Dirigieren. Noch war er Lehrling der Kunst, und so wird seine Tätigkeit ausgefüllt gewesen sein mit Korrepetieren, Begleiten der Choreographie und Einstudieren der Chorsätze.
Dort kam er erstmals mit denen zusammen, die ihm zeitlebens das Wichtigste gewesen sind: mit Frauen. Gewiss wird manche Sopranistin, manche Soubrette und die eine oder andere „Naive“ mit dem untrüglichen Instinkt der Damen bemerkt haben, dass in Walter etwas steckte, dass aus ihm mal „was werden“ könne. Damals wie heute verdienten sich die Schauspielerinnen zu ihren kargen Gagen gern noch etwas hinzu. Und so wird manche von ihnen noch nach der Vorstellung in irgendeinem Königsberger Nachtkabarett aufgetreten sein. Bekannte Komponisten waren kostspielig, und wenn man gerade eine Chansonmusik benötigte, warum sollte sie nicht Walter machen? Zahlungsmittel waren ein ungewöhnlich huldvolles Lächeln, und falls das Chanson allzu viele Verse hatte, noch ein wenig mehr. Für meinen Vater war diese Zahlmethode ermutigender als bare Münze.
Walter Kollo in Königsberg, erstes Engagement 1898
Die Damen von der Königsberger Bühne werden schnell kapiert haben, wie viel mehr Erfolg sie im Publikum hatten, wenn Walter unten am Klavier saß und sie mit sich fortriss, mit einem anfeuernd lächelnden Blick durch den „Kneifer“ ermunterte und antrieb. Und sie werden gesagt haben: „Komm mit, Walter!“ Sie werden ihn dem Kabarettdirektor präsentiert und empfohlen haben und mein Vater wird nicht lange gezögert haben, seine Rolle als vielleicht irgendwann einmal zweiter Kapellmeister hinzuschmeißen und lieber „Erster am Klavier“ zu sein.
Da war einer, bei dem sie auf die Kompositionen warten konnten. Sie flossen aus ihm heraus, selbstverständlich, zwang- und mühelos und – sie waren gut. Sie sangen sich, spielten sich, behielten sich.
Fraglos ist ja die Produktivität als solche das untrüglichste Zeichen von Genie, Begabung, Talent. Man konnte gut mit ihm arbeiten. Er war der geborene Kabarett-Komponist, zu einer Zeit, als das Kabarett noch Neuland war, in dem noch vieles zu suchen und zu finden war. Heute ist es ein abgegrastes Stück der Welt. Jeder darin schreibt heute „gute Verse“, jeder „gute Musik“.
Damals waren die Autoren noch rar. Es waren Verse von Liliencron, die man vertonte. „Die Musik kommt“, das später von Oskar Straus so klassisch in Melodie gesetzt wurde, war unzählige Male ähnlich vertont worden. Es waren nicht immer Chansons, sondern auch kleine melodramatische Szenen, musikalische Parodien, und so hatte mein Vater auch bereits eine Faust-Parodie komponiert. Diese seine ersten handgeschriebenen Kompositionen, „zweistimmig für Gesang und Klavier“, liegen heute, vergilbt, vor mir; sie führen noch die Bezeichnung „Opus 1“ usw. und ich muss an das Wort eines Meisters denken, der die Wichtigtuer im Auge hatte: „Wenn ich schon Opus höre!“ Aber mein Vater war jung. Er tat später alles andere als wichtig. Gerade er war weit entfernt von aller Art „Opus“, was er einmal „Opuspokus“ nannte. Als Unterschrift steht noch unter seinen Kompositionen „Walter Kollodzieyski, Capellmeister“. Die weltbekannt gewordene Abkürzung „Kollo“ war noch nicht geprägt worden und das große C für Kapellmeister erinnert heute rührend daran, wie lange alles schon zurückliegt.
Kabarett war der letzte Schrei der damaligen Jahre. Von Paris war es herüber ins frostige Deutschland geweht, wo man es selbstverständlich sofort mit dem deutschen grimmigen Ernst versah und ihm jene tiefere, mitunter sogar schon sozialkritische Bedeutung gab, ohne die man in Germania nicht leben kann. Wolzogen war die eine Seite der Kleinkunst, die andere, aggressivere, hieß Wedekind. Herr von Wolzogen plante noch sein „Überbrettl“; Wedekind erschreckte erstmals seine gemütvollen bayerischen Zuhörer durch grimmige Fratzenhaftigkeiten aus Pandorens Büchse. Mein Vater schrieb die Musik zu einer Parodie auf Hauptmanns Die versunkene Glocke und anderes.
Mein Vater hatte am Klavier eine leichte, anmutige und sehr pointierte Hand. Seine Pausen, Verzögerungen, Haltetöne, sein Rubato und seine Zäsuren legten dem Interpreten schon den ganzen Vortrag in den Mund. Er hatte einen untrüglichen Instinkt für das, was „wirkte“, für das, was „ankam“ und einschlug. Er war ein geborenes dramatisch-musikalisches Talent und diejenigen, die gern in ihm einen großen Schlagerkomponisten sehen möchten, tun ihm viel zu wenig Ehre an. Der Schlager floss ihm nebenbei aus der Hand wie Hobelspäne. Er machte ihm keine Mühe. Er musste ihn nicht erst suchen oder finden, er trug ihn latent in sich und konnte ihn jederzeit aus dem Ärmel schütteln. Seine Schlager waren eigentlich nichts weiter als seine in Musik umgesetzte gute Laune, seine Fröhlichkeit und Bereitschaft, zu lachen und lachen zu machen. Sein wirkliches Talent hieß aber Theater.
Ich habe es als Junge oft bewundert, wie mein Vater vom Dirigentenpult bei seinen Premieren auf die Bühnen hinaus ausstrahlte. Seine heitere, unnervöse Grazie, seine Ruhe – die nichts war als Beherrschtheit und gute Erziehung – ,seine Freude an der Sache, der Spaß, den er an allem hatte, das zog die Darsteller oben in ihren Bann; oft streifte ihn ein schneller Blick von oben, dann sahen sie: Ihr Witz war angekommen, ihre Szene saß; er gab ihnen Ruhe und Zuversicht und die Sache oben lief – durch ihn. Diese Begabung wird sich bei ihm früh gezeigt haben und sie wird der Grund gewesen sein, dass sich Sängerinnen und auch Sänger bald um ihn rissen.
Jeden Abend, wenn er die Soubretten und Vortragskünstler in Königsberg begleitete und all die Namen auf den Notenblättern bekannter Lieder sah, Paul Lincke und Victor Hollaender, Oskar Straus und Franz Lehár, da wehte ihn jedes Mal Weltstadtluft an. Das alles kam aus Wien und Berlin, und besonders Berlin prägte sich ihm wie ein Kehrreim ein. Königsberg, das war aus zweiter Hand, war Provinz. Aber Berlin, das war der große Sog, die Riesen-Verführung, der Topf, in dem alles brodelte und kochte. Und in dem nur der nicht verkochte, der Kraft genug besaß.
Daran dachte er, wenn oben auf dem kleinen Podium ein Komiker die Mär von dem armen, zur Armee einberufenen Bauernsohn sang, der über das, was er am eigenen Leibe erlebte, seiner heimatlichen Geliebten schrieb:
„Ach, mein liebes Lenchen, du kannst lachen,
hast ja keine Ahnung in Polzin,
was sie hier mit mir für Zicken machen,
in der großen Kaiserstadt Berlin.“
Kaiserstadt Berlin! Da müsste man hin! Irgendetwas flüsterte in ihm: „Du kannst es! Du würdest es schaffen!“
Aber Walter war schüchtern. Er war ein kleiner „Traumich-nicht“. Er fühlte, dass er jemanden würde haben müssen, der wie ein Motor hinter ihm stünde, der an seiner Seite stehen, der ihm den kleinen Stoß in die Rippen geben würde, den er benötigte. Das Gefühl, nicht allein zu sein. Dass er bis hierhergekommen war, dass man ihn in Königsberg überall kannte, von ihm schon sprach, dass man ihn vertrauensvoll und gläubig mit Kompositionsaufträgen überhäufte, die freilich nicht viel einbrachten – wem verdankte er das? Den Frauen.