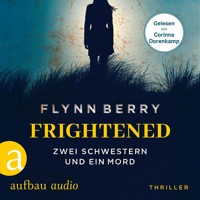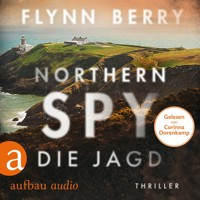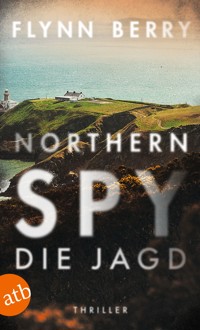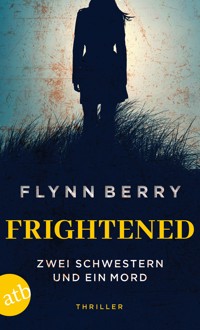
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
»Außerordentlich spannend und intensiv!« Washington Post.
Nora will ihre Schwester Rachel besuchen, die aufs Land gezogen ist. Doch dann findet sie Rachel ermordet in ihrem Haus vor. Zwar ist sofort die Polizei zur Stelle, doch die Schwestern konnten schon vor vielen Jahren nicht auf sie vertrauen. Damals gab es einen Vorfall, der das Leben beider für immer verändert hat. Also macht Nora sich selbst auf eine fieberhafte Suche nach dem Täter und stößt auf ein Netz aus Geheimnissen, das sie daran zweifeln lässt, wem sie vertrauen kann.
Ein hochspannender psychologischer Thriller über die Frage, wie gut wir unsere eigene Familie kennen.
Einer der besten Spannungsromane des Jahres – ausgezeichnet mit dem Edgar Award.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Ähnliche
Über das Buch
Als Nora ihre Schwester in einer Kleinstadt in der Nähe von Oxford besuchen will, macht sie eine grausame Entdeckung: Rachel wurde ermordet. Zwar werden sofort Ermittlungen eingeleitet, doch Nora ist misstrauisch. Zu sehr wurden sie und ihre Schwester in der Vergangenheit bereits von der Polizei enttäuscht. Es liegt an ihr, den Mörder zu finden, und sie darf keine Zeit verlieren. Verzweifelt macht sie sich auf die Suche und findet heraus, dass Rachel kurz vor ihrem Tod offenbar große Angst hatte: Sie hat sich einen Wachhund besorgt und überstürzt einen Umzug geplant. Doch von wem fühlte sie sich so bedroht? Nora muss erkennen, dass weit mehr Menschen Rachel schaden wollten, als sie vermutet hätte – und gerät schließlich selbst ins Visier der Polizei.
Über Flynn Berry
Flynn Berry ist eine amerikanische Autorin, die bereits mit dem Edgar Award ausgezeichnet wurde.
Im Aufbau Taschenbuch liegt von ihr der Thriller »Northern Spy – Die Jadg« vor, der in zahlreiche Sprachen übersetzt und von der Washington Post als einer der besten Thriller des Jahres gepriesen wurde.
Wolfgang Thon studierte Sprachwissenschaft, Germanistik und Philosophie in Berlin und Hamburg. Thon arbeitet als Übersetzer und seit 2014 auch als Autor in Hamburg, tanzt leidenschaftlich gern Argentinischen Tango und hat bereits etliche Thriller von u. a. Brad Meltzer, Joseph Finder, Robin Hobb, Steve Barry und Paul Grossman ins Deutsche übertragen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Flynn Berry
Frightened – Zwei Schwestern und ein Mord
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Thon
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
TEIL EINS — HUNTERS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
TEIL ZWEI — MARLOW
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
TEIL DREI — FÜCHSE
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Danksagungen
Impressum
Wer von diesem Thriller begeistert ist, liest auch ...
TEIL EINS
HUNTERS
1
Im East Riding wird eine Frau vermisst. Sie ist in Hedon verschwunden, wo wir aufgewachsen sind. Wenn Rachel davon erfährt, wird sie denken, dass er es war.
Das Kneipenschild des Surprise, das Gemälde eines Klippers auf einem grünen Meer, schaukelt knarrend im Wind. Der Pub liegt in einer ruhigen Straße in Chelsea. Nach der Arbeit in der Phene Street bin ich zum Lunch und auf ein Glas Weißwein hergekommen. Ich arbeite als Assistentin einer Landschaftsarchitektin. Sie hat sich auf Wiesen spezialisiert, die aussehen, als wären sie gar nicht angelegt worden.
Im Fernsehen geht ein Reporter durch den Park, in dem die Frau zuletzt gesehen wurde. Polizisten und Hunde durchkämmen die Hügel hinter der Stadt. Ich könnte Rachel heute Abend von ihr erzählen, aber das würde meinen Besuch bei ihr überschatten. Vielleicht hat es ja gar nichts mit dem zu tun, was ihr widerfahren ist.
Die Bauarbeiter auf der anderen Straßenseite haben ihre Mittagspause beendet. Weiße Papiertüten liegen zerknüllt vor ihren Füßen, und sie lehnen sich im kalten Sonnenschein an die Stufen der Treppe. Ich hätte schon längst losgehen sollen, damit ich den Zug nach Oxford noch bekomme, aber ich warte in Mantel und Schal an der Bar, während ein Detective aus Hull die Öffentlichkeit um Informationen über die verschwundene Person bittet.
Als die Sendung weitergeht und über den Sturm im Norden berichtet, verlasse ich den Pub, gehe unter dem Kneipenschild hindurch und biege an der nächsten Ecke in die Royal Hospital Road ein. Ich gehe an den gepflegten Plätzen von Burton Court vorbei, vorbei an den Maklerbüros. Den sonnigen Häusern von Chelsea und Kensington. Ich wohne immer noch in einem Hochhaus in Kilburn. Das Treppenhaus riecht nach frischer Farbe, Möwen stürzen sich auf die Balkone. Ironischerweise habe ich natürlich keinen Garten.
Schwarze Taxis fahren die Sloane Street hinunter. An den Seiten der Gebäude leuchten verschwommen Lichtkegel, die von den Fenstern gegenüber reflektiert werden. In der Buchhandlung liegt ein Stapel einer Neuübersetzung von Tausendundeiner Nacht aus.
In einer der Geschichten trank ein Magier von einem Trunk aus einem Kraut, das ihn jung hielt. Das Problem war, dass das Kraut nur auf dem Gipfel eines Berges wuchs. Also brachte der Magier jedes Jahr einen Jungen dazu, den Berg zu besteigen. Wirf das Kraut einfach hinunter, sagte der Zauberer. Dann komme ich dich holen. Der Junge warf das Kraut hinunter. An das Ende kann ich mich nicht mehr erinnern. Vielleicht war es das ja auch schon. Ich habe das Ende der meisten Geschichten vergessen, außer das der wichtigsten: Scheherazade überlebte.
Ich fahre ein paar Minuten mit der U‑Bahn, dann laufe ich die Treppen zum Bahnhof Paddington hinauf. Ich kaufe mein Ticket und eine Flasche Rotwein im Whistle-stop.
Auf dem Bahnsteig brummen die Lokomotiven. Ich wünschte, Rachel würde nach London ziehen. »Aber dann könntest du nicht mehr hierherkommen«, sagt sie. Und ich liebe ihr Haus wirklich, das alte Bauernhaus auf dem flachen Hügel, flankiert von zwei uralten Ulmen. Das Rauschen der Ulmen im Wind erfüllt die Schlafzimmer im Obergeschoss. Und sie lebt gern dort, lebt gern allein. Vor zwei Jahren hätte sie beinahe geheiratet. »Gerade noch mal davongekommen«, sagte sie.
Im Zug lehne ich meinen Kopf gegen den Sitz und beobachte, wie die winterlichen Felder am Fenster vorbeiziehen. Mein Abteil ist leer, bis auf ein paar Pendler, die am Wochenende früher Feierabend gemacht haben. Am grauen Himmel liegt ein lila Band über dem Horizont. Hier, außerhalb der Stadt, ist es kälter. Man sieht es an den Gesichtern der Menschen, die auf den Bahnhöfen warten. Ein dünner Luftstrom pfeift durch einen Riss am unteren Rand der Scheibe. Der Zug ist eine beleuchtete Kapsel, die durch die kohlschwarze Landschaft zischt.
Zwei Jungen mit Kapuzen laufen neben meinem Waggon her. Bevor ich sie einholen kann, springen sie über eine niedrige Mauer und verschwinden die Böschung hinab. Der Zug fährt zwischen einer dichten Hecke hindurch. Im Sommer färbt sie das Licht im Waggon flackernd grün, als wäre man unter Wasser. Jetzt ist die Hecke so kahl, dass das Licht sich nicht verändert. Ich kann kleine Vögel in den Lücken zwischen den Ästen sehen, umrahmt von Ranken.
Vor ein paar Wochen erwähnte Rachel, dass sie Ziegen züchten will. Sie sagte, der Weißdorn am Ende ihres Gartens sei ideal für sie, um darauf herumzuklettern. Sie hat bereits einen großen Deutschen Schäferhund. »Was wird Fenno von den Ziegen halten?«, fragte ich.
»Wahrscheinlich wird er vor Freude ausflippen«, antwortete sie.
Ich frage mich, ob alle Ziegen auf Bäume klettern, oder nur bestimmte Arten. Ich habe ihr nicht geglaubt, bis sie mir Bilder von einer Ziege zeigte, die am Ende eines Zedernfächers balancierte. Andere kletterten in einem weißen Maulbeerbaum herum. Auf keinem der Bilder war jedoch zu sehen, wie die Ziegen den Baum erklommen hatten. »Sie benutzen ihre Hufe dafür, Nora«, erklärte Rachel, eine Antwort, die irgendwie keinen Sinn ergibt.
Eine Frau kommt mit einem Serviertrolley durch den Gang, und ich kaufe einen Twix-Riegel für mich und eine Tafel Aero-Schokolade für Rachel. Unser Vater nannte uns immer gierige kleine Mädchen. »Stimmt genau«, bemerkte Rachel.
Ich beobachte, wie die Felder vorbeiziehen. Heute Abend werde ich ihr von meinem Stipendium in der Künstlerresidenz erzählen, das in zwei Monaten, Mitte Januar, beginnt. Zwölf Wochen Frankreich, mit Unterkunft und einer finanziellen Unterstützung. Ich hatte mich mit einem Theaterstück beworben, das ich an der Universität geschrieben habe: Der Räuberbräutigam. Es ist mir peinlich, dass ich seither nichts Besseres zustande gebracht habe, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr, denn in Frankreich werde ich etwas Neues schreiben. Rachel wird sich für mich freuen. Sie wird uns einen Drink einschenken, um das zu feiern. Später, beim Abendessen, wird sie mir von ihrer Arbeitswoche erzählen, und ich werde ihr nichts von der vermissten Frau in Yorkshire verraten.
Der Zug gibt ein langes, tiefes Hupen von sich, während er durch die Kreidehügel braust. Ich versuche mich daran zu erinnern, was Rachel heute Abend kochen wollte. Ich sehe vor mir, wie sie in ihrer Küche herumhantiert und die große Schieferschale mit den Kastanien an den Rand der Arbeitsplatte schiebt. Coq au vin und Polenta, glaube ich.
Sie kocht gern, auch wegen ihrer Arbeit. Sie sagt, ihre Patienten reden ständig übers Essen, jetzt, wo sie nicht mehr essen können, was sie wollen. Sie fragen oft, was Rachel kocht, und sie möchte ihnen gern eine gute Antwort geben.
Lehmdächer und Schornsteine erheben sich über eine hohe Ziegelmauer neben mir, die schließlich das Dorf umschließt. Hinter der Mauer liegt ein Feld mit trockenen Sträuchern und Hecken, das von einigen Wegen durchzogen ist. Am Rande des Feldes beaufsichtigt ein Mann mit einem grünen Hut ein Feuer, in dem er Müll verbrennt. Die heiße Luft wirbelt verkohlte Blätter hoch in den weißen Himmel, und sie schweben über das Feld.
Ich ziehe den Ordner mit den zu vermietenden Immobilien in Cornwall aus meinem Beutel. Während des Sommers hatten Rachel und ich ein Haus in Polperro gemietet. An Weihnachten haben wir beide frei, und an diesem Wochenende wollen wir ein Haus für die Feiertage buchen.
Polperro ist in eine tiefe Küstenschlucht gebaut. Weiß getünchte Häuser mit Schieferdächern schmiegen sich an grüne Bäche. Zwischen den beiden Klippen liegt ein Hafen und hinter einem Damm ein Innenhafen, gerade groß genug für ein Dutzend kleiner Segelboote. Häuser und Kneipen grenzen auf dem Kai direkt ans Wasser. Bei Ebbe liegen die Boote im Innenhafen auf ihren Rümpfen im Schlamm. Am westlichen Ende der Schlucht stehen zwei viereckige Kaufmannshäuser – eines aus tweedbraunem Backstein, das andere weiß. Über ihnen heben sich Schirmkiefern vor dem Himmel ab. Hinter den Kaufmannshäusern, an der Spitze der Schlucht, ist eine Fischerkate direkt in den Felsen gebaut. Sie besteht aus unverputztem Granit, so dass sie an nebligen Tagen mit den Steinen um sie herum verschmilzt. Das Haus, das wir gemietet hatten, lag auf einer Landzunge, zehn Minuten zu Fuß über den Küstenweg von Polperro entfernt. Vom Strand führte eine private Treppe mit einundsiebzig Stufen die Klippe hinauf.
Ich liebte Cornwall. Mit neunundzwanzig hatte ich es gerade erst für mich entdeckt, aber es schien mein Ort zu sein. Die Liste der Dinge, die ich an Cornwall liebte, war schon lang, aber noch nicht vollständig.
Sie umfasste natürlich unser Haus und die Stadt, die Halbinsel The Lizard und die Legende von König Artus, dessen Herrschaftssitz sich ein paar Meilen weiter die Küste hinauf in Tintagel befand. Die Stadt Mousehole, ausgesprochen »Mouzall«. Daphne du Maurier und den ersten Satz ihres berühmten Romans Rebecca: »Vergangene Nacht träumte ich, ich wäre wieder in Manderley«. Und natürlich stimmte das, jeder, der von dort wegging, tat das. Die Fotos von Wracks in den Pubs, neben den zerstörten Rümpfen winzig die Stadtbewohner in langen braunen Röcken und Jacken.
Jeden Tag musste diese Liste umgeschrieben werden. Ich fügte die Schirmkiefern und das Bed & Breakfast Crumplehorn Inn hinzu. Cornish Pasties, die typischen Fleischpasteten, und Cornish Ale. Das Schwimmen, sowohl im offenen Meer als auch in den stillen, tropfenden Höhlen. Eigentlich jede Minute, die wir dort verbracht haben.
»Hier ist alles besser«, sagte ich.
Und Rachel sagte: »Na gut.«
»Was gefällt dir am besten an Cornwall?«, fragte ich, und sie stöhnte. »Oder soll ich dir verraten, was mir am besten gefällt?«
Aber dann sagte sie: »Also, erst mal … ist da das Meer.«
Ihr hat es eher noch besser gefallen als mir, und sie freut sich am meisten darauf, dorthin zurückzukehren. Sie war in letzter Zeit nicht mehr sie selbst. Ihre Arbeit scheint sie auszulaugen, und sie wirkt immer müde.
Am nächsten Bahnhof warnt der Schaffner die Fahrgäste vor möglichen Verspätungen am nächsten Tag wegen des Sturms. Ausgezeichnet, denke ich, es wird also schneien.
Wir fahren durch eine weitere Stadt. Die Autos haben jetzt ihre Scheinwerfer eingeschaltet, blassgelbe Murmeln im schwachen Nachmittagslicht, dann biegt der Zug um eine Pappelhecke, fährt geradeaus weiter und erreicht Marlow.
Rachel wartet nicht am Bahnhof auf mich. Das ist nicht ungewöhnlich. Ihre Schichten im Krankenhaus dauern oft lange. Ich verlasse den Bahnsteig in einem düsteren Licht, lasse das Dorf hinter mir und gehe in Richtung ihres Hauses. Bald befinde ich mich auf der Landstraße, einem schmalen Asphaltband zwischen Bauernhöfen.
Ich frage mich, ob sie mir mit Fenno zu Fuß entgegenkommt. Die Rotweinflasche schlägt gegen meinen Rücken. Ich stelle mir Rachels Küche vor. Die Schale mit den Kastanien, die Polenta, die auf dem Herd blubbert. Ein Auto fährt auf mich zu, und ich trete an den Randstreifen. Es wird langsamer, und die Frau am Steuer nickt mir zu, bevor sie beschleunigt und weiterfährt.
Ich gehe schneller, mein Atem wärmt meine Brust, meine kalten Finger sind tief in den Taschen vergraben. Schwere Wolken türmen sich über mir auf, und in der Stille scheint die kalte Luft zu klirren.
Und dann taucht ihr Haus auf. Ich steige den Hügel hinauf, und der Kies knirscht unter meinen Füßen. Ihr Auto steht in der Einfahrt. Sie muss gerade nach Hause gekommen sein. Ich öffne die Tür.
Bevor ich begreife, was hier nicht stimmt, stolpere ich zurück, als wäre mir etwas entgegengeflogen.
Als Erstes sehe ich den Hund. Er hängt an seiner Leine am oberen Ende der Treppe und dreht sich langsam um sich selbst. Seine Leine ist um einen Pfosten des Geländers gewickelt. Er muss sich darin verheddert haben, gefallen sein und sich selbst stranguliert haben. Aber auf dem Boden und an den Wänden ist Blut.
Ich beginne zu hyperventilieren, obwohl alles um mich herum ruhig und still ist. Ich muss dringend etwas tun, aber weiß nicht, was.
Ich steige die Treppe hinauf. Direkt unter meiner Schulter ist ein Blutstreifen an der Wand, als wäre jemand beim Hinaufgehen dagegengesackt. Als der Streifen endet, sehe ich rote Handabdrücke auf der Stufe darüber, auf der nächsten Stufe und auf dem Treppenabsatz.
Im Flur im Obergeschoss sind die Flecken verschmiert. Es sieht aus, als wäre jemand gekrochen oder geschleift worden. Ich starre auf die Flecken und schaue schließlich zum Ende des Flurs.
Ich höre mich selbst wimmern, als ich zu ihr krieche. Die Vorderseite ihres T‑Shirts ist schwarz und nass, und ich hebe sie vorsichtig auf meinen Schoß. Ich lege meine Hand an ihren Hals und versuche, ihren Puls zu ertasten, dann lege ich mein Ohr an ihr Gesicht, um ihren Atem zu hören. Meine Wange streift ihre Nase, und ein Schauer läuft mir über den Rücken. Ich blase Luft in ihren Mund und massiere pumpend ihre Brust, dann höre ich auf. Es könnte nur noch mehr Schaden anrichten.
Ich lege meine Stirn an Rachels, und der Flur wird dunkel. Mein Atem streicht über ihre Haut und in ihr Haar. Der Flur verengt sich um uns herum.
Mein Telefon hat in ihrem Haus nie Empfang. Ich muss hinausgehen, um einen Krankenwagen zu rufen. Ich kann sie nicht allein lassen, aber dann stolpere ich die Treppe hinunter und durch die Tür.
Sobald das Gespräch beendet ist, weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf der Straße ist niemand zu sehen, nur die Häuser ihrer Nachbarn und der Bergrücken dahinter, und in der summenden Stille glaube ich, das Meer zu hören. Der Himmel über mir wirkt aufgewühlt. Ich schaue hinauf. Lege meine Hände an den Kopf. Meine Ohren klingeln, als würde jemand sehr laut schreien.
Ich warte darauf, dass Rachel in der Tür erscheint. Ihr Gesicht verwirrt und erschöpft, die Augen auf mich gerichtet. Ich lausche auf das leise Geräusch ihrer Schritte, als ich die Sirenen höre.
Sie muss nach unten kommen, bevor der Krankenwagen eintrifft. Der Alptraum endet, wenn jemand anderes sie sieht. Ich flehe sie an, nach unten zu kommen. Die Sirenen werden lauter. Ich beobachte die Tür, warte auf sie.
Dann kommt der Krankenwagen in Sicht. Er rast die Straße zwischen den Bauernhöfen entlang. Als sich die Türen öffnen und die Sanitäter zu mir laufen, kann ich nicht sprechen. Die erste Sanitäterin betritt das Haus, und der zweite fragt mich, ob ich verwundet sei. Ich schaue an mir hinab. Mein Hemd ist blutverschmiert. Als ich nicht antworte, beginnt er, mich zu untersuchen.
Ich reiße mich von ihm los und laufe hinter seiner Kollegin die Treppe hinauf. Rachels Gesicht ist der Decke zugewandt, ihr dunkles Haar auf dem Boden ausgebreitet, ihre Arme liegen an den Seiten an. Ich sehe ihre Füße in den dicken Wollsocken. Ich möchte um die Sanitäterin herumkriechen, sie zwischen meine Hände nehmen und drücken.
Die Sanitäterin zeigt auf eine Stelle an Rachels Hals, dann berührt sie die gleiche Stelle an sich selbst, unter ihrem Kiefer. Ich kann sie unter den Lauten, die ich von mir gebe, nicht verstehen. Sie hilft mir die Treppe hinunter, öffnet die Türen des Krankenwagens, setzt mich auf den Rand und wickelt mir eine Rettungsdecke um die Schultern. Die Nässe auf meinem Hemd wird kalt und lässt den Stoff an meinem Bauch kleben. Mir klappern die Zähne. Die Sanitäterin schaltet einen Heizlüfter ein, der mir den Rücken wärmt.
Kurz darauf treffen Streifenwagen ein, Polizisten in schwarzen Uniformen versammeln sich auf der Straße und kommen dann den Rasen herauf. Ich starre sie an, mein Blick wandert von einem Gesicht zum nächsten. An einem Gürtel knistert etwas statisch. Ein Constable rammt einen Eisenstab in den Boden und zieht ein Band vor die Tür, das heftig auf und ab flattert, während es sich hinter ihm abrollt.
Die Ränder meines Sichtfelds verschwimmen. Ich bin so müde. Ich versuche, die Polizei zu beobachten, damit ich Rachel erzählen kann, wie es war.
Der Himmel schäumt, als ob sich die Gischt einer riesigen Welle auf uns herabsenkt. Wer hat dir das angetan, frage ich mich, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du zurückkommst. Die offene Scheune in dem Haus auf der anderen Straßenseite, in der sie normalerweise parkt, ist leer. Dort wohnt ein Professor aus Oxford. »Der Gentleman-Farmer«, wie Rachel ihn nennt. Hinter dem Haus des Professors erhebt sich der Bergrücken zu einer fast senkrechten Felswand mit steilen, in den Stein gehauenen Wegen. Ich starre auf den Grat.
Keiner geht ins Haus. Sie alle warten auf jemanden. Der Constable, der das Band gespannt hat, steht davor und bewacht den Eingang. Auf der Koppel neben dem Haus des Professors sehe ich eine Frau reiten. Ihr Haus steht am Fuße des Bergrückens. Sie galoppiert in einem großen Kreis unter dem sich verdunkelnden Himmel.
Als sich die Frau nach vorne in den Wind beugt, frage ich mich, ob sie uns sehen kann. Das Haus, den Krankenwagen, die uniformierten Polizisten auf dem Rasen.
Am Ende der Einfahrt schlägt eine Autotür zu, und ein Mann und eine Frau treten auf den Kies. Ich beobachte, wie das Paar den Hügel heraufgeht. Sie tragen hellbraune Trenchcoats, haben die Hände in die Taschen gesteckt, und ihre Schöße flattern hinter ihnen im Wind. Ihr Blick ist auf das Haus gerichtet, dann schaut die Frau in meine Richtung, und unsere Blicke begegnen sich. Der kalte Wind peitscht um mich herum. Die Frau hebt das Band an, duckt sich darunter weg und betritt das Haus. Ich schließe die Augen. Ich höre, wie sich Schritte auf dem Schotter nähern. Der Mann geht neben mir in die Hocke. Er wartet.
Bald werde ich die Ulmen wieder über mir rauschen hören. Wenn ich die Treppe hinuntergehe, sehe ich unser Geschirr in der Spüle. Die Reste der Polenta, eingetrocknet auf dem Boden des Topfes. Die Kastanienschalen auf der Arbeitsplatte, wo wir sie abgezogen und uns dabei die Finger verbrannt haben. Wenn ich in ihr Zimmer gehe, sehe ich die Schatten der Ulme auf den Dielen tanzen. Der Hund schläft vor dem Bett auf dem Boden, so nah, dass Rachel den Arm ausstrecken und ihn streicheln kann. Ich sehe Rachel, schlafend.
Ich öffne die Augen.
2
Der Mann, der neben mir kniet, sagt »Hallo.« Er drückt sich die Krawatte gegen den Bauch. Hinter ihm weht der Wind das Gras auf dem Hügel platt.
»Hallo, Nora«, sagt er, und ich frage mich, ob wir uns schon einmal begegnet sind. Ich kann mich nicht erinnern, jemandem meinen Namen gesagt zu haben. Er muss Rachel kennen. Er hat ein großes, kantiges Gesicht, schwere Augenlider, und ich versuche, ihn zuzuordnen. »Detective Inspector Moretti. Ich komme vom Revier in Abingdon.«
Er kannte Rachel nicht, und in der Stadt gibt es keine Mordkommission. Wenn man eine Anzeige erstatten will, muss man wahrscheinlich nach Oxford oder Abingdon fahren. Als wir die Auffahrt hinuntergehen, kommen uns zwei Frauen in den weißen Overalls der Gerichtsmediziner entgegen, sie sind auf dem Weg zum Haus.
Als wir wegfahren, kann ich nicht mehr atmen. Ich schaue aus dem Fenster und sehe die Platanen vorbeifliegen. Ich hätte gedacht, es würde sich wie ein Traum anfühlen, aber das tut es nicht. Der Mann neben mir ist real, die Landschaft vor dem Fenster ist real, wie auch die Nässe, die mein Hemd an meinen Bauch klebt, und die Gedanken, die durch meinen Kopf wirbeln.
Ich will, dass der Schock mir ein wenig mehr Zeit verschafft, aber die Trauer ist schon da, seit die Frau ihren Finger an Rachels Hals legte. Ich kann nur immer wieder denken, dass ich meine Schwester nie wieder sehen werde. Als wir durch Marlow fahren, merke ich, dass ich in meinem Kopf mit mir selbst rede. Wenn ich das unheimliche Gefühl habe, mich selbst beim Denken zu beobachten, formuliere ich meine Gedanken normalerweise so, als würde ich sie Rachel erzählen.
Ich schrumpfe auf dem Sitz zusammen. Autos rauschen auf der Autobahn an uns vorbei. Ich frage mich, ob der Detective immer so langsam fährt, oder nur, wenn er jemanden im Auto hat. Ich habe nicht auf die Straßenschilder geachtet, um mitzukriegen, wohin er mich bringt. Ein Teil von mir stellt sich vor, dass er mich auf ein dunkles Feld bringt, weit weg von den Lichtern der Stadt. Erst die eine Schwester ermordet und dann die andere, innerhalb weniger Stunden. Er war es. Dann ist er um das Haus gegangen, die Auffahrt hochgekommen und hat mich dazu gebracht, mit ihm zu gehen, während alle anderen abgelenkt waren. Es ist nicht schwer, mich zu überreden. Die Angst ist schon da und drückt gegen die Oberfläche. Ich nehme einen Stift aus meiner Tasche und klemme ihn unter meinen Oberschenkel.
Ich warte darauf, dass er in eine der Abzweigungen einbiegt, auf eine stillgelegte Fabrik oder einen leeren Obstgarten. Um die Autobahn herum ist Niemandsland, er hat viele Möglichkeiten. Ich bereite mich darauf vor, ihm den Stift ins Auge zu rammen und dann zurück zu ihrem Haus zu laufen.
Doch dann taucht das Schild für Abingdon auf, der Detective biegt von der Autobahn ab und hält am Ende der Ausfahrt langsam an. Sein Gesicht ist schlaff, der Blick durch die Windschutzscheibe auf die Ampel gerichtet.
»Wer war das?«, frage ich.
Er sieht mich nicht an. Der Blinker tickt in dem stillen Auto. »Das wissen wir noch nicht.«
Die Ampel springt um, und er legt den Gang ein. Das beleuchtete Schild der Thames Valley Police dreht sich auf einem Pfosten am Eingang des Gebäudes.
In einem Großraumbüro im Obergeschoss steht ein blonder Mann in einem dunklen Anzug, der von seinen Schultern herabhängt. Als er uns eintreten hört, wendet er sich von einer Tafel ab, auf die er gerade ein Bild von Rachel geklebt hat.
Ich stöhne. Es ist das Foto von der Krankenhaus-Website, dunkles Haar umrahmt ihr ovales Gesicht. Es ist mir so vertraut, als würde ich mich selbst ansehen. Sie ist blasser und hat markantere Gesichtszüge. Ich kann in einem Raum verschwinden, sie nicht. Wir haben beide hervorstehende Wangenknochen, aber ihre sind ausgeprägter. Auf dem Foto lächelt sie mit geschlossenem Mund, die Lippen ein wenig zur Seite gezogen.
Im Verhörraum setzt sich Moretti mir gegenüber und öffnet den Knopf seiner Anzugjacke.
»Sind Sie müde?«, fragt er.
»Ja.«
»Das ist der Schock.«
Ich nicke. Es ist seltsam, so müde zu sein und gleichzeitig so verängstigt, als würde mein Körper schlafen, aber gleichzeitig Stromstöße bekommen.
»Kann ich Ihnen etwas bringen?«, fragt er. Ich weiß nicht, was er meint, und als ich nicht antworte, bringt er mir einen Tee, den ich nicht trinke. Er hält mir ein marineblaues Sweatshirt und eine Jogginghose hin. »Falls Sie sich umziehen möchten.«
»Nein, danke.«
Er redet ein paar Minuten lang über Belanglosigkeiten, sein Blockhaus in Whitstable. Es ist wunderschön dort, sagt er, bei Ebbe. Er macht mich nervös, selbst wenn er über das Meer spricht.
Er bittet mich, ihm zu erzählen, was ich gesehen habe, als ich das Haus betrat. Ich höre, wie sich meine Zunge vor jeder Antwort mit einem Schnalzen vom Boden meines Mundes löst. Er reibt sich den Nacken, das Gewicht seiner Hand drückt seinen Kopf nach unten.
»Wohnen Sie bei ihr?«
»Nein, ich lebe in London.«
»Ist es üblich, dass Sie am Freitagnachmittag dort sind?«
»Ja. Ich komme oft zu Besuch.«
»Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrer Schwester gesprochen?«
»Gestern Abend, gegen zehn.«
Der Himmel hat sich verdunkelt, so dass ich die blassen zitronengelben Quadrate der Bürobeleuchtung auf der anderen Straßenseite sehen kann.
»Und wie klang sie?«
»Wie immer.«
Hinter seiner Schulter geht eins der gelben Quadrate aus. Ich frage mich, ob er denkt, ich hätte es getan, aber das ist irgendwie unwahrscheinlich.
»Wie lange wird das anhalten?«, frage ich.
»Was?«
»Der Schock.«
»Kommt drauf an. Vielleicht ein paar Tage.«
In einem Büro auf der anderen Straßenseite hebt eine Putzfrau das Kabel eines Staubsaugers an und schiebt Stühle aus dem Weg.
»Es tut mir leid«, sagt er. »Ich weiß, dass Sie nach Hause wollen. Ist Ihnen in letzter Zeit aufgefallen, ob etwas Rachel belastet hat?«
»Nein. Vielleicht ihre Arbeit, ein wenig.«
»Fällt Ihnen jemand ein, der Rachel etwas antun wollte?«
»Nein.«
»Wenn sie sich bedroht gefühlt hätte, hätte sie es Ihnen gesagt?«
»Ja.«
Nichts davon passt zu ihr. Ich kann mir genauso gut ein anderes Szenario vorstellen. Ich sehe Rachel blutüberströmt in diesem Stuhl sitzen und dem Detective geduldig erklären, wie sie den Mann, der sie angegriffen hat, getötet hat.
»Hat es lange gedauert?«, frage ich.
»Ich weiß es nicht«, antwortet er, und ich senke den Kopf gegen das Klingeln in meinen Ohren. Die Frau, die mit ihm die Auffahrt heraufgekommen ist, öffnet die Tür. Sie hat ein weiches, aufgequollenes Gesicht und ihr lockiges Haar zu einem Knoten zusammengebunden. »Alistair«, sagt sie. »Auf ein Wort.«
Als er zurückkommt, fragt mich Moretti: »Hatte Rachel einen Freund?«
»Nein.«
Er bittet mich, die Namen der Männer aufzuschreiben, mit denen sie im letzten Jahr ausgegangen ist. Ich male jeden Buchstaben fein säuberlich auf, beginnend mit dem letzten, und gehe sechzehn Jahre zurück bis zu ihrem ersten Freund in Snaith, wo wir aufgewachsen sind. Als ich mit der Liste fertig bin, sitze ich mit gekrümmten Händen auf dem Tisch da, und Moretti steht in der Nähe der Tür. Er hat seinen Kopf über das Papier gebeugt. Ich beobachte ihn, um zu sehen, ob er einen der Namen aus anderen Fällen wiedererkennt, aber sein Gesichtsausdruck verändert sich nicht.
»Der erste Name«, sage ich. »Stephen Bailey. Vor zwei Jahren hätten sie fast geheiratet. Sie hat ihn manchmal noch getroffen. Er lebt in West Bay, Dorset.«
»War er jemals gewalttätig ihr gegenüber?«
»Nein.«
Moretti nickt. Stephen wird trotzdem die erste Person sein, die sie auszuschließen versuchen. Der Detective verlässt den Raum, und als er zurückkommt, sind seine Hände leer. Ich denke an den Pub am Nachmittag und an die vermisste Frau in Yorkshire.
»Da ist noch etwas anderes«, sage ich. »Rachel wurde überfallen, als sie siebzehn Jahre alt war.«
»Überfallen?«
»Ja. Die Anklage hätte auf schwere Körperverletzung gelautet.«
»Kannte sie den Angreifer?«
»Nein.«
»Wurde jemand verhaftet?«
»Nein. Die Polizei hat ihr nicht geglaubt.« Sie räumten zwar ein, dass Rachel überfallen worden war, aber nicht so, wie sie es beschrieben hatte. Sie vermuteten, dass sie versucht hatte, jemanden auszurauben oder zu belästigen, und gewaltsam abgewiesen worden war. Die Polizisten gehörten damals noch zur alten Schule und stürzten sich darauf, wie viel sie getrunken hatte, und darauf, dass sie nicht weinte. »Das war in Snaith, Yorkshire. Ich weiß nicht, ob es noch Aufzeichnungen darüber gibt. Es ist fünfzehn Jahre her.«
Moretti dankt mir. »Bitten bleiben Sie in der Gegend. Können Sie heute Nacht irgendwo schlafen?«, fragt er.
»In Rachels Haus.«
»Dort können Sie nicht bleiben. Gibt es jemanden, der Sie abholen kann?«
Ich bin so müde. Ich will nicht versuchen müssen, das jemandem zu erklären, und ich will auch nicht auf dem Bahnhof warten, bis einer meiner Freunde aus London kommt. Als die Befragung beendet ist, fährt mich ein Constable zum einzigen Gasthaus in Marlow.
Ich hoffe, wir verunglücken. Auf der Abingdon Road fährt ein Lastwagen mit Metallstangen vor uns her, und ich stelle mir vor, wie das Nylonband reißt, die Metallstangen herausfallen und auf der Straße tanzen, wobei eine von ihnen mich auf den Sitz nagelt.
Die Hauptstraße von Marlow ist wie eine Sichel gebogen, mit dem Park an einem und dem Bahnhof am anderen Ende. Das Hunters liegt am unteren Ende des Halbkreises, direkt neben dem Bahnhof. Es ist ein viereckiges, cremefarbenes Steingebäude mit schwarzen Fensterläden. Als der Constable mich am Gasthaus absetzt, warten ein paar Leute auf dem Bahnsteig. Sie drehen sich alle nach dem Streifenwagen um.
Im Hunters schließe ich die Zimmertür ab und lege die Kette vor. Ich streiche mit der Hand an der tapezierten Wand entlang, dann drücke ich mein Ohr dagegen und halte den Atem an. Ich möchte eine Frauenstimme hören. Vielleicht eine Mutter, die mit ihrer Tochter spricht, während sie sich bettfertig machen. Kein Ton dringt durch die Wand. Wahrscheinlich schlafen alle, sage ich mir.
Ich mache das Licht aus und verkrieche mich unter die Decke. Ich weiß, dass das, was hier passiert, real ist, aber ich erwarte dennoch, dass sie jeden Moment anruft.
3
Wir wollten heute eigentlich nach Broadwell fahren, Preiselbeer-Crêpes essen und ins Museum gehen, denke ich, als ich aufwache. Ich ärgere mich, dass wir unsere Pläne verschieben müssen.
Auf halbem Weg zwischen dem Bett und dem Badezimmer geben meine Knie nach. Ich breche zusammen, aber es fühlt sich an, als würde ich wieder hochgerissen. Der Hund baumelt von der Decke. Rachel liegt zusammengerollt an der Wand. Auf den Stufen die roten Handabdrücke. Am Geländer drei saubere Pfosten und ein schmutziger, an dem die Leine des Hundes festgebunden ist.
*
Ich weiß nicht, wie lange ich so dagelegen habe. Irgendwann beschließe ich, mich zu waschen. Ich kann nicht duschen, denn ich bilde mir ein, ihr Haus in meinen Haaren zu riechen. Stattdessen ziehe ich mich aus, wische mit einem feuchten Waschlappen über meinen Körper und beobachte, wie sich der Stoff rosa und braun verfärbt.
Ich ziehe mich an, stopfe meine Kleidung von gestern in eine Plastiktüte und bringe sie in den Müllcontainer hinter dem Gasthaus. Das fühlt sich seltsam an, als würde ich Beweismaterial entsorgen, aber die Polizei hat mich nicht gebeten, sie zu behalten. Sie hätten mich eben sorgfältiger instruieren müssen. In der Eingangshalle gehe ich an dem Gemälde einer Fuchsjagd vorbei, auf dem sich rote Reiter hinter den Bäumen verstecken.
Als ich die Treppe hinaufsteige, ruft Moretti an und sagt, er habe noch ein paar Fragen an mich. »Ich gebe in einer Stunde eine Presseerklärung ab. Darin werde ich den Hund nicht erwähnen.«
»Warum nicht?«
»Die Leute fixieren sich auf solche Dinge. Ich kann Sie nicht darauf vorbereiten«, sagt er, »wie es sein wird, wenn sich dies landesweit herumspricht. Wir können Ihnen nicht verbieten, mit der Presse zu sprechen, aber ich kann Ihnen sagen, dass es dem Fall nicht helfen wird. Sie kommen uns nur in die Quere, und wenn sie sich dann zu langweilen beginnen, suchen sie nach etwas, das Rachel interessant machen könnte.«
»Was macht sie interessant?«
»Die schlimmsten Dinge über sie.«
Ein Constable soll mich um siebzehn Uhr im Hunters abholen. Ich entschließe mich, in meinem Zimmer zu warten. Es sind noch sechs Stunden, und ich frage mich, ob ich es so lange aushalten werde.
*
Ein paar Stunden später klopft es an der Tür. »Einige der anderen Gäste haben sich beschwert«, sagt die Managerin des Gasthauses. Hinter ihr werden in der Halle die Lampen eingeschaltet. Sie trägt einen Schal mit Schottenkaro, und ich möchte ihr gern erzählen, dass ich früher in Schottland gelebt habe. Meine Schwester hat mich dort besucht.
»Dieses ganze Gerede nervt sie.«
»Tut mir leid.« Ich muss mich an den Türrahmen lehnen. Ich habe heute noch nichts gegessen oder getrunken. Das Essen wird ein Problem werden.
»Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas brauchen«, sagt sie. »Es tut mir so leid. Es ist eine so schwierige Zeit. Erst Callum und jetzt Ihre Schwester.«
»Callum?«
»Der junge Mann aus der Stadt, der bei einem Unfall auf der Bristol Road ums Leben kam. Er war erst siebenundzwanzig.«
Jetzt fällt es mir wieder ein. Rachel war eine seiner Krankenschwestern. Ich überlege, ob ich der Frau mitteilen soll, was Rachel mir über ihn erzählt hat, entscheide mich aber dagegen.
*